Szilárd Rubin: «Der Eisengel» (Roman)
.
Die Vampirin von Törökszentmiklós
Günter Nawe
.
 Was sich im ersten Augenblick wie ein veritabler Kriminalroman liest, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als eine Art literarischen Experiments, als ein Dokumentarroman. Unternommen hat diesen Versuch, der an dieser Stelle schon als gelungen zu bezeichnen ist, der ungarische Schriftsteller Szilárd Rubin (1927-2010). Dass er hierzulande relativ unbekannt ist– es gibt drei Werke in deutscher Übersetzung –, erweist sich zwar als ein Manko. Umso mehr freut sich der Leser jetzt über eine Neu- bzw. Wiederentdeckung. Denn Rubin ist ein hochinteressanter Autor, dessen Erzählen von großer Faszination ist, die sich nicht nur aus der Geschichte selbst ergibt, sondern auch aus der atmosphärischen Dichte dieser Prosa und eben dem schon genannten dokumentarischen Charakter der Romankonstruktion.
Was sich im ersten Augenblick wie ein veritabler Kriminalroman liest, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als eine Art literarischen Experiments, als ein Dokumentarroman. Unternommen hat diesen Versuch, der an dieser Stelle schon als gelungen zu bezeichnen ist, der ungarische Schriftsteller Szilárd Rubin (1927-2010). Dass er hierzulande relativ unbekannt ist– es gibt drei Werke in deutscher Übersetzung –, erweist sich zwar als ein Manko. Umso mehr freut sich der Leser jetzt über eine Neu- bzw. Wiederentdeckung. Denn Rubin ist ein hochinteressanter Autor, dessen Erzählen von großer Faszination ist, die sich nicht nur aus der Geschichte selbst ergibt, sondern auch aus der atmosphärischen Dichte dieser Prosa und eben dem schon genannten dokumentarischen Charakter der Romankonstruktion.
Wovon ist die Rede? Vom Roman «Eisengel». In Törökszentmiklós, einem ungarischen Provinznest, sorgt ein fünffacher Mord an jungen Mädchen für großes Aufsehen. Eine mehr als merkwürdige Geschichte – geschehen in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, in Zeiten des ungarischen Poststalinismus.
Lange, so weiß es das ausführliche Nachwort zu diesem Roman, hat sich Szilárd Rubin mit diesem authentischen Fall befasst, der weit über das kriminelle Geschehen hinaus auch eine politische Dimension hat. Aufmerksam geworden ist Rubin auf den «Fall» durch die Fotografie einer jungen Frau, die einige Jahre zuvor hingerichtet worden ist. Piroska Janscó ist / war eine anmutige, schöne junge Frau und war doch die «Vampirin von Törökszentmiklós». Ihr wird dieses grausige Verbrechen zugeschrieben.
Unser Autor, als Schriftsteller und Journalist auftretend, will jedoch mehr wissen, als die Aktenlage ausweist, will die Hintergründe einer Mordserie, die zwischen Oktober 1953 und August 1954 geschah, kennenlernen. Bizarre Morde, ein unvorstellbares Verbrechen, das seinerzeit hohe Wellen geschlagen hat – In Törökszentmiklós und darüber hinaus. Verdächtigt der Morde wurden erst einmal sowjetischen Soldaten, die in Ortsnähe in Garnison lagen. Auch tauchten plötzlich die uralten Verdächtigungen auf von Ritualmorden, begangen von – natürlich – den Juden auf. Oder waren es Fremde? Es kam sogar zu Massendemonstrationen gegen die vermeintlichen Täter. Wir kennen ganz aktuell die Mechanismen von Verdrängung, Verdächtigungen und Verleumdungen. Bis endlich klar wurde: Gemordet «aus niederträchtigen Gründen», hat Piroska. Und so wurde sie für fünffachen Mord und einmaligem Mordversuch zum Tode verurteilt und hingerichtet.

Rubin Szilárd (1927-2010)
So beginnt der Schriftsteller zu recherchieren. Er sucht die Tatorte auf, spricht mit den Familien, mit der Mutter der Mörderin, den Eltern der ermordeten Kinder und mit der Leiterin des Gefängnisses, in dem Piroska die letzten Stunden ihres Lebens verbracht hat. Nicht alle waren sehr auskunftsfreudig. Schon gar nicht die Polizei, die damals recht schlampig ermittelt hat, und sich immer noch nicht sehr auskunftsfreudig zeigt; genauso wenig wie die unantastbaren Russen.
Vieles in der Schilderung der «Zeugen» ist widersprüchlich. Der ermittelnde Schriftsteller entdeckt das Böse, das Grausige und Obsessive – gerade auch in der Bevölkerung. Ja, Piroska Janscó war eine Prostituierte, die bei den sowjetischen Soldaten ein- und ausging, sie kannte ebenso wie die Menschen um sie herum keine Moral. Wirklich nicht? Von der «Metaphysik der Sünde» spricht József Keresztesi und Freund des Autors in seinem klugen Nachwort. Und Szilard Rubin: « Und ich möchte nicht die existenzialistische These über die Unergründbarkeit der Welt darstellen, keine kafkaeske Parabel verfassen, sondern einen dem sozialistischen Geist verbundene, künstlerisch gut gelösten und authentischen Tatsachenroman schreiben.» Das ist Rubin unzweifelhaft gelungen, auch wenn manche Szene sich sehr kafkaesk liest und die «Unergründbarkeit der Welt» zweifelsfrei zu erahnen ist.

Der Roman «Der Eisengel» des ungarischen Autors Szilárd Rubin ist eine wunderbare und spannende Neuentdeckung. Die Geschichte der fünffachen Mörderin von Törökszentmiklós ist ein Krimi und doch mehr als das: eine faszinierende kleine literarische Sensation. Absolut lesenswert!”
Zurück zum «Fall» und zu Piroska, diesem «Eisengel», «kalt bis ans Herz hinan», liebende Mutter und gnadenlosen Mörderin, zu dieser Protagonistin eines außergewöhnlichen Romans. Mörderin und Heilige, der Engel und das Biest? Charakteristika, die stimmen und doch nicht stimmen. Folgen wir also dem Autor, der von seiner Heldin sagt: «Ich betrachte die Fotografie des Mädchens, unruhig und ratlos. Darüber stand: Die Täterin. Und unter dem Bild der Name Piroska Janscó. Dieses Bild vor mir erweckte zugleich Mitleid, Lust und Angst. In der Tiefe des trotzigen Blicks glühten die Falschheit und der Hochmut der Verführerin, in den katzenartigen Umrissen des Gesichts etwas, das sie auf rätselhafte und unheilverkündende Weise begehrenswert mache, und das konnte selbst durch die in ihren Zügen liegende Furcht eines in die Ecke gedrängten Raubtiers nicht gebannt werden.»
Gerade das also macht diesen Roman, bei dem so vieles im Ungefähren bleibt, trotz aller Brüche und Unschärfen, so einzigartig und lesenswert.
Der Leser, der einen Krimi erwartet hat, wird vielleicht enttäuscht sein. Der Leser, der sich auf das Abenteuer dieses Buches einlässt, hält einen brillanten, einen faszinierenden Roman in Händen, eine kleine literarische Sensation. ■
Szilárd Rubin: Der Eisengel, Roman, aus dem Ungarischen von Timea Tankó, Rowohlt Verlag, ISBN 978 3 87134 789 4
.
.
.
.
Michel Bergmann: «Alles was war» (Erzählung)
.
«Ins Leben. Unbeschwert»
Günter Nawe
.
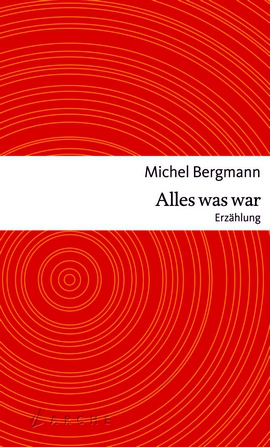 «Jedes jüdische Kind im Deutschland der Fünfziger Jahre wächst am Rande eines Massengrabs auf.» – Es lebt mit all den Opfern von Auschwitz, Majdanek und den vielen anderen Vernichtungslagern der Nazis: den nicht mehr existierenden Großeltern, Onkeln und Tanten. Es wächst auf mit den Tränen, die um die vielen, vielen Verwandten immer und immer wieder vergossen werden.
«Jedes jüdische Kind im Deutschland der Fünfziger Jahre wächst am Rande eines Massengrabs auf.» – Es lebt mit all den Opfern von Auschwitz, Majdanek und den vielen anderen Vernichtungslagern der Nazis: den nicht mehr existierenden Großeltern, Onkeln und Tanten. Es wächst auf mit den Tränen, die um die vielen, vielen Verwandten immer und immer wieder vergossen werden.
Von einem solchen Kind schreibt Michel Bergmann in seiner berührenden Erzählung «Alles was war». Es ist ein kleines großes Buch des Erinnerns – voller Trauer und voller Witz, melancholisch und heiter. Und er schreibt sicher von eigenem Erleben, denn dieser Michel Bergmann wurde 1945 als Kind jüdischer Eltern in einem Internierungslager geboren. Seine Kindheit verbrachte er in Paris und Frankfurt/Main. Es waren seine Jahre als jüdisches Kind, als jüdischer Junge, die er in den 50er Jahren im Nachkriegsdeutschland verbrachte. In einem Land, das einerseits vom schrecklichen Geschehen während der Naziherrschaft und des Krieges traumatisiert war; andererseits aber auch noch längst nicht «entnazifiziert» war.
Bergmann ist bereits durch drei wunderbare Bücher literarisch auffällig geworden. Und das im besten Sinne. Mit seinen Romanen «Die Teilacher», «Machloikes» und «Herr Klee und Herr Feld» hat er von den Erlebnissen der Juden erzählt, die sich wieder in Frankfurt niedergelassen habe. Sie alle tragen schwer an dem Schicksal, das ihnen die Geschichte, das ihnen die Deutschen angetan haben.
Und nun also die Erzählung eines alten Mannes, der auf seine Kindheit zurückblickt. Er erinnert sich an die Schulzeit, daran, das er, den Ranzen auf dem Rücken, losrennt: «Ins Leben. Unbeschwert. Es ist sein Tag! Wie jeder Tag sein Tag ist!» Arzt soll er werden, stellt sich jedenfalls die Mutter vor, die mühsam wieder ein annähernd normales Leben zurückgefunden hat als Geschäftsfrau.
Dass das nicht einfach würde – alle wussten es, die den Weg des Jungen begleiteten. Erst aber einmal wird «gelebt». So stromert das Kind durch die Trümmergrundstücke. Er hat Freunde und später Freundinnen. Oft allerdings nur solange, bis herauskommt, dass er Jude ist. Freunde und Freude hat er in und mit der Familie, der Mischpacha, mit Freunden, den Chaverim. Er feiert unter etwas Weihnukka – eine Mischung aus Weihnachten und Chanukka. Er gerät in den einen und anderen Schlamassel. Voller Witz auch die Schilderung der Bar Mizwa, die der Junge trotz erster religiöser Zweifel über sich ergehen lassen muss.
In dreizehn wundervoll erzählten Kapiteln, teilweise im leicht jiddisch eingefärbten Deutsch, schreibt der alte Mann, hinter dem wir getrost Bergmann vermuten dürfen, sein kleine, seine exemplarische Geschichte, die für den Leser auch eine Art Geschichtsunterricht wird. Nicht dröge und keinesfalls belehrend, aber einfühlsam und bei aller Schwere leicht und mit Witz und einem gehörigen Schuss Melancholie. Und immer gegenwärtig in diesem jungen Leben sind die, die nicht mehr sind. Schließlich ist er «am Rande eines Massengrabs» aufgewachsen.
Der Junge wird älter. Er verliebt sich, wird betrogen, schafft gerade mal so das Abitur, genießt seine Freiheit und verachtet alles Angepasstheit und – auch sie gibt es wieder – die saturierte Bürgerlichkeit. Was aber steht hinter all dem? Kasches, Fragen, werden gestellt – und bleiben oft unbeantwortet. Die jüdisch-deutsche Problematik, die Geschichte der Juden in Deutschland sollte für den Ich-Erzähler später einmal von existenzieller Bedeutung werden.
Erst einmal aber wird er Volontär bei den «Frankfurter Rundschau». Auch kein Traumjob, aber… Hier lernt er den Generalstaatsanwalt Fritz Bauer kennen. Dessen unermüdliches Engagement um den und im Auschwitz-Prozess ist beispielhaft gewesen. Mit großer Leidenschaft und großer Anteilnahme wird der junge Journalist.
Ein alter Mann erinnert sich. Auch daran, dass im Laufe der Jahre die Verbindung zur Mutter abgebrochen ist. Er erinnert sich an die Menschen, denen er in den Jahren seines Lebens begegnet ist. So trifft er bei der Beerdigung der Mutter einen alten Freund Marian wieder – und es war «wie am ersten Tag». Ihm wird er dieses kleine wundervolle Buch, diese auf ihrer Weise einzigartige Biografie widmen.

Die Geschichte einer jüdischen Kindheit im Deutschland der Nachkriegszeit – Michel Bergmann hat sie aufgeschrieben. Auch sie ein Kapitel deutscher Geschichte – wunderbar erzählt, heiter und witzig und voller Melancholie und Nachdenklichkeit. Ein kleines großes Buch, das traurig und zugleich glücklich macht.
Im letzte Kapitel, das bezeichnenderweise die Überschrift «Chaim – Leben» trägt, zitiert Michel Bergmann Søren Kierkegaard: «Das Leben kann nur nach rückwärts schauend verstanden, aber nur nach vorwärts schauend gelebt werden». In diesem Sinne hat Michel Bergmann dieses Buch geschrieben – und uns, seine Leser, auf wunderbare Weise beschenkt. ■
Michel Bergmann: Alles was war, Erzählung, Arche Verlag, ISBN 978-3-7160-2716-5
.
.
.
.
Eleni Torossi: «Als ich dir zeigte, wie die Welt klingt» (Roman)
.
Sehnsucht nach griechischer Hühnersuppe
Günter Nawe
.
 Eleni Torossi ist sicher eine sehr verdienstvolle und interessante Autorin. Die deutsch-griechische Schriftstellerin, in Athen geboren, lebt seit 1968 in München. Sie schreibt in zwei Sprachen, hat mehrere Geschichten und Hörspiele geschrieben und zahlreiche Bücher – u. a. «Warum Iphigenia mir einen Korb schenkte» – veröffentlicht.
Eleni Torossi ist sicher eine sehr verdienstvolle und interessante Autorin. Die deutsch-griechische Schriftstellerin, in Athen geboren, lebt seit 1968 in München. Sie schreibt in zwei Sprachen, hat mehrere Geschichten und Hörspiele geschrieben und zahlreiche Bücher – u. a. «Warum Iphigenia mir einen Korb schenkte» – veröffentlicht.
Soviel zur Person, weil Eleni Torossi – wie man zu Recht vermuten darf – mit ihrem neuen Buch «Als ich dir zeigte, wie die Welt klingt» einen autobiografischen Roman geschrieben hat. Damit erhält die Geschichte, die sie erzählt, ein hohes Maß an Authentizität. Denn sie ist die Tochter, die in Athen in Zeiten der Militärdiktatur aufwächst; deren Mutter, eine Hutmacherin, taub ist. Wie es sich lebt in diesen unruhigen Zeiten und warum beide Athen und eine Reise ins Ungewisse – nach Deutschland – antreten. Und wie es sich in Deutschland leben lässt.
Im Vordergrund ihrer Geschichte steht die Beziehung zwischen der tauben Mutter und der Tochter. Eine Beziehung, die sozusagen «wortlos» ist. Denn Eleni verständigt sich mit ihrer eleganten Mutter durch Gesten und Zeichen und mit Augen und Händen. Ein schwieriges Verfahren, das viel Geduld von beiden Seiten und große Vertrautheit miteinander erfordert. Und das dennoch weitestgehend gelingt. Auch wenn es Schwierigkeiten, immer wieder Verständigungsprobleme, Ängste und Schuldgefühle zu überwinden gilt – die Liebe zueinander widersteht allem. Es ist ein symbiotisch anmutendes Verhältnis, das Mutter und Tochter miteinander verbindet.

Der Roman «Als ich dir zeigte, wie die Welt klingt» von Eleni Torossi erzählt über die außergewöhnliche Beziehung eines Kindes und einer jungen Frau zu ihrer tauben Mutter. Und erzählt von einer Reise ins Ungewisse in den 60iger Jahren – von Athen nach München. Doch er zeigt dem Leser – das Buch hat doch einige Schwächen – kaum überzeugend, «wie die Welt klingt». Tiefenschärfe und Nachhaltigkeit gehören nicht zu den Stärken dieses Romans.
Eleni Torossi erzählt diese Geschichte mit sehr viel Einfühlungsvermögen und sehr einem sehr persönlichen und psychologischen Feingefühl. Das allerdings ist nur die eine Erzählebene des Romans. Die andere behandelt das «historische» Geschehen. Spielt sich doch die Lebensgeschichte dieser beiden Frauen im Kontext der Zeit ab. Eleni erlebt den Widerstand gegen die politischen Verhältnisse in Athen, ist teilweise auch in diesen Widerstand eingebunden. Die Folge: Die als Hutmacherin erfolgreiche Mutter und ihre Tochter machen sich irgendwann auf die Reise ins Ungewisse – nach Deutschland, nach München.
Hier gibt es andere, gänzlich neue Probleme: Sprachkenntnisse, Aufenthaltsgenehmigung, Arbeitserlaubnis. Die Mutter arbeitet als Küchenhilfe, die Tochter beginnt ein Studium. Herausforderungen, mit denen in den 60-iger Jahre alle Gastarbeiter und Migranten zu tun hatten. Caruso, Freund des Hauses, hilft, wo er nur kann. Parallel dazu engagiert sich Eleni in einer linken Exilantengruppe, die sich dem Kampf gegen die griechische Diktatur verschrieben hat. Was die Integration in Deutschland nicht leichter macht. Beide, Mutter und Tochter, erfahren auf höchst unterschiedliche Weise, «wie die Welt klingt». Und das sind nicht immer harmonische Klänge.
Trotzdem führen Mutter und Tochter kein schlechtes Leben. Es öffnen sich neue Türen in dieses neue Leben, und bald sind sie – die Geschichte zieht sich bis in die 90-ger Jahre – wie man so sagt: integriert. Was aber bleibt, ist die Zerrissenheit zwischen alter und neuer Heimat, die stille Sehnsucht nach dem Zurück, die «Sehnsucht nach der griechischen Hühnersuppe».
Das ist alles sehr schön und interessant und von Eleni Torossi gut erzählt. Dennoch bleiben ihre Figuren seltsam blass. Vor allem die Tochter. So erfahren wir zwar von ihrer Mitgliedschaft in linken Gruppierungen sowohl in Athen als auch in München. Wenig aber von ihren eigentlichen Überzeugungen, von ihrer inneren Verfassung. Die politischen und sozialen Gegebenheiten für die Gastarbeiter in Deutschland werden recht einseitig-kritisch beleuchtet. Es fehlt die Tiefenschärfe. Und so überzeugt dieser Roman insgesamt nur bedingt, er lässt beim Leser Fragen offen und lässt Nachhaltigkeit vermissen. ■
Eleni Torossi: Als ich dir zeigte, wie die Welt klingt, Verlag Langen Müller, ISBN 978-3-7844-3356-1
.
.
.
.
.
Anne Carson: «Decreation» (Gedichte – Oper – Essays)
.
«Die Liebe ist immer du»
Günter Nawe
.
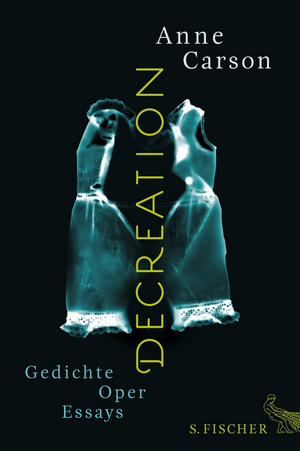 Den Titel ihres neuen Buches hat die kanadische Autorin Anne Carson von der französischen Philosophin Simone Weil übernommen. Für Weil – sie hat diesen Begriff geprägt –, von der sich die Carson stark beeinflusst sieht, bedeutet «décréation» einerseits Analyse der Selbstreflexion des Menschen und zugleich «Rückschöpfung», also eine «Ent-Schaffung»; anders: alles Erschaffene noch einmal ins Unerschaffene zu überführen.
Den Titel ihres neuen Buches hat die kanadische Autorin Anne Carson von der französischen Philosophin Simone Weil übernommen. Für Weil – sie hat diesen Begriff geprägt –, von der sich die Carson stark beeinflusst sieht, bedeutet «décréation» einerseits Analyse der Selbstreflexion des Menschen und zugleich «Rückschöpfung», also eine «Ent-Schaffung»; anders: alles Erschaffene noch einmal ins Unerschaffene zu überführen.
Aus diesem philosphisch-religiösen Gedankengut und in diesem Kontext der Simone Weil speist sich im Wesentlichen die Literatur der Anne Carson – vor allem, was das neue Buch «Décréation» betrifft. Es enthält Gedichte, Essays und ein Opernlibretto (nicht zu vergleichen mit einem herkömmlichen Libretto). Sehr unterschiedliche Spielarten der Literatur also, die jedoch bei Anne Carson in ihrem Innersten zusammenhängen. Auch der Lyrikerin geht es darum, eine Art «Rück-schöpfung» zu «inszenieren», indem sie ihre Vorstellung davon als Frage formuliert. Und dies Genre-übergreifend, sozusagen als Brückenschläge.
So in den Gedichten, die vor allem ihrer Mutter gewidmet sind. Sie ist «die Liebe meines Lebens». Mit ihr redet sie in ihren Versen: «Wenn ich mit meiner Muter spreche, mache ich es schön…». Von ihr hat die Dichterin gelernt: «Die letzte Lektion einer Mutter in einem Haus im letzten Licht / bringt den Ruin der Welt und den Handel zum Erliegen…». «Diese Stärke, Mutter: hervorgewühlt. Gehämmert, gekettet, / geschwärzt, gesprengt, heult, holt aus…».
Anne Carson, 1950 in Toronto geboren, ist im deutschen Sprachraum bisher durch die Bücher «Glas, Ironie und Gott» (Gedichte, 2000) und «Rot: Ein Roman in Versen» (2001) bekannt geworden Jetzt also «Décréation», und im Herbst wird der Band «Anthropologie des Wassers» erscheinen. Alle Bücher dieser Dichterin überzeugen durch die Klang- und Aussagekraft ihrer Poesie, durch die Intensität ihre Sprache, durch den Verzicht auf jegliches Pathos und die Bandbreite ihrer Themen. Großes Lob an dieser Stelle für Anja Utler, die «Decreation» aus dem Amerikanischen sehr feinfühlig ins Deutsche übersetzt hat. «Decreation» ist so eine weitere Möglichkeit, ein Versuch der Annäherung an eine der bedeutendsten Lyrikerinnen unserer Zeit.
Die lyrische Diktion dieser Autorin ist oft experimentell – auch von der formalen Struktur der Gedichte her. Ihr poetisches Credo: «Du kannst nie genug wissen, nie genug arbeiten, niemals die Infinitive und Partizipien auf genügend befremdliche Art verwenden, nie die Bewegung brüsk genug ausbremsen, nie den Geist schnell genug hinter dir lassen.» Das gilt – hervorragend umgesetzt – für die Verse, für ihre Essays und das Opernlibretto: zusammengefasst in diesem wunderschönen Band.
In dem kleinen Text «Jedes Abgehen ist ein Anfang» dekliniert Anne Carson zum Beispiel die verschiedenen Lesarten des Schlafs. Und bemüht dabei Aristoteles, Kant und Keats, um sich am Ende ausführlich Virginia Woolf zu widmen. Und so lesen wir «O zarter Salber stiller Mitternacht… Beschütz mich dann, dass nicht der Tag erneut / Aufs Kissen scheint, der mich so leiden ließ; …».

«Décréation» ist ein außergewöhnliches Buch einer außergewöhnlichen Dichterin. Klug, anregend und voller sublimer Erkenntnisse. Anne Carson gehört zweifellos zu den bedeutendsten zeitgenössischen Lyrikerinnen – und «Decreation» ist bis jetzt eines ihrer wichtigsten Werke.
Ihr großartiger Essay «Decreation – Wie Sappho, Marguerite Porete und Simone Weil Gott sagen» setzt die gelernte Gräzistin sich mit drei großen Frauen und ihren «spirituellen Erlebnissen» auseinander. Sappho, die die Liebe pries und diesen Lobpreis der Göttin Aphrodite weihte; Marguerite Porete hat über die Liebe Gottes geschrieben und wurde dafür 1310 als Ketzerin verbannt; Simone Weil, die «Erfinderin» des Begriffs der «décréation», Altphilologin und Philosophin hatte, wie die Carson schreibt, «ein Programm, mit dem sie ihr Selbst aus dem Weg schaffen wollte, um zu Gott zu gelangen. Um Liebe also geht es diesen drei Frauen, um Liebe auch geht es auch Anne Carson. Auch im Operntext, der ebenfalls den Titel «Decreation» trägt. So lässt sie Hephaistos singen: «Die Liebe ist immer du, / wenn sie frisch ist. / Wenn du da bist, wenn sie frisch ist, wenn sie frisch ist, wenn du da bist, / die Liebe ist immer, / immer / wenn du da bist.». Oder, wenn im 3. Teil des Librettos Simone die «Arie des Rückschöpfens» singt.
Und um «Erhabenes», einer Art Gedichtzyklus, in dem die Autorin in teilweise enigmatische «Versen» Kant eine Frage zu Monica Vitti stellen und Longinus von Antonioni träumen lässt.
Was aber ist dieses Erhabene, was ist die Seele und welcher Schlaf ist Befreiung vom Selbst? Zu erfahren vielleicht im Gespräch mit Gott, das wie Simone Weil auf andere Art auch Anne Carson führt. Es ist ein nahezu undurchdringliches Geflecht, das Anne Carson anbietet. Für den Leser aber, der sich lesend an die «Entflechtung» wagt, ein unendlicher Gewinn. ■
Anne Carson: Decreation – Gedichte, Oper, Essays, 250 Seiten, S. Fischer Verlag, ISBN 978-3-10-010243-0
.
.
.
.
.
Elif Shafak: «Ehre» (Roman)
.
Rosarotes Schicksal und Genug Schönheit
Günter Nawe
.
 Sie heißen Pembe Kader und Jamila Yeter – die Zwillingsschwestern. «Namen wie Zuckerwürfel», findet ihr Vater, «süß und geschmeidig und ohne scharfe Kanten». Übersetzt bedeuten die Namen Rosarotes Schicksal und Genug Schönheit. Nomen est omen. Die Schwestern wurden 1945 «in einem Dorf an den Ufern des Euphrat», in Kurdistan, geboren. Ihre Geschichte erzählt die preisgekrönte türkische Autorin Elif Shafak in ihrem neuen Roman «Ehre». Und sie macht dies auf meisterhafte Weise.
Sie heißen Pembe Kader und Jamila Yeter – die Zwillingsschwestern. «Namen wie Zuckerwürfel», findet ihr Vater, «süß und geschmeidig und ohne scharfe Kanten». Übersetzt bedeuten die Namen Rosarotes Schicksal und Genug Schönheit. Nomen est omen. Die Schwestern wurden 1945 «in einem Dorf an den Ufern des Euphrat», in Kurdistan, geboren. Ihre Geschichte erzählt die preisgekrönte türkische Autorin Elif Shafak in ihrem neuen Roman «Ehre». Und sie macht dies auf meisterhafte Weise.
Ehre! – «Männer besaßen Ehre… Frauen besaßen keine Ehre, sie besaßen Scham. Und ‚Scham’, das wusste jeder, wäre ein ziemlich schlechter Name». Und die Geschlechter haben eine Farbe: Männer sind schwarz, Frauen sind weiß. Und die weiße Fläche verzeiht keinen Schmutz. Jeder Fleck an fehlender Bescheidenheit und Unterwürfigkeit, jede Abweichung von der Keuschheit ist sofort für alle sichtbar. Das werden auch die beiden Schwestern erfahren. Pembe wird «aus Ehre» mit Adem verheiratet, verlässt ihre Heimat in Richtung Istanbul und geht dann endgültig mit ihrer Familie nach London. Ihre Schwester dagegen bleibt «ehrenhaft» in ihrer Heimat und lebt dort ein Leben als eine unverheiratete Frau, gefangen in den alten Traditionen.
Pembe versucht, im fernen London mit ihrem Mann und ihren drei Kindern ein erfülltes Leben in einem anderen, in einem modernen Kulturkreis zu leben. Dass dies nicht gelingt, macht die Tragik dieses Romans aus. Gescheiterte Hoffnungen, Verrat und Verlust – ein schöner Traum ist sehr schnell ausgeträumt. Da ist einmal die fremde Welt, die mit ihrem liberalen und freizügigen Lebensverständnis verstört. Da sind andererseits die Familie und die patriarchalischen Strukturen. Die Kinder werden «flügge», ihr Mann ist ein Zocker, der sich zudem noch in einer anderen Frau, einer Nackttänzerin, verfällt und die Familie verlässt. Und Pembe begegnet einem heimatlosen Koch, Sie verliebt sich in ihn, sie trifft sich heimlich mit ihm – und weiß, dass sie damit gegen den Ehrencodex ihrer Religion und Kultur verstößt. Kein «rosarotes Schicksal» also. Und am Ende steht ein unbegreiflicher Mord aus «Ehre» – begangen von dem Sohn Iskender an seiner Mutter. Eine «Ehrensache»!
 Elif Shafak (Bild) schreibt eine wunderbar klare, eine nahezu sinnliche Sprache, die den Leser sofort gefangen nimmt. Sehr sensibel und mit viel Empathie begleitet sie ihre Figuren durch das Romangeschehen. Und packend und ausdrucksstark schildert die wunderbare Autorin den Kontrast zwischen türkisch-islamischer Tradition und britisch-westlicher Lebenswelt.
Elif Shafak (Bild) schreibt eine wunderbar klare, eine nahezu sinnliche Sprache, die den Leser sofort gefangen nimmt. Sehr sensibel und mit viel Empathie begleitet sie ihre Figuren durch das Romangeschehen. Und packend und ausdrucksstark schildert die wunderbare Autorin den Kontrast zwischen türkisch-islamischer Tradition und britisch-westlicher Lebenswelt.
Im fernen Kurdistan lebt Jamila «Genug Schönheit» – auch sie gefangen in ihrer Lebenswelt – ein anderes Leben als Hebamme und Heilerin, fest verwurzelt in den Traditionen einer islamischen Männergesellschaft. Einst war sie verliebt in Adem und er in Jamila. Aber diese Verbindung durfte nicht sein, weil auch ihre Ehre «beschmutzt» war. So geht es in diesem Leben auch für sie nicht ohne Verletzungen ab.
Im ständigen Kontakt der Zwillingsschwestern weiß Jamila um das Leben von Pembe. Und so ahnt die sensible Jamila, dass sich in London, dass sich für Pembe Unheil anbahnt. Sie macht sich aus schwesterlicher Liebe auf nach London. Ob sie retten kann, was nicht zu retten ist, sei an dieser Stelle dahingestellt.
Elif Shafak erzählt diese Geschichte als ein Familienepos und einen Generationsroman, fast in Episodenform und wechselt häufig die Zeitebenen und die Sichtweisen auf das Geschehen. So hält sie den Spannungspegel hoch. Die Schilderung des Lebens der Protagonisten, alle durchweg sehr komplexe Charaktere, im Widerstreit zwischen Islam und westlichen Lebensstilen gelingt der erfolgsgewohnten türkischen, in Straßburg geborenen Schriftstellerin hervorragend. ■

Elif Shafak hat mit «Ehre» einen wunderbaren Roman geschrieben, in dem sie das Schicksal zweier Schwestern zwischen den Traditionen von islamischer Religion und moderner Lebenswelt auf unnachahmliche Weise thematisiert und zu einer spannenden und berührenden Familiengeschichte gestaltet. Lesenswert!
Elif Shafak: Ehre, Roman, Kein&Aber-Verlag, 528 Seiten, ISBN 978-3036956763
.
.
.
.
.
Gesina Stärz: «Die Verfolgerin» (Roman)
.
«Heute Nacht bin ich gestorben»
Günter Nawe
.
 Was wäre, wenn… man einfach einen Menschen töten würde. Einfach so – auf der Straße? Traum oder Albtraum – oder gar Wirklichkeit? Ein solcher Gedanke jedenfalls wird für Jossi zu einer Art Obsession. Dabei ist Jossi, Anfang vierzig, eine eigentlich recht unauffällige Frau, die in sogenannten gutbürgerlichen Verhältnissen lebt. Ihr Mann ist Kardiologe, die beiden Söhne studieren, sie verdient sich ihr Geld als Texterin.
Was wäre, wenn… man einfach einen Menschen töten würde. Einfach so – auf der Straße? Traum oder Albtraum – oder gar Wirklichkeit? Ein solcher Gedanke jedenfalls wird für Jossi zu einer Art Obsession. Dabei ist Jossi, Anfang vierzig, eine eigentlich recht unauffällige Frau, die in sogenannten gutbürgerlichen Verhältnissen lebt. Ihr Mann ist Kardiologe, die beiden Söhne studieren, sie verdient sich ihr Geld als Texterin.
Wäre da nicht… Von ihrem Mann, der im Roman nur als «der Ehemann» oder «der Mann» bezeichnet wird, fühlt sie sich nach zwanzig Jahren Ehe nicht mehr genügend beachtet, ja verlassen – und wird es letztendlich auch. Ihre Liaison mit Till ist mehr oder minder oberflächlich. Bleibt nur der Schmerz, das Unausgefülltsein. Am Ende hat der Leser ein großartiges Psychogramm einer Frau gelesen.
«Heute Nacht bin ich gestorben», so heißt es zu Beginn des Romans. «Innerlich… Der Mann neben mir im Bett hat geschnarcht…« Ein Whiskey sour lässt «alle Zellen in mir in Schneekristalle verwandeln. Ich weiß nicht, ob ich das geträumt habe, aber ich fühlte mich besser, und etwas in mir wusste, dass dieser Zustand anhalten würde.»
Soweit also die «psychologischen» Voraussetzungen in dem Roman «Die Verfolgerin» von Gesina Stärz. Die Autorin, sie ist in Sachsen geboren, lebt in München und hat mit «kalkweiss» bereits 2011 einen beachtlichen und beachteten Roman veröffentlicht. In ihrem neuen Roman gelingt es ihr auf sehr subtile Weise, Fiktion und Wirklichkeit in Einklang zu bringen, ein spannendes Geflecht von Traum und realem Erleben herzustellen.
Jossi «erfindet» sich ein neues Leben außerhalb der bisherigen Lebenswirklichkeit. Sie verstrickt sich in die Gedankenwelten von Mörderinnen und Mördern, plant gedanklich den perfekten Mord. Motiv: Fehlanzeige. Ihre «Opfer»: Zufallsbegegnungen und Menschen, auf deren Gesichtern alle Empfindungen gelöscht sind. Sie wird zur «Verfolgerin» – auf der steten Suche nach ihren Opfern.
Hier bekommt der Roman einen interessanten kriminalistischen Touch. Jossi recherchiert bis ins kleinste Detail eine Tötungsmethode, die keine Spuren hinterlässt. Ein Gift, das nicht oder kaum nachweisbar ist, wird über eine komplizierte Konstruktion durch einen Stock für das Opfer kaum wahrnehmbar injiziert wird.

Gesina Stärz hat einen schönen und spannenden Roman geschrieben, der angesiedelt ist zwischen Psychologie und Kriminalistik, zwischen Traum und Wirklichkeit – und zugleich eine interessante psychologische Studie darstellt über Fiktion und Realität
Die «Planungen» der Morde, die Recherche nach einem seltenen Gift, die Konstruktion der «Waffe», die «Durchführung» (Jossi hat 17 Morde begangen, und niemand hat es bemerkt) – dies alles steht in direktem Zusammenhang mit dem realen Leben der Verfolgerin. Nach außen sieht es so aus, als gelte der ganze Aufwand einem Romanprojekt. Familie, Freundinnen, der Liebhaber – sie alle werden auf raffinierte Art und Weise getäuscht. Alles andere bleibt offen. Fiktion oder Realität? Am Ende bekennt die Verfolgerin: «Ich wollte nicht, das der Ehemann geht. Ich wollte, dass er mich sieht, dass er mich spürt, dass er mir die Hand reicht.». Gibt es hier doch das, was Psychologen und Kriminologen ein Motiv nennen?
Am Ende steht auch ein Satz, der diesen Roman in sprachlicher Hinsicht charakterisiert: «Ihr Ton ist sachlich und wirkt streng.» Das gilt auch für Gesina Stärz’ Sprache, die fast emotionslos ist und wie ein Dossier gelesen werden kann. Die Spannung bezieht das interessante Werk aus seiner gelungenen Mischung von Traum und Wirklichkeit – und tieferer Bedeutung. ■
Gesina Stärz: Die Verfolgerin, Roman, edition 8, 174 Seiten, ISBN 978-3-85990-183-4
.
.
.
.
Jaume Cabré: «Das Schweigen des Sammlers» (Roman)
.
Von Dämonen besessen
Günter Nawe
.
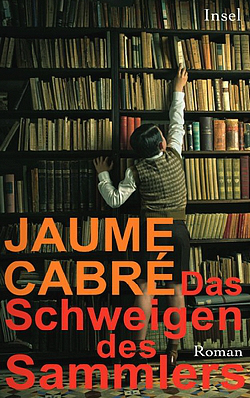 Die Vial, eine wertvolle Geige aus der Werkstatt des Cremoneser Geigenbauers Storioni aus dem 18. Jahrhundert, übt eine seltsame Faszination auf den jungen Adrià Ardèvol aus. Dieser polyglotte, außerordentlich begabte Sohn eines Antiquitätenhändlers aus Barcelona und diese Geige mit ihrem bezaubernden Klang, an der allerdings Blut klebt, stehen im Mittelpunkt des neuen Romans des katalanischen Autors Jaume Cabré.
Die Vial, eine wertvolle Geige aus der Werkstatt des Cremoneser Geigenbauers Storioni aus dem 18. Jahrhundert, übt eine seltsame Faszination auf den jungen Adrià Ardèvol aus. Dieser polyglotte, außerordentlich begabte Sohn eines Antiquitätenhändlers aus Barcelona und diese Geige mit ihrem bezaubernden Klang, an der allerdings Blut klebt, stehen im Mittelpunkt des neuen Romans des katalanischen Autors Jaume Cabré.
Die Geige, die Adrià bald perfekt zu spielen versteht, ist auch der Grund für ein Tötungsdelikt, für einen geheimnisvollen Mord, dem Adriàs Vater Felix Ardèvol i Bosch zum Opfer fällt. Für dieses Verbrechen macht sich der Junge selbst verantwortlich. Hat er doch die wertvolle Stoirioni, die sein Vater einem Interessenten zeigen will, gegen seine eigene und weniger wertvolle Geige ausgetauscht. Diese «Schuld», die er später auf andere Weise – die Geige gehörte eigentlich einem jüdischen Besitzer – abtragen will, muss Adrià leben.
Das ist die Konstellation, aus der heraus der Autor seinen Roman konstruiert. Dabei entwickelt er Handlungsstränge, die sich ständig überschneiden oder parallel zueinander verlaufen. Das vielstimmige Personal dieses umfangreichen Buches, die Schauplätze, ein schier unübersehbare Fülle von Ereignissen in Vergangenheit und Gegenwart – das alles ist auf höchst kunstvolle Weise mit- und ineinander verschränkt, so dass eine Nacherzählung fast unmöglich wird.
Dennoch: Gelehrter soll nach Vaters Willen Adrià werden, nach Mutters Willen Geigenvirtuose. Die Konflikte, die sich daraus für den Jungen ergeben, sind evident – und machen die psychische Situation aus, in der der sensible Adrià, eine höchst eindrucksvolle Figur, sich befindet. Adrià – wie schon sein Vater – ist nicht nur von der Musik besessen, sondern auch von dessen Sammelleidenschaft erfasst. Er verstand, «…dass ich von dem gleichen Dämon besessen war wie mein Vater. Das Kribbeln im Bauch, das Jucken in den Fingern, der trockene Mund…». Adrià versucht, sich in diesem Zwiespalt von Gefühlen und Ambitionen, was einem Fluch gleichkommt, zwischen musikalischem Virtuosentum und Gelehrsamkeit einzurichten.
Aus den Recherchen Adriàs über den Mord an seinem Vater und auf der Suche nach dem Täter erschließt sich die Familiengeschichte und die Geschichte der Geige und ihrer Entstehung in Cremona im 17./18. Jahrhundert. Eine dunkle Vergangenheit tut sich auf. Sie ist verbunden mit der Inquisition im 14. und 15. Jahrhundert, in der der Großinquisitor und sein Sekretär, ein Meuchelmörder, ein Mönch und ein jüdischer Arzt entscheidende Rollen spielen; Paris wird zum Schauplatz und 1914 bis 1918 auch Rom. Eine Geschichte, die Jaume Cabré in Auschwitz–Birkenau 1944 enden lassen wird, mit den schrecklichen Verbrechen von Sturmbannführern und KZ-Ärzten an jüdischen Häftlingen. Cabré schlägt damit einen historischen Bogen vom Mittelalter bis in die Neuzeit – und stellt oft erschreckende Übereinstimmungen, vor allem in ihren negativen Erscheinungsformen, fest.
Es ist eine Geschichte, es sind viele Geschichten in einer von Gier und Macht und Neid, von dunklen Mordfällen und finsteren Intrigen, vom Bösen schlechthin – aber auch über die Liebe. Eine Liebe, die Adrià und Sara erleben und erleiden. Der Roman ist eine Art Metapher über den Missbrauch von Macht und über die Macht der Kunst. Damit ist dieser wunderbare Roman auch ein Buch über die conditio humana, melancholisch dargestellt und sehr tragisch, der sich Adrià ausgesetzt sieht. Rettung erwächst ihm jedoch aus der Liebe und aus der Liebe zur Gelehrsamkeit und zur Musik.
Jaume Cabré wechselt oft unerwartet die Zeitebenen. Erzählzeit und erzählte Zeit gehen plötzlich ineinander über. Es ist ein faszinierendes Tableau der Gleichzeitigkeit von aktuellem Geschehen, von Erinnerung und historischen Fakten, das dieser geniale Autor geschaffen hat. Mitten im Satz wird aus dem Ich-Erzähler ein auktorialer Erzähler; ergibt sich eine Art «Wechselgesang» zwischen der ersten und dritten Person. Wir haben es mit einer sehr kühnen, jedoch sehr gelungene Romankonstruktion zu tun, die vom Leser ein hohes Maß an Aufmerksamkeit erfordert; ihn dafür aber auch wunderbar belohnt. Die kongeniale Übersetzung durch Kirsten Brandt und Petra Zickmann trägt dazu in hohem Maße bei.

Jaume Cabrés Roman “Das Schweigen des Sammlers” ist eine Studie von einzigartigem, ja weltliterarischem Rang über die Macht und deren Missbrauch – und über die Macht der Kunst.
Jaume Cabré ist ein äußerst kluger, ein souveräner Autor. Das hat er bereits in seinen früheren Büchern («Die Stimmen des Flusses», «Senyoria») bewiesen. Mit diesem Roman toppt er jedoch seine bisher erschienenen Romane. Das hat nicht nur etwas mit dem Plot, den vielen Plots, sehr ambitioniert und virtuos miteinander verknüpft, zu tun, sondern auch mit der Musikalität der Sprache des katalanischen Autors. Jaume Cabré hat einmal darüber gesagt: «…denn mehr noch als Schriftsteller bin ich Musiker, jedenfalls, was die Leidenschaft angeht… Es gibt eine syntaktische Kadenz, an der ich dauernd arbeite…». Genau so auch liest sich der Roman, hoch musikalisch, von großer sprachlicher Dichte, artistisch, ohne artifiziell zu sein.
Es sicher nicht zu weit ausgeholt, diesem großartigen Roman weltliterarischen Rang zuzusprechen. ■
Jaume Cabré: Das Schweigen des Sammlers, 839 Seiten, Insel-Suhrkamp Verlag, ISBN 978-3-458-17522-3
.
.
.
.
.
.
Andreas Maier: «Das Haus» (Roman)
.
«Ich im Haus und alle anderen draußen»
Günter Nawe
.
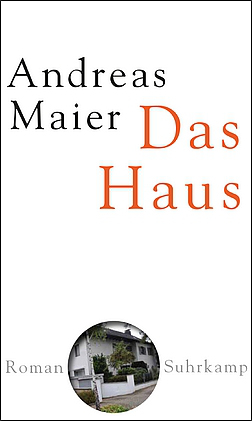 Es ist nicht das erste Mal, dass Andreas Maier literarisch im besten Sinne auffällig wird. Bereits mit «Wäldchestag» hat er auf sich aufmerksam gemacht. Und mit «Das Zimmer» (2010) den großartigen Beginn eines auf elf Bände angelegten Romanzyklus’ vorgelegt: eine Familiensaga, ein großangelegter Heimatroman. Und das ist in diesem Falle kein negativ besetzter Begriff, sondern für Andreas Maier schon fast ein Markenzeichen. Jetzt liegt der zweite Band – betitelt «Das Haus» – vor. Und wieder kann man nur staunen, mit welcher Sensibilität, mit wieviel Empfinden sich der Autor in die Welt eines Kindes hinein versetzen kann. Eines Kindes zudem, das soziophob, das beinahe autistisch ist. Dieses kinndliche Ich – und vielleicht liegt da der Grund – hat in dieser autobiografisch eingefärbten Geschichte zweifellos Bezüge zum Autor Andreas Maier selbst.
Es ist nicht das erste Mal, dass Andreas Maier literarisch im besten Sinne auffällig wird. Bereits mit «Wäldchestag» hat er auf sich aufmerksam gemacht. Und mit «Das Zimmer» (2010) den großartigen Beginn eines auf elf Bände angelegten Romanzyklus’ vorgelegt: eine Familiensaga, ein großangelegter Heimatroman. Und das ist in diesem Falle kein negativ besetzter Begriff, sondern für Andreas Maier schon fast ein Markenzeichen. Jetzt liegt der zweite Band – betitelt «Das Haus» – vor. Und wieder kann man nur staunen, mit welcher Sensibilität, mit wieviel Empfinden sich der Autor in die Welt eines Kindes hinein versetzen kann. Eines Kindes zudem, das soziophob, das beinahe autistisch ist. Dieses kinndliche Ich – und vielleicht liegt da der Grund – hat in dieser autobiografisch eingefärbten Geschichte zweifellos Bezüge zum Autor Andreas Maier selbst.
Und so erzählt er, besser: lässt er Andreas erzählen von den Jahren früher Kindheit wie von einem verlorenen Paradies. «Drinnen» ist das erste von zwei Kapiteln überschrieben. Fremd ist Andreas in einer Welt, der er sich zudem durch eine Art Sprachlosigkeit verweigert. Es gab in diesem Leben noch keine Zwänge, einzig die Urgroßmutter ist so etwas wie eine Bezugsperson. Alles spielt sich im Innern des Kindes ab, ist eine Form der Erinnerungsarbeit. Mit drei Jahren beginnt er sich zu erinnern. «Bis heute kommt es mir vor, als habe damals mein Kopf begonnen, eine Geschichte zu erzählen, die Geschichte meiner Welt oder der Welt schlechthin.» Oder: «Vielleicht war es einfach die Welt, die mir die Welt erzählte.» Und: «… so rekontruiere ich bis heute eigentlich auch immer wieder zwanghaft die Jahre, an die ich mich nicht erinnern kann…». Das also ist die Geschichte, die Andreas Maier erzählt.
«Nach der Verweigerung des Kindergartens hatte ich noch drei Jahre im wiedergefundenen Paradies gelebt.» Doch dann wird diese Welt sehr real. Mit dem Einzug in ein neues Haus beginnt für Andrreas auch das Leben, von dem im Kapitel «Draußen» erzählt wird. Maier porträtiert ein Kind, das sich bewusst als Außenseiter gibt, für den das neue Haus, das er allerdings nun immer wieder verlassen muss, zum Rückzugsraum wird aus der Welt draußen. Erstaunlich ist, dass es von der Außenwelt keine Repressionen ob dieser Verweigerungshaltung gibt. Eher erfährt das Kind Verständnis. «Faul ist er nicht, dumm auch nicht, aber er zieht sich immer so zurück», so die Eltern.
Er konnte sich den Gesetzen der Schule einfach nicht unterordnen. Freunde hatte er nicht, mitmachen wollte er nicht. Er war allein und wollte allein sein. Bei sich war er nur dann. Dieses Leben, diese Welt aber hat auch etwas Bedrohliches, generiert Angst. Sie liegt «…wie ein Gemälde von Breughel…vor mir». Aufregend aber war das «andere» Leben, das Leben im Haus jedoch nicht.besonders. Für das Kind galt es nur zu beobachten: die Eltern, die Geschwister, das Leben draußen – aus sicherer Entfernung.

Roman einer Kindheit, Familiensaga und Heimatroman – Andreas Maier ist mit «Das Haus» ein außergewöhnliches Buch gelungen, das durch die psychologische Tiefe, durch eine fast klinische Nüchternheit und seine lakonische Diktion überzeugt.
So unterscheidet sich dieser Roman von Andreas Maier, wunderbar lakonisch und schon fast schlicht erzählt, grundlegend von anderen Büchern dieser Art, seien sie Kindheitserinnerungen, Entwicklungsromane und ähnliches. Er hat eine ganz eigenen und unverwechselbare Handschrift. Und wenn Maier auch nicht das Kind ist: das Kind ist doch ein Stück weit der brillante und außergewöhnliche Autor Andreas Maier. Das Leben draußen also: Das ist für das Kind und für Andreas Maier die Straße, in der das Haus steht, die Stadt Bad Nauheim, die Wetterau. So wird dieser Roman zu einer Art Heimatroman. Hier ist der Autor Andreas Maier zu Hause – und von hier und darüber erzählt er. «Und die Musik vermischte sich mit meinem Zustand und dem Haus und allen Räumen und der Wetterau vor den Fenstern. Mit den Bäumen, mit der Usa, dem Himmel, und der Ferne, auch mit Herrn Rubin, der lautlos da draußen vor sich hinarbeitet», heißt es am Ende des Romans – dieser Familiensaga, auf deren Fortsetzung wir gespannt sein dürfen. ●
Andreas Maier: Das Haus, Roman, 164 Seiten, Suhrkamp Verlag, ISBN 978-3-518-42266-3
.
.
.
.
.
Tomas Espedal: «Gehen – oder die Kunst, ein wildes und poetisches Leben zu führen»
.
«Warum nicht mit der Straße beginnen»
Günter Nawe
.
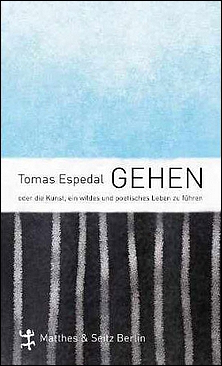 Während Thomas Bernhard in seiner Erzählung «Gehen» Denken und Gehen in einem schier unmöglichen Zusammenhang sieht, findet Karl Krolow in seiner Erzählung «Im Gehen»: «Späth wollte einiges im Gehen loswerden. Er wollte das, was anhänglich war, vergessen.» Beide Titel – und einige mehr – fallen dem Leser (vielleicht) ein bei der Lektüre des wunderbaren Buches des Norwegers Tomas Espedal: «Gehen – oder die Kunst, ein wildes und poetisches Leben zu führen».
Während Thomas Bernhard in seiner Erzählung «Gehen» Denken und Gehen in einem schier unmöglichen Zusammenhang sieht, findet Karl Krolow in seiner Erzählung «Im Gehen»: «Späth wollte einiges im Gehen loswerden. Er wollte das, was anhänglich war, vergessen.» Beide Titel – und einige mehr – fallen dem Leser (vielleicht) ein bei der Lektüre des wunderbaren Buches des Norwegers Tomas Espedal: «Gehen – oder die Kunst, ein wildes und poetisches Leben zu führen».
Doch wie anders ist dieses Buch dieses Autors. Espedal sieht sehr wohl einen Zusammenhang zwischen Gehen und Denken, einen sehr fruchtbaren gar. Auch geht es ihm nicht darum, etwas loszuwerden, zu vergessen, sondern etwas zu gewinnen. Und dies geschieht durch waches Beobachten, durch ein Den-Dingen-«nachdenken», durch Reflexion – auf dem Weg zu sich selbst.
Dieser Tomas Espedal (geb. 1961), ein in Norwegen sehr geschätzter Autor, ist leider im deutschen Sprachraum bisher völlig unbekannt. «Gehen» ist das erste seiner Werke, das in deutscher Übersetzung (Paul Berf) vorliegt.
«Wir denken weniger, wenn wir weit gehen, wir gleiten in den Rhythmus des Gehens, und die Gedanken enden, werden zu einer konzentrierten Aufmerksamkeit, die darauf gerichtet ist, was wir sehen und hören, was wir riechen; diese Blume, der Wind, die Bäume, als würden die Gedanken umgeformt und zu einem Teil dessen werden, was ihnen begegnet; ein Fluss, ein Berg, ein Weg.» So formuliert Espedal seine «Kunst, ein wildes und poetisches Leben zu führen» – und damit fast eine kleine Philosophie des Gehens.
«Warum nicht mit einer Straße beginnen» – mit diesem Satz beginnt dieses wunderbare Buch. «Hatte ich mir nicht schon seit langem gewünscht, mich auf den Weg zu machen, ohne Kurs und Ziel, und nur zu gehen, in eine einzige, beliebige Richtung… Der Philosoph ging täglich. Das schärfe sein Denken.» So gerüstet verlässt ein Mann Frau, Kind und Haus, um das Leben eines Landstreichers zu führen. Er macht sich auf den schon erwähnten Weg zu sich selbst. Es ist ein abenteuerlicher Weg – zum Beispiel durch sein Heimatland Norwegen. Und schnell stellt er fest: «Du bist glücklich, weil du gehst.» Dies Gehen ist aber nicht nur Glück. Es ist auch ein Scheitern, es ist Trinken, ist Not, ist manchmal ein hohes Maß an Verzweiflung. Sein «Gehen» durch Norwegen, später Frankreich und Deutschland, ist eine existenzielle Erfahrung. Im Gepäck hat Espedal, der Schriftsteller, eine Reihe von Kollegen. Vor allem sind es Jean-Jacques Rousseau und Arthur Rimbaud, die ihn «begleiten». Später wird er auf Alberto Giacometti treffen, einen Dialog mit Eric Satie führen, in Deutschland dann, in Todtnauberg, auf Martin Heidegger («Der Feldweg») stoßen. So ist diese Reise auch und vor allem – neben den körperlichen Anforderungen – ein Abenteuer des Denkens.
An einer Stelle zitiert Espedal Walt Whitman, auch er Tramp und Wandersmann:
«Zu Fuß und leichten Herzens schlag ich die offene Straße ein,
Gesund, frei, vor mir die Welt
…
Hinfort frage ich nicht nach Glück, ich bin das Glück
…
Stark und zufrieden zieh ich den offenen Weg.»

Tomas Espedal erzählt vom Abenteuer des Gehens und des Denkens in Reflexionen, Geschichten und wunderbaren Beschreibungen. Illustre Gefährten aus Literatur und Philosophie begleiten den «Landstreicher» auf seinen Wegen durch Norwegen, Frankreich, Deutschland, Griechenland und die Türkei – und die Landschaften des Denkens.
«Stark und zufrieden» zieht Espedal seinen Weg und lernt die Kunst zu reisen! Viele haben sich schon an ihr – teilweise sehr erfolgreich – versucht. W. G. Sebald fällt uns ein und Gottfried Seume. Und all die Flaneure und Spaziergänger der Literaturgeschichte. Tomas Espedal reiht sich mit seinen poetischen Texten ein. Und nimmt uns mit in ein «wildes» Leben, das im zweiten Teil des Buches nach Griechenland, über den Peloponnes und in die Türkei führt. Mit dem Autorenfreund Narve Skaar ist er unterwegs. Sie «gehen, um zu gehen, um zu sehen». Und sehen und erleben sehr viel. Daraus ergeben sich sehr schöne, kleine Erzählungen. Über Istanbul und Merih Günay, der an «Fernando Pessoa erinnert». Oder über den Oberst und seine Familie, denen sie, Espedal und Skaar, auf dem Wege nach Olympos begegnen.
Es ist das Abenteuerliche, das an diesem Buch fasziniert. Es sind aber auch auch die «Gespräche», die der Wanderer führt, die Reflexionen, die sich daraus ergeben. Der Leser «geht» gern mit, lässt sich führen und verführen.
Tomas Espedal, Gehen – oder die Kunst, ein wildes und poetisches Leben zu führen, 235 Seiten, Matthes & Seitz Berlin, ISBN 978-3-88221-551-9
.
.
.
.
Interview mit Rebecca Gablé («Der dunkle Thron»)
.
«Ich erzähle euch, wie es gewesen sein könnte»
Günter Nawe
.
Vor einigen Tagen veröffentlichte die deutsche Bestseller-Autorin Rebecca Gablé (Bürgerlicher Name: Ingrid Krane-Müschen) mit «Der dunkle Thron» ihren 13. «historischen Roman». Für das Glarean Magazin fragte Günter Nawe die erfolgreiche Schriftstellerin nach ihren literarischen Motivationen und nach den Gründen des Booms von Mittelalter und Renaissance in der modernen Literatur.
.
Glarean Magazin: Frau Gablé, vom berühmten Leopold Ranke stammt das Diktum, dass der Historiker aufzuzeigen habe, «wie es eigentlich gewesen» sei. Hat sich die Mediävistin und Schriftstellerin Rebecca Gablé diesen Satz zueigen gemacht?
Rebecca Gablé: Nein, denn dieser Anspruch ist unerfüllbar und überholt. Ganz gleich, wie gründlich wir schriftliche Quellen und archäologische Funde auswerten, kann das, was wir daraus ableiten, doch immer nur eine Rekonstruktion von Vergangenheit sein. Ein educated guess, wie die Briten sagen: eine Vermutung auf Grundlage der bekannten Indizien. Wie es «eigentlich gewesen» ist, können wir nicht erforschen und darum niemals wissen. So betrachtet, haben wir Schriftsteller es einfacher als die armen Wissenschaftler, denn wir sagen lediglich: «Ich erzähle euch, wie es gewesen sein könnte.» Nichts anderes hat übrigens auch Leopold Rankes Urgroßneffe Robert Graves getan: Er hat mit Kaiser Claudius einen Ich-Erzähler von scheinbar großer Zuverlässigkeit erdacht, der behauptet, er werde die Geschichte nun so erzählen, wie sie «eigentlich gewesen» sei, um dann ein abenteuerliches Konstrukt aus Intrigen und Mord zu spinnen, das zwar möglich, aber keinesfalls nachweisbar ist. Es kommt einem vor, als habe er mit einem Augenzwinkern in Richtung seines berühmten Vorfahren geschrieben.
GM: Sie haben sich vorwiegend und äußerst erfolgreich am englischen Mittelalter «abgearbeitet». In einem Interview haben Sie einmal gesagt: «Mein Herz gehört dem historischen Roman und dem englischen Mittelalter». Warum gerade diesem?
RG: Meine Vorliebe für das englische Mittelalter geht auf mein Literaturstudium zurück. Dort bin ich zum ersten Mal der englischen Dichtung des 8. bis 14. Jahrhunderts begegnet, die mich seither fasziniert und meine Fantasie anregt, weil sie so farbenprächtig, ausdrucksstark und in vieler Hinsicht auch sonderbar ist. All diese Werke – auch wenn sie religiöse oder sagenhafte Motive behandeln – erzählen etwas über ihre Verfasser und deren Zeit. Darum erschien es mir immer naheliegend, diese Literatur als Ausgangspunkt zu nehmen und mir die Lebenswelt der Dichter und ihrer Zeitgenossen vorzustellen. Von da war der Schritt nicht mehr weit, mich an einem historischen Roman zu versuchen, der, wie sich herausstellte, eine Literaturform ist, die mir besonders liegt.
GM: Mit dem neuen Roman «Der dunkle Thron» haben Sie allerdings das Mittelalter verlassen. Der vierte Teil der berühmten Waringham-Saga spielt bereits in der Renaissance, im 16. Jahrhundert. War das dem Interesse Ihrer Leserschaft geschuldet, die nach «Das Lächeln der Fortuna», «Die Hüter der Rose» und «Das Spiel der Könige» einfach wissen wollte, wie es weitergeht mit den Waringhams?
RG: Dem Interesse meiner Leserschaft und meinem. Ich wäre nicht in der Lage, mich zwei Jahre lang einem Thema zu widmen, das nicht in allererster Linie meine eigene Neugier weckt. Ich selber wollte wissen, wie es den Waringham – diesen wertekonservativen Spinnern, die immer noch Ritter sein wollen – in einer Epoche ergehen würde, die sich in vielerlei Hinsicht radikal vom Mittelalter unterscheidet.
GM: Im Mittelpunkt der Tetralogie steht das Geschlecht derer von Waringham. Mit dem Roman «Der dunkle Thron» haben Sie dieses Geschlecht in der mittlerweile sechsten Generation durch eine fast 200-jährige Geschichte begleitet und damit einen relativ langen Zeitraum der Geschichte abgeschritten. Wie hält das die Autorin durch, ohne den roten Faden zu verlieren?
RG: Mit Stammbäumen, sehr vielen Notizen und einem halbwegs zuverlässigen Gedächtnis.
GM: Die «Waringhams» sind ein fiktive Größe in Ihrem Roman. Sie erleben Abenteuer, Liebesgeschichten, Aufstieg und Fall. Dies alles eingebunden in den Fluß realer Geschichte. Wie viel in Ihren Romanen ist Fakt, wie viel Fiktion?
RG: Das ist schwierig zu bemessen, und wir sprachen ja eingangs schon über die Problematik historischer «Fakten». Dem historisch verbrieften Personal meiner Romane (das ja meist in der Überzahl ist), dichte ich keine Taten an, die sie nicht tatsächlich vollbracht haben, aber in dem Moment, da ich sie zu Romanfiguren mache, werden sie fiktionalisiert. Ich bemühe mich, ihre Charaktere so zu beschreiben, wie sie nach meiner Deutung wahrscheinlich waren, aber dessen ungeachtet werden sie zu Geschöpfen meiner Fantasie mit einer eigenen Ausdrucksweise und Körpersprache, mit Dialogen und Emotionen. Das gilt natürlich erst recht für die erfundenen Figuren, also zum Beispiel alle Waringham, obwohl ich auch dort immer mein Augenmerk darauf richte, ihre Lebensgeschichte so zu zeichnen, wie sie sich in der jeweiligen Epoche hätte zutragen können.
GM: Mit Nicholas Waringham, dem Protagonisten des neuen Romans, haben sie eine starke, eine faszinierende Figur geschaffen. Hat es eine vergleichbare Persönlichkeit in dieser Zeit gegeben – oder anders: Hätte es diesen Nicholas Waringham geben können?
RG: Es hätte Nicholas of Waringham in dem oben beschriebenen Sinne geben können, aber er hat kein historisches Vorbild.
GM: Historische Hauptfiguren in Ihrem Roman sind König Heinrich VIII., Anne Boleyn und seine anderen Frauen. Uns ist aufgefallen, dass Sie Heinrich VIII. nicht unbedingt mögen, die Frauen – vor allem Mary, seiner Tochter und späteren Königin, dafür Ihre – sagen wir einmal so – besondere Sympathie genießen. Haben wir richtig gelesen?
RG: Ich muss widersprechen: Die historische Hauptfigur dieses Romans ist allein die besagte Tochter, die spätere Königin Mary I. Ihr Vater Heinrich VIII. (den ich in der Tat fürchterlich finde), ihre Mutter und ihre fünf Stiefmütter sind natürlich wichtige Figuren, aber im Grunde nur in ihrer Beziehung zu Mary oder dem Protagonisten Nicholas of Waringham. Ich glaube, ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass ich «besondere Sympathie» für Mary hege, dafür waren die Gräuel ihrer Regentschaft vielleicht einfach zu schrecklich. Aber es war mein Anliegen, diese in den Geschichtsbüchern so oft vernachlässigte Königin einmal zu entstauben, genauer zu betrachten und zu ergründen, warum sie wurde, wie sie war. Das ist es auch, was dieser Roman erzählt. Und je besser ich Mary kennen lernte, desto größer wurde meine Toleranz ihr gegenüber.
GM: Das ganze Romangeschehen spielt vor dem Hintergrund der geistigen, religiösen und politischen Umbrüche im 16. Jahrhundert. Und das nicht nur in England, das neben seinen Königen auch Persönlichkeiten wie Thomas Morus aufzuweisen hatte. Wir sprechen von der Reformation, die auch England erreicht, von der Loslösung Englands von dem Papst, von Heiratspolitik mit politischen Folgen. Hat die lange und intensive Beschäftigung mit dieser Zeit auch die Sichtweise der Autorin beeinflusst?
RG: Natürlich habe ich bei meiner Recherche viel Neues gelernt und bin Personen, Gedanken und Ereignisketten begegnet, von denen ich zuvor nur nebulöse Vorstellungen hatte. Aber meine Sichtweise hat sich nicht geändert. Ich wusste vorher schon, dass Religionen und Absolutheitsansprüche in Glaubensfragen das gefährlichste Konfliktpotenzial sind, das die Menschheit je ersonnen hat.
GM: Sie haben einmal gesagt, Ihr vordringliches Ziel sei zu unterhalten. Kann das gerade der historische Roman mit seiner Mischung aus Fakten und Fiktion leisten? Und ist darin das große Interesse Ihrer ständig wachsenden Leserschaft begründet? Auch weil – wir kommen noch einmal auf den Satz von Leopold Ranke zurück – es Ihnen so gelingt, am besten zu zeigen, «wie es eigentlich gewesen» ist?
RG: Ich glaube nicht, dass der historische Roman einen höheren Unterhaltungswert hat als andere Genres. Der anhaltende Erfolg ist eher der Mischung aus Unterhaltung und Wissensvermittlung geschuldet – «Infotainment», um mal ein besonders abscheuliches Wort zu bemühen, ist ja sehr in Mode. Viele Menschen interessieren sich für Geschichte und wollen wissen, wie die Welt früher war oder wie wir zu der Gesellschaft wurden, die wir heute sind, aber längst nicht alle haben die nötige Zeit oder Motivation, sich zur Beantwortung ihrer Fragen durch historische Fachliteratur zu quälen. Sie greifen lieber zu einem historischen Roman.
GM: Wie wir sehen, ist Ihnen das bestens gelungen zu unterhalten. «Der dunkle Thron» ist mittlerweile Ihr 13. Roman. Sie sind Bestseller-Autorin, gelten als «Königin des historischen Romans», sind in in Bücher-Charts prominent vertreten. Was kann jetzt noch kommen? Eine Fortsetzung der «Waringham-Saga» – oder etwas ganz anderes?
RG: Auf jeden Fall eine Rückkehr in mein geliebtes Mittelalter. Aber mehr wird noch nicht verraten… ■
.
.
.
.
Rebecca Gablé: «Der dunkle Thron»
.
Geschichte in Geschichten
Günter Nawe
.
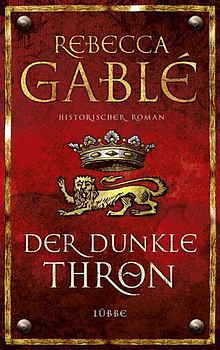 Es waren in jeder Hinsicht aufregende Zeiten, die England zwischen 1529 und 1553 erlebte. Heinrich VIII. wird sich von der katholischen Kirche lossagen, eine Frau nach der anderen heiraten. Einige, wie Anne Boleyn, landen auf dem Schafott. Auf dem Schafott landet auch der papsttreue Thomas Beckett. Wie überhaupt Anhänger der katholischen Kirche vor Verfolgung nicht sicher sind. Andererseits gibt es reformatorische Tendenzen, die von Deutschland aus auf die Insel kommen.
Es waren in jeder Hinsicht aufregende Zeiten, die England zwischen 1529 und 1553 erlebte. Heinrich VIII. wird sich von der katholischen Kirche lossagen, eine Frau nach der anderen heiraten. Einige, wie Anne Boleyn, landen auf dem Schafott. Auf dem Schafott landet auch der papsttreue Thomas Beckett. Wie überhaupt Anhänger der katholischen Kirche vor Verfolgung nicht sicher sind. Andererseits gibt es reformatorische Tendenzen, die von Deutschland aus auf die Insel kommen.
Eine kritische Gemengelage also, die nicht nur die Gesellschaft in Unruhe versetzt, sondern auch die Monarchie. Während sich Heinrich VIII. bemüht, einen Thronfolger in die Welt zu setzen, gibt es immer noch Mary, seine Tochter und damit die legitime Thronfolgerin – und Papistin. Auf sie setzen die Engländer ihre Hoffnungen. Als spätere Königin wurde sie als «Bloody Mary» bekannt. Sie ist «die historische Hauptfigur» im neuen Roman von Rebecca Gablé. Aus ihrer Perspektive erzählt die Autorin – und gibt ihr so die Gelegenheit, etwas an ihrem Bild in der Geschichtsschreibung zu korrigieren. Um sie und die Kontrahenten herum hat Rebecca Gablé das gesamte historische Personal der Zeit hervorragend in Szene gesetzt.
Mary steht als fiktive Hauptfigur Nicholas of Waringham gegenüber. Und damit sind wir «im Roman». «Der dunkle Thron» ist der nun vierte Band der mittlerweile berühmten Waringham-Saga, mit der die Autorin nicht nur alle Bestsellerlisten erklommen, sondern auch eine millionenfache Fangemeinde gefunden hat. Das hat wiederum etwas mit der sehr gelungene Mischung aus Fakten und Fiktion, die diese schon fast beispielhaften und literarisch anspruchsvollen historischen Romane der Gablé auszeichnet.
Mary und Nick: Sie kennen sich von Kindheit an. Sie sind befreundet und irgendwie liebt er sie auch ein wenig. Auf jeden Fall ist er immer an ihrer Seite, wenn es gilt, sie von ihrem größten Feind, ihrem Vater, zu beschützen. Denn Mary ist nicht nur ein Stachel im Fleische Henry VIII., sie steht seiner Heiratspolitik ebenso entgegen wie seinen kirchenpolitischen Plänen. Und Nick? Als Erbe einer heruntergekommenen Baronie hat er nicht nur wirtschaftliche Probleme zu bewältigen. Als Earl steht er auch mitten im politischen Geschehen seiner Zeit. Auf einer Seite ist er dem König den Vasalleneid schuldig, auf der anderen Seite steht eben Mary. Eine Position, die zu Verwicklungen führt, Gefahren für Leib und Leben birgt. Gefährliche Abenteuer sind für ihn zu bestehen, politische Händel auszufechten, Familienprobleme zu lösen. Er kämpft, stürzt, steht wieder auf. Er liebt und leidet, zeigt Mut und Schwäche, glaubt und zweifelt.
Nicholas of Waringham ist eine starke Figur. Und bewährt sich glänzend. «Vielleicht sind Männer wie ich so überholt und überflüssig geworden wie alte Schlachtrösser, die meine Vorfahren einst gezüchtet haben. Aber kein Waringham hat sich je einem Tyrannen unterworfen. Und ich schwöre bei Gott, ich werde nicht der erste sein». Es gibt zwar kein historisches Vorbild für ihn, so Rebecca Gablé in einem Interview mit dem Glarean Magazin, aber «es hätte Nicholas of Waringham… geben können».

Mit dem vierten Roman der Waringham-Saga legt Rebecca Gablé, die «Königin des historischen Romans», wieder einem spannenden und sehr unterhaltenden Roman vor. Mit profundem Wissen ausgestattet zeichnet sie sprachmächtig und fantasiereich ein farbenfreudiges Bild Englands an der Nahtstelle von Mittelalter und Renaissance.
Wie in allen ihren Romanen versteht es die Autorin auch in «Der dunkle Thron» hervorragend, Geschichte in Geschichten zu erzählen – kenntnisreich, farbenprächtig und sprachmächtig. Ihr «Herz gehöre dem englischen Mittelalter», hat Rebecca Gablé einmal gesagt. Mehr noch: Ausgestattet mit einem profunden Wissen um die Zeit verdienen die Romane der studierten Mediävistin und Germanistin im wahrsten Sinne des Wortes das Prädikat «historisch».Mit «Der dunkle Thron» hat Rebecca Gablé das Mittelalter verlassen und ist in der Renaissance angekommen. Aber es sind ja immer die Zusammenhänge und Übergänge, die Epochen der Geschichte so spannend machen. Ein Spannung, die auch durch die gesamte abenteuerliche Geschichte von Nicholas of Waringham hindurch zu spüren ist. Aber nicht nur daran ist es Rebecca Gablé gelegen. Sie möchte ihre Leser unterhalten. Und das ist ihr – wie schon mit den früheren Waringham-Romanen – hervorragend gelungen.
Rebecca Gablé, Der dunkle Thron, Historischer Roman, 956 Seiten, Lübbe-Ehrenwirth Verlag, ISBN 978-3-431-03840-8
.
.
.
.
.
.
Wells Tower: «Alles zerstört, alles verbrannt»
.
Wie schrecklich Liebe sein kann
Günter Nawe
.
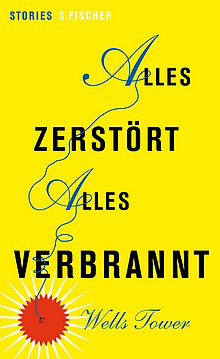 Es ist schön, dass es immer wieder Bücher gibt, die sich auf die eine oder andere Weise aus der Flut von Neuerscheinungen herausheben, neugierig machen – und auch glücklich, weil sie dem Leser das Gefühl vermitteln, etwas Wunderbares entdeckt zu haben. Ein solches Buch ist «Alles zerstört, alles verbrannt», ein schmaler Band mit Stories des jungen Kanadiers Wells Tower, 1973 in Vancouver geboren. Ein erstaunliches Debüt.
Es ist schön, dass es immer wieder Bücher gibt, die sich auf die eine oder andere Weise aus der Flut von Neuerscheinungen herausheben, neugierig machen – und auch glücklich, weil sie dem Leser das Gefühl vermitteln, etwas Wunderbares entdeckt zu haben. Ein solches Buch ist «Alles zerstört, alles verbrannt», ein schmaler Band mit Stories des jungen Kanadiers Wells Tower, 1973 in Vancouver geboren. Ein erstaunliches Debüt.
Was eine gute Short Story zu sein hat – Ernest Hemingway und Raymond Carver haben es gezeigt. Sie zeichnet sich durch eine bestimmte Art von Minimalismus und einen lakonischen Stil aus. Sie berichtet in der Regel von einfachen Menschen, von Alltäglichem und oft Nebensächlichem – und wird dadurch zu etwas beispielhaft Besonderem.
Von dieser Art sind auch die Geschichten, die Wells Tower erzählt. So von dem Mann, der von seiner Frau rausgeworfen wird, nachdem sie an der Windschutzscheibe seine Wagens einen Fußabdruck entdeckt, der mit ihrem eigene nicht übereinstimmt. «Vicky erblickte über dem Handschuhfach den schemenhaften Fußabdruck einer Frau an der Windschutzscheibe. Sie zog ihre Schuhe aus, sah, dass der Abdruck nicht mit ihrem übereinstimmte, und sagte Bob, er sei in ihrem Haus nicht mehr willkommen.»
Von einem unglücklichen Vater ist die Rede und seinem missratenen Sohn. Und von einer Insel, in der titelgebenden Erzählung «Alles zerstört, alles verbrannt», auf der die Menschen versuchen, sich durch Brandschatzen und Blutvergießen aus ihrer Hoffnungslosigkeit und von ihren Depressionen zu befreien. Das betrifft auch die persönlichen Beziehungen. «Pia fehlte mir schon jetzt… Zu böse und zu traurig war sie nicht aufgestanden, um von mir Abschied zu nehmen.» Am Ende stellt der Ich-Erzähler fest, «wie schrecklich die Liebe sein kann».
Es sind fast durchweg verkrachte Existenzen in einem «Wild America» – so der Titel einer der Geschichten. Wie Derrick und Claire, die sich permanent mit billigem Fusel besaufen. Zerstörung allenthalben und Selbstzerstörung. «Feindschaft» herrscht auch zwischen den beiden Mädchen Jacey und Maya. Zwischenmenschliche Beziehungen werden jeweils auf den Prüfstand gestellt – mit allen negativen Ergebnissen. Und Illusionen zerschellen an den Klippen des Lebens.

Mit «Alles zerstört, alles verbrannt» haben wir ein erstaunliches literarisches Debüt vor uns. Diese Stories des Kanadiers Wells Tower stehen in der Tradition der klassischen amerikanischen Kurzgeschichte, und doch hat der junge Autor seinen eigenen Stil, einen unverwechselbaren Ton. Seine Geschichten von verkrachten Existenzen und an den an den Klippen des Lebens zerschellten Illusionen gehören zum Besten, was das Genre «Kurzgeschichte» zurzeit zu bieten hat.
In Amerika gilt Wells Tower als hervorragender und vor allem als einer der besten Nachwuchsautoren der amerikanischen Literatur. Die Erstveröffentlichung seiner «Stories», die jetzt auch hier in der hervorragenden Übersetzung von Malte Krutzsch und Britta Waldhof zu lesen sind, erfolgte in «The New Yorker» und in «The Paris Review» – und wurden bereits mehrfach ausgezeichnet.
Tower ist allerdings kein Epigone von Hemingway oder Carver. Er hat schon seinen eigenen Stil, einen sehr eigenen Ton. Seine Geschichten sind von einer großartigen Eindringlichkeit. Atmosphärisch dicht, schnörkellos in der Diktion, kraftvoll und unsentimental und gerade deshalb von großer Tiefe. Meisterhaft.
Wells Tower ist ein großartiger Autor, von dem wir sicher noch viel erwarten dürfen. Deshalb dürfen wir auf das nächste Buch von ihm – er schreibt an einem Roman – sicher gespannt sein. ■
Wells Tower, Alles zerstört, alles verbrannt – Stories, 270 Seiten, S. Fischer Verlag, ISBN 978-3-10-080031-2
.
.
.
.
.
Brigitte Fuchs: «salto wortale»
.
NIELÄUFTEINWURMSTURM
Günter Nawe
.
. «Als sich das ROTWEINROT und das
«Als sich das ROTWEINROT und das
WEISSWEINWEISS näher kamen,
sah die Welt plötzlich ganz rosé aus»
Von dieser und anderer, fantastisch vielfältiger Art sind die Sprachspiele der Brigitte Fuchs. Und so liegt – um es vorwegzunehmen – ein höchst amüsantes, ein sehr intelligentes und sehr schönes Buch vor mir, das jede Empfehlung wert ist. Was die Lyrikerin Brigitte Fuchs hier bietet, ist sprachliche Equilibristik der besonderen Art. Sie spielt mit den Wörtern, schüttelt sie sich zu recht, findet poetische Wortbilder, schlägt gewagte Salti und Kapriolen. Sie schreibt Sinn und vermeintlich Unsinn – doch lasse man sich nicht täuschen. Alles, was wir in diesem Buch sehen und lesen, ist begründet in der Lust an der Sprache und hat einen höchst poetischen Wert.
Ihre Lyrik ist – so hat Brigitte Fuchs es einmal selbst formuliert – «Arbeit an der Aussage, am Klang, am Rhythmus, an der Form». Ein hoher Anspruch, dem die Schweizer Lyrikerin in jeder Zeile, in jedem Bild gerecht wird. Für die Sprachartistin gehören «Genauigkeit des Denkens und das genaue Hinsehen wesentlich zum Handwerk des Schreibens». Und so ist das, was hier so leichtfüßig herkommt, harte Arbeit und pefektes Handwerk.
Geboren in Widnau im St. Galler Rheintal lebt die Lyrikerin heute im Kanton Aargau. Die gelernte Lehrerin ist nicht nur nur als Dichterin, sondern auch gestalterisch tätig. Ihren Arbeiten merkt man dies an. Dafür hat sie bereits zahlreiche Literaturpreise erhalten. Die Bücher der Brigitte Fuchs – zum Beispiel: «Herzschlagzeilen», «Das Blaue vom Himmel oder ich leben jetzt» und «Solange ihr Knie wippt» – sind längst über den Status eines Geheimtipps hinaus. Und das sollte auch für den Band «salto wortale» gelten.
Die Sprachkünstlerin Brigitte Fuchs konfrontiert den Leser mit oft sehr ungewohnten visuellen und verbalen Überraschungen. Seien es Wortcollagen, Sprachbilder, Gedichte oder Schüttelreime.
Da gibt es das Sprachbild «KONKRET», das mit der Zeile NIELÄUFTEINWURMSTURM endet.
Da sagt
«…der Seiltänzer zu seiner Frau: >Du müsstest wissen, dass für mich ein Seitensprung nicht in Frage kommt!<
Oder man lese das «Sonett» – wenn man so will: ein wunderbares Liebesgedicht, in dem der Liebste aufgefordert wird, ein Sonett zu schreiben. Worauf er dichtet:
«…Sonette sind was Bittersüsses, Feines, / für Mädchen, die längst Frauen sind, mein Kind! / Sonette sind die Länge deines Beines – / denkst du denn, dass ich dafür Worte find?»
Manchmal «jandelt» es richtig schön. So, wenn Brigitte Fuchs ihrem großen Kollegen Ernst Jandl folgendes Gedicht widmet:
Oh Schandl
Was für ein Wandl
seit Ernst Jandl
verschwandl
… .
kein Wortspielhandl
alles verläuft im Sandl
oh Schandl

In ihrem Lyrik-Band «salto wortale» versteht es Brigitte Fuchs souverän, auf der gesamten Klaviatur der Sprache zu spielen. Ihr Buch ist amüsant, hintergründig und vordersinnig, intelligent und wunderbar – voller Lust an der Sprache und von hohem poetischen Wert. Durch die kongenialen Wortbilder von Beat Hofer bekommt dieser Lyrikband zudem ein unverwechselbares Aussehen.
Nein, nichts verläuft in diesem herrlichen Buch, in diesen «vergnüglichen, anregenden und bekömmlichen Blätterbuch für Sprachfans» «im Sandl». Auch nicht die wunderbaren Farbbild-Seiten des Grafikers Beat Hofer. Er spielt ebenfalls gekonnt mit Bild und Wort und Farbe und hat so dem Lyrikband sein unverwechselbares Aussehen gegeben.
Übrigens: Müsste man der POESIE nicht endlich das DU anbieten? Brigitte Fuchs steht längst mit der Poesie auf Du und Du. Im «Vor- und Nachwort» schreibt sie: «Wir verlangen ja nicht viel vom Wort: Das und kein anderes soll es sein, anfänglich, wahr, gut, groß, geflügelt. Es soll uns auf die Sprünge helfen, wir wollen es ergreifen, halten, führen, erteilen, entziehen. Eines gibt das andere, wir werden jedes unterschreiben und das letzte, noch ehe es gesagt ist, behalten». Dem ist nichts hinzuzufügen. ▀
Brigitte Fuchs, salto wortale – Sprachliche Kapriolen (Zweite/erweiterte Auflage), mit Wortbildern von Beat Hofer, 192 Seiten, edition 8, ISBN 978-3-85990-110-0
.
.
.
.
Inge Grolle: «Die jüdische Kauffrau Glikl» (Biographie)
.
«Aus vielen Sorgen und Nöten und Herzeleid»
Günter Nawe
.
 Sie war eine deutsch-jüdische Kauffrau, eine erfolgreiche Unternehmerin und Perlenhändlerin. Sie lebte von 1646 bis 1724, geboren in Hamburg und gestorben in Metz. Sie hieß eigentlich korrekt «Glikl bas Judah Leib» (Tochter des Judah Leib), wurde aber eher bekannt als «Glückl von Hameln», benannt nach dem Herkunftsort ihres Mannes Chajim: Hameln.
Sie war eine deutsch-jüdische Kauffrau, eine erfolgreiche Unternehmerin und Perlenhändlerin. Sie lebte von 1646 bis 1724, geboren in Hamburg und gestorben in Metz. Sie hieß eigentlich korrekt «Glikl bas Judah Leib» (Tochter des Judah Leib), wurde aber eher bekannt als «Glückl von Hameln», benannt nach dem Herkunftsort ihres Mannes Chajim: Hameln.
Glikl führte ein außergewöhnliches und exemplarisches Leben, über das sie in erster Linie ihren Kindern berichtete – und durch einen Glücksfall auch der Nachwelt. So liegen sowohl der Urtext ihrer Erinnerungen in westjiddischer Sprache (und hebräischen Schriftzeichen) – in «Weiberdeutsch», wie es etwas despektierlich hieß – vor als auch mehrere Übertragungen. Zuletzt kam dieses Verdienst 1913 Alfred Feilchenfeld zu. Eine Neuausgabe erfolgte 1994, der Fassung von Bertha Pappenheim, eine Nachfahrin der «unbekannten Jüdin» Glikl, durch Viola Roggenkamp.
Dieser außergewöhnlichen Frau hat jetzt Inge Grolle ein «Lebensbild» gewidmet. Die Autorin, sie studierte Geschichte, Germanistik und Romanistik, hat sich durch zahlreiche wissenschaftliche Publikationen einen Namen gemacht. Ihr besonderes Interesse gilt der hamburgischen Sozial- und Frauengeschichte. Ihre Arbeit über die Kauffrau Glikl hat sie entlang der bekannten biografischen Fakten gerschrieben, immer aber in den Konzext von Zeit und Zeitumständen gestellt.

Bertha Pappenheim im Kostüm der Glikl. Pappenheim, eine entfernte Verwandte Glikls, übersetzte und veröffentlichte 1910 deren Memoiren. (Nach einem Gemälde von L. Pilichowski)
So ist Grolles Buch für den Leser ein faszinierendes Porträt der Glikl von Hameln und gleichzeitig ein spannendes Zeitpanorama. Wie lebte Glikl von Hameln, und wie lebten Juden Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts in Deutschland? In den Erinnerungen der Glikl können wir es nachlesen. Sie hatten geschäftlichen Erfolg, genossen zum Beispiel als «Hofjuden» Anerkennung. Sie waren insgesamt und als Familie im Besonderen gefährdet als Juden und Kaufleute. Es gab Krankheiten wie die Pest. Und es gab religiöse Umbrüche und Irritationen (zum Beispiel das Auftreten dess Sabbatai Zwi), die sich auf das religiöse Leben der Juden auswirkten. Es gab staatliche Restriktionen und persönliche Verfolgungen.
Das alles hat Glikl nicht nur miterlebt, sondern auch aufgeschrieben. Sie, Mutter von 12 Kindern, dreißig Jahre mit Chajim verheiratet, später als selbständige Geschäftsfrau mit internationalen Verbindungen tätig, schildert sehr ausführlich die äußeren Umstände ihres Lebens. Sie gibt aber auch einen Blick in ihre Seelenlage – «Aus vielen Sorgen und Nöten und Herzeleid». Sie, die aufopferungsvolle Frau und Mutter, findet ihren Halt im Glauben an einen Gott, der sie hält, obwohl «sündig», und dem sie sich in jeder Siuation ihres Lebens anvertraut. Dass sie, nach einer zweiten und nicht sehr glücklichen Ehe, verarmt starb, macht ihre persönliche Tragik aus.

nge Grolle erinnert uns mit ihrem Lebensbild der Kauffrau Glikl von Hameln nicht nur an eine faszinierende Frau, sondern gibt auch ein sehr differenziertes Zeitbild. Die Lebenswelt der Glikl war geprägt von Zeitgeist und Zeitumständen und kann so als exemplarisch gelten. Inge Grolles sehr empfehlenswerte Arbeit ist es auch.
Dies alles ist bei Inge Grolle zu lesen. Und mehr. Die jüdischen Sitten und Gebräuche werden uns ebenso nahegebracht wie das Rollenverständnis von Mann und Frau in der jüdischen Lebenswelt – vor allem aber das Selbstverständnis einer jüdischen Frau in der damaligen Zeit.
So erzählt Inge Grolle von der Geschichte und den Geschichten.der Glikl, die uns mit ihren Aufzeichnungen auch ein höchst wichtiges literarisches Zeugnis hinterlassen hat. Und es ist sehr schön, dass die Autorin einige dieser von Glikl erzählten Geschichten an das Ende ihres Buches gestellt hat. Von einer «märchenhaften Atmosphäre altjiddischer Erzählkunst» ist die Rede (I.G.). Und weiter: «Inmitten von Glikls biografischem Bericht ist die sprachliche Suggestion der Geschichten manchmal so stark, dass die dramatischen Ereignisse ihres eigene Lebens fast selbst den Charakter eines alten Exempels annehmen.» Dem ist von Seiten des Lesers nichts hinzuzufügen. ▀
Inge Grolle: Die jüdische Kauffrau Glikl (1646-1724), 194 Seiten, Edition Temmen Hamburg, ISBN 978-3-8378-2017-1
.
.
.
.
Mariel Hemingway (Hg.): Ermest Hemingway in Bildern und Dokumenten
.
«Aber das Leben ist nun einmal anderswo»
Ernest Hemingway zum 50. Todestag
Günter Nawe
.
 «Der alte Mann und das Meer» gehört wohl zu den schönsten Erzählungen, die uns Ernest Hemingway hinterlassen hat. Ansonsten assoziiert man mit dem Namen Hemingway häufig nur Frauen, Alkohol und ein abenteuerliches Leben, dem er am 2. Juli 1961 in Ketchum selbst ein Ende setzte.
«Der alte Mann und das Meer» gehört wohl zu den schönsten Erzählungen, die uns Ernest Hemingway hinterlassen hat. Ansonsten assoziiert man mit dem Namen Hemingway häufig nur Frauen, Alkohol und ein abenteuerliches Leben, dem er am 2. Juli 1961 in Ketchum selbst ein Ende setzte.
Das also war vor 50 Jahren und damit Anlass genug, dieses außergewöhnlichen Autors zu gedenken. Sehr eindrucksvoll tut es die Enkelin Mariel Hemingway als Herausgeberin des fulminanten Bands »Ernest Hemingway in Bildern und Dokumenten».
Im Vorwort schreibt sie: «Ein richtiger Kerl, ein Jäger, ein Hochseeangler, ein Mann der klaren Worte und mein Großvater… Ich bin glücklich, Ernest Hemingways Enkelin zu sein… und ich fühle mich geehrt, ein Teil von ihm zu sein». Von diesem Stolz und von dieser Verehrung für «Papa Hemingway» ist viel in diesem Buch zu spüren. Allein die liebevolle und sehr geglückte Auswahl der Fotos, die den Menschen und Autor mit all seinen Facetten zeigen, belegt dies.
Es gab einmal eine Zeit, da war der Literatur-Nobelpreisträger von 1954 – den Preis hat er für den (man möchte sagen: unvergänglichen) Kurzroman «Dar alte Mann und das Meer» erhalten – regelrecht en vogue. Seine großartigen Reportagen als Kriegsberichterstatter vom Spanischen Bürgerkrieg und vom Stierkampf, seine Romane «Fiesta» (1926), «In einem anderen Land»(1929) und «Wem die Stunde schlägt» (1940) waren Bestseller. Wie auch das erst nach seinem Tod erschienene Buch «Paris – ein Fest fürs Leben», in dem Hemingway so brillant von seiner Zeit in Paris (1921-1928) erzählt, von seinen Begegnungen mit Gertrude Stein und anderen Persönlichkeiten aus Kunst und Literatur, von seiner Liebe zu seiner ersten Frau Hadley und von seiner Geliebten und zweiten Frau Pauline Pfeiffer. Insgesamt ist dieses Buch, das jetzt übrigens in einer sehr schönen neuen Übersetzung erschienen ist, auch eine wunderbare Erinnerung eine längst vergangene Zeit.
Seinen literarischen Ruhm hat Ernest Hemingway jedoch in erster Linie mit seinen Kurzgeschichten errungen, mit denen er fast eine eigene Stilrichtung begründet hat, einen Stil, revolutionär für die Literatur überhaupt, den der Autor von «Schnee auf dem Kilimandscharo», und «Das kurze glücklose Leben des Francis Macomber», um nur zwei Beispiele zu nennen, in Perfektion beherrschte.
Leben und Werk beschreibt in diesem Band Boris Vejdovsky, amerikanischer Literaturwissenschaftler und Mitglied der Hemingway Society. In acht programmatisch benannten Kapiteln – von «Eine amerikanische Kindheit» und «Die Kriege des Ernest Hemingway» über «Das Schreiben und der Tod» bis zu «Das verlorene Paradies der Männer ohne Frauen» – zeichnet er den Lebensweg dieses Autors nach. Mit Spannung folgt ihm der Leser von Hemingways Anfängen im amerikanischen Oak Park (1899) über die wunderbare Zeit in Paris, über die Reportagereisen nach Spanien und Italien, die Erkundung der afrikanischen Welt, seinen Kuba-Aufenthalt und so weiter – bis zum freiwilligen Ende in Ketchum am 2. Juli 1961.
Darüber geschrieben hat Hemingway immer «anderswo»: «Deshalb fährt er in sein Haus nach Key West, um dort über seine Erlebnisse in Afrika zu schreiben, so wie er, nach einem bereits bekannten Muster, in Paris über Michigan, auf Kuba über Paris, in Florida über Spanien schreiben wird – aber das Leben ist nun einmal anderswo.» (Vejdovsky)
Wer also war dieser Ernest Hemingway? Ein Frauenheld (er war viermal verheiratet und hatte unzählige Affären), ein Alkoholiker, ein Abenteurer, Großwildjäger, Stierkämpfer, ein Aufschneider, am Ende gar ein Psychopath? Vejdovsky gelingt es nicht nur, ein hervorragendes Psychogramm eines Machos mit einer sehr empfindsamen Seele zu zeichnen, er räumt vor allem mit vielen Legenden auf, für die Hemingway oft genug selbst verantwortlich war, weil er häufig Literatur und Leben miteinander verwechselt hat. Gerade das aber mag ihn zu einem so großartigen Schriftsteller gemacht haben.

Es macht Freude, den Lebensweg Ernest Hemingways in diesem Buch mitzugehen, und es sind – neben dem Hemingway-Essay von Boris Veidovsky – nicht zuletzt die 300 von Papa Hemingways Enkelin Mariel zusammengetragenen, teilweise bisher unbekannten Bilder, die dem Leser das Genie Hemingways näherbringen.
Es macht Freude, den Lebensweg Ernest Hemingways in diesem Buch mitzugehen. Es sind die 300 von Hemingways Enkelin zusammengetragenen, teilweise bisher unbekannten Bilder, die dem Leser diesen Ernest Hemingway näherbringen. Wer selbst einmal im Geburtshaus in Oak Park war oder in Paris und in Spanien den Spuren von Hemingway nachgegangen ist, wird geradezu ein Déjà-vu-Erlebnis haben.
Es ist vor allem auch der großartige biografische Essay von Boris Vejdovsky, den diese Bilder illustrieren. Ein Text, mit dem der Autor nicht nur den Menschen und Schriftsteller Ernest Hemingway «lebendig» werden lässt. Dieser biografische Essay ist auch, wie das gesamte Buch, aus gegebenem Anlass eine wunderbare und würdige Hommage für Ernest Hemingway. ▀
Mariel Hemingway (Hg.), Ernest Hemingway in Bildern & Dokumenten, 208 Seiten, 350 Abbildungen, Edition Olms Zürich, ISBN 978-3-283-01178-9
.
.
Interview mit der Claudius-Biographin Annelen Kranefuss
.
«Vorrang der Realität vor aller Kunst»
Günter Nawe
.
 Unlängst würdigte unser Magazin die kürzlich bei Hoffmann&Campe erschienene Claudius-Biographie der Kölner Germanistin Dr. Annelen Kranefuss: «Originell und unverwechselbar» – übrigens die erste Biographie seit über siebzig Jahren, die sich dieses Mannes (der als Journalist, als Dichter, als homme de lettres und als Redakteur des «Wandsbecker Bothen» Literaturgeschichte geschrieben hat) wieder umfassend annimmt. Günter Nawe unterhielt sich mit der Autorin über den Dichter Claudius, dessen wissenschaftliche Erforschung noch längst nicht am Ende sei. –
Unlängst würdigte unser Magazin die kürzlich bei Hoffmann&Campe erschienene Claudius-Biographie der Kölner Germanistin Dr. Annelen Kranefuss: «Originell und unverwechselbar» – übrigens die erste Biographie seit über siebzig Jahren, die sich dieses Mannes (der als Journalist, als Dichter, als homme de lettres und als Redakteur des «Wandsbecker Bothen» Literaturgeschichte geschrieben hat) wieder umfassend annimmt. Günter Nawe unterhielt sich mit der Autorin über den Dichter Claudius, dessen wissenschaftliche Erforschung noch längst nicht am Ende sei. –
Glarean Magazin: Frau Kranefuss, es gibt das berühmte Diktum Goethes über die Hauptaufgabe einer Biographie. War es auch für Sie Maßstab ihrer Arbeit?
Annelen Kranefuss: Ja. «Den Menschen in seinen Zeitverhältnissen darzustellen» – das ist in der älteren Claudius-Biographik oft vernachlässigt worden. Damit hat man wesentliche Aspekte seines Schreibens und Lebens ausgeblendet. Die historischen Bedingungen (also auch die sozialen Besonderheiten des jeweiligen Lebensraums) waren nicht nur für sein Leben bestimmend, Claudius hat auch als Literat, als homme des lettres, wie er sich nannte, auf das Zeitgeschehen reagiert. Er hat ja als Journalist angefangen und auch nach dem Ende seiner Zeitungsarbeit in seinen Texten immer wieder auf Zeitereignisse und kulturelle Debatten reagiert, sehr oft indirekt, so dass es für die Nachwelt nicht ohne Weiteres erkennbar ist. Er hat allerdings auch als Journalist versucht, die Dimensionen von Zeit und Zeitlosigkeit in Beziehung zu setzen und seinen Lesern zu vermitteln, dass es noch etwas anderes gibt als die Tagesaktualität.
GM: Seit der letzten größeren Claudius-Biographie sind rund 70 Jahre vergangen. Woher das Desinteresse der Germanistik an diesem «originellen und unverwechselbaren» Dichter?

Germanistin Kranefuss: «Mich spricht bei Claudius das Lakonische, seine Nüchternheit an, die gleichzeitige Herzlichkeit und Empathie, die Verbindung von Humor und Tiefgang, seine Mitmenschlichkeit und Weltbejahung ohne jede Verharmlosung.»
AK: Das Desinteresse ist nicht so groß, wie es scheint: In den letzten Jahrzehnten hat sich eine Reihe von Germanisten immer wieder intensiv mit dem Werk von Matthias Claudius befasst. Zugegeben: das ist nur eine Handvoll gemessen an der Fülle von populären und oft betulichen Claudius-Darstellungen und im Vergleich zu den kaum noch zu übersehenden Forschungen über andere Autoren, etwa Goethe oder Kafka. Hier geht es Claudius nicht anders als anderen «kleineren Poeten» der Literaturgeschichte. Es interessieren sich für ihn aber auch andere Disziplinen. Es gibt ausgezeichnete theologische Arbeiten über ihn; er hat einen Platz in der Geschichte von Theologie und Frömmigkeit – das heißt, man kann sich ihm im Grunde nur fächerübergreifend annähern. Was in der Forschung bis auf wenige Ausnahmen bisher zu kurz kam, ist ein seriöser biographischer Zugang, der über die älteren erbaulichen Schriften hinausgeht. Biographien galten in der Literaturwissenschaft ja lange als unseriös. Möglicherweise stand im Fall von Claudius auch das überlieferte Klischeebild des frommen Idyllikers und Familienvaters einem größeren Interesse im Wege.
GM: Was hat Sie letztlich bewogen, sich dieses Autors anzunehmen?
AK: Claudius hat mich seit meinem Studium immer wieder begleitet und beschäftigt. In seinen gelungenen Stücken (daneben gibt es durchaus auch Schwächeres) ist er einer der großen Meister unserer Sprache und der kleinen Form. Mich hat auch der dahinter zu spürende Mensch angesprochen, das Lakonische, seine Nüchternheit, die gleichzeitige Herzlichkeit und Empathie, die Verbindung von Humor und Tiefgang, seine Mitmenschlichkeit und Weltbejahung ohne jede Verharmlosung. Er hat unsere Hilflosigkeit angesichts des Todes erfahren und dargestellt. Und es hat mich gereizt, seiner «Mischung von Schöngeisterei und Religion», so beschreibt er die «Idiosynkrasie des Boten», nachzugehen. Das ist nicht zu verwechseln mit der Vorstellung von der ästhetischen Autonomie des Kunstwerks, wie sie die Klassiker zur gleichen Zeit entwickelten. Claudius beharrt auf dem Vorrang der Realität vor aller Kunst, was vielleicht erst heute, nach dem Ende des Zeitalters der Kunstreligion, wieder als künstlerische Möglichkeit neu gesehen werden kann.
GM: An einer Stelle schreiben Sie, dass in der «Verflechtung mit seinem Zeitalter … Claudius’ Eigenart sichtbar» wird. Welches war die «Eigenart» von Matthias Claudius?
AK: Ich habe sie u.a. mit dem Begriffspaar «Eigensinn und Geselligkeit» zu fassen gesucht. Er war weder im Leben noch im Schreiben der isolierte Außenseiter, als den ihn die Literaturwissenschaft lange geführt hat, er hatte Freunde, war gut vernetzt, aber er hat auch – im Dialog mit den Zeitgenossen – immer eine eigene Position zu behaupten gesucht und dem Zeitgeist auch widersprochen. Das wird deutlich, wenn man die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts nicht nur als Goethezeit betrachtet, sondern den jeweils lokalen Besonderheiten nachgeht.
GM: Sie haben in diesem Buch einerseits mit Legenden aufgeräumt, andererseits von «Leerstellen» in der Claudius-Biographie gesprochen. Ist die Forschung über Claudius noch nicht am Ende?
AK: Mit Sicherheit nicht. Es lässt sich bestimmt noch eine Menge entdecken. Einerseits ganz positivistisch faktenbezogen. Ich denke, dass mit der wissenschaftlichen Edition der Briefe von und an Matthias Claudius, an der unter der Leitung von Professor Jörg-Ulrich Fechner in Bochum gearbeitet wird, noch das eine oder andere ans Licht kommen dürfte, manches wird mögicherweise auch in anderem Licht erscheinen. Ich musste mich noch weitgehend mit der unzulänglichen Briefausgabe von 1938 behelfen. Andererseits geht es ohnehin nicht in erster Linie darum, Lücken in der biographischen Überlieferung zu schließen, manche «weiße Flecken» werden bleiben. Vielmehr sind die Claudius-Texte selbst immer noch einmal genau zu lesen, genauer zu entziffern und im Kontext der Zeit zu deuten. Das habe ich versucht, aber damit kommt man nicht so schnell ans Ende. Das Genre Biographie eignet sich auch nicht als Container für alle Forschungsfragen und -ergebnisse. Schließlich sollte mein Buch nicht allzu dick werden. Und dann wird auch jeder Forscher, jede Epoche wieder andere Fragen an den Autor stellen und einen neuen Zugang finden.
GM: Mit der Ausgabe der «Sämtlichen Werke des Wandsbecker Bothen» hat Matthias Claudius ein einzigartiges Werk geschrieben. Wie ist dieses Werk zu klassifizieren, wo hat es seinen Platz in der Literaturgeschichte?
AK: Ich denke, das müsste aus meinen bisherigen Antworten schon hervorgehen.
GM: In Zusammenhang mit Claudius ist auch einmal von einem «sokratischen Schriftsteller» die Rede. Ist das eine weitere der vielen Facetten, die diese Autor hat?
AK: Das 18. Jahrhundert ist das «sokratische Jahrhundert» genannt worden. Die kirchliche Orthodoxie verdammte Sokrates als Heiden und sprach ihm jede Tugend ab, für die Aufklärer war er eine Symbolfigur im Kampf um Toleranz. In diesem Sinn ergreift auch Claudius Partei für Sokrates. Der Philosoph mit seinem «Ich weiß, dass ich nichts weiß» war auch für ihn ein Gewährsmann in seiner Wendung gegen Pedanterie und abstrakte Gelehrsamkeit. Seine Verehrung geht aber darüber hinaus. Der Sokrates, der in Athen vor Gericht stand und zum Tode verurteilt wurde, war ihm ein Vorbild innerer, religiös verstandener Freiheit.
GM: Was kann Matthias Claudius dem Leser von heute sagen? Kann er dem Leser von heute überhaupt noch etwas sagen?
AK: In vielem sind uns Claudius’ politische Ansichten, seine Lebensform heute fremd, gerade in dem, was z.B. das Bürgertum des 19. Jahrhunderts an ihm schätzte. Wir können die restaurativen Tendenzen seines Spätwerks nicht mehr nachvollziehen. Er ist weder der Dichter zeitloser Wahrheiten noch lässt er sich krampfhaft aktualisieren. Das ist aber auch gar nicht nötig – es gibt viele Züge, in denen wir uns zu diesem Menschen und Schriftsteller in Beziehung setzen, uns ihm annähern können, ohne uns identifizieren zu müssen. Er spricht auf anrührende und einfache Weise von den elementaren Gegebenheiten des Menschenlebens, von den Schönheiten der Natur, von der Vergänglichkeit und den ungelösten Fragen des Daseins und kann uns ermutigen, das zu suchen, was auch ihm wichtig war: «etwas Eigenes», das standhält.
GM: Einige wenige Menschen kennen bestenfalls die erste Strophe des berühmten «Der Mond ist aufgegangen…» und vielleicht noch den Schlussvers. Oder aber den Vers, von dem kaum einer weiß, dass «’s ist leider Krieg – und ich begehre / Nicht schuld daran zu sein!» von Claudius ist. Sollte dieser Dichter nicht wieder im Deutschunterricht von heute seinen Platz finden?
AK: Ich weiß nicht, ob er wirklich so ganz aus dem Deutschunterricht verschwunden ist. Das «Kriegslied» kommt, wie ich höre, durchaus vor. Und gerade hat mir jemand von einer Schulveranstaltung erzählt, bei der Claudius’ Gedicht «Die Sternseherin Lise» rezitiert wurde. Wichtig finde ich, dass die Schule beides vermittelt: die wunderbaren Texte und das Gefühl für die Zeit und die Person des Dichters. ■
.
.
.
Annelen Kranefuss: «Matthias Claudius – Biographie»
.
«Originell und unverwechselbar»
Günter Nawe
.
 «Denn dieses scheint die Hauptaufgabe der Biographie zu sein, den Menschen in seinen Zeitverhältnissen darzustellen, und zu zeigen, inwiefern ihm das Ganze widerstrebt, inwiefern es ihn begünstigt, wie er sich eine Welt- und Menschenansicht daraus gebildet…», so Goethe. Nichts anderes hat Annelen Kranefuss mit der jetzt vorliegende Biografie über Matthias Claudius getan. Eine Biografie, die das Zeug hat, zum Standardwerk zu werden. Es ist übrigens die erste umfassende Biografie seit über siebzig Jahren, die sich dieses Mannes annimmt, der als Journalist, als Dichter, als homme de lettres und als Redakteur des «Wandsbecker Bothen» Literaturgeschichte geschrieben hat.
«Denn dieses scheint die Hauptaufgabe der Biographie zu sein, den Menschen in seinen Zeitverhältnissen darzustellen, und zu zeigen, inwiefern ihm das Ganze widerstrebt, inwiefern es ihn begünstigt, wie er sich eine Welt- und Menschenansicht daraus gebildet…», so Goethe. Nichts anderes hat Annelen Kranefuss mit der jetzt vorliegende Biografie über Matthias Claudius getan. Eine Biografie, die das Zeug hat, zum Standardwerk zu werden. Es ist übrigens die erste umfassende Biografie seit über siebzig Jahren, die sich dieses Mannes annimmt, der als Journalist, als Dichter, als homme de lettres und als Redakteur des «Wandsbecker Bothen» Literaturgeschichte geschrieben hat.
Matthias Claudius hat nur ein schmales Werk hinterlassen, aus dem das berühmte «Abendlied» («Der Mond ist aufgegangen…») im Bewusstsein der Nachwelt besonders herausragt. Dass dieser Claudius mehr war – Annelen Kranefuss zeigt es uns mit einer sehr geglückten Gesamtschau von Person, Werk und Zeit. Die Autorin, langjährige Kulturredakteurin beim Westdeutschen Rundfunk in Köln, hat Germanistik, Anglistik und Theologie studiert. Aus ihrer Dissertation über Matthias Claudius ist die großartige Biografie über den «bekannten Unbekannten» entstanden. Sachlich, aber auch leidenschaftlich und mit viel Sympathie für Claudius ist Annelen Kranefuss akribisch seinen Lebensspuren gefolgt. Sie macht überzeugend deutlich, wie Claudius «seine Rolle im Laufe seines Lebens ausfüllt, wie er mit ihr spielt, sie in Literatur und Publizistik verwandelt, auch das macht seine Gestalt in der Geschichte der Literatur und Kulturgeschichte aus».
Dabei räumt Annelen Kranefuss mit einigen Legenden auf. So, dass Claudius sein Studium in Jena abgebrochen habe. «Claudius verlässt die Universität….mit dem ‚guten Titel étudiant en droit’», weiß die Autorin. Sie weiß aber auch, dass es immer noch weiße Flecken in der Biografie des Dichters gibt. Zum Beispiel die drei Jahre im Reinfelder Elternhaus (1765-1768).
In Reinfeld wird Matthias Claudius am 15. August 1740 geboren. Danach Lateinschule und Studium in Jena. 1763 erscheint sein Erstlingswerk «Tändeleyen und Erzählungen».
1768 beginnt seine journalistische Tätigkeit als Redakteur der «Hamburgischen-Addreß-Comtoir-Nachrichten». !772 heiratet Claudius Rebecca Behn. Zwölf Kinder sollte sie ihm gebären – und seine große Liebe sein, der der Familienmensch und Kinderfreund einige seiner schönsten Gedichte gewidmet hat.
Claudius kommt mit den Aufklärern Herder und Lessing und anderen Berühmtheiten der Zeit zusammen. 1771 dann Umzug nach Wandsbek, das zu seinem Lebensmittelpunkt werden sollte. Von 1771 bis 1775 arbeitet Claudius als Redakteur beim «Wandsbecker Bothen». 1775 erscheint »ASMUS omnia sua SECUM portans oder Sämmtliche Werke Werke des Wandsbecker Bothen». Es sollte das Werk werden, das Claudius beliebt und berühmt macht. Das politische Geschehen wird ebenso kommentiert, wie «gelehrte Sachen» notiert und religiöse Themen behandelt wurden. Gedichte werden veröffentlicht und ein fiktiver Briefwechsel mit Freund Andres. Durch Claudius wurde der «Wandsbecker Bothe» zu einem Vorläufer des späteren Feuilletons.
1776/177 eine kurze Episode in Darmstadt und wieder Rückkehr nach Wandsbek. Es folgen Übersetzungsarbeiten und die Fortsetzung des ASMUS. 1784 reist Claudius nach Schlesien und Weimar. 1813 muss nach Schleswig-Holstein und Lübeck fliehen. 1814 ist er wieder in Wandsbek, wo er am 21. Januar 1815 stirbt.

Mit ihrer Claudius-Biografie ist Annelen Kranefuss eine geglückte, lebhaft geschriebene und hervorragend zu lesende Gesamtschau von Person, Werk und Zeit gelungen.
Claudius hat gegen Klischees angeschrieben, einen eigenen Stil kreiert – «originell und unverwechselbar». Er stand an der Schwelle zwischen Tradition und Moderne. Hinter der bewusst zur Schau getragenen Naivität verbarg sich eine komplexe Persönlichkeit. Er war im Kleinen groß – und verkörperte wie kaum ein anderer die Einheit von Schriftsteller und Person. Annelen Kranefuss hat ihn und sein Werk in den historischen Kontext gestellt. Sie ist damit Goethes Anforderung an eine Biografie im besten Sinne gerecht geworden.
Und sie hat Matthias Claudius den Platz zugewiesen, der ihm gebührt. Gleichzeitig hat sie mit ihrer lebhaften, hervorragend zu lesenden Biografie Matthias Claudius einer literarisch interessierten Öffentlichkeit wieder näher gebracht. ■
Annelen Kranefuss: Matthias Claudius – Eine Biographie, 320 Seiten, Hoffmann und Campe, ISBN 978-3-455-50190-2
.
Lesen Sie auch unser Interview mit der Biographin Annelen Kranefuss
.
.
.
Peter Höner: «Gynt»
.
Alle spielen Rollen – im Theater und im Leben
Günter Nawe
.
 Peer Gynt – wer kennt es nicht, das großartige dramatische Gedicht des Henrik Ibsen. Diese Geschichte von der Möglichkeit unterschiedlicher Lebensentwürfe, vom Spiel mit dem Schein und der Flucht in die Lüge. «Ibsens Höllenparabel» – wie Peter Höner schreibt.
Peer Gynt – wer kennt es nicht, das großartige dramatische Gedicht des Henrik Ibsen. Diese Geschichte von der Möglichkeit unterschiedlicher Lebensentwürfe, vom Spiel mit dem Schein und der Flucht in die Lüge. «Ibsens Höllenparabel» – wie Peter Höner schreibt.
Peer Gynt also, wie er einmal beschrieben wurde: als «ein Kerl für sich. Das war ein Abenteurer und Lügenschmied, wie er im Buche steht». Dieses dramatische Gedicht hat sich Peter Höner zum «Vorbild» genommen für seinen neuen Roman, der bezeichnenderweise im Theatermilieu spielt und den Titel «Gynt» trägt.
Peter Höner (Jahrgang 1947) kommt aus der Szene. Er hat als Schauspieler in Hamburg, Bremen, Berlin und Basel gearbeitet. Weitere berufliche Stationen: freischaffenden Schriftsteller und Regisseur. Lesenswert seine Kriminalromane «Seifengold», «Das Elefantengrab» und «Wiener Walzer» – sowie der zuletzt erschienene Roman «Am Abend, als es kühler wurde». Und jetzt «Gynt» – die Geschichte um die die berühmte Frage: «Wer bin ich?». Die Schauspielerin Johanna Hatt in Wien grübelt darüber, wie sie ihre Rolle als Geliebte Solveig anlegen soll. Und ihr Freund Daniel Tauber inszeniert in der Schweiz das gleiche Stück mit Jugendlichen.
Beide «Inszenierungen» wachsen sich zu einer Auseinandersetzung mit dem Theater und über das Theater aus, in dessen Welt Höner den Leser auf sehr authentische Art entführt. Er gerät – wie auch die Personen des Romans – zunehmend in den Sog des Theaters, unterliegt seiner Faszination.
Alle Beteiligten – Johanna und Daniel, Anita und Jakob, Luka und Alisa, Felix und Sarina, Miriam und Severin – nehmen ihre eigene Wirklichkeit mit in das Theater und in das Stück: ihre Hoffnungen und ihr Scheitern, Utopien und Gewissheiten, jugendliches Schwärmen und die Rebellionen des Alters. Und alle spielen Rollen – auf dem Theater und im Leben, Konflikte zwischen beidem inbegriffen. Oder anders: Die Welt ist ein Theater und das Theater die Welt!
Auf jeden Fall verändert sich bei bei der Arbeit an dem Stück, schon fast zwangsläufig, das Stück selbst – und es verändern sich die Schauspieler. Diesen psychologischen Prozess lässt Höner den Leser miterleben, indem er in den einzelnen Kapiteln die verschiedene Sichtweisen nicht nur verdeutlicht, sondern ihnen – wie im Peer Gynts Beispiel von der Zwiebel – Schicht für Schicht auf den Grund geht. Höner gelingt dies auf sehr subtile Weise: durch den Perspektivenwechsel, aus denen heraus erzählt wird, mit sprachlichen Mitteln, die dem Autor in allen Facetten zur Verfügung stehen, durch eine spannende Inszenierung.
Konnte das also gut gehen, was Tauber sich vorgenommen hatte? Heißt es doch, dass sich «die Welt der Pubertierenden nicht auf ein Theaterstück aus dem vorletzen Jahrhundert beschränkte», sondern andere Ausdrucksformen hat. Er, der Regisseur Tauber, musste daran scheitern. «Er brandmarkte einen flunkernden Schelm als üblen Lügner, aber der eigenen Lebenslüge stellte er sich nicht». Und so verändern sich die Jugendlichen wie auch die Alten, deren vermeintliche Gewissheiten auf den Prüfstand kommen.
«Vom Erfolg war kaum die Rede, dafür vom Scheitern.» – Scheitern an sich, an den anderen, am Stück. So gibt es Selbstmord, es gibt Hass auf sich selbst und untereinander. Es gibt Verzweiflungen an der Rolle und an sich selbst. Es gibt Gleichgültigkeit. Und es gibt die Liebe. Allerdings wird Gynts Frage «Wer bin ich?» am Ende immer noch nicht beantwortet. Oder doch? Ist die Liebe ein Bleibendes und gewiß?

Was hat Peter Höner mit «Gynt» geschrieben? Einen Theaterroman. Einen Liebesroman und eine faszinierende psychologische Studie. Einen Generationenroman - und ein sehr lesenswertes Buch.
Der Schluss des Romans gibt vielleicht ein wenig Aufschluss. «Johanna hat ihre Hand auf den Arm Julias gelegt. ‚Sie spielen die Solveig?’, fragte das Mädchen. ‚Ich auch. Allerdings nur die blinde. Eine schwierige, aber auch eine schöne Rolle…’. Sie lächelte und drehte sich nach Julia um.»
Und dann geht es um einen Satz von Ibsen, den Solveig verstanden hatte, Julia erst einmal nicht und dann doch: «Die ungesungenen Lieder sind stets die schönsten.»
Was hat Peter Höner geschrieben? Einen Theaterroman. Einen Liebesroman und eine faszinierende psychologische Studie. Einen Generationenroman – und ein sehr lesenswertes Buch. ●
Peter Höner: Gynt, Roman, 284 Seiten, Limmat Verlag, ISBN 978-3-85791-623-6
.
.
.
.
Helmut Brenner / Reinhold Kubik: «Mahlers Welt»
.
«In einem stillen Fichtenwäldchen»
Günter Nawe
.
 Ein kleines Haus, ganz aus Holz gezimmert, gelegen «in einem stillen Fichtenwäldchen»: das Komponierhäuschen des Gustav Mahler. Der Ort, an dem «Das Lied von der Erde» entstanden ist; wo Mahler seine IX. und die unvollendet gebliebene X. Symphonie komponiert hat. Gerade die X. hatte große Bedeutung in Zusammenhang mit den Ereignissen um Alma und Walter Gropius.
Ein kleines Haus, ganz aus Holz gezimmert, gelegen «in einem stillen Fichtenwäldchen»: das Komponierhäuschen des Gustav Mahler. Der Ort, an dem «Das Lied von der Erde» entstanden ist; wo Mahler seine IX. und die unvollendet gebliebene X. Symphonie komponiert hat. Gerade die X. hatte große Bedeutung in Zusammenhang mit den Ereignissen um Alma und Walter Gropius.
So beschreiben die Autoren des wunderbaren Bandes «Mahlers Welt – Die Orte seines Lebens» Helmut Brenner und Reinhold Kubik diesen im Leben des Gustav Mahler so bedeutenden Ort. Und nicht nur diesen. Man kann davon ausgehen, dass dieses Nachschlagewerk, das zugleich ein sehr schönes Lesebuch und ein bedeutendes Stück Musikgeschichte darstellt, an Vollständigkeit nichts zu wünschen übrig lässt.
Helmut Brenner hat seinen Ruf als Mahler-Experte bereits unter Beweis gestellt. Der freischaffende Publizist zeichnet unter anderem für die Ausgabe der Familienbriefe Mahlers verantwortlich. Auch Reinhold Kubik, unter anderem Musikwissenschaftler, bekannt als Editionsleiter der Gesamtausgabe der Werke von Gustav Mahler, hat sich längst als bedeutender Mahlerianer ausgewiesen. Dies muss vorausgeschickt werden, um zu zeigen, welche Kompetenz hinter dem Buch steht. Hinter einem Werk, das neben der fulminanten Biografie von Jens Malte Fischer («Gustav Mahler») zu den Standardwerken zu zählen ist.
Ausgangspunkt für die Reise durch die Wohn-, Aufenthalts- und Lebensorte von Gustav Mahler war eine Ausstellung über «Mahler in Wien». Helmut Brenner erzählte bei der «weltweit» ersten Buchvorstellung in Köln – auch ein wichtiger Ort in der Biografie Gustav Mahlers, wurde doch hier am 18. Oktober 1904 die V. Symphonie, vom Meister selbst dirigiert, uraufgeführt – vom Entstehen dieses Bandes, der eine Fortsetzung der Wiener Ausstellung auf andere Weise werden und den gesamten Kosmos Mahlerscher Aufenthalte umfassen sollte. Von der aufregenden, aber mühevollen Recherche war seine Rede, einer Recherche, die zwei ganze Jahre dauerte bis zur Fertigstellung des Buches, und die von Sankt Petersburg bis Uruguay reichte. Von 2’500 Mails berichtete Brenner, von unzähligen Telefonaten, von der – wie man jetzt sagen kann – erfolgreichen Suche nach bisher unveröffentlichten Texten.
Benutzt wurden nur Primärquellen, Sekundärquellen nur aus erster Hand. Nur was Mahler selbst gesehen (und wie er es gesehen) hat, galt. So setzt sich das Werk aus authentischen Bildern, aus Briefen und Notaten, aus öffentlichen Dokumenten und privaten Erinnerungen zusammen. Akribisch genau, dabei aber lebhaft und lebendig kommt dieses Buch daher. Ein Gewinn an Information und eine Freude für die Sinne.
Diese Biografie in Orten ist einfach grandios. Beginnend in Kalischt, dem Geburtsort Mahlers, über die unzähligen Lebenstationen bis zu seiner Grabstätte auf dem Grinzinger Friedhof in Wien reicht die chronologische Auflistung aller Orte von Abbazia bis Wörthersee – und dies weltweit: ob Skandinavien und Russland, in Amerika oder England, die Ländern der Donaumonarchie natürlich und Deutschland – hier sind sie zu finden. 597 Bilder illustrieren das Buch und geben Einblick in Mahlers Welt. Die Texte nennen nicht nur die einzelnen Aufenthaltsdaten, die Autoren haben es verstanden, weiterführende Informationen zu geben, den jeweiligen Ort näher zu beschreiben und so ein Gesamtbild zu geben. Eine einzigartige Topografie.

Dem Autoren-Duo Helmut Brenner und Reinhold Kubik ist mit «Mahlers Welt» ein grandioses Nachschlagewerk und ein einzigartiges Stück Musikgeschichte gelungen, das zugleich ein wunderbares Lesebuch ist. Akribisch recherchiert zeichnen Bilder und Texte eine faszinierende Topografie des Mahlerschen Lebens
Vor 100 Jahren, am 18. Mai 1911, starb Gustav Mahler. Noch am 11. Mai desselben Jahres – so ist es bei Brenner&Kubik zu lesen – machte sich der schwerkranke Komponist von Paris aus auf den Weg nach Wien. «Am 11. Mai 1911 wurde Mahler nachts mit dem Orientexpress und unter ärztlicher Betreuung durch den aus Wien herbeigerufenen Professor Dr. Franz Chvostek nach Wien zurückgebracht und am 12. Mai ins Sanatorium Loew eingeliefert… wo er am 18. Mai um 23.05 Uhr starb. Mahlers Sterbezimmer Nr. 82 war ein gartenseitig gelegener Erkerraum». ●
Helmut Brenner / Reinhold Kubik: Mahlers Welt – Die Orte seines Lebens, 404 Seiten, Residenz Verlag Salzburg, ISBN 978-3-7017-3202-9
.
.
.
.
.
Boris Kálnoky: «Ahnenland»
.
«Wir stehen auf den Schultern unserer Ahnen»
Günter Nawe
.
 «Vielleicht ist es meine Aufgabe, Hugós Geschichte zu erzählen… Hugó, ich verspreche Dir, mein Bestes zu geben… Es müsste, wenn es Dir recht ist, zugleich die Geschichte des Paradieses auf Erden sein… und die Geschichte Deiner Familie, auch jener, die vor Dir waren und nach Dir kamen.»
«Vielleicht ist es meine Aufgabe, Hugós Geschichte zu erzählen… Hugó, ich verspreche Dir, mein Bestes zu geben… Es müsste, wenn es Dir recht ist, zugleich die Geschichte des Paradieses auf Erden sein… und die Geschichte Deiner Familie, auch jener, die vor Dir waren und nach Dir kamen.»
Wer dies sagt und schreibt, ist der Autor eines großartigen Epos’ über eine 800-jährige Familiengeschichte; eine europäische Geschichte, die sich im Gebiet des früheren Österreich-Ungarn-Siebenbürgen abgespielt hat und noch abspielt. Boris Kálnoky ist Nachfahre des legendären Urahn Bencenc, der 1252 vom ungarischen König, als Belohnung für den Kampf gegen die Tartaren, ein Stück Land geschenkt bekam. Und damit gehörten die Kálnokys zu den Széklern, den ungarischen Grenzwächtern. Sie spielten – oft auf verschiedenen Seiten – wichtige Rollen in den großen Glaubenskämpfen des Mittelalters, in den politischen Verwicklungen der Zeit. Sie werden irgendwann einmal Grafen. Einer von ihnen wird später, am Ende des 19.Jahrhunderts, k.u.k.-Außenminister der österreich-ungarischen Doppelmonarchie. Eine höchst bewegte Geschichte in immer wieder sehr bewegten Zeiten.
Davon also erzählt Boris Kálnoky, der 1961 in München geboren wurde. Aufgewachsen ist er in Deutschland, in den Niederlanden, in Frankreich. Er lebte in Ungarn und lebt heute in der Türkei, wo er als Nahost-Korrespondent für die «Welt» arbeitet. Weltläufig geschult und mit journalistischem Spürsinn ausgestattet hat er sich nicht nur auf die Suche seiner «Heimat», seiner Familie gemacht, sondern auch nach deren Seele. «Früher war Heimat dort, wo man lebte. Heute in einer globalisierten Welt, in der man nur noch wohnt, aber nicht mehr zu Hause ist, da ist sie vielleicht eher ein innerer Ort: Nicht nur wohin man gehören, sondern wer man sein will. Wem es gegeben ist, an einen Gott zu glauben, der wird die Heimat der Seele finden – eine Heimat, die man auch dann nicht verlässt, wen man durch die Welt zieht wie einst die alten Székler durch die Steppe.» So der etwas pathetische Schluss des Buches.
Bis zu dieser Kálnoky-Erkenntnis ist es ein weiter Weg durch dieses abenteuerliche Geschichts- und Geschichtenbuch über Familienereignisse und Weltgeschehen, durch Kriege und Kämpfe und Verluste. Der Leser findet witzige bis aberwitzige Ereignisse, trifft auf Hasadeure und Rebellen, begegnet Literaten und Richtern. Und fühlt sich wohl in diesem Panaroma aufregender Erzählungen. Denn der Autor versteht es auf ausgezeichnete Weise, historische Fakten, private Ereignisse, belegt durch eine Vielzahl sehr interessanter Briefe, essayistische Passagen und persönliche Einschätzungen und Wertungen miteinander zu verbinden. Daraus ergibt sich ein geschlossenes Bild einer bestimmten Epoche in einem definierten geografischen Raum, in der und in dem europäische Geschichte geschrieben wurde – mit Nachwirkungen bis in unsere Zeit.

Der Journalist Boris Kálnoky hat sich in «Ahnenland» auf die «Suche nach der Seele» seiner Familie begeben. Die Spurensuche ist ihm zu einem faszinierenden Geschichts- und Geschichtenbuch geraten.
Das «Salz in der Suppe» dieser historischen Erzählung ist natürlich die Familiengeschichte. Aus ihr resultiert überhaupt erst das Interesse des Autors, der eigentlich eine Biografie seines Großvaters Húgo Kálnoky schreiben wollte. Denn «wir stehen auf den Schultern unserer Ahnen». Dieser Großvater, Journalist wie der Enkel, der ebenfalls auf der Suche nach der Heimat war, war sozusagen ein Seelenverwandter. Ihm folgte Enkel Boris durch das Land seiner Vorfahren. Genius loci und literarischer Topos ist das Dorf Köröspatak am Fuße der Karpaten, wo einst auch Graf Dracula residierte. Dieser Húgo ist eine wahrhaft faszinierende Figur: ein Weltsucher, der bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit einem Flugzeug unterwegs sein wollte. Einer, der eine Romanze erlebte. Dessen Artikel für den Poster Lloyd ihn bei den Nazis in Ungnade fallen ließ. Und so weiter – man lese selbst. Vor allem die wunderbaren Briefe, die Enkel Boris hier veröffentlicht, sind nicht nur Zeitzeugenschaft, sondern geben Zeugnis von persönlichem und familiärem Erleben.
Boris Kálnoky hat seine Heimat gesucht und die Seele seiner Familie gefunden. An der persönlichen Freude darüber lässt er den Leser teilhaben, in dem er von acht Jahrhunderten europäischer Geschichte erzählt, spannend, kompetent und sehr unterhaltsam. «Húgo, ich verspeche Dir, mein Bestes zu geben…». Er hat es getan. ■
Boris Kálnoky: Ahnenland oder die Suche nach der Seele meiner Familie, 490 Seiten, Droemer Verlag, ISBN 978-3-426-27465-1
.
.
.
.
Jean-Marc Souvira: «Der Zauberer»
.
Mörderische Tricks – Mistral ermittelt
Günter Nawe
.
 Er ist so ganz anders – der Kommissar Ludovic Mistral, Leitender Kommissar im Pariser Polizeipräsidium am Quai des Orfèvres. – kein Kriminalrambo, weder Alkoholiker; noch depressiv. Dafür ein braver Familienvater mit zwei Kindern, intelligent, musikliebend, einfach ein netter Kerl.
Er ist so ganz anders – der Kommissar Ludovic Mistral, Leitender Kommissar im Pariser Polizeipräsidium am Quai des Orfèvres. – kein Kriminalrambo, weder Alkoholiker; noch depressiv. Dafür ein braver Familienvater mit zwei Kindern, intelligent, musikliebend, einfach ein netter Kerl.
So erlebt der Leser ihn in dem jetzt erstmals in Deutschland veröffentlichten und in Köln Presse und Publikum vorgestellten Debüt-Roman «Der Zauberer». Der Autor Jean-Marc Souvira, geboren 1954 in Oran, war 25 Jahre Kriminalkommissar und ist jetzt Leiter der Abteilung Geldwäsche und Terrorismus in Paris. Er hatte bereits mit einer kurzen Geschichte, die Luc Besson unter dem Titel «Go fast» verfilmt hat, erste literarische Aufmerksamkeit gefunden.
Der «Gegenspieler» von Kommissar Mistral in seinem Roman ist der «Zauberer»Arnaud Lécuyer, der vor Jahren Paris in Angst und Schrecken versetzt hat. Mit Zaubertricks, mörderisches Tricks, hat er kleine Jungen angelockt, sie beinahe rituell erdrosselt, erstochen und vergewaltigt – ohne auch nur die geringste Spur zu hinterlassen. Mordwaffe ist ein umfunktionierter Schraubenzieher, mit dem Lécuyer auch andere Morde verübt hat. Nach zwölf Jahren Gefängnisaufenthalt – übrigens wegen eines anderen Delikts – beginnt sein Treiben nun von Neuem. Und weitere Opfer sind zu erwarten.
Damit beginnt auch die Jagd auf den «Zauberer». Ein Kampf gegen die Zeit und ein schwieriges Unterfangen, denn der Mann ist unscheinbar, unauffällig, aber von inneren Dämonen getrieben, mit denen er «im Gespräch» ist, und äußerst raffiniert in der Ausführung seiner schrecklichen Taten. Ein so ganz anderer Tätertyp als wir ihn aus den herkömmlichen Kriminalromanen und Thrillern kennen.
Souvira, der im Gespräch in Köln bekannte, dass «beaucoup» von ihm selbst in Kommissar steckt, hat mehrere authentische Fälle zu einer Romanhandlung komprimiert. Er kennt natürlich die Ermittlungsarbeit, er weiß aber auch um die unterschiedlichsten Täterprofile. In diesem Fall hat ihn – und letztlich auch den Leser – die Seelenlage des Täters, eines Geisteskranken, interessiert. Souvira beschreibt in einem fast lakonischen Stil, aus wechselnden Perspektiven, die Obsessionen des Täters, seine Wahrnehmungen und Ängste. Das macht diesen Roman so außergewöhnlich, auch aus literarischer Sicht, und so spannend.
Auch von der Dramaturgie her ist der Roman hochinteressant. Obwohl der Leser den Täter von Anfang an kennt, lassen die Spannung und das Interesse nicht nach. Souvira: «Der Roman hat eine Melodie. Der Rhythmus wird dem Ende zu immer schneller» – bis zum schrecklich-großartigen Showdown. Und so verfolgt der Leser das Geschehen atemlos bis zur letzten Seite. Was nicht zuletzt auch an der ausgezeichneten Übersetzung ins Deutsche von Ulrike Werner liegt.

Ein Krimi, ein Thriller mit einem interessanten Plot, spannend, gut geschrieben und mit Tiefgang: «Der Zauberer» ist ein faszinierender Roman, den man gern empfiehlt.
Im Gespräch erläuterte Jean-Marc Souvira seine Intention. Ihn hat vor allem interessiert, was hinter der Tat steht. So versucht sein Kommissar Mistral, in die Seelenwelt des Täters einzudringen. Und die so gewonnen Erkenntnisse für die Ergreifung des Täters zu nutzen.
Das gelingt ihm auf hervorragende Weise.
Kommissar Ludovic Mistral wird – so Jean-Marc Souvira – weiter ermitteln. Ein zweiter Fall wird im Roman «Die dunkle Seite des Spiegels» gelöst. Und ein dritter Roman ist in Arbeit. Zur Freude des Lesers, der diesen Autor und seinem Kommissar gern bei seinen Ermittlungen begleiten wird. ■
Jean-Marc Souvira, Der Zauberer, Kriminalroman, 491 Seiten, Bastei-Lübbe-Verlag, ISBN 978-3-404-16526-1
.
.
Jürg Amann: «Der Kommandant»
.
«Angesichts der Wirklichkeit ist alles Erfinden obszön»
Günter Nawe
.
 Die Erinnerungen – oder besser: das Selbstzeugnis des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höß aus dem Jahre 1958 – sie sind im Gedächtnis geblieben als grausames Dokument. Nicht zuletzt war es die unglaubliche Kälte und die fast perverse Naivität und Selbstgerechtigkeit des Textes und seines Autors, die den Leser auf das Äußerste erschüttert haben.
Die Erinnerungen – oder besser: das Selbstzeugnis des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höß aus dem Jahre 1958 – sie sind im Gedächtnis geblieben als grausames Dokument. Nicht zuletzt war es die unglaubliche Kälte und die fast perverse Naivität und Selbstgerechtigkeit des Textes und seines Autors, die den Leser auf das Äußerste erschüttert haben.
«Das hat mich geradezu über den Haufen geworfen, dass einer sich hinstellt, einer der Haupttäter des Nazi-Regimes, und schreibt freiwillig Faktum für Faktum, wie das zustande gekommen ist, wie er den Auftrag erhalten hat, wie er den umgesetzt hat, wie er den pflichtdienstlich zur höchsten Effektivität gesteigert hat, als ob er Buchhaltung führen würde über sich selber.»

Braver Katholiken-Sohn, korrekter Verwaltungs-Beamter - und gewissenloser Gas-Massenmörder: Auschwitz' berüchtigster Kommandant Ruolf Höss (Geb. 1900, 1947 als Kriegsverbrecher hingerichtet)
So der Schweizer Autor Jürg Amann in einem Interview über die Höß’schen Aufzeichnungen und sein literarisches Projekt. Und so hat er sich – anders als seiner Zeit Jonathan Littell in «Die Wohlgesinnten» – den Originaltext vorgenommen und ihn verdichtet. Amann wollte nichts erfinden, die Fakten waren schlimm genug. «Angesichts der Wirklichkeit ist alles Erfinden obszön», so Jürg Amann.
Herausgekommen ist bei dem dramaturgischen Prozess der Verdichtung und Neustrukturierung der Erinerungen von Rudolf Höß ein Text, der noch dramatischer, noch schrecklicher ist als das Original, obwohl kein Wort hinzugefügt und kaum ein Satz verändert worden ist. Jürg Amann ist ein als «Monolog» bezeichnetes Monodram in sechzehn Stationen gelungen, in dem das gelebte Leben des Rudolf Höß noch einmal eine eigentlich kaum möglich geglaubte Zuspitzung erhält.
Es fällt schwer zu lesen, wie der spätere Lagerkommandant zuerst Priester werden wollte, dann als Soldat «eine Heimat, ein Geborgensein, in der Kameradschaft der Kameraden» gefunden hat; wie aus dem einfachen, aber fast fanatischen Soldaten der SS-Mann und später der Lagerkommandant geworden ist. Von den kalten Schilderungen des Lagerlebens und der Grausamkeiten nicht zu reden. Sätze wie: «So gab es viele erschütternde Einzelszenen, die allen Anwesenden nahegingen», oder: «Das Leben und das Sterben der Juden gab mir wahrhaft Rätsel genug auf, die ich nicht zu lösen imstande war» machen den Leser wütend, traurig – und ratlos.
Am Ende der Orignalaufzeichnungen schrieb Rudolf Höß bzw. zitiert Jürg Amann: «Mag die Öffentlichkeit ruhig weiter in mir die blutrünstige Bestie, den grausamen Sadisten, den Millionenmörder sehen – denn anders kann sich die breite Masse den Kommandanten nicht vorstellen. Sie würde doch nie verstehen, dass der auch ein Herz hat, das nicht schlecht war.»

Jürg Amann hat in seinem «Kommandanten» ein beeindruckendes Stück Literatur geliefert - Literatur, die dem ungeheuerlichen Stoff gerecht wird. Durch die Verdichtung, den dramaturgischen Prozess der Verschlankung eines Textes gelingt es ihm, ohne persönlich gefärbte Zusätze die nackte Wirklichkeit herauszustellen - und die ist grausam genug.
Jürg Amann hat versucht – und es ist ihm hervorragend gelungen -, mit der literarischen Verdichtung des Höß-Textes, mit dem distanzierten Blick des Autors eine Annäherung an das Böse zu finden, das Unfassbare begreiflich zu machen, zu erkennen, was wohl im Kopf eines Massenmörder vor sich geht. Dabei ließ er sich nicht von Emotionen, von eigenen Vorstellungen und Phantasien, von möglichen Einflüssen auf Denken und Fühlen leiten. Er läßt auf seine Weise nur das Original sprechen – und das ist schrecklich genug. Einmal mehr aber erkennt der Leser gerade dadurch, was es mit der Formulierung Hannah Arendts von der «Banalität des Bösen» auf sich hat. ■
Jürg Amann, Der Kommandant – Monolog, 108 Seiten, Arche Verlag. ISBN 978-3-7160-2639-7
.
.
.
.
Thomas Bernhard: «Der Wahrheit auf der Spur»
.
«Ich bin kein Skandalautor»
Günter Nawe
.
 Gibt es einen Unterschied zwischen dem «öffentlichen» Thomas Bernhard und den fiktiven Figuren in seinen Romanen und Theaterstücken? Wer war dieser monomanische Schriftsteller, der am 9. Februar 1931 – also vor 80 Jahren – erst auf die Welt und dann in die Literatur gekommen und am 12. Februar 1989 als Autor von Weltrang gestorben ist? Das dürfte ein nie ganz zu lösendes Rätsel bleiben. Es fällt allerdings oft eine eigentümliche Übereinstimmung zwischen den öffentlichen Äußerungen Thomas Bernhards und vielen seiner Romanfiguren auf. Vielleicht sind die Bücher dieser «misanthropische Wortmühle» (Sigrid Löffler) nichts anderes als Selbstbeschreibungen?
Gibt es einen Unterschied zwischen dem «öffentlichen» Thomas Bernhard und den fiktiven Figuren in seinen Romanen und Theaterstücken? Wer war dieser monomanische Schriftsteller, der am 9. Februar 1931 – also vor 80 Jahren – erst auf die Welt und dann in die Literatur gekommen und am 12. Februar 1989 als Autor von Weltrang gestorben ist? Das dürfte ein nie ganz zu lösendes Rätsel bleiben. Es fällt allerdings oft eine eigentümliche Übereinstimmung zwischen den öffentlichen Äußerungen Thomas Bernhards und vielen seiner Romanfiguren auf. Vielleicht sind die Bücher dieser «misanthropische Wortmühle» (Sigrid Löffler) nichts anderes als Selbstbeschreibungen?
Eine Antwort kann eventuell der jetzt erschienene Band «Der Wahrheit auf der Spur» geben. In chronologische Reihenfolge sind Zeitungsartikel, Leserbriefe, Interviews und öffentliche Erklärungen gesammelt. Nicht alles ist neu, vieles konnte bereits in «Meine Preise» gelesen werden. Dennoch: Alle Beiträge in diesen Band sind interessant, werfen Schlaglichter auf den Autor, vor allem weil sie durchweg «Selbstauskünfte» sind. Beginnend mit einem Vortrag, den der jungen Thomas Bernhard 1954 zu Ehren von Arthur Rimbaud gehalten hat, und einem Artikel in der Gmundener Lokalzeitung, in dem er sich für den Erhalt der Straßenbahn in Gmunden einsetzte.
Viele dieser öffentlichen Äußerungen waren einserseits Selbststilisierungen, ironische Spielchen mit seinem Publikum oder dem Interviewpartner. Andererseits erzeugte Bernhard damit Skandale und Skandälchen, die er mal lustvoll, mal bitterböse kommentierte. Er war ein Meister des Eklats, der wunderbar austeilen, aber selten einstecken konnte. Eberhard Falcke hat ihn einmal einen «Verzweiflungsvirtuosen und Mißmutsmanieristen» genannt. Und so geben viele Beiträge Anlass zu glauben, dass dieser außergewöhnliche Autor am Leben litt. Aber «sich umzubringen hat genausowenig Sinn wie weiterzuleben.»
Immer wieder seine Haßliebe zu Österreich, die ihn umgetrieben hat. Es gab für ihn kein schöneres Land als Österreich, in dem er nicht leben konnte, und in dem er doch bis zu seinem Tode blieb. Wut, Zorn und Häme galten dem Land und seinen Menschen. Vor allem die Politiker hatten es ihm angetan. Berühmt der Skandal bei der Verleihung des Österreichischen Staatspreises an Thomas Bernhard am 4. März 1968. Unter dem Titel «Verehrter Herr Minister…» ist die Rede hier noch einmal zu lesen. Es waren wohl die Sätze: «Der Staat ist ein Gebilde, das fortwährend zum Scheitern, das Volk ein solches, das ununterbrochen zur Infamie und Geistesschwäche verurteilt ist…. Wir sind Österreicher, wir sind apathisch…». Polemisch und ein wenig verzweifelt klingt das auch heute noch. Der österreichische Unterrichtsminister verließ jedenfalls unter Protest den Saal. Der Skandal war perfekt. Aber nein: «Ich bin kein Skandalautor», so Thomas Bernhard…

Wer war Thomas Bernhard? Er schrieb Weltliteratur, war einer der berühmtesten Stückeschreiber seiner Zeit. Der «Alles-und alle-Beschimpfer» provozierte Skandale und wollte dennoch kein «Skandalautor» sein. Der Wahrheit auf der Spur also? Zumindest kann man sich ihr mit diesem Buch nähern.
Jeder dieser Texte in diesem Band steht für sich. Mancher könnte als pure Literatur gelesen werden. Denn Literat, Schriftsteller – das war der «Alles-und alle-Beschimpfer» letztendlich. Und als solcher äußert er sich über Politik und Kultur, über Kollegen und das Leben im Allgemeinen und über sein eigenes(?) im Besonderen. Das gilt auch für die Interviews. Sehr eindrucksvoll – vielleicht das ehrlichste und persönlichste – ist das Gespräch, das die Kollegin Asta Scheib am 17. Januar 1987 mit ihm führte («Von einer Katastrophe ind die andere»). Da heißt es doch wahrlich: «Das Leben ist schön… Doch, jetzt hänge ich am Leben…» – Worte, die man dem «staatlich geprüften Misanthropen» (Marcel Reich-Ranicki) nicht zugetraut hätte.
Wer war Thomas Bernhard? Mit diesem Buch kann sich der Leser auf die Spur der Wahrheit begeben. Ob er darin die ganze Wahrheit über ihn finden wird, bleibt dahingestellt. ■
Thomas Bernhard, Der Wahrheit auf der Spur, 344 Seiten, Suhrkamp Verlag, ISBN 978-3-518-42214-4
.
.
.
.
.
Jens Bisky (Hg.): «Heinrich von Kleist – Bisse, Küsse»
.
«…und wer recht von Herzen liebt»
Insel-Almanach 2011 auf Heinrich von Kleist
Günter Nawe
.
 Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Und ein literarisches «Großereignis» ist mit dem 21. November 2011 gegeben. An diesem Tage, vor 200 Jahren, hat sich Heinrich von Kleist (1777 – 1811), einer der größten deutschen Dichter und Autor des berühmten «Michael Kohlhaas», am Berliner Wannsee zusammen mit seiner Geliebten Henriette Vogel das Leben genommen.
Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Und ein literarisches «Großereignis» ist mit dem 21. November 2011 gegeben. An diesem Tage, vor 200 Jahren, hat sich Heinrich von Kleist (1777 – 1811), einer der größten deutschen Dichter und Autor des berühmten «Michael Kohlhaas», am Berliner Wannsee zusammen mit seiner Geliebten Henriette Vogel das Leben genommen.
Mit «Küsse, Bisse», dem Insel Almanach auf das 2011, wird das Kleist-Jahr gewissermaßen eingeläutet. Es werden zwar sicher noch eine Reihe von Publikationen folgen – hier aber hat die interessierte Leserschaft schon einmal ein sehr schönes, sehr informatives Kompendium aus Gedichten, Auszügen aus dem dramatischen Werk, Erzählungen und Briefen zur Hand.
Im Vorwort wird eine schöne Charakteristik dieses «Fachmanns für Emotionen», wie Kleist genannt worden ist, von Clemens Brentano zitiert, der den Dichterkollegen 1810 in Berlin erlebt hat. Er «fand ihn sanft und ernst, ‚frisch und gesund’, untersetzt, ‚mit einem erlebten rund Kopf, gemischt launigt, kindergut, arm und fest». «Ein guter, grober, bornierter, dummer, eigensinniger , mit langsamen Konsequenztalent herrlich ausgerüsteter Mensch.’»
So viel zu den Äußerlichkeiten dieses ungewöhnlichen Menschen. Ebenso wichtig und nach wie vor spannend zu lesen die hier gesammelten Auszüge aus dem Werk Kleists. So aus dem Trauerspeil «Penthelisea», dem auch der Titel des Almanachs entnommen ist: «… Küsse, Bisse, / das reimt sich, und wer recht von Herzen liebt, / Kann schon das Eine für das Andre greifen.»
Zum Thema «Liebe» im Werk von Heinrich von Kleist, der sich mit ihr persönlich sehr schwer getan hat, werden Texte aus den Erzählungen (u. a. aus «Das Erdbeben von Chili») zitiert und vor allem Briefe an seine Verlobte Wilhelmine von Zenge, aus der nie seine Frau werden sollte. Wie sollte auch eine Ehe aussehen, die unter folgender Voraussetzung geschlossen worden wäre: «Der Mann ist nicht bloß der Mann seine Frau, er ist auch ein Bürger des Staates, die Frau hingegen ist nichts, als die Frau ihres Manns… das Glück des Weibes ist zwar ein unerläßlicher aber nicht der einzige Gegenstand des Mannes… das Glück des Mannes hingegen ist der einzige Gegenstand der Frau….».
Freundschaften pflegte Kleist hingegen besonders mit seiner Halbschwester Ulrike von Kleist und mit Ernst von Pfuel, eine mehr als symbiotische Beziehung, wie aus den im Almanach abgedruckten Briefen herauszulesen ist.

Mit diesem sehr schönen und sehr informativen Almanach, einem Kompendium aus Gedichten, Auszügen aus dem dramatischen Werk, aus Erzählungen und Briefen ist ein kompetenter Einstieg in jede weitere Beschäftigung mit einem der größten deutschen Dichter gelungen. Lesenswert!
Kleist also der unglückliche Dichter, der sich als Virtuose der großen Gefühle gefällt? Zeugnisse allenthalben jedenfalls – auch zum Thema «Hass», der u. a. in «Die Hermannschlacht» sein literarisches Zeugnis findet.
Heinrich von Kleist – er war als Dichter groß, als Mensch unglücklich. Und so ist am Ende des Almanachs auch der Tod am Wannsee dokumentiert – das außergewöhnliche Ende einer außergewöhnlichen Persönlichkeit. ■
Jens Bisky (Hg.): Heinrich von Kleist – Bisse, Küsse, Insel Almanach auf das Jahr 2011, 230 Seiten, Insel / Suhrkamp Verlag Berlin, ISBN 978-3-458-17486-8
.
.
.
Eve Pormeister: «Grenzgängerinnen»
.
Fortgehen und Daheimbleiben in einem
Günter Nawe
.
 Zwei schreibende Frauen, zwei bedeutende Schweizer Schriftstellerinnen – mit dem literarischen Schaffen von Gertrud Leutenegger (geb. 1948) und der Nonne Silja Walter (geb. 1919) beschäftigt sich die estnische Germanistin und Literaturwissenschaftlerin Eve Pormeister, Professorin an der Universität Tartu. Sie hat bereits in Einzelstudien über beide Autorinnnen gearbeitet und kann darüber hinaus als Expertin für Schweizer Literatur gelten.
Zwei schreibende Frauen, zwei bedeutende Schweizer Schriftstellerinnen – mit dem literarischen Schaffen von Gertrud Leutenegger (geb. 1948) und der Nonne Silja Walter (geb. 1919) beschäftigt sich die estnische Germanistin und Literaturwissenschaftlerin Eve Pormeister, Professorin an der Universität Tartu. Sie hat bereits in Einzelstudien über beide Autorinnnen gearbeitet und kann darüber hinaus als Expertin für Schweizer Literatur gelten.
In dem vorliegenden Band legt sie neue Studien über die beiden «Grenzgängerinnen» Gertrud Leutenegger und Silja Walter vor – literarische Essays, die einzeln und nebeneinander gelesen werden können, und die doch zusammenhängen. Für Eve Pormeister ist das Band, das beide Schriftstellerinnen verbindet, das «Fortgehen und Dableiben in einem» (Silja Walter). Beide sitzen sie auf einem Baum: eine auf ihrem «Apfelbaum», die andere auf ihrem «Wolkenbaum». Metaphern, wie sie in der Dichtung der einen und anderen zu finden sind. Von ihren «Bäumen» herab zeigen sie uns die Welt – zeitkritisch, spirituell, lyrisch und sprachmächtig.
Eve Pormeister beschreibt die gebürtige Innerschweizerin Leutenegger als sehr poetische Autorin. Nahe am Werk zeigt sie die farbenreichen und musikalischen Sprachbilder als Gegenentwurf zu den – wie Pormeister schreibt – «erstarrten Denk- und Verhaltensmustern». Exemplarisch dargestellt am Roman «Vorabend» zum Beispiel. Und sie zitiert Leutenegger: «Ich schreibe, um aus meinen Schmerzen ein Fest zu machen». Schmerzliche Erfahrungen macht die Leutenegger auch in ihrem Werk «Pomona», das Eve Pormeister ebenfalls ausführlich untersucht und deutet.
Dabei erfahren wir, dass es sich – wie später auch bei Silja Walter – nicht um feministische Literatur, nicht um eine écriture féminine handelt, sondern einfach nur um «Texte von weiblicher Hand». Beider Poetik ist allerdings jeweils eine «schmerzliche und notwendige Grenzerfahrung» in vielerlei Hinsicht.
Die Nonne und Dichterin Silja Walter versteht es auf hohem literarischem Niveau, Spiritualität mit Poesie zu einer religiösen Dichtung zu verbinden. Werke wie ihre Gedichte (z.B. «Die Feuertaube» 1985), Chronikspiele (u.a. «Die Jahrhundert-Treppe» 1981), Theaterstücke («Sie kamen in die Stadt» 1982) und Prosa («Der Wolkenbaum. Meine Kindheit im alten Haus» 1991) belegen dies. Pormeister versucht die «Außenseiterin» in die schweizerische Literatur einzuordnen und ihr den Platz, den sie verdient, zuzuweisen. Sie macht dies sehr klug, und sie verdeutlicht damit auch die Verbindung, ja die «Verwandtschaft» mit Gertrud Leutenegger.
Silja Walter über sich selbst: «Ich bin nicht Schriftstellerin / und dazu noch Nonne. / Ich bin nur eine Nonne, / die schreibt. / Ich glaube, darum schreibe ich.» – «Ich glaube, darum schreibe ich» ist eine Art dichterischen Credos, das ihr ganzes Werk durchzieht. Von ihr wurde einmal geschrieben: …wie niemand sonst schafft Silja Walter im Einklang mit ihrem Bekenntnis Werke, die literarisch auf der Höhe unserer Zeit stehen.» («Weltwoche» 1977). Eve Pormeister bestätigt diese Würdigung 30 Jahre Jahre später mit ihrem Essay.

Das Werk Gertrud Leuteneggers und Silja Walters, der beiden bekannten Schweizer Autorinnen und «Grenzgängerinnen», hat in der gleichnamigen, sehr lesenswerten Untersuchung von Eve Pormeister überzeugende Deutungen erfahren.
«Grenzgängerinnen» also zwischen Poesie und Erzählung, zwischen Zeitkritik und spiritueller Erfahrung. So mit den Augen der Literaturwissenschaftlerin Pormeister gelesen zeigen sich neue Aspekte im Werk der beiden Autorinnen – oder bestätigen bestehende Auffassungen. Geistesverwandt beide: Gertrud Leutenegger und Silja Walter, denen «diese Lust: eine Welt entflammen zu lassen» gemeinsam ist.
Das Werk Leuteneggers und Walters hat in dieser Untersuchung überzeugende Deutungen erfahren, und die wunderbaren Arbeiten von Eve Pormeister, ergänzt um persönliche Gespräche mit den Autorinnen, «entflammen» auch den Leser, machen neugierig auf mehr. Was kann man Besseres von einem Buch sagen! ■
Eve Pormeister: Grenzgängerinnen – Gertrud Leutenegger / Silja Walter, 222 Seiten, SAXA Verlag, ISBN 978-3-939060-26-0
.
.
Esther Pauchard: «Jenseits der Couch»
.
Die Niederungen der menschlichen Seele
Günter Nawe
.
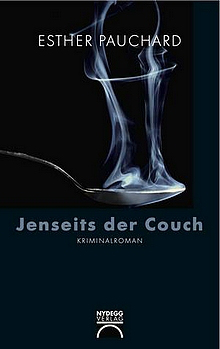 Nichts ist mehr, wie es war für die Assistenzärztin Kassandra Bergen, die in der Psychiatrischen Klinik Eschenberg arbeitet. Und das hat einzig und allein etwas mit dem Notfall zu tun, der gegen halb drei Uhr morgens eingeliefert worden ist. Entgleiste Schizophrenie lautet die Diagnose, nicht zuletzt forciert durch die Einnahme illegaler Substanzen. Doris Greub ist die Patientin, die offensichtlich ihren Ehemann nicht nur eines Verbrechens beschuldigt, sondern auch versucht hat, ihn umzubringen.
Nichts ist mehr, wie es war für die Assistenzärztin Kassandra Bergen, die in der Psychiatrischen Klinik Eschenberg arbeitet. Und das hat einzig und allein etwas mit dem Notfall zu tun, der gegen halb drei Uhr morgens eingeliefert worden ist. Entgleiste Schizophrenie lautet die Diagnose, nicht zuletzt forciert durch die Einnahme illegaler Substanzen. Doris Greub ist die Patientin, die offensichtlich ihren Ehemann nicht nur eines Verbrechens beschuldigt, sondern auch versucht hat, ihn umzubringen.
Ein klarer Fall? Mitnichten. Die Schweizer Autorin Esther Pauchard ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, sie arbeitet als Oberärztin in einer Suchtklinik. Und sie entwickelt dank geballter Fachkompetenz und einem Gespür für die menschlichen Abgründe aus dem, was eigentlich nur ein psychiatrischer Fall ist, einen brillanten Krimi.
Denn sehr schnell kommt Kassandra Bergen darauf, dass es mit Doris Greub eine andere Bewandtnis haben muss. Sind die Beschuldigungen der Patientin gegen ihren Mann, dem sie den Missbrauch ihrer Tochter unterstellt, und der sie bewusst für unzurechnungsfähig erklären will, nur die Folge der Einnahme von Drogen, sind ihre Halluzinationen und Wahnvorstellungen nicht näher an der Wirklichkeit, als es ihr Mann glauben machen will?
Die resolute Kassandra Bergen beginnt an ihrer Diagnose zu zweifeln, setzt sich vehement auch gegen den Kollegen Martin zu Wehr und beginnt auf eigene Faust nicht nur in der Krankengeschichte von Doris zu forschen, sondern sich auch das Familienumfeld vorzunehmen. Das ist natürlich weit außerhalb dessen, was ihr als Ärztin erlaubt ist. Sie gefährdet ihre Karriere und gerät in gefährliche Turbulenzen. Esther Pauchard zeichnet ein großartiges Psychogramm dieser Ärztin, dieser Frau, die sich, selbstbewusst und dennoch verletzlich, ihrem Beruf und ihrer Aufgabe als Ärztin verpflichtet fühlt, auch über fachliche Grenzen hinaus.
Immer deutlicher wird es für Kassandra – spätestens nach dem Selbstmord ihrer Patientin Doris -, dass hier etwas nicht stimmt. Mit Hilfe der Medizinstudentin Kerstin Lindner «ermittelt» sie auf eigene Faust, auf eigene Gefahr und «jenseits der Couch». Und bald tut sich vor ihr ein Abgrund von Lügen, Verschleierungen und kriminellen Aktivitäten auf. Sie dienen einzig dem Ziel, nicht nur Doris Greub auszuschalten, die mehr weiß als es anderen recht sein kann (was schließlich gelungen ist), sondern auch alle Spuren zu verwischen, die auf die Untaten des «seriösen» Peter Greub und seiner vier bürgerlich gutsituierten Freunde verweisen.

Die Berner Autorin Esther Pauchard hat mit «Jenseits der Couch» einen Debüt-Krimi geschrieben, der eine höchst spannende Studie über die Abgründe der menschlichen Seele darstellt. Mit der Fachkompetenz der Ärztin und Psychiaterin entwickelt die brillante Erzählerin eine faszinierende Geschichte, die den Leser über die Lektüre hinaus beschäftigen dürfte.
Der als Schriftstellerin debütierenden Autorin Esther Pauchard gelingt es, die Niederungen der menschlichen Seele zu beschreiben, Menschen in Extremsituationen darzustellen. Und das macht sie so geschickt, dass dem Leser manchmal der Atem stockt. Vor diesem Hintergrund also ist ein Buch entstanden, dem es an Tiefgang beileibe nicht fehlt.
Denn Pauchard geht es nicht um spektakuläre Bilder, um wilde Verfolgungsjagden, auch wenn sie sich der üblichen Versatzstücke eines Krimis bedient. Er geht es um das, was hinter dem Verbrechen steht. Und das macht sie hervorragend – bis zum Schluss, bis zu dem Moment, wo der eindeutige Beweis der Schuld von Greub und seiner Kumpane vorliegt.
Und was für ein Beweis! Kassandra hat alle Gefahren, auch die für Leib und Leben letztlich überstanden. Auch wenn sie, nachdem sie das Video gesehen hat, das die permanente Vergewaltigung der Tochter von Doris Greub zeigt, gestehen muss: «Alles, worauf ich gebaut habe, ist ins Wanken geraten». Für sie und in ihr ist mehr passiert als nur die Aufklärung eines Verbrechens. Und nichts ist, wie es einmal war.
Auch wenn am Ende alles gut geht – die Psychiaterin hat Mühe, sich nicht nur von diesen Bildern zu befreien, sie muss auch eigene Probleme verarbeiten, die sich im Verlaufe der Geschichte für sie ergeben haben.
Und auch der Leser dieses faszinierenden Krimis wird sich weit über das Geschehen hinaus damit beschäftigen… ■
Esther Pauchard: Jenseits der Couch, Roman, 429 Seiten, Nydegg Verlag, ISBN 978-3-9522295-9-0
.
.
Charles Lewinsky: «Der Teufel in der Weihnachtsnacht»
.
Die Zehn Gebote und Krombacher Pils
Günter Nawe
.
 Einen Spaß wollte er sich machen, dieser Charles Lewinsky. Und das ist ihm bestens gelungen. Gerade recht zum Weihnachtsfest kommt diese nicht ganz ernstgemeinte (und bereits vor 13 Jahren erstmals verlegte) Geschichte über den Papst und seinen unheiligen Besuch in der heiligen Weihnachtszeit erneut auf den Gabentisch.
Einen Spaß wollte er sich machen, dieser Charles Lewinsky. Und das ist ihm bestens gelungen. Gerade recht zum Weihnachtsfest kommt diese nicht ganz ernstgemeinte (und bereits vor 13 Jahren erstmals verlegte) Geschichte über den Papst und seinen unheiligen Besuch in der heiligen Weihnachtszeit erneut auf den Gabentisch.
Schwester Innocentia, Seiner Heiligkeit deutsche Haushälterin mit Schnurrbärtchen, ist eigentlich mal wieder schuld daran, dass es dank ihrer köstlichen Christstollen, die dem Papst schwer im Magen liegen, zu diesem außergewöhnlichen Rencontre kommt, zu einem Rededuell mit dem Teufel; mitten in der Nacht – ein Albtraum!
Will der Leibhaftige den Papst nach neutestamentlichem Strickmuster verführen? Immerhin kommt der Teufel sehr präsentabel daher, fein gekleidet und bestens gelaunt.
Gut gelaunt war wohl auch der Zürcher Theater- und Roman-Autor Charles Lewinsky beim Schreiben dieses Textes. Er zündet ein wahrhaftiges Feuerwerk toller Idee, witzig, intelligent – und trotz mancher Respektlosigkeit nie verletzend. Nach Teufels Art also weiß sich der Leibhaftige hervorragend zu verkaufen, so dass sogar dem Heiligen Vater manchmal nicht nur die Argumente ausgehen, sondern er beinahe wirklich in Versuchung kommt, dem Teufel zu glauben. Weiß Satan doch genau, wo dem Papst und damit der Kirche der berühmte Schuh drückt. Laufen ihnen die Schäfchen weg, bröckelt das Image, sinken die Erträge.
So empfiehlt Satan nichts weniger als einen Relaunch, eine Optimierung kirchlicher Unternehmenspolitik, und verspricht dadurch eine «Umsatzsteigerung» in allen Bereichen. Zum Beispiel Werbespots, die zum Empfang der Sakramente auffordern und das Beten wieder salonfähig machen sollen. Einen elektronischen Beichtstuhl empfiehlt er – eine wahrhaft teuflische Idee. Und ein letzter, sozusagen ultimativer Vorschlag: Sponsoring zum Füllen vatikanischer Kassen. Bedingung: die Sponsoren wollen bei allen Kulthandlungen und Verlautbarungen genannt werden. Nach dem Beispiel: Der Weihrauch riecht nach Käpt’n Iglus Fischstäbchen und die Zehn Gebote werden von Krombacher Pils präsentiert.
Es gibt noch mehr solcher Ideen, die alle sehr überzeugend klingen, sodass der Papst bereit ist, seine Unterschrift unter einen enstprechenden Vertrag zu setzen. Just in dem Augenblick schellt der Wecker und Schwester Innocentia steht in der Tür – mit einem großen Stück köstlichen Dresdener Christstollen….

Charles Lewinskys «Der Teufel in der Weihnachtsnacht» arrangiert ein weihnächtliches Treffen zwischen dem Papst und dem Teufel - ein satanisches Komplott, das den Papst nicht nur in Bedrängnis bringt, sondern gar das Seelenheil kosten kann... Die ganz andere Weihnachts-Geschichte: frech, witzig, maliziös, und sehr gescheit.
Von dieser Art ist Lewinskys Erzählung vom Teufel, der den Papst in der Weihnachtsnacht besucht hat – ein kleines und feines literarisches Kabinettstückchen voller ironischer Komik, gerade recht zur Weihnachtszeit. ■
Charles Lewinsky: Der Teufel in der Weihnachtsnacht, 60 Seiten, Nagel & Kimche, ISBN 978-3-312-00465-2
.
.
.
.
Arno Stocker: «Der Klavierflüsterer»
.
Von Caruso «auf die Beine geholt»
Günter Nawe
.
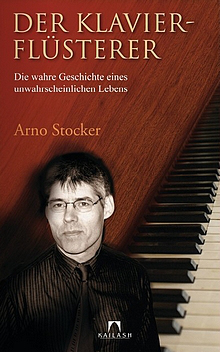 Es kommt nicht allzu häufig vor, dass man den Titeln auf Buch-Covern trauen kann. Diesmal aber stimmt der Untertitel: «Die wahre Geschichte eines unwahrscheinlichen Lebens». Erlebt und aufgeschrieben hat sie Arno Stocker, «der Klavierflüsterer», der in diesem Buch unter anderem erzählt, «wie mich Caruso auf die Beine holte».
Es kommt nicht allzu häufig vor, dass man den Titeln auf Buch-Covern trauen kann. Diesmal aber stimmt der Untertitel: «Die wahre Geschichte eines unwahrscheinlichen Lebens». Erlebt und aufgeschrieben hat sie Arno Stocker, «der Klavierflüsterer», der in diesem Buch unter anderem erzählt, «wie mich Caruso auf die Beine holte».
Er, geboren 1956, der singen wollte wie Caruso und spielen wie Horowitz, kam mit einer spastischen Lähmung auf die Welt. Mit geschädigtem Gehirn und verrenkten Glieder sowie fast blind ist von einer großen Karriere nicht einmal zu träumen. So bedurfte es einerseits einiger besonderer Zufälle als auch eines besonders ausgeprägten Willens, um dieses Leben zu meistern.
Es ist nicht zuletzt die Musik, genauer gesagt eine Platte von Caruso, durch die Arno sprechen lernt, indem er – fasziniert von der Stimme des Sängers – die Arien «nachahmt». Etwas später und vermittelt durch den Großvater wird es Maria Callas sein, der er nicht nur persönlich begegnet, er wird gar ihr Meisterschüler. Sie weist ihm den Weg zur Musik – und damit zu einem selbstbestimmten Leben.
Von diesem Leben erzählt Arno Stocker. Und das in einer unnachahmlichen Manier; weder larmoyant noch überheblich, sondern direkt und schnörkellos. Er erzählt von den Höhen und Tiefen, von Erfolgen und Rückschlägen. Selbstzweifel plagten ihn, und Widerstände – nicht zuletzt wegen seiner Behinderung – gab es genug, die oft unter Aufbietung aller Kräfte überwunden werden mussten.
Lang und beschwerlich war der Weg zur Musik, zum «Klavierflüsterer», zu einem Mann, der mit Horowitz und anderen Größen der Musikgeschichte arbeitete, sich als Restaurator einen Namen machte und selbst einen neuartigen Konzertflügel konstruierte, und der wie kein anderer viel von Musik und alles von Klavieren und Flügeln verstand. Auf diesem Weg versuchte er sich zwischenzeitlich in anderen Berufen (einfach um zu überleben), er gerät in die Schuldenfalle und ins Gefängnis, verdiente Unsummen und verlor sie wieder. Zwischendurch hat er bei Erika Köth Gesang studiert. Er war bei den Opernfestspielen in München engagiert und verkaufte und restaurierte Klaviere in Amerika.
Persönliches Glück war ihm kaum beschieden. Mehrere Ehen zerbrachen. Sesshaft wurde er kaum. Nicht nur wegen seines Berufes, der ihn immer wieder an andere Orte zwang, bewegte sich sein Leben geografisch zwischen den Welten. All das aber waren nur «Begleitumstände» eines Lebens, das ganz der Faszination «Musik» untergeordnet war.
Am Ende hat Stocker, zurück in München und inspiriert von Fischer-Dieskaus Interpretation der vier letzten Lieder von Brahms, auch den Weg zu Gott gefunden. Von nun an bilden «Liebe, Glaube, Hoffnung… die Anker in meinem Leben. Die Liebe zur Musik, der Glaube an das Gute. Die Hoffnung, noch viel Zeit zu haben, das, was mir Gutes passiert ist, an Menschen weiterzugeben und sie zu ermutigen, an ihren Zielen festzuhalten». Letzteres wird mit diesem Buch sicher gegeben sein.

Die Lebenserzählung «Der Klavierflüsterer» ist die faszinierende Geschichte des Arno Stocker, der mit geschädigtem Gehirn, mit verrenkten Gliedern und fast blind auf die Welt gekommen ist. Ein Buch über die Macht der Musik - und eine großartige Vision, die Stocker gegen alle Vernunft zum weltbekannten «Klavierflüsterer» werden lassen.
So erzählt diese großartige Lebensgeschichte von der Macht der Musik. Und von der Macht einer Vision, der zu folgen alle Widrigkeiten und Widerstände überstehen lässt. So ist auch Arno Stockers Biografie am Ende eine wunderbare Erfolgsgeschichte, eben die «wahre Geschichte eines unwahrscheinlichen Lebens»: spannend und faszinierend. ■
Arno Stocker: Der Klavierflüsterer – Die wahre Geschichte eines unwahrscheinlichen Lebens, 317 Seiten, Kailash Verlag, ISBN 978-3-424-63027-5
.
.
.
.
V. Gebhardt:«Lese und höre – Orte der Dichtung und Musik»
.
Auf den Spuren des genius loci
Günter Nawe
.
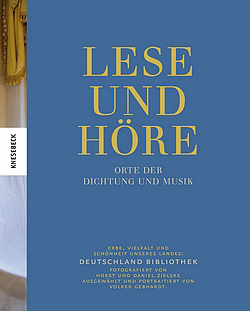 Genius loci ist einer der Begriffe, die immer dann verwendet werden, wenn man den Einfluss von Orten, Häusern und Landschaften unter anderem auf Schriftsteller, Musiker und Philosophen und ihre Werke beschreiben will. Und in der Tat, vielfach hat man eigene Erfahrungen damit gemacht, was das Goethe-Wort bedeutet: «Wer den Dichter will verstehen, muss in Dichters Lande gehen».
Genius loci ist einer der Begriffe, die immer dann verwendet werden, wenn man den Einfluss von Orten, Häusern und Landschaften unter anderem auf Schriftsteller, Musiker und Philosophen und ihre Werke beschreiben will. Und in der Tat, vielfach hat man eigene Erfahrungen damit gemacht, was das Goethe-Wort bedeutet: «Wer den Dichter will verstehen, muss in Dichters Lande gehen».
Nicht immer aber kann man reisen. So ist es oft ein Buch, das dem neugierigen, dem interessierten Leser hilft «zu verstehen». Ein solches Buch ist der opulente Band «Lese und höre» aus der «Deutschland-Bibliothek» des Knesebeck-Verlages. In ihm werden Orte der Dichtung und Musik in Text und Bild vorgestellt. Orte, die zu den schönsten und bedeutendsten unserer Kultur und Kulturlandschaft gehören.
Im Kontext zu den biografischen Daten finden wir einfühlsame Chrakteristika der Häuser und Räume, in denen zum Beispiel Theodor Storm gelebt und gearbeitet hat, in der «grauen Stadt am grauen Meer», in Husum also. Wir lernen das Lessing-Haus in Wolfenbüttel ebenso kennen wie die pompöse Villa Wahnfried, Richard Wagners langjährige Wirkungsstätte. Wir sind sozusagen bei Bert Brecht und Helene Weigel im Sommerhaus am Scharmützelsee «zu Gast», wandern mit Theodor Fontane durch das Ruppiner Land, treffen den Weltbürger Georg Friedrich Händel in Halle/Saale und den großen Johann Sebastian Bach – natürlich in Leipzig. Selbstverständlich auch Goethe und Schiller und…

Genius loci der «Götter-Dämmerung» und des «Parsifal»: Die Villa «Wahnfried» des Dichters und Musikers Richard Wagner
Ihren eigenen genius loci haben nicht nur Wohnhäuser und Arbeitszimmer, sondern auch zum Beispiel Bibliotheken und Konzerthäuser. Das gilt für die Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel und den Philosophenweg in Heidelberg, diese herrliche Promenade mit Schlossblick, ebenso wie für das Gewandhaus in Leipzig, die Semperoper in Dresden, die Berliner Phiharmonie, das Opernhaus in Bayreuth und das Beethoven-Haus in Bonn – um nur einige zu nennen. Hier mag sich der Leser selbst auf Entdeckungsreise begeben.

«Lese und höre – Orte der Dichtung und Musik» ist ein opulenter Text- und Bildband, der den Leser zu bedeutenden Orten der Dichtung und Musik in Deutschland begleitet und mit eindrucksvollen Fotos zum «Lies und höre» verführt.
«Dieser Band geht den Spuren der Dichtung und Musik in Deutschland nach», so Volker Gebhardt, der die kluge und gelungene Auswahl vorgenommen und die informativen Porträts geschrieben hat, in seiner Einleitung. Die bestechend schönen Fotos sind von Horst und Daniel Zielske. Sie bestehen sowohl für sich allein als auch als illustrative Ergänzung zum Text.
Schönheit und Vielfalt des Landes in seiner dichterischen und musikalischen Ausprägung sind also in diesem Band zu finden. Augenlust und Leselust werden auf das beste bedient. Und Anregungen, sich mit dem dichterischen und musikalischen Erbe zu beschäftigen, finden sich in Hülle und Fülle. Das Buch entführt – und verführt. ■
Volker Gebhardt / Horst & Daniel Zielske: Lies und höre – Orte der Dichtung und Musik, 190 Seiten, zahlreiche Abb., Knesebeck Verlag, ISBN 978-3-86873-268-9
.
.
.
Bernhard Strobel: «Nichts, nichts»
.
Die karge Welt der Verlierer
Günter Nawe
.
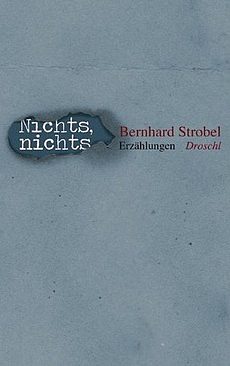 Schnörkellos, beinahe minimalistisch lesen sich die Geschichten des Bernhard Strobel. Und sind gerade deshalb sehr intensiv und nachhaltig. Der junge Skandinavist aus Wien, Jahrgang 1982, hat bereits mit seinem ersten Erzählband «Sackgasse» auf sich aufmerksam gemacht – und bestätigt das positive Urteil der Kritik mit dem jetzt vorliegenden Band «Nichts, nichts».
Schnörkellos, beinahe minimalistisch lesen sich die Geschichten des Bernhard Strobel. Und sind gerade deshalb sehr intensiv und nachhaltig. Der junge Skandinavist aus Wien, Jahrgang 1982, hat bereits mit seinem ersten Erzählband «Sackgasse» auf sich aufmerksam gemacht – und bestätigt das positive Urteil der Kritik mit dem jetzt vorliegenden Band «Nichts, nichts».
Strobel beherrscht die Kunst des Weglassens, sodass am Ende nur noch das Wesentliche bleibt. Schließlich geht es in seinen durchweg kurzen Erzählungen um Menschen, denen ohnehin nicht mehr viel geblieben ist als Obdachlosigkeit, Sprachlosigkeit und Lebenstristesse. Seine Figuren sind Außenseiter, die sich am Rande der Gesellschaft «eingerichtet» haben und auch daraus noch vertrieben werden – ins Nichts.
So in der Titelerzählung «Nichts, nichts». Es ist eine Momentaufnahme zweier Menschen, die sich nichts zu sagen haben, die Fragen haben und keine Antworten. Ein kleiner «Dialog» zwischen Markus und Lara mag das belegen:
«’Was war denn mit dir los?’ fragt sie. ‚Weiß nicht’, sagt er. Nach einer längeren Pause sagt sie: ‚Willst du darüber reden?’ ‚Es kommt ja sowieso nichts dabei raus.’»…
So geht es weiter bis zur ultimativen Aussage «Nichts, nichts». Der Leser weiß nicht, worüber sie überhaupt hätten reden sollen. Es ist alles gesagt, da es nichts zu sagen gibt.
Bernhard Strobels Figuren befinden sich – und das ist sarkastisch gemeint – durchweg «in guter Gesellschaft» – dies auch der Titel einer weiteren Erzählung. Es ist Weihnachten, als der Ich-Erzähler konstatiert: «Ich will nicht behaupten, dass ich es satt habe, zu leben; aber die Vorstellung, sozusagen meine letzte große Feierlichkeit zu begehen, erfüllte mich in den vergangenene Tagen immer häufiger mit einem Gefühl großer Wärme und Zufriedenheit.» Einundachtzig ist er, drei Scheidung hat er hinter sich, einen Wohnungsbrand verursacht und zwei Töchter, bei denen er wechselweise Wehnachten verbracht hat. Dann aber bekommt die Geschichte einen ganz anderen Drive.
So also gibt es Erzählungen mit einem guten Ende und Geschichten mit einem bösen Ende. Und alle bleiben irgendwie unvollendet, sodass der Leser sie weiterdenken kann oder muss.

Der österreichische Autor Bernhard Strobel hat in seinem neuen Prosaband «Nichts, nichts» Erzählungen vorgelegt, die von außerordentlicher Kunstfertigkeit sind, wie wir sie heute in der Literatur nur noch ganz selten finden.
Strobel schildert lakonisch die karge Welt der Verlierer. Manchmal wütend und dann wieder voller grimmiger Komik. «Du machst es einem nicht gerade leicht», ist einer der Sätze, die Strobel nicht nur zu einer Figur sagt. Auch der Leser könnte diesen Satz sagen. Nein, leicht macht es Strobel, machen es seine Protagonisten dem Leser nicht. Das ist aber auch letztlich nicht Aufgabe von Literatur.
Dieser Erzählband nimmt den Leser mit in eine Welt der Verzweifelten, der Verweigerer, in eine Welt derer, die in ihr keinen Sinn mehr sehen. Und meist «geschieht» dann bei der Lektüre auch mit dem Leser etwas. Etwas, was ihn berührt, was ihn lehrt zu verstehen. Strobels Erzählungen sind zudem von einer Kunstfertigkeit, wie wir sie heute kaum noch zu lesen bekommen – und deshalb außergewöhnlich.
Bernhard Strobel ist also ein großartiger Erzähler, der sich Zeit lässt mit dem, was er zu sagen, zu erzählen hat. Umso wertvoller ist das Ergebnis. Und umso höher sind die Erwartungen an das nächste Buch. Es soll ein Roman werden… ■
Bernhard Strobel: Nichts, nichts – Erzählungen, 116 Seiten, Literaturverlag Droschl, ISBN 978-3-85420-766-5
.
.
Roland Heer: «Fucking Friends»
.
Auf ganzer Linie gescheitert
Günter Nawe
.
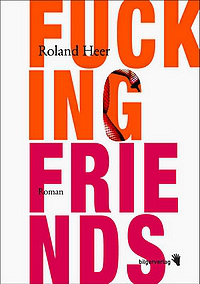 Manches macht viel Mühe – und ist ihrer letztlich doch nicht wert. Das gilt hier und jetzt für das Buch des Bergsteigers und Deutschlehrers Roland Heer, der mit «Fucking Friends» seinen Debütroman abgeliefert hat – und damit auf der ganzen Linie gescheitert ist.
Manches macht viel Mühe – und ist ihrer letztlich doch nicht wert. Das gilt hier und jetzt für das Buch des Bergsteigers und Deutschlehrers Roland Heer, der mit «Fucking Friends» seinen Debütroman abgeliefert hat – und damit auf der ganzen Linie gescheitert ist.
Der Anfang dieses Romans ist noch einigermaßen nachvollziehbar. Während der Extrembergsteiger Greg wieder einmal und gegen den Willen seiner jungen Familie auf dem Wege zum Gipfel eines Siebentausenders ist, kommen seine Frau und sein kleine Tochter bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Dies bedeutet für Greg den Absturz in eine tiefe Depression. Soweit, so gut! Und vielleicht hätte daraus eine richtig gute Geschichte werden können.
Doch bei Roland Heer bekommt die Sache einen ganz anderen Drive. Zwar wird am Anfang noch ein wenig Psychologie bemüht. Doch Greg, Anfang 40 und Comic-Zeichner, versucht, seinem Schmerz beizukommen, indem er sich bald in ein exzessives Sexualleben stürzt. Und hier wird der Roman in höchstem Maße peinlich, unappetitlich und damit die Lektüre zum Ärgernis.
Greg, wie ein Spätpubertierender, verlegt sich auf Kopulationsakrobatik jeglicher Art. Frauen (von Liebe, selbst von Zuneigung kann keine Rede sein) sind nur noch Objekte seiner sexullen Begierde. Und für diese Begierde findet er seine «Objekte» in der digitalen Welt der Kontaktmöglichkeiten. Greg unterliegt ohne auch einen Hauch von Widerstand den Verheißungen der Cyberwelt. Auf Porno-Sites, in Online-Single-Börsen und in Darkrooms findet er willfährige Partner(innen), seine fucking friends, die es ihm erlauben, seine sexuellen Obessionen auszuleben. Um den ultimativen Kick geht es – und auf den muss immer noch einer draufgesetzt werden. Und so weiter. Virtuell – bei Online Datings – und ganz real in irgendwelchen Betten wird gefickt und gevögelt, gekifft und gesoffen. Zitate, die dies in allen Einzelheiten belegen könnten, verbieten sich ob der Obszönität, sie mögen deshalb dem Leser erspart bleiben. Irgendwann landet Greg dann bei einer Heike, die genau so abgefuckt ist wie er selbst. Und am Ende ist er HIV-infiziert – und der Leser von alledem völlig abgestoßen.

«Fucking Friends» von Roland Heer aus dem BilgerVerlag ist ein miserables Buch, das viel verspricht und nichts hält. Simpler Porno, und zwar von der schmuddeligsten Sorte, aber immer schön unterm Mäntelchen der Selbstfindung. Vergessen!
Hier verfängt auch die Verlagswerbung für dieses Buch nicht, die einen «schonungslos offenen Blick» auf die entsprechenden Internet-Formate ansagt und damit einen sozial-kritischen Ansatz suggeriert. Nichts davon; dieses Buch ist schlichter und simpler Porno – und zwar miserabler – , der unter dem Mäntelchen der Selbstfindung, der Trauerarbeit und einer bescheidenen Gesellschaftsrelevanz daherkommt. Keine Literatur, sondern auch sprachlich unterste Schublade – eine Ansammlung von schmuddeligen, unappetitlichen Sexgeschichten übelster Art.
Und so hat es Mühe gemacht, diesen Roman überhaupt zu Ende zu lesen. Eine Mühe, die sich in keiner Weise gelohnt hat. «Fucking Friends» ist ein miserables Buch, das viel verspricht und nichts hält. Da hilft auch der Zitatenverweis, der alle oder viele große Namen der Weltliteratur enthält, nichts. Diese Autoren dürften sich in diesem Zusammenhang absolut unwohl fühlen.
So bleibt nur, vor der Lektüre des Romans «Fucking Friends» zu warnen – weniger der Moral wegen, allein schon aus Gründen der Ästhetik. ■
Roland Heer, Fucking Friends, 376 Seiten, BilgerVerlag Zürich, ISBN978-3-03762-011-3
.
.
.
Rolf D. Sabel: «Der Pompeji-Papyrus»
.
Der Monsignore und die Papyrus-Morde
Günter Nawe
.
 «Nein, sicher nicht die Welt-, aber die hier erzählte Geschichte wäre anders verlaufen, wenn Monsignore Dr. Peter Diefenstein an diesem Tage nicht gerade diesen Weg eingeschlagen hätte…». Genau das jedoch hat der Pfarrer der Kölner Basilika St. Pantaleon getan: in Pompeji. Was daraus geworden ist? Auf drei Erzählebenen wird eine Geschichte ausgebreitet – halb historischer Roman, halb Kriminalstory.
«Nein, sicher nicht die Welt-, aber die hier erzählte Geschichte wäre anders verlaufen, wenn Monsignore Dr. Peter Diefenstein an diesem Tage nicht gerade diesen Weg eingeschlagen hätte…». Genau das jedoch hat der Pfarrer der Kölner Basilika St. Pantaleon getan: in Pompeji. Was daraus geworden ist? Auf drei Erzählebenen wird eine Geschichte ausgebreitet – halb historischer Roman, halb Kriminalstory.
Da gibt es einmal den Briefwechsel zwischen dem Römer Theophilos und dem Pompejaner Fronto; da gibt es zum anderen die Geschichte vom Untergang Pompejis am 24. August 79 n. Chr. – und es gibt die gefährlichen Abenteuer des katholischen Monsignore Diefenbach und seines protestantischen Freundes Bassler.
Der Autor Rolf D. Sabel, unter anderem Lateinlehrer an einem Kölner Gymnasium, hat sich – nicht zum ersten Mal – an einen historischen Stoff gewagt. Mit den Romanen «Die Pilatus-Verschwörung» und «Agrippinas Geheimnis» hat er sich bereits eine ansehnliche Lesergemeinde erschrieben. So bleibt er auch mit dem «Pompeji-Papyrus» dem Genre treu, wobei allerdings der kriminalistische Aspekt überwiegt.
Was macht den Aufenthalt in Pompeji für die beiden geistlichen Freunde so gefährlich? Ein Papyrus aus dem 1. Jahrhundert nach Chr. – erstanden für zehn Euro von einem Jungen auf den Straßen von Pompeji nuova – erweist sich nicht nur als echt, sondern auch als Auslöser verzwickter Verwicklungen. Gauner und Ganoven sind dahinter gekommen, dass hier etwas zu holen ist. Der Vatikan ist plötzlich an der Geschichte interessiert, geht es doch auch um Dokumente, die die Kirchengeschichte betreffen. In Amerika wird ein schwerreicher Kunstsammler auf die Funde aufmerksam und schickt einen skrupellosen Helfeshelfer nach Pompeji. Die beiden Geistlichen werden Zeugen eines Mordes und desselben verdächtigt. Dem Verdacht folgt eine etwas bieder und schlicht inszenierte Flucht der beiden ökumenischen Brüder. Diefenstein wird gefasst, kommt ins Gefängnis, wird am Ende entlastet und kehrt nach Köln zurück. Ende gut, alles gut? Mitnichten. Es kommt noch einmal zu einem gefährlichen Showdown…

Der Autor hat in «Der Pompeji-Papyrus» den Untergang Pompejis, den Brand von Rom und die ersten Christenverfolgungen mit einer neuzeitlichen Kriminalhandlung verknüpft, in deren Mittelpunkt zwei geistliche Herren unterschiedlicher Konfession stehen. Ein bisschen viel auf einmal – und deshalb nicht gerade miss-, aber auch nicht sehr gelungen.
In «Rückblenden» erzählt Sabel die Geschichte der Papyri, die in der Bibliothek des Fronto, eines frühen Christen (siehe auch die Briefe des Theophilos), lagerten. Fronto kommt natürlich wie die gesamte Bevölkerung bei dem berühmten Vulkanausbruch ums Leben. Seine Bibliothek aber…. Zu Anfang des 3. Jahrtausends sollte ihr wieder große Bedeutung zukommen – im Roman von Rolf D. Sabel.
Zu den «Rückblenden» gehören auch die Briefe des Theophilos an den pompejanischen Freund Fronto. Sie erzählen von den ersten Christen in Rom, von Petrus und Paulus und den Evangelisten Markus und Lukas; vom machthungrigen Kaiser Nero, dem Brand von Rom im Jahre 64 n. Chr. und von den Christenverfolgungen.
Das ist vom Autor alles sehr gut gemeint – aber ein wenig zuviel gewollt. Für die eigentliche Geschichte der Papyrus-Funde sind die Briefe von nur geringem Interesse. Eher lenken sie ab. Vom Leben im alten Pompeji dagegen hätte man sich mehr gewünscht. Und die Krimigeschichte ist doch zu durchsichtig, als dass größere Spannung aufkommen könnte.
«Aut prodesse volunt aut delectare poetae», zitiert Rolf D. Sabel den guten alten Horaz. Dichter wollen also entweder nützen oder unterhalten. Sabel wollte nach eigener Aussage beides. Und das ist zwar nicht unbedingt miss-, aber auch nicht sehr gelungen. ■
Rolf D. Sabel, Der Pompeji-Papyrus, Roman, 264 Seiten, SCM Hänssler Verlag, ISBN 978-3-7751-5266-2
.
.
.
Ricardo Piglia: «Ins Weiße zielen»
.
Annalen der Boshaftigkeit und Verleumdung
Günter Nawe
.
 Wer hat Tony Durán ermordet? Die klassische Frage, auf die normalerweise und mit großer Selbstgewissheit Kriminalromane eine Antwort geben. Eine solche Antwort hat auch Ricardo Piglia. Aber welche? Der 1941 geborene argentinische Autor – er zählt zu den bedeutendsten argentinischen Schriftstellern – hat einen Krimi vorgelegt, der eigentlich keiner ist. Oder anders: der das Genre des Kriminalromans sprengt.
Wer hat Tony Durán ermordet? Die klassische Frage, auf die normalerweise und mit großer Selbstgewissheit Kriminalromane eine Antwort geben. Eine solche Antwort hat auch Ricardo Piglia. Aber welche? Der 1941 geborene argentinische Autor – er zählt zu den bedeutendsten argentinischen Schriftstellern – hat einen Krimi vorgelegt, der eigentlich keiner ist. Oder anders: der das Genre des Kriminalromans sprengt.
Mord in der Pampa also. Kommissar Croce begibt sich auf die Suche nach dem Täter. Der windige Staatsanwalt Cueto dagegen glaubt ihn bereits zu haben. Zwei Schwestern hatten sehr engen Kontakt mit dem Mordopfer Durán, das ebenfalls eine zwielichtige Rolle spielte. Der kleine Japaner, ein Nachtportier, wird eingesperrt. Ein Jockey liebt sein Pferd mehr als sein Leben. Und der Kommissar nimmt sich eine «Auszeit» im Irrenhaus. Auch der Journalist Rienzi hat eine Theorie und recherchiert auf seine Weise.
Da gibt es aber auch noch die Familie Belladonna, Land- und Fabrikbesitzer mit etwas eigenartigem Geschäftsgebaren. Was hat der Chef mit dem Mordopfer zu tun? Geht es um Spekulation oder Liebe? Piglia hat alle Versatzstücke, die zu einem Krimi gehören, in dieses Buch hineingepackt – und sie so miteinander verknüpft, dass am Ende nichts ist, wo es scheint. Aber «alles ist so, wie wir es kennen, bevor wir es sehen». Und die wesentlichen Fragen werden woanders gestellt und beantwortet. Und so entstehen quasi «Annalen der Boshaftigkeiten und Verleumdungen in der argentinischen Pampa».
Denn dieses Buch ist eine großartige Beschreibung der argentinischen Wirklichkeit in den siebziger Jahren: Bodenspekulation, verbrecherischer Aktienhandel, korrupte Justiz – und alles in der Erwartung der Rückkehr von Perón. Eine Gesellschaft, in der der Einzelne sich nur schwer zurecht finden kann. Man lebt in einer Kultur, die längst «nicht mehr weiß, was Wahrheit» ist. «Die Geschichte der argentinischen Politik bewege sich auf Bodenhöhe, während alle übrigen Ereignisse in der Höhe vorbeizögen, wie ein Schwalbenschwarm, der im Winter fortzieht», heißt es an einer Stelle.

Bodenspekulation, verbrecherischer Aktienhandel, korrupte Justiz, Folter, Terror, Diktatur: Argentinische Terror-Opfer in den Siebzigern (Prozess-Video vimeo)
Luca, Sproß der Fabrikantenfamilie Belladonna, die den Ruin ihres Unternehmens erleben muss, weiß die Wahrheit. Er bringt den «Mut auf, sich seinem Traum zu stellen», den Traum einer Künstlerexistenz. Hunderttausend Dollar sind geblieben, sollen als Hypothek für das Fabrikgelände dienen. Sie liegen bei der Staatsanwaltschaft und werden nur freigegeben, wenn der Japaner verurteílt wird. Von Luca hängt es ab. Seine Aussage wider besseres Wissen macht ihn schuldig. Er bekommt das Geld, muss aber mit der Schuld einer Falschaussage und den Konsequenzen leben – und kann es letztlich nicht.
Dies alles zusammen ergibt ein Bild der argentinischen Gesellschaft und eröffnet zudem tiefe Einblicke in die Seelnlage der Figuren: vom vegetarischen Gaucho über den Matetrinker mit den literarischen Interessen zum korrupten Staatsanwalt; von den Opfern der Gesellschaft bis zu ihren Tätern. Von Croce, der ehrlichen Haut, bis zur Renzi, dem Journalisten auf der Suche nach der Exklusivstory. Piglia bietet faszinierende Psychogramme.

Ricardo Piglia erzählt von einem Mord in der Pampa, hinter dem sich ein Stück argentinischer Geschichte und ein Psychogramm der argentinischen Gesllschaft verbirgt. Ein hervorragend konstruierter Roman, sprachlich brillant und von außerordentlicher Tiefe – ein Meisterwerk.
So komplex wie die Geschichte und so facettenreich und unterschiedlich wie die handelnden Figuren ist auch das Buch. Alles zielt ins Weiße, um den Romantitel aufzunehmen, ins Zetrum der Dinge. Ricardo Piglia erzählt davon auf mehreren Ebenen, bemüht gekonnt die Philosophie und die Psychologie, verknüpft die verschiedenen Theorien miteinander, um dann den Knoten wieder zu lösen. Er hat einen hervorragend konstruierten Roman geschrieben, sprachlich brillant und von außerordentlicher Tiefe. Es wechseln «die Wörter ständig ihren Ort und erlaubten ganz unterschiedliche, zur selben Zeit simultane wie aufeinanderfolgende Lesarten der Sätze».
Die Mutter der Belladonna-Schwestern hat alles gelesen, was ihr an Weltliteratur in die Hände kam. «Nur argentinische Schriftsteller liest sie nie, sie sagt, die Geschichten würde sie schon alle kennen». Und weil das für uns nicht gilt, sollten wir das Meisterwerk von Ricardo Piglia lesen. ■
Ricardo Piglia, Ins Weiße zielen, Roman, 252 Seiten, Wagenbach Verlag Berlin, ISBN 9783803132321
.
.
Alan Pauls: «Geschichte der Tränen»
.
«Zuhören, weinen, in seltenen Fällen auch reden»
Günter Nawe
.
 Argentinien ist in diesem Jahr Gastland der Frankfurter Buchmesse. Argentinien feiert zugleich 200 Jahre Unabhängigkeit. Geschichte und Literatur also in einem. Und eine Reihe prominenter argentinischer Schriftsteller weiß sich mit ihren Werke beidem verpflichtet: der Literatur und der Geschichte.
Argentinien ist in diesem Jahr Gastland der Frankfurter Buchmesse. Argentinien feiert zugleich 200 Jahre Unabhängigkeit. Geschichte und Literatur also in einem. Und eine Reihe prominenter argentinischer Schriftsteller weiß sich mit ihren Werke beidem verpflichtet: der Literatur und der Geschichte.
Einer der wichtigsten Autoren Argentiniens ist sicher Alan Pauls. Der 1959 geborene Journalist, Schriftsteller und Dozent für Literaturgeschichte hat in Deutschland mit seinem Roman «Die Vergangenheit» großes Interesse und viel Lob bei Kritikern und Lesern gefunden. Große Aufmerksamkeit und Begeisterung gilt jetzt auch dem neuen Roman «Geschichte der Tränen».
Pauls erzählte eine der wichtigsten Episoden in der Geschichte seines Heimatlandes. Es geht im Wesentlichen um das Regime Videla und die Gegenrevolution der Gewerkschaften in den 70er Jahren. Und es geht um die «Empfindsamkeit», die diese Aktivitäten deutlich werden lassen. Zum Beispiel bei einem hypersensiblen jungen Mann, der Hauptfigur, die als Kind Superman liebt. Allerdings nicht wegen seiner Stärken, sondern wegen seiner Schwächen. Diese Sensibilität hat ihren Preis. So hat der Protagonist, der sonst viel geweint hat, nach der Fernsehübertragung des Putsches gegen Allende in Chile, keine Tränen mehr. Dafür lernt er im Lauf der Zeit zu verstehen, was es auch mit der Diktatur in seinem Lande auf sich hat.
Das alles geschieht in diesem Roman in Form einer Art Entwicklungsgeschichte, in der der jungen Mann, namenlos und damit stellvertretend, vom «Superman» zum Sozialisten wird. «Schwülstige Menschlichkeit» stösst ihn ab, er verachtet seinen Vater, verlässt seine Freundin und findet seine Berufung. Aus Schwäche wird Stärke.
So erlebt der Held aus der Ortega-y-Gasset (der Name dieser Straße ist ein Stück Programm) im Zentrum von Buenos Aires, wo er mit der geschiedenen Mutter und seinen Großeltern wohnt, seine Geschichte: Er ist ein Einzelgänger, ein Individualist, der die Geschichten von Superman sich zu eigen macht, der ganz in seiner «Empfindsamkeit» aufgeht, der sich in der Kunst des Weinens – vorerst noch – übt. «Zuhören, weinen, in seltenen Fällen auch reden» – so sein Motto. Sein Medium ist das Ohr. Und weil dem so ist, wird er zum Ansprechpartner für alle und jeden; für seine Eltern, für Menschen mit Liebesäffaren und verunglückten Lebensträumen. Denn mitten im Lärm und den Wirrnissen der Politik und ihrer fatalen Erscheinungen, die ihm keinesfalls entgehen, kommt auch immer wieder das Private, das Persönliche zum Ausdruck.
Dem komplexen Geschehen, den sehr differenzierten Wahrnehmungen entspricht die Sprache Alan Pauls, eine Sprache, die an Marcel Proust geschult ist. Es sind monologisch erzählte Episoden, es sind verschiedene «Stimmen», mal laut mal leise, die erzählen. So auch von den Folterungen in den Gefängnissen mit Langzeitfolgen. Der «Zuhörer» bemerkt eine Narbe: «…und plötzlich bleibt sein Blick an der schimmernden Stelle hängen, einer Lichtung, wo sich die Haut zur glatten Oberfläche ohne Poren, ohne Haare, ohne Unregelmäßigkeiten spannt…». Folter, Schmerz, Leid allenhalben.
Gibt es in diesem Leben außer Schmerz auch Glück? Der Held findet es. Und als er zeigt, wer sein Glück ist und wie es aussieht, erhält er prompt eine Warnung, dass dieses Glück nur deshalb so ist, wie es ist, «…weil du nie an ein Bettgestell gefesselt warst, während zwei Typen dir die Eier verkohlen». Dies und das ist bitterböse, ist erschreckend und – wenn man so will – auch eine Anklage mit den Mitteln der Literatur.

Dieser Roman ist vieles zugleich, vor allem aber ein beeindruckendes Psychogramm eines Individualisten - und erschreckendes Zeitzeugnis.
Schmerz und Leid, Öffentliches und Privates sind in diesem Roman thematisiert. Biografie und Zeitgeschichte sind miteinander verwoben. Und das auf eine wunderbar kunstvolle, literarisch bedeutende Art und Weise. Ein großer, ein bedeutender Roman. ■
Alan Pauls, Geschichte der Tränen, Roman, 140 Seiten, Klett-Cotta Verlag, ISBN 978-3-608-93710-7
.
.
.
Michael Kleeberg: «Das amerikanische Hospital»
.
Von geschundenen Seelen
Günter Nawe
.
 Er stand auf der Longlist der Vorschläge zum Deutschen Buchpreis 2010, hat es aber leider nicht in die Shortlist der sechs vermeintlich besten Romane dieses Jahres geschafft. Das ist zu bedauern. Denn Michael Kleeberg gehört zweifelsfrei zu den bedeutendsten deutschen Autoren der Gegenwart – und der neue Roman «Das amerikanische Hospital» zu den wichtigsten und schönsten Neuerscheinungen.
Er stand auf der Longlist der Vorschläge zum Deutschen Buchpreis 2010, hat es aber leider nicht in die Shortlist der sechs vermeintlich besten Romane dieses Jahres geschafft. Das ist zu bedauern. Denn Michael Kleeberg gehört zweifelsfrei zu den bedeutendsten deutschen Autoren der Gegenwart – und der neue Roman «Das amerikanische Hospital» zu den wichtigsten und schönsten Neuerscheinungen.
Kleeberg, bereits vielfach preisgekrönt, hat sich vor allem mit Titeln wie «Der König von Korsika» und «Karlmann» einen Namen gemacht. Außerdem ist er als hervorragender Übersetzer bekannt. Zum Beispiel von Marcel Prousts «Combray» und «Eine Liebe Swanns» – beide allerdings eher brillante «Nachdichtungen».
Jetzt also «Das amerikanische Hospital», ein Buch, in dem Kleeberg sehr eindringlich Zeitgeschichte und Privatgeschichte miteinander verbindet, tief in die Seelen seiner Protagonisten eintaucht, sozusagen mit dem literarischen Seziermesser die verschiedenen Schichten offenlegt.
Paris 1991. In der Empfangshalle eines amerikanischen Hospitals treffen sich Hélène und David. Sie, französische Mittelschicht, möchte sich per In-vitro-Fertilisation einen langgehegten Kinderwunsch erfüllen. Er, amerikanischer Soldat, ist wegen seiner Traumata und Panik-Attacken, die er aus dem ersten Irak-Krieg davongetragen hat, in psychiatrischer Behandlung.
Sensibel und sehr eindringlich schildert Michael Kleeberg die Ännäherung dieser beiden Menschen. Er erzählt von den Erfolgen und Misserfolgen ihrer «Behandlungen». Die kontrapunktische Anlage des Buches ermöglicht es dem Leser, sich von verschiedenen Seiten her dem Thema Kleebergs zu nähern: Der Fragwürdigkeit technischer, politischer und bürokratischer Faktoren auf das Leben des Individuums im 20. Jahrhundert.
Hélène unterzieht sich immer wieder der technisch-nüchternen Prozedur, die die Reproduktionsmedizin bietet, um sich den Kinderwunsch zu erfüllen. Und jedesmal erfolgt auf die Hoffnung die Enttäuschung. «A bloody mess» – ein tragisches Erlebnis folgt auf das nächste. Die seelischen Folgen sind unübersehbar.
David, Literatur- und Lyrikfan und Soldat, leidet an den seelischen Beschädigungen, die seine Teilnahme am ersten Irak-Krieg hervorgerufen haben. Posttraumatische Belastungsstörungen nennt man das. Einfacher gesagt: Es sind die Bilder, die sich ihm eingebrannt haben – von den Ibissen, die eine Öllache mit einem See verwechseln und elendiglich zu Grunde gehen. Oder von den Kindern, die in Basra von einer Bombe zerfetzt werden. «A bloody mess» auch hier und für ihn.

Ein fesselnder Roman, der den Leser im wahrsten Sinne des Wortes mitnimmt; atmosphärisch dicht und sprachlich brillant. Große Literatur, die eindringlich von Individuen erzählt, die Zeitgeschichte nicht nur erleben, sondern an sich selbst erfahren.
Sie möchte neues Leben schaffen; er in ein neues Leben zurückfinden. Auf dieser Ebene finden sie sich, kommen sie sich näher. Kleeberg, brillanter Erzähler, der er ist, schildert auf sehr präzise Weise diese Erlebnisse und Vorkommnisse. Vor allem aber sind es Hélène und David, die sich nach und nach davon erzählen: Von ihrem Leben, von der Literatur, die sie beide kennen und lieben, und von sich selbst und ihren geschundenen Seelen – und auf diese Weise eine Therapie absolvieren, die erfolgreicher ist als jene der Ärzte des amerikanischen Hospitals. Eine «Objektivierung» des Erzählten erfolgt quasi durch eine dritte Person in diesem «Zweipersonenstück», durch den eigentlichen Erzähler, der am Ende so etwas wie ein Resumee zieht, wenn er von den Briefen erzählt, die sich Hélène und David geschrieben haben – und von der Trennung Hélènes von ihrem Mann.
Die ausgezeichneten Dialoge zwischen Hélène und David, in denen sich ihr Innenleben darstellt, korrespondieren mit der Außenwelt, den Bildern, die Kleeberg von den Spaziergängen der beiden durch Paris, durch den Hospitalpark, über den Père Lachaise zeichnet. Auch diese Bilder heilen. Und wenn sich am Ende beide zwar näher gekommen sind, sich aber dann doch trennen, so geschieht das irgendwie versöhnt – mit ihrem Schicksal, mit sich selbst und ein wenig auch wieder mit der Welt. ■
Michael Kleeberg: Das amerikanische Hospital, 232 Seiten, Deutsche Verlags-Anstalt, ISBN 978-3-421-04390-0
.
.
.
Isabelle Stamm: «Schonzeit»
.
«Die Welt begann sich langsamer zu drehen»
Günter Nawe
.
 Nein, es gibt keine «Schonzeit» für die Liebe und schon gar keine im Leben überhaupt.
Nein, es gibt keine «Schonzeit» für die Liebe und schon gar keine im Leben überhaupt.
Bis Miruna Lupescu, Schweizerin mit rumänischen Vorfahren, zu dieser Erkenntnis kommt, lebt sie einsam und zurückgezogen, hat lediglich Kontakt zu ihrer Schwester. Ab und an schleicht sich ein Liebhaber nachts bei ihr ein. Drogen versetzen sie zwischendurch in eine lethargische Unwirklichkeit. Ansonsten geht das Leben an ihr vorbei. So gibt es für die junge Frau fast keine Außenwahrnehmung – und niemand findet Zugang zu ihrem Inneren.
Die junge Schweizer Autorin Isabelle Stamm hat 2008 mit dem Roman «Zwillings Welten» auf sich aufmerksam gemacht und bereits mehrere Auszeichnungen erhalten. Dass sie die verdient hat, beweist sie nun mit ihrem zweiten Roman «Schonzeit».
Das «Leben» oder was auch immer kommt zu Miruna in Form von Briefen, die sie aus dem Rumänischen übersetzen soll. Briefe, die sie auf seltsame Weise anrühren und beschäftigen, obwohl sie weder Briefschreiber, Gabriel Alexandru, noch Adressaten kennt. Haben sie doch etwas mit ihrer eigenen Geschichte zu tun. Auch sie kam aus Rumänien, ihrer Eltern sind nach dem Tod ihres dritten Kindes dahin zurück gekehrt.
So empfindet sie das, was sie übersetzt, auch als ein Stück eigener Familiengeschichte. Die andere, die übersetzte Familiengeschichte macht es möglich. Beide sind beinahe spiegelbildlich zu sehen. Auf jeden Fall möchte Miruna den Empfänger der Briefe kennen lernen. Mit Johann Tschanun, dem Enkel des Briefschreibers, hat sie plötzlich einen (Gesprächs-)Partner. Ihrer beider Lebens- und Familiengeschichten korrespondieren miteinander. Und ihre Kenntnis setzt bei beiden Erinnerungen frei.
So konnte sich Johann bisher nicht an seine Mutter erinnern, die ihn im Alter von drei Jahren verlassen hat. Ein traumatisches Erlebnis. Und Miruna ist nun auch in der Lage, ihre eigene Geschichte zu akzeptieren. «…die Welt begann sich langsamer zu drehen», aber «ich konnte ihr folgen».
Spannung erzeugt die Autorin durch häufige Perspektivwechsel. Mal lesen wir Briefe, mal Erzählungen und Gespräche. Und dies alles in Zeitsprüngen – ein kunstvolles Erzählgeflecht. Was für den Leser nach und nach offensichtlich wird, verschweigen die Liebenden – und das sind sie mittlerweile – voreinander: ihre tiefen Wunden und Verletzungen. So Miruna, die ebenfalls mit einem Trauma fertig werden muss: mit dem Tod ihres Bruders.

Isabelle Stamm erzählt in ihrem Roman «Schonzeit» zwei Familiengeschichten, die miteinander korrespondieren, und eine Beziehungsgeschichte, die sich daraus ergibt. Die Vielschichtigkeit des Plots, die Charakteristik der Protagonisten und das psychologische Einfühlungsvermögen der Autorin sowie sprachliches Feingefühl machen «Schonzeit» zu einem bemerkenswerten Buch.
Mit viel psychologischem Einfühlungsvermögen schildert Isabelle Stamm die Seelenproblamatik, für die es keine Lösung zu geben scheint. Es sei denn, es müsse eine katastrophale sein. Und so kommt es – nach dem Miruna ein weiteres und besonders furchtbares Geheimnis bei Johann entdeckt. Was bis jetzt Schonzeit war, ist aufgehoben. Die Wirklichkeit fordert anderes.Und so führt die schonungslose Konfrontation (vorerst) zur Trennung. Miruna lebt wieder in ihrer Isolation – in ihrem Turm von Einsamkeit und Gleichgültigkeit. Wird sie sich daraus wieder befreien können? Stärke wird gefragt sein; eine Stärke, die aus der Schwächer erwächst.
Äußerst vielschichtig ist dieser Roman. Die Charaktere der beiden Protagonisten sind komplex. Die Geschichte selbst manchmal etwas bemüht konstruiert, aber in sich sehr schlüssig. Auf jeden Fall ist Isabelle Stamm ein bemerkenswerter Roman gelungen. Leseempfehlung! ■
Isabelle Stamm, Schonzeit, Roman, 220 Seiten, Limmat Verlag Zürich, ISBN 978-3-85791-598-7
.
.
.
Peter Gülke: «Robert Schumann – Glück und Elend der Romantik»
.
«Was er bedeute und wolle»
Günter Nawe
.
 Das ist das Schöne an Gedenktagen, dass sie immer wieder Dichter, Denker, Maler oder Komponisten aus der Gefahr der Vergessenheit erretten oder neue und anders gewichtete Aspekte von Leben und Werk an das Licht einer interessierten Öffentlichkeit bringen. In diesem Jahr waren und sind es vor allem Komponisten wie Chopin, Mahler und Robert Schumann, die Aufmerksamkeit erregten und zu vielfältigen Würdigungen Anlass gaben und geben.
Das ist das Schöne an Gedenktagen, dass sie immer wieder Dichter, Denker, Maler oder Komponisten aus der Gefahr der Vergessenheit erretten oder neue und anders gewichtete Aspekte von Leben und Werk an das Licht einer interessierten Öffentlichkeit bringen. In diesem Jahr waren und sind es vor allem Komponisten wie Chopin, Mahler und Robert Schumann, die Aufmerksamkeit erregten und zu vielfältigen Würdigungen Anlass gaben und geben.
Eine sehr gewichtige neue Arbeit ist Robert Schumann gewidmet. Von ihr soll hier die Rede sein – und von seinem (aus der Fülle vieler «Wortmeldungen») herausragenden Biografen Peter Gülke.
Gülke, Kapellmeister, Musikwissenschaftler und Musikdirektor in Dresden und Weimar, ist eine Ausnahmeerscheinung sowohl als Musiker wie auch als Autor umfangreicher Musikliteratur. Und das eben bekommt seiner großen Biografie – oder soll man besser sagen: seinem biografischen Essay – besonders gut. «Robert Schumann – Glück und Elend der Romantik» ist deshalb auch keine chronologische Abfolge von Lebens- und Werkdaten, sondern eine thematisch gegliederte, musikologisch orientierte Arbeit.

«Innige Verbindung von Musik und Dichtung»: Die von Schumann gegründete «Neue Zeitschrift für Musik» (1834)
Wichtig erscheint Gülke, die große romantische Gestalt des Komponisten darzustellen, der zwischen kreativem Überschwang und dem Zwang zu schöpferischen Vollendung seiner Kompositionen zu sehen ist. «Unter den Großen war er der Ungeduldigste. Entweder gelingt etwas sofort, oder es gelingt nie – das war die Prämisse seiner Arbeit, ausgewiesen durch kaum glaubliche, nur Mozart und Schubert vergleichbare Geschwindigkeit und Sicherheit im Vollbringen» – so Peter Gülke.
Leidenschaftlich war dieser Robert Schumann, der am 8. Juni 1810 in Zwickau geboren wurde, der im Alter von 44 Jahren dem Wahnsinn verfiel und am 29. Juli 1856 in einer Nervenheilanstalt in Bonn-Endenich verstarb, in vieler Hinsicht. Eine Pianistenlaufbahn wegen eines ruinierter Fingers blieb ihm verwehrt. Stattdessen widmete er sich ausführlicher Lektüre von Jean Paul und E. T. A. Hoffmann, Hölderlin und Poe, sowie der Abfassung von beachtlichen und beachtete Musikkritiken. Und schließlich dem Komponieren.
Eine sehr genaue Zeittafel ist übrigens dem Buch von Gülke angefügt. Leben und Werk – auch hier wird es deutlich – ist bei Robert Schumann eng verflochten. Das zu analysieren und zu bewerten hat sich Peter Gülke zur Aufgabe gemacht – und diese hervorragend gelöst.
Klavierwerke, Lieder, Sinfonien, Opern und ein Requiem – vielseitiger und umfangreicher ging es kaum. Und das von einem wilden, kreativen, ja versoffenen Genie. Gülke: «Auf der einen Seite war er störrisch, hochfahrend und stolz. Aber auf der anderen Seite war er ebenso oft wahnsinnig, oft zerknirscht, tief enttäuscht und in unendliche Depressionen versunken. Das geht unglaublich stark hin und her bei ihm». So gegensätzlich wie der Mensch ist auch sein Werk. «Die Träumerei» und manche Lieder wurden und werden unter dem Rubrum «romantisch» gehört – trotz vieler artifizieller Eigenheit und Raffinessen.
Zum «romantischen» Schumann gehört natürlich die Ehe mit Clara Schumann, auch wenn diese Ehe alles andere als nur romantisch war. Wenn zwei geniale Künstler zusammenkommen, bringt das zwangsläufig Interessenkonflikte, die ausgelebt und ausgekämpft werden müssen. So auch bei Robert und Clara, der er in unzähligen Liedern permanent Liebeserklärungen macht. Robert Schumann war im wahrsten Sinne eine zerrissene Persönlichkeit. Und Gülke weiß das – und lässt es uns wissen. Glück und Elend der Romantik also am Beispiel des Robert Schumann.
Dies alles erzählt Peter Gülke – er ist schließlich Musikwissenschaftler – unter dem Gesichtspunkt des Werkverständnisses. Und so wird das immense Werk des Robert Schumann ausführlich interpretiert. Denn, so Schumann selbst: «Es affiziert mich alles, was in der Welt umgeht, Politik, Literatur, Menschen – über alles denke ich in meiner Weise nach, was sich dann durch die Musik Luft machen, einen Ausdruck suchen will.»
Gülke hat sich mit den musikalischen und vielen ästhetischen Aspekten auseinandergesetzt. Er war den vielen Einflüssen auf der Spur und hat sie gefunden.
Ein brillanter Essay, eine großartige Monografie. Peter Gülke hat die Persönlichkeit Robert Schumanns eloquent, sprachlich geschliffen, vor allem aber mit großer Sachkenntnis – sowohl was das Biografische als auch das Werk mit seinen vielen Facetten angeht – dargestellt.

Peter Gülke hat in seiner neuen Biographie die Persönlichkeit Robert Schumanns eloquent, sprachlich geschliffen, vor allem aber mit großer Sach- und Fachkenntnis dargestellt – sowohl was das Biografische als als auch das Werk und dessen viele Facetten angeht. Ein brillanter Essay!
Robert Schumann hat, wie Gülke schreibt, «ein geordnetes Haus hinterlassen». Und er zitiert den Komponisten: «Man hüte sich als Künstler, den Zusammenhang mit der Gesellschaft zu verlieren, sonst geht man unter wie ich.» Peter Gülke hat stellvertretend den «Zusammenhang mit der Gesellschaft», mit uns, den Lesern, wieder hergestellt. Und etwas erreicht, was Schumann verwehrt blieb. Dem Besucher Joseph Joachim hat Schumann am Ende «zugeraunt», «er müsse von Endenich weg, denn die Leute verstünden ihn gar nicht, was er bedeute und wolle.» Wie wahr! ■
Peter Gülke: Robert Schumann – Glück und Elend der Romantik, 268 Seiten, Paul Zsolnay Verlag, ISBN 978-3-552-05492-9
.
.
Robert Zimmer: «Arthur Schopenhauer» (Biographie)
.
Ein durchweg zweideutiges Leben
Zum 150. Todesjahr von Arthur Schopenhauer
Günter Nawe
.
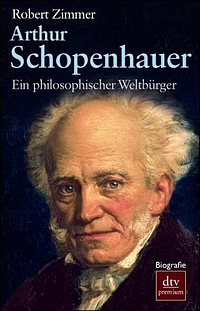 Rechtzeitig zum 150. Todesjahr des großen deutschen Philosophen Arthur Schopenhauer hat Robert Zimmer eine großartige Biografie vorgelegt. Für den promovierten Philosophen war und ist Arthur Schopenhauer nicht nur ein bedeutender Philosoph, er war der wohl einzige Philosoph, der ein umfassendes Verständnis hatte für Musik und Kunst und Literatur (Shakespeare und Goethe zum Beispiel), und der selbst ein exzellenter Schriftsteller war. Dies alles beschreibt Zimmer im Kontext zu den Lebensdaten und der Werk- und Wirkungsgeschichte Schopenhauers. Und das in einer Art und Weise, die auch dem nicht philosophisch geschulten Leser Gewinn verspricht und Freude machen wird, und ohne ins populärwissenschaftliche Genre abzugleiten.
Rechtzeitig zum 150. Todesjahr des großen deutschen Philosophen Arthur Schopenhauer hat Robert Zimmer eine großartige Biografie vorgelegt. Für den promovierten Philosophen war und ist Arthur Schopenhauer nicht nur ein bedeutender Philosoph, er war der wohl einzige Philosoph, der ein umfassendes Verständnis hatte für Musik und Kunst und Literatur (Shakespeare und Goethe zum Beispiel), und der selbst ein exzellenter Schriftsteller war. Dies alles beschreibt Zimmer im Kontext zu den Lebensdaten und der Werk- und Wirkungsgeschichte Schopenhauers. Und das in einer Art und Weise, die auch dem nicht philosophisch geschulten Leser Gewinn verspricht und Freude machen wird, und ohne ins populärwissenschaftliche Genre abzugleiten.
Denn es war für einen Denker und Gelehrten schon ein aufregendes Leben, das dieser 1788 in Danzig geborene Schopenhauer geführt hat. Eine Reihe von Lebensstationen gab es: Hamburg (hier erlernte er den Kaufmann-Beruf), Gotha und Weimar, Göttingen und Berlin, Rudolstadt und Dresden, und schließlich Frankfurt/Main. Dazu viele Reisen, schon als Kind mit Aufenthalten in Holland, England, Frankreich und der Schweiz. Später zwei Italienreisen. In Rudolstadt schrieb er seine Dissertation «Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde», Grundlage für sein späteres Hauptwerk «Die Welt als Wille und Vorstellung» (1818). In Weimar gab es dann die Auseinandersetzung mit Mutter Johanna und Schwester Adele, die mit einem unkittbaren Zerwürfnis endete. Mit Goethe, den er verehrte, hatte er Kontakt über die «Farbenlehre», der Schopenhauer allerdings selbstbewusst und überheblich eine eigene Schrift «Über das Sehn und die Farben» (1816) entgegenstellte. Ein «durchweg zweideutiges Leben» also. Am 21. September 1860 ist der Philosoph Arthur Schopenhauer in Frankfurt/Main gestorben.
Zimmer versteht es, alle diese Ereignisse korrespondieren zu lassen mit den Anschauungen dieses gern als pessimistisch, misanthropisch und frauenfeindlich apostrophierten Einzelgängers mit dem Pudel, der allerdings auch Liebesbeziehungen, unter anderem mit einer Choristin der Berliner Oper, und uneheliche Kinder hatte. Stattdessen war – nach Zimmer – der Philosoph ein kosmopolitischer Denker (mit gutem Grund trägt diese Biografie den Untertitel «Ein philosophischer Weltbürger»), der es verstanden hat, abendländisches Denken mit fernöstlichen Weisheiten in Verbindung zu bringen.
Dies und sein Eigenwille brachte ihn zwangsläufig in Konflikt mir der bisherigen Philosophie und ihren Vertretern, die er neben sich nicht gelten ließ – außer Kant, den die akademische Philosophie missverstanden habe, und mit dem einzig er – Schopenhauer – auf Augenhöhe denken könnte. So ist besonders die Auseindersetzung mit seinen «Erzfeinden» Hegel, Fichte und Schelling und mit der gesamten akademischen Philosophie bemerkenswert. Den Vorwurf: «Die Philosophie-Profeßoren haben redlich das Ihrige gethan, um dem Publiko die Bekanntschaft mit meinen Schriften wo möglich auf immer vor zu enthalten. Beinahe 40 Jahre hindurch bin ich ihr Caspar Hauser gewesen.» wird er bis in seine letzten Jahre aufrecht erhalten.. Er rächt sich, indem er vom «ekelhaften Hegeljargon» spricht, von der «Hegelei» und von «Hegelianischen Flausen», und auch an allen anderen kein gutes Haar lässt.
Auch am Leser übrigens nicht. «Meine letzte Zuflucht ist jetzt, ihn (den Leser) zu erinnern, daß er ein Buch, auch ohne es gerade zu lesen, doch auf mancherlei Art zu benutzen weiß. Es kann, so gut wie viel andere, eine Lücke seiner Bibliothek ausfüllen, wo es sich, sauber gebunden, gewiß gut ausnehmen wird. Oder auch er kann es seiner gelehrten Freundin auf die Toilette, oder den Theetisch legen. Oder endlich er kann ja, was gewiß das Beste von Allem ist und ich besonders rathe, es recensiren.» Auch wenn Schopenhauer gedichtet hat: «Daß von allem, was man liest, / Man neun Zehntel bald vergißt, / Ist ein Ding, das mich verdrießt./ Wer’s doch All auswendig wüßt’!»

Robert Zimmer erzählt in «Ein philosphischer Weltbürger» umfassend von Leben und Werk des Denkers Arthur Schopenhauer, der die deutsche Philosophie aus dem akademischen Elfenbeinturm befreit hat.
So war er, dieser Arthur Schopenhauer, der einmal von sich sagte: «Das Leben ist eine missliche Sache: ich habe mir vorgesetzt, es damit hinzubringen, über dasselbe nachzudenken.» Und das tat er gründlich und prononciert, sodass sein Werk, vor allem die «Parerga und Paralipomena» (1851) mit den «Aphorismen zur Lebensweisheit», eine Art «Steinbruch» sind, aus dem sich jeder, was immer er will herausschlagen kann. Zum Beispiel Sprachpuristen, die gern sein Diktum gegen die «Sprachverhunzung» zitieren: «Empörend ist es, die deutsche Sprache zerfetzt, zerzaust und zerfleichst zu sehen, und oben drauf den triumphirenden Unverstand, der selbstgefällig sein Werk belächelt.»
Robert Zimmer erzählt umfassend und verständlich, sodass der Leser ein sehr komplexes Bild von diesem kosmopolitischen Denker und Schriftsteller, auch vom Menschen Schopenhauer und vom Philosophen erhält, der die deutsche Philosophie des 19. Jahrhunderts maßgeblich erweitert hat. Vor allem hat er sie dank seiner verständlichen Sprache aus dem akademischen Elfenbeinturm befreit. ■
Robert Zimmer: Arthur Schopenhauer – Ein philosophischer Weltbürger, Biografie, 316 Seiten, Deutscher Taschenbuch Verlag, ISBN 978-3-423-24800-6
.
.
.
John Boyne: «Das Haus zur besonderen Verwendung»
.
Bauernsohn und Zarentochter
Günter Nawe
.
 Es war sicher nicht die Absicht von John Boyne, den vielen Legenden um Tod und/oder Überleben der Großfürstin Zarewna Anastasia von Russland (Anastasia Nikolajewna Romanowa), der jüngsten Tochter des letzten russischen Zarenpaares, eine weitere hinzuzufügen. Der englische Schriftsteller, Autor des international gerühmten Romans «Der Junge im gestreiften Pyjama» hat allerdings die Zarentochter zu einer der Hauptfiguren seines neuen Buches gemacht. Er hat kein Sachbuch darüber geschrieben, sondern Literatur. Und das in Form, wenn man so will, eines Liebesromans? Nein, auch das nicht, sondern eher die Biografie einer Liebe und einer Ehe in unruhigen Zeiten und unter schwierigen Bedingungen. Auf keinen Fall – und das freut – keine neue Legende.
Es war sicher nicht die Absicht von John Boyne, den vielen Legenden um Tod und/oder Überleben der Großfürstin Zarewna Anastasia von Russland (Anastasia Nikolajewna Romanowa), der jüngsten Tochter des letzten russischen Zarenpaares, eine weitere hinzuzufügen. Der englische Schriftsteller, Autor des international gerühmten Romans «Der Junge im gestreiften Pyjama» hat allerdings die Zarentochter zu einer der Hauptfiguren seines neuen Buches gemacht. Er hat kein Sachbuch darüber geschrieben, sondern Literatur. Und das in Form, wenn man so will, eines Liebesromans? Nein, auch das nicht, sondern eher die Biografie einer Liebe und einer Ehe in unruhigen Zeiten und unter schwierigen Bedingungen. Auf keinen Fall – und das freut – keine neue Legende.
Die Geschichte spielt vor dem Hintergrund der Geschehnisse in Russland in den Jahren 1915 bis 1918. Der sechzehnjährige Bauernsohn Georgi aus dem gottverlassenen Nest Kaschin verhindert ein Attentat auf ein Mitglied der Zarenfamilie. Dabei setzt er das Leben seines Freundes aufs Spiel. Das Gefühl der Schuld wird ihn für den Rest seines Lebens begleiten. Als Dank jedoch wird Georgi an den Zarenhof nach Sankt Petersburg gerufen und Leibwächter des Zarewitsch. Hier lernt er auch die Zarentochter Anastasia kennen und lieben. Eine Liebe auf den ersten Blick – von beiden Seiten.

Liebesgeschichte inmitten Kriegswirren: Eisensteins Film-Sequenz «Sturm auf das Winter-Palais des Zaren»
Ein Bauernsohn und die Zarentochter? Kann das etwas werden? Manchmal am Rande des Rührselig-Trivialen erzählt John Boyne souverän diese Geschichte einer unmöglichen Liebe. Fiktion und Realität ergänzen einander. So vermittelt der Autor interessante Einblicke in das Leben am Hofe. Die politischen Verhältnisse um den ersten Weltkrieg herum, um die Oktoberrevolution und die Absetzung des Zaren und die Ermordung der ganzen Familie durch die Bolschewiki werden allerdings nur angedeutet.
Sie aber sollen auch nicht im Mittelpunkt der Erzählung stehen. Geschickt konstruiert und aus wechselnden Zeitperspektiven wird ein anderes Geschehen erzählt. Mit der Absetzung des Zaren ist auch der Kontakt der beiden Liebenden unterbrochen. Die Zarenfamilie wird nach Jekaterinburg verschleppt – in das berühmte «Haus zur besonderen Verwendung», ins Ipatjew-Haus. Hier wird Georgi Zeuge der Ermordung der Zarenfamilie. Nur Anastasia wird in einer dramatischen Aktion gerettet – von Georgi.

John Boynes «Das Haus zur besonderen Verwendung» ist die Romanbiografie einer Liebe und Ehe in unruhigen Zeiten und unter schwierigen Bedingungen. Viel Fiktion und wenig historische Fakten – doch John Boyne ist es gelungen, einen spannenden und fantasievollen Roman zu schreiben. Einfach gute Unterhaltung.
Mit der Flucht von Georgi und Soja – so nennt sich die Zarentochter jetzt – über Paris nach London beginnt sozusagen ein neues Leben. Sie heiraten, müssen mit den Unzulänglichkeiten des Exils fertigwerden, bekommen Kinder. Krankheit und Verlust der Tochter müssen verarbeitet werden, berufliche und finanzielle Schwierigkeiten sind zu überwinden Im Mittelpunkt und über allem aber steht die große Liebe, die durch nichts beeinträchtigt werden kann. Bis Soja 1981 stirbt. Ihr Geheimnis nimmt sie mit ins Grab.
Mit der Benennung genauer Jahreszahlen, auch für den fiktiven Bereich der Erzählung, will John Boyne historische Authentizität vermitteln. Das jedoch ist ein wenig Etikettenschwindel. Den Leser aber wird dies letztlich nicht interessieren. Hat er doch einen routiniert geschriebenen, spannenden und sehr fantasievollen Roman, von Fritz Schneider bestens übersetzt, vor sich, der ihn mit Sicherheit von der ersten bis zur letzten Seite in Atem halten, ja am Ende sogar etwas rühren wird. Die Liebesgeschichte vom Bauersohn und der Zarentochter: ein Stoff, aus dem Träume entstehen. ■
John Boyne, Das Haus zur besonderen Verwendung, Roman, 560 Seiten, Arche Verlag, ISBN 978-3-71602-642-7
.
.
.
Hiromi Kawakami: «Am Meer ist es wärmer»
.
Eine Hauch von Melancholie
Günter Nawe
.
 Selbst dreizehn Jahre später hat Kei das Verschwinden ihres Ehemanns Rei noch nicht verwunden. Seit dreizehn Jahren lebt sie mit ihrer (und Reis) Tochter sowie ihrer Mutter zusammen. Mit Seiji ist sie eine neue Bindung eingegangen. Das Verhältnis zu ihrer pubertierenden Tochter ist nicht einfach. Und das Leben ohne Rei ohnehin nicht.
Selbst dreizehn Jahre später hat Kei das Verschwinden ihres Ehemanns Rei noch nicht verwunden. Seit dreizehn Jahren lebt sie mit ihrer (und Reis) Tochter sowie ihrer Mutter zusammen. Mit Seiji ist sie eine neue Bindung eingegangen. Das Verhältnis zu ihrer pubertierenden Tochter ist nicht einfach. Und das Leben ohne Rei ohnehin nicht.
«Auch nachdem er mich verlassen hatte, liebte ich ihn noch. Ich konnte nicht aufhören, ihn zu lieben. Es war schwierig, jemanden zu lieben, der nicht da war». «Aber eigentlich wusste ich immer noch nicht, was das Wort Liebe bedeutet». – So Kei über ihre Empfindungen.
Eine seltsame Geschichte von Liebe und Sehnsucht also. Von körperlicher Distanz und emotionaler Nähe. Und von der Suche nach dem Geliebten. Der «Sehnsuchtsort» heißt Manazuru und liegt am Meer. Er ist auf einer der letzten Tagebuchseiten von Rei notiert. Diesen Ort sucht Kei in regelmäßigen Abständen auf. Hier erlebt Kei Hoffnung auf Wahrheit und die Angst vor der Erinnerung. Hier – am Meer, das zugleich eine großartige Metapher in diesem Buch ist – muss sie um den Verlust ihrer Sinne bangen. Vorstellung und Realität klaffen auseinander. Und «was wirklich ist, weiß sowieso kein Mensch».
Mit großer Meisterschaft beschreibt Hiromi Kawakami diese Liebesgeschichte, die gleichzeitig eine Geschichte auf der Suche nach sich selbst ist. Mit äußerster Genauigkeit, mit großartiger Zurückhaltung und vielleicht gerade deshalb mit großer Intensität lässt sie den Leser teilhaben an dieser seltsamen Geschichte. Und über allem liegt ein Hauch von Melancholie. Der Roman hat etwas Schwebendes, etwas Unwirkliches und ist doch eine sehr reale Geschichte. Der Leser erinnert sich an frühere, erfolgreiche Bücher diese Autorin («Herr Nakano und die Frauen», «Der Himmel ist blau») und an die Bücher von Murakami – obwohl Hiromi Kawakami einen ganz eigenen Ton hat. Und so ist der Autorin ein besonderes, fantastisches Buch gelungen, eine wunderbare Liebesgeschichte, sinnlich und warm und voll tiefer Symbolik. Eine der schönsten Liebesgeschichten, die wir in den letzten Jahren lesen konnten.
Seltsam ist die Geschichte auch, weil Kei auf der Suche nach Rei einer Frau aus einer anderen Welt begegnet. Erst als ein Hauch, ein Schatten, dann immer näher und körperlicher wird diese Frau zu ihrer ständigen Begleiterin. Woher kommt sie? Aus der Welt, in der auch Rei ist? Was weiß die Frau, die anfangs so etwas wie eine Bedrohung für Kei darstellt? Findet Kei bei ihr die Lösung?

Hiromi Kawakami erzählt eine Liebesgeschichte der besonderen Art; eine Geschichte von Nähe und Ferne. Der Autorin ist ein wunderbares, ein beeindruckendes Buch gelungen; eine der schönsten Liebesgeschichten, die wir in den letzten Jahren lesen konnten.
Resignation und Hoffnung also erlebt die etwa 40-jährige Kei, die an einem Roman schreibt. Ist es die Geschichte von Hiromi Kawakami? Ein Roman, in dem Kei auch von ihrer Vergangenheit mit Rei erzählt und von ihrem Leben mit Momo, Reis Tochter. Auch mit ihr, die sie liebt, kämpft sie um Nähe. Eine Nähe, die ihr Momo verweigert. Was wiederum mit dem Verschwinden des Vaters zusammenhängt…
Was also ist mit Rei? Wo ist Rei? «Ob mein Mann sterben wollte? Oder war er verschwunden, weil er leben wollte?» Auch die unbekannte Frau will es nicht wissen. Und so bleibt am Ende für Kei nur, ihren Mann für tot erklären zu lassen. Die Hoffnung aber bleibt. «Rei, irgendwann in ferner Zukunft können auch wir uns wiedersehen… Aus dem Nichts kommen wir, und ins Nichts kehren wir zurück.» ■
Hiromi Kawakami, Am Meer ist es wärmer, Roman, 208 Seiten, Hanser Verlag, ISBN 978-3-446-23553-3
.
.
.
Rudolf Heinemann: «Die Uraufführung»
.
Hechtsprung in die Musikgeschichte
Günter Nawe
.
 Die Reihe der Fachpublikationen, die Rudolf Heinemann vorzuweisen hat, ist beachtlich. Der studierte Musiker und Soziologe, promovierte Musikwissenschaftler und Redakteur (und, und…) ist bereits mehrfach für seine «Verdienste um die Deutsche Musik» ausgezeichnet worden. Jetzt hat er seinen vielen Berufen und Berufungen eine weitere angefügt und sich als veritabler Schriftsteller geoutet – mit der herrlich satirischen Erzählung «Die Uraufführung».
Die Reihe der Fachpublikationen, die Rudolf Heinemann vorzuweisen hat, ist beachtlich. Der studierte Musiker und Soziologe, promovierte Musikwissenschaftler und Redakteur (und, und…) ist bereits mehrfach für seine «Verdienste um die Deutsche Musik» ausgezeichnet worden. Jetzt hat er seinen vielen Berufen und Berufungen eine weitere angefügt und sich als veritabler Schriftsteller geoutet – mit der herrlich satirischen Erzählung «Die Uraufführung».
Seinem Metier, der Musik, ist er auch hier treu geblieben. Seine Insider-Kenntnisse des Musik- und Kulturbetriebes sind ihm dabei sehr zustatten gekommen. Und so ist ihm eine wunderbare Persiflage auf die manchmal recht eigenartigen Umtriebe, kuriosen Erscheinungen und fatalen Auswirkungen gelungen – verpackt in die spannende Geschichte um Anton Schriller und seinen außergewöhnlichen Eintritt in die Musikgeschichte.
Dieser Anton Schriller, geschieden, ist gelegentlicher Besucher in einem Etablissement, in dem ihm eine wunderschöne und geheimnisvolle Chinesin zu Diensten ist. Bei ihr findet er von Mal zu Mal die höchste Erfüllung seiner sexuellen Wünsche. Am Ende zieht er sich bei einem Superorgasmus einen Hinriss zu. Der wiederum führt zu entrückten Zuständen bis hin zum Gedächtnisverlust. Und das ist auf Dauer nicht unbedingt lustig.
Während Schriller also sein Leben so oder so vor sich hinlebt, seine Chinesin besucht, und sich musikalischen Genüssen hingibt, bereitet sich der Ort, in dem er lebt, auf ein kulturelles Ereignis der Sonderklasse vor: Die Uraufführung eines multimedialen Gesamtkunstwerks eines Großkomponisten, der Kontakt selbst mit Außerirdischen haben soll, steht bevor. Schon im Vorfeld wird darüber mehr oder minder klug diskutiert. Der aufmerksame Leser zeigt sich nicht nur höchlichst amüsiert, sondern vielfältig erinnert an reales Geschehen in Redaktionsstuben und kulturpolitischen Gremien.
Und dann das Ereignis! «…während der Uraufführung schlendert Anton Schriller … wie die meisten Besucher im Stadtpark herum…». Über dem Park liegt ein riesiges Tonfresko, das das Publikum teils amüsiert, teils fasziniert oder langweilt. Plötzlich setzt sich ein geparkter Jaguar ohne Motorstart in Bewegung. In diesem Augenblick bekommt Schriller seine «Zustände». Er hechtet auf den Jaguar, der nun quer durch die Uraufführung rollt und im Abenddunst verschwindet. Verschwunden ist auch Schriller, bis er schlafend in einem Blumenbeet gefunden wird. Er kann sich an nichts mehr erinnern. Wie also das Geschehen aber der Polizei und überhaupt erklären?
Oder war dieser Hechtsprung, der Schriller in die Musikgeschichte katapultiert hat, Teil der Inszenierung des Großkomponisten? Für die öffentliche und veröffentlichte Meinung Grund zu tiefschürfenden Auseinandersetzungen. Schriller aber ist das letztlich egal. «Sein Hechtsprung gehörte nun dazu. Sein Name war mit diesem Werk verbunden, ja, er würde bei dem Werk für immer mitgedacht werden. Das ist der Ruhm, dachte Anton Schriller.» Die Chinesin allerdings meidet er künftig.

Rudolf Heinemann hat mit «Die Uraufführung» eine amüsante Persiflage auf den Musik- und Kuturbetrieb geschrieben - eine sehr intelligente Erzählung voller Scherz, Satire, Ironie und tieferer Bedeutung. Blendende Unterhaltung!
Alle bekommen in dieser brillanten Erzählung ihr Fett weg: die Medien und die selbstherrlichen Kritiker, die Kulturpolitiker, der Komponist dieses multimedialen Events, dem es nicht mehr allein um die Musik, sondern mehr um das Aufsehen geht. Und das Publikum, dem es häufig einfach nur darum geht, bei einem solchen Event dabei gewesen zu sein. Das Dèja-vu-Erlebnis des Lesers wird individuell verschieden sein – ist aber in jedem Fall gegeben.
Für diese Geschichte findet der Autor den richtigen Ton. Rudolf Heinemann hat ein wunderbares, kleines Buch geschrieben, ein – um in der Sprache der Musik zu bleiben – Scherzo: voller Scherz, Satire, Ironie und tieferer Bedeutung. Blendende, intelligente Unterhaltung! ■
Rudolf Heinemann, Die Uraufführung, Eine satirische Erzählung, 110 Seiten, BUCH&media (Allitera), ISBN 978-3-86520-362-5
.
.
Charlotte Thomas: «Der König der Komödianten»
.
Die Welt ist eine Bühne, und unser Stück ist das Leben
Günter Nawe
.
 Nach den spannenden und interessanten historischen Romanen – u.a. «Die Madonna von Murano» und «Die Lagune des Löwen» – erleben wir diesmal eine ganz andere Charlotte Thomas. «König der Komödianten» heißt ihr neuer Roman und ist auf seine Art in der Tat eine Komödie. Klassisch kommt er daher, wie die alte und herrliche Commedia dell’ Arte – und hat eine Menge mit ihr gemein.
Nach den spannenden und interessanten historischen Romanen – u.a. «Die Madonna von Murano» und «Die Lagune des Löwen» – erleben wir diesmal eine ganz andere Charlotte Thomas. «König der Komödianten» heißt ihr neuer Roman und ist auf seine Art in der Tat eine Komödie. Klassisch kommt er daher, wie die alte und herrliche Commedia dell’ Arte – und hat eine Menge mit ihr gemein.
Anders auch die Erzählform. Ein Ich-Erzähler diesmal. Die Autorin nimmt sich zurück, um auf diese Weise doch wieder ihrem Helden ganz nahe zu kommen, Marco, der sich schon mal täuschen lässt von «falschen Helden, falschen Schwertern und falschen Weibern» und ihre volle Sympathie hat. Und bald auch die Sympathie des Lesers.
Worum geht es? Der junge Marco verlässt sein Kloster und schließt sich einer Gruppe von Komödianten an, fahrendem Volk, das durch das Veneto zieht, um die Leute mit ihrem Spiel zu erfreuen und zu unterhalten. In dieser Truppe, ein zusammengewürfelter Haufen herrlicher Typen, die alle mehr oder weniger den bekannten Figuren der Commedia gleichen oder sie spielen, findet Marco seine Erfüllung. Schnell steigt er, der irgendwann einmal seinen «leidenschaftlichen Hang zum Schreiben» entdeckt, vom Kulissenschieber zum Theaterdichter auf.
«Die Welt ist unsere Bühne, und unser Stück ist das Leben, und wenn es sich gerade fügt, geben wir unser Spiel vor anderen zum Besten», heißt es an einer Stelle. Nun ist das Leben auf dieser Bühne nicht immer lustig. Das Repertoire an Stücken der «Incomparabili» (der «Unvergleichlichen») ist begrenzt, und meist reichen die Einnahmen auf den Straßen und Plätzen von Padua und Venedig kaum zum Leben. So kommt Marco als «Theaterdichter» gerade recht. Mit ihm kommt aber auch das Abenteuer. Denn Marcos Herkunft birgt ein für ihn selbst und dann auch für die Theatergruppe gefährliches Geheimnis.
Diese abenteuerliche Geschichte erzählt Charlotte Thomas routiniert und sehr intelligent, mit vielen spannenden Erlebnissen und vor allem mit viel komödiantischem Geschick. So jagt, um es etwas platt zu sagen, ein «Gag» den anderen – manchmal sogar etwas zu oft.
Der Leser aber glaubt sich wirklich «im Theater», in einer herrlichen Komödie vor einer wunderbaren Kulisse, der Charlotte Thomas auch noch einen anderen Aspekt gibt. Sie erzählt ein Stück Geschichte der Commedia dell’ Arte, also ein Stück Theatergeschichte, garniert mit Zitaten und Verweisen aus zeitgenössischen Stücken. Indirekt treten auch einige Autoren auf die «Bühne»: zum Beispiel Plautus und Terenz und der unvergleichliche Shakespeare mit seinen Komödien.

Ein spannender historischer Roman, der schon wegen des Sujets eine besondere Qualität hat. Charlotte Thomas, mittlerweile in der vorderen Reihe von Autoren dieses Genres, ist es wieder einmal gelungen, eine phantasievolle Story mit interessanten historischen Fakten zu verbinden und so einen unterhaltsamen Roman zu schreiben.
Und Marco? Der Junge lernt das Leben kennen, Gefahren zu bestehen; er lernt, natürlich, die Liebe kennen. Nicht nur die komödiantischen Verwicklungen, auch die biographischen Entwicklungen bestimmen ein Leben, das er nach und nach zu meistern weiß – mit dem klassischen «Ende gut, alles gut». Und das gilt auch für den Leser dieses Romans. ■
Charlotte Thomas, Der König der Komödianten, Roman 696 Seiten, Lübbe Verlag, ISBN 978-343-103-807-1
.
.
.
Leseproben
.
.
.
José Saramago: «Die Reise des Elefanten»
.
Salomons abenteuerliche Reise nach Wien
Günter Nawe
.
 Am 18. Juni 2010 ist der portugiesische Autor und Literatur-Nobelpreisträger José Saramago im Alter von 87 Jahren gestorben. Der überzeugte Kommunist und bekennende Atheist, Autor so berühmter Bücher wie «Die Stadt der Blinden» und «Die Stadt der Sehenden», hat uns jetzt, als eine Art Vermächtnis, einen kleinen Roman, eher eine wunderbare Novelle hinterlassen.
Am 18. Juni 2010 ist der portugiesische Autor und Literatur-Nobelpreisträger José Saramago im Alter von 87 Jahren gestorben. Der überzeugte Kommunist und bekennende Atheist, Autor so berühmter Bücher wie «Die Stadt der Blinden» und «Die Stadt der Sehenden», hat uns jetzt, als eine Art Vermächtnis, einen kleinen Roman, eher eine wunderbare Novelle hinterlassen.
Saramago war ein äußerst eleganter Spötter, ein brillanter Ironiker und ein herausragender Erzähler. Alles, was er an literarischen und intellektuellen Fähigkeiten besaß, hat er noch einmal in «Die Reise des Elefanten» eingebracht. Eine Geschichte, die auf einer historischen Begebenheit basiert. Denn tatsächlich hatte Mitte des 16. Jahrhunderts König Johann von Portugal einen an seinem Hofe lebenden Elefanten dem österreichischen Erzherzog Maximilian zur Hochzeit geschenkt und auf die Reise durch Spanien, über das Mittelmeer, durch Italien und über die Alpen nach Wien geschickt.
José Saramago macht daraus eine großartige comédie humaine. Denn neben der abenteuerlichen Schilderung dieser Reise werden die Eitelkeiten und Schwächen der Menschen, repräsentiert durch das riesige Gefolge, das den Elefanten «standesgemäß» begleitet oder ihm begegnet, aufgezeigt – seien sie Könige, Mächtige oder einfache Soldaten. Oder Kirchenmänner.
An ihnen und dem christlichen Glauben sowie seiner Überlieferung wetzt Saramago genüsslich sein literarisches «Messer» in Form von brillanten Sottissen und blasphemisch anmutenden Sentenzen. So heißt es an einer Stelle: «Darin liegt jedoch der große Irrtum des Himmels, da für ihn selbst nichts unmöglich ist, glaubt er, die angeblich nach dem Vorbild seines allmächtigen Bewohners geschaffene Menschen verfügen über dasselbe Prinzip.» Oder: «Fast sind wir versucht wie dieser andere zu sagen, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein.» Das kann und wird nicht unbedingt jedem gefallen, aber hier geht es nicht um Glaubensbekenntnisse, sondern um Literatur. Kommt hinzu: Die Geschichte spielt in der Zeit der beginnenden Gegenreformation. Luther hatte gerade den Stein in den etwas trüben Teich römisch-katholischen Absolutheitsanspruchs geworfen, formierte sich mit Inquisition und dem Konzil von Trient heftiger Widerstand.

Die wahre Geschichte eines indischen Elefanten auf der Reise von Lissabon nach Wien – literarisch hervorragend «in Szene» gesetzt» vom portugiesischen Literaturnobelpreisträger José Saramago. Noch einmal hat der Alt-Kommunist und bekennende Atheist sein ganzes Können gezeigt: als brillanter Erzähler, als eleganter Spötter und Ironiker.
Hauptperson der höchst vergnüglichen Geschichte, vom Autor ganz leicht und locker erzählt, ist der Elefantenführer Subhro, der als Mahut dafür sorgen soll, dass das Tier mit dem Namen Salomon letztlich sein Ziel unbeschadet erreicht. So sorgt er für die Bedürfnisse des Tieres auf der schweren Reise, als da sind Unmengen von Futter und Wasser; für die «Entsorgung» ebenso großer Mengen von Exkrementen – kurz: für das Wohl und Wehe des ihm anvertrauten Tieres. Außerdem bringt Subhro, ein gebürtiger Inder, ein Underdog und ein kluger Mann, den es nach Portugal verschlagen hat, seinem Elefanten auf Befehl bei, vor einer Kirche eine Kniebeuge zu machen. Ironischer geht es nicht. Ironie ist es auch und letztlich Spott, wenn die Rechtgläubigen den Elefanten in «Soliman» und Subhro in «Fritz» umtaufen. Der Dickhäuter jedenfalls nimmt’s gelassen und sein Herr, Mahut Subhro, beobachtet reflektierend aus luftiger Höhe, vom Elefantenrücken das aberwitzige Treiben.
Das alles hat doppelte Bedeutung und steckt voller Witz. Der Leser findet in diesem Roman Geschichte und Geschichten – und wird dank der Kunst des Autors herrlich unterhalten. ■
José Saramago, Die Reise des Elefanten, Roman, 236 Seiten, Hoffmann und Campe Verlag, ISBN 978-3-455-40279-7
.
.
Leseproben
.
.
.
.
Karin Andert: «Monika Mann – Eine Biografie»
.
Das ungeratene Kind
Günter Nawe
.
 Im September 1934 beschrieb Katia Mann ihrem Sohn Klaus die Rückkehr der Tochter und Schwester Monika aus dem Internat Salem: «Vom Mönle (Monika – die Red.), Deiner Lieblingsschwester in ihrer Art, muß ich Dir doch wohl auch kurz berichten, um so mehr, als ihre Ankunft geradezu sensationellen Charakter trug, so überaus verschönt, gertenschlank, mit herrlichen Fladeaus versehen und mit feurigen Samzungen modisch angetan und stolz gereckt entstieg sie dem Zuge, die eigenen Geschwister erkannten sie buchstäblich nicht, aber bei näherer Bekanntschaft erwies sich die Transformation doch nur als recht äußerlich, auch bekommt ihr ja leider das Elternhaus erfahrungsgemäß nicht, und sie ist, nach dreiwöchigem Aufenthalt hier, doch ganz das alte dumpf-wunderliche Mönle, völlig unbeschäftigt, die Speisekammer bemausend (was ihrer Schlankheit abträglich ist), teilnahmslos und unbekümmert, mit bisweilen aufblitzenden Hintergründen. So wird es wohl bleiben». Mutterliebe klingt anders.
Im September 1934 beschrieb Katia Mann ihrem Sohn Klaus die Rückkehr der Tochter und Schwester Monika aus dem Internat Salem: «Vom Mönle (Monika – die Red.), Deiner Lieblingsschwester in ihrer Art, muß ich Dir doch wohl auch kurz berichten, um so mehr, als ihre Ankunft geradezu sensationellen Charakter trug, so überaus verschönt, gertenschlank, mit herrlichen Fladeaus versehen und mit feurigen Samzungen modisch angetan und stolz gereckt entstieg sie dem Zuge, die eigenen Geschwister erkannten sie buchstäblich nicht, aber bei näherer Bekanntschaft erwies sich die Transformation doch nur als recht äußerlich, auch bekommt ihr ja leider das Elternhaus erfahrungsgemäß nicht, und sie ist, nach dreiwöchigem Aufenthalt hier, doch ganz das alte dumpf-wunderliche Mönle, völlig unbeschäftigt, die Speisekammer bemausend (was ihrer Schlankheit abträglich ist), teilnahmslos und unbekümmert, mit bisweilen aufblitzenden Hintergründen. So wird es wohl bleiben». Mutterliebe klingt anders.
Und so ist es geblieben – nicht das Mönle, aber das Verhältnis von Monika zu Vater und Mutter und zu den Geschwistern. Sie war eindeutig das «Stiefkind» in der Familie des Großschriftstellers Thomas Mann, der Monikas Geburt einfach ignorierte, weil mit ihr «die Grenze des Lächerlichen, fürchte ich, erreicht» ist. Auch in den Forschungen um und über die Familie Mann, in der Literaturwissenschaft und in der Biografistik ist dem «vierten der sechs ungeratenen Kinder» (so Monika über sich selbst), dem «ungeliebten» Mönle, bisher wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden.

Monika Mann in den 1920-er Jahren: «Das alte dumpf-wunderliche Mönle, völlig unbeschäftigt, die Speisekammer bemausend»
Jetzt hat Karin Andert diesem «Stiefkind», dessen 100. Geburtstags wir in diesem Jahr gedenken, eine umfassende, sehr kluge und sensible Biografie gewidmet. Übrigens: die erste überhaupt. Die Autorin verfolgt weniger chronologisch denn auf Lebensereignisse und Lebensbeziehungen bezogen den Lebensweg von Monika Mann, geboren am 7. Juni 1910 in München und gestorben am 17. März 1992 in Leverkusen. Der Biografin ist so nicht nur eine eindringliche, brillante Biografie gelungen, sondern auch ein höchst sensibles Porträt einer Frau mit den «zwei Gesichtern» (Andert). Dass Monika Mann die Sympathie der Autorin gehört, kann der Leser teilnehmend nachvollziehen. Dennoch lässt die Literaturwissenschaftlerin Karin Andert zu keiner Zeit die wissenschaftlich-kritische Distanz vermissen.
Auch aus einem anderen Grund ist diese Biografie bemerkens- und lesenswert. Hat doch Karin Andert eine Fülle bisher unbekannten Materials gesichtet und berücksichtigt. So das bisher unveröffentlichte «New Yorker Tagebuch» aus dem Jahre 1945, das dieser Biografie sowohl in deutscher als auch englischer Sprache dieser Biografie angefügt ist.Das gilt auch für das «Monika-Büchlein» der Mutter Katia Mann aus den Jahren 1910-1914.
So sehen wir jetzt deutlicher, wer diese Frau war, die – es sei noch einmal gesagt – so recht nicht zur Familie gehörte. Sie hat ihren Vater geliebt und stets die Nähe zur Mutter gesucht; auch später in ihren Schriften. Nichts davon ist ihr zurückgegeben worden. Sicher, sie war kein einfaches Kind – aber wer von den Mann-Kindern war das schon. Und so ist Monika Mann ihren Lebensweg allein gegangen. Die begabte Musikerin hat ein Klavier-Karriere abgebrochen, die späteren Veröffentlichungen der sehr talentierten Schriftstellerin – Feuilletons, «Vergangenes und Gegenwärtiges», «Das fahrende Haus» sowie beachtete Texte in deutscher, englischer und italienischer Sprache – sind gegen den Widerstand der Familie, vor allem zum Missfallen der Schwester Erika, der Gralshüterin, erschienen.
Das traumatische Erlebnis ihres Lebens war der Tod ihre Mannes Jenö Lányi. Auf der Überfahrt nach Amerika 1940 wurde die «City of Benares» von einem deutschen U-Boot torpediert und sank. Monikas Mann ertrank vor ihren Augen. Auch in dieser Situation erschreckt die Kälte, die ihr von den Eltern entgegenschlug. Es dauerte, bis sie sich gefangen hatte und an «neues» Leben denken konnte. Nach vielen Reisen und immer neuen Wohnsitzen – ein Zusammenwohnen mit der Familie, ob mit Eltern oder Geschwistern, erwies sich als unmöglich -, nach der Emigration fand sie auf Capri nicht nur eine neue Liebe, die ihr Leben dreißig Jahr lang bestimmen sollte, sondern auch endlich so etwas wie Heimat – real und gefühlsmäßig. Hier ist Monika Mann zu einer selbstbewussten, höchst eigenständigen Persönlichkeit geworden. Hier hat sie aber auch die gewünschte Anonymität gefunden: «Mann suchte Landschaft, Ruhe und Menschenleere. Ihr Gang nach außen waren ihre Texte», so der Verleger Nikolaus Gelpke. Und Karin Andert: «Monika Mann hatte es als schweigsame Person schwer in einer Familie, in der das gesprochene Wort eine wichtige Rolle spielte». Monika Mann reagierte mit ihren Texten.

Karin Andert ist nicht nur eine eindringliche, brillante Biografie gelungen, sondern auch ein höchst sensibles Porträt einer Frau mit den «zwei Gesichtern» (Andert). Sie stellt das Persönlichkeitsbild der Monika Mann in den Kontext der Familien- und Zeitgeschichte. Sie hat bisher unbekanntes Material gesichtet und berücksichtigt. Und sie hat das Bild von Monika Mann, diesem ungeliebte Mitglied der Familie Mann, neue und sicher gerechtere Konturen verliehen. Aus diesen und vielen anderen Gründen: lesenswert.
Karin Anderts Biografie wirft auch ein vielleicht nicht unbedingt neues, aber bezeichnendes Licht auf die übrigen Familienmitglieder dieser in jeder Hinsischt außergewöhnlichen Familie Mann. Gleichzeitig ist diese Biografie eine Art Rehabilitation dieser komplexen, oft auch widersprüchlichen Persönlichkeit.
Frido Mann, der Neffe, der Nepomuk Schneidewein aus dem «Doktor Faustus» von Thomas Mann, schrieb in seiner Autobiografie «Achterbahn» über seine Tante: «Monika ist und bleibt die Verfemteste unter allen Geschwistern, über den Tod hinaus. Auch ihre Mutter verhält sich entsprechend. Sich über Monikas Schriftstellerei herablassend, ja angewidert zu äußern, gehört die ganzen Jahre und Jahrzehnte hindurch zum guten Familienton.»
Sein Fazit über die Biografie von Karin Andert lautet deshalb: «Eine überfällige, liebevoll und akkurat durchgeführte Rehabilitation dieser allseits verfemten Verwandten». ■
Karin Andert: Monika Mann – Eine Biografie, 326 Seiten, Mare-Verlag, ISBN 978-3-86648-125-1
.
.
L. Sternes «A Sentimental Journey…» in neuer Übersetzung
.
«Einen Lidschlag lang herschte Schweigen»
Günter Nawe
.
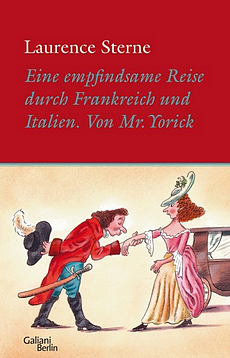 Ein einfacher Reisender war er nicht, dieser Mr. Yorick, den uns Laurence Sterne in seiner wunderbaren Reisebeschreibung «Eine empfindsame Reise durch Frankreich und Italien. Von Mr. Yorick» vorgestellt hat. Dennoch hat er sich als solcher empfunden und seine Reiseeindrücke der Nachwelt hinterlassen: «Empfindsame Reisende (worunter ich meine Wenigkeit verstehe) als welcher gereiset ist, worüber Rechenschaft abzulegen ich mich nunmehr niedersetze – ebenso sehr aus Notwendigkeit und Besoin de Voyager wie jeder andere dieser Klasse.»
Ein einfacher Reisender war er nicht, dieser Mr. Yorick, den uns Laurence Sterne in seiner wunderbaren Reisebeschreibung «Eine empfindsame Reise durch Frankreich und Italien. Von Mr. Yorick» vorgestellt hat. Dennoch hat er sich als solcher empfunden und seine Reiseeindrücke der Nachwelt hinterlassen: «Empfindsame Reisende (worunter ich meine Wenigkeit verstehe) als welcher gereiset ist, worüber Rechenschaft abzulegen ich mich nunmehr niedersetze – ebenso sehr aus Notwendigkeit und Besoin de Voyager wie jeder andere dieser Klasse.»
Diese «Rechenschaft» also lesen wir jetzt in einer herrlichen Neuübersetzung von Michael Walter in dem ebenso herrlich aufgemachten Band aus dem Galiani Verlag mit höchstem Vergnügen. Geschrieben hat dieses Reisetagebuch Laurence Sterne 1768. Da war der Autor längst eine literarische Größe, der mit dem «Tristram Shandy» einen Welt-Bestseller veröffentlicht hatte. Und nun – kurz vor seinem Tod – also der zweite literarische Streich, ein Hauptwerk «A Sentimental Journey through France and Italy. By Mr. Yorick». Und was für einer!
Unser Ich-Erzähler Mr. Yorick reiste von England nach Frankreich; Hier, in Calais, beginnen die Abenteuer. Eine Dame, die ihm absichtlich oder versehentlich die Hand reichte (zweifellos für die damalige Zeit eine höchst erotische Geste), ist der Auslöser unendlich vieler, oft widerstreitender Gefühle. «Niedrige Leidenschaft! Sagte ich…. Gott behüte! Sagte sie und hob die Hand an die Stirne, denn ich hatte justament Fronte vor der Dame gemacht… Gott behüte, fürwahr, sagte ich, und bot ihre meine – Sie trug ein paar schwarze Seidenhandschuhe, offen nur an Daumen und zwei Vorderfingern, und so nahm sie meine Hand ohne Vorbehalt – und ich führte sie vor das Tor der Remise.»

Das Sentimental Journey von Laurence Sterne in einer englischen Ausgabe von 1803 (Zeichnung: William Craig)
Diese Szene wird brillant ironisierend fortgeführt, denn die «pochenden Pulse in meinen Fingern, die ihre drückten, vermittelten ihr, was in meinem Innern geschah; sie senkte den Blick – einen Lidschlag lang herrschte Schweigen….». Eine kleine Dose spielt auch hier mit erotischer Annotation eine entscheidene, zu vielen Weltbetrachtungen Anlass gebende Rolle. Alles und jedes ist ein weiterer Grund für den empfindsamen Reisenden – so auch die Begegnung mit einem Zwerg – zu moralischen und philosophischen Betrachtungen, an denen er uns teilhaben lässt: «In meinem Innern regen sich gewisse kleine Prinzipien, die mich bestimmen, mitleidvoll zu sein gegen diesen armen versehrten Teil meiner Mitmenschen… Ich ertrag’ es nicht mit anzusehen, wenn man einen wie mit Füßen tritt.»
Und weiter also nach Paris. Passangelegenheiten sind zu regeln. Eine Begegnung «mit der jungen fille de chambre» gibt zu Vermutungen Anlass. Und immer wieder Beobachtungen vielfältigster Art auch auf der weiteren Reise nach Italien. Hier wird’s noch einmal heftig, als er in einer überbelegten Herberge mit einer dreißigjährigen Dame in einem Zimmer, fast in einem Bette schlafen muss, nicht ohne dass man sich unfreiwilligerweise (?) nahe kommt. Im rechten Augenblick tritt eine Kammerjungfer «dazwischen» – und jetzt Yorick: «Wie ich also die Hand ausstreckte, erhaschte ich der Kammerjungfer – ». Was wohl – Sterne lässt uns alles und jedes vermuten.
Sterne hatte sich nicht nur den Ruf eines exzellenten Literaten erworben, er galt (zumindest nach dem «Tristram Shandy») als ausgemachter «obszöner Lüstling», – ein Ruf, der ihn störte, und den er mit der «Sentimentalen Reise» widerlegen wollte; nicht, weil er nicht unmoralisch sein wollte, weit gefehlt, er war es immer mit listigem Augenzwinkern; aber er wollte (so der Nachwort-Autor Wolfgang Hörner) nicht dafür gelten. Ganz ist es ihm kaum gelungen.
So vielfältig wie die Ansichten des Mr. Yorick sind auch die Aussichten, die der Leser auf der literarischen Reise mit Mr. Yorick genießt. Sterne ist auf diese Weise eine völlig neue Art der Reiseliteratur gelungen, die weit über die reine Deskription von Gesehenem und Erlebtem hinausgeht. Und so hatte sein Werk immense Auswirkungen auf eine ganze literarische Epoche, wie Hörner in seinem kenntnisreichen und sehr informativen Nachwort nachweist.
Uns, den Nachgeborenen, bleibt bis heute und darüber hinaus das uneingeschränkte Vergnügen an der Lektüre dieses Buches, die ihren besonderen Reiz durch die glänzende Übersetzung von Michael Walter bekommt. ■
Laurence Sterne, Eine empfindsame Reise durch Frankreich und Italien – Von Mr. Yorick; Neu übersetzt von Michael Walter, Galiani Verlag Berlin, 357 Seiten, ISBN 978-3-86971-014-3
.
.



































































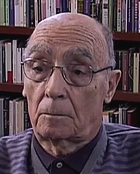















leave a comment