Thomas O. H. Kaiser: «Klaus Mann – Ein Schriftsteller in den Fluten der Zeit»
.
Gute Recherche – in schlechte Form gegossen
Bernd Giehl
.
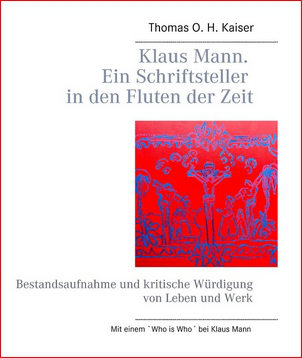 Sagen wir es einmal so: Es hätte was werden können. Ein richtig gutes Buch hätte es werden können. Eines, das auch Interesse bei einem Leser weckt, der Klaus Mann nur als den berühmten Sohn eines noch berühmteren Vaters kennt. Vermutlich hätte der Autor dazu nur dem Vorbild von Marcel Reich-Ranicki folgen müssen, der einen Aufsatz über Klaus Mann mit folgenden Sätzen einleitet: «Er war homosexuell. Er war süchtig. Er war der Sohn von Thomas Mann. Also war er dreifach geschlagen.» So erweckt man Aufmerksamkeit und zwingt den Leser förmlich dazu weiterzulesen.
Sagen wir es einmal so: Es hätte was werden können. Ein richtig gutes Buch hätte es werden können. Eines, das auch Interesse bei einem Leser weckt, der Klaus Mann nur als den berühmten Sohn eines noch berühmteren Vaters kennt. Vermutlich hätte der Autor dazu nur dem Vorbild von Marcel Reich-Ranicki folgen müssen, der einen Aufsatz über Klaus Mann mit folgenden Sätzen einleitet: «Er war homosexuell. Er war süchtig. Er war der Sohn von Thomas Mann. Also war er dreifach geschlagen.» So erweckt man Aufmerksamkeit und zwingt den Leser förmlich dazu weiterzulesen.
Dass Klaus Manns Leben es wert ist, nacherzählt zu werden, zeigt Autor Dr. Thomas O.H. Kaiser auf fast jeder Seite. Geboren als ältester Sohn des berühmten Schriftstellers Thomas Mann – nur seine Schwester Erika war ein Jahr älter – wächst Klaus Mann in großbürgerlichen Verhältnissen auf. Der Vater darf nicht gestört werden – er ist schließlich ein wichtiger Mann, der ein «Werk» schafft –; die Mutter ist oft leidend und einmal für mehrere Monate in einem Lungensanatorium in der Schweiz.

Originär, schwul, genial: Klaus Mann (1906-1949)
Und so wachsen Klaus Mann und seine fünf Geschwister in der Obhut von allerlei Dienstmädchen auf. Seine Distanz zum Vater ist entsprechend groß; wo Thomas Mann durch und durch bürgerlich ist, gibt Klaus Mann den Bohemien. Wo der Vater versucht, seine Homosexualität zu verbergen, lebt der Sohn sie offen aus. Er wird Schriftsteller wie sein Vater und tritt so in offene Konkurrenz zu einem, der sich selbst in der Nachfolge Goethes sieht und schon mit 54 Jahren den Nobelpreis bekommt. Er will alles vom Leben und legt sich dabei – anders als der Vater – keine Zügel an. In vielem, auch in seiner Drogensucht ist er maßlos. Grenzen existieren nicht für ihn. Das hat er spätestens in dem halben Jahr an der Odenwaldschule ausgetestet, wo er – vom Unterricht freigestellt – tun und lassen konnte, was er wollte (1922/23). Und dann kommen, als Klaus Mann gerade mal 27 Jahre alt ist, die Nazis an die Macht und die haben für einen bekennenden Schwulen und eher links orientierten Schriftsteller, der in seinen Werken tabuisierte Themen wie Homosexualität und Inzest behandelte, natürlich keine besonderen Sympathien, so dass Klaus Mann, ebenso wie sein Vater Thomas und sein Onkel Heinrich Mann – auch dieser ein berühmter Schriftsteller – im Frühjahr 1933 ins Exil geht.
Es ist ein spannendes Leben, das Kaiser sich zum Thema genommen hat. Wie schon gesagt: Es hätte etwas werden können. Nur hätte Thomas Kaiser in dem Fall seinem Hang zur Ausschweifung Zügel anlegen müssen. Natürlich kann man im Vorwort das Interesse an seinem Forschungsgegenstand begründen, nur sollte man dann nicht bei der Suche nach den verschwiegenen Außenstellen der Konzentrationslager in Südniedersachsen, der Heimat des Autors beginnen. Von dort ist es ein weiter Weg bis zum Schriftsteller Klaus Mann. Womöglich wäre das ja nicht der Erwähnung wert, wenn es nicht symptomatisch wäre für dieses Buch. Der Autor findet kein tragendes Prinzip, um seinen Stoff zu gliedern. 800 Fußnoten auf 380 Seiten Text – das ist zumindest ein Indiz, dass hier etwas nicht in Ordnung sein kann. Und wenn man dann noch sieht, dass die Fußnoten um ein Mehrfaches länger sind als der Text, sollte man sich vielleicht doch einmal überlegen, ob hier das Verhältnis noch stimmt.

Es ist schade um den Stoff, den sich Klaus-Mann-Biograph Thomas O.H. Kaiser vorgenommen hat. Denn Autor Kaiser hat offensichtlich genau recherchiert und viel Mühe aufgewandt, um den Spuren seines Helden quer durch Europa zu folgen. Es steckt eine Menge Arbeit in diesem Buch. Leider hat der Autor aber nicht die Form gefunden, das Leben von Klaus Mann so zu präsentieren, dass man bis zum Ende durchhält.
Diese Fußnoten haben etwas Eigenartiges. Manchmal sind es Nebengedanken, die dem Autor ebenfalls noch wichtig sind (wie das auch sonst bei Fußnoten oft der Fall ist), oft jedoch fächern sie einen Gedanken des Haupttextes noch einmal auf. Man fragt sich dann, warum der Autor ihren Inhalt nicht einfach in den Haupttext übernommen hat. Manches hätte er sich auch einfach sparen können, so z.B. die ausführlichen Informationen zu den verschiedenen Nazis, die er erwähnt, die aber keine besondere Rolle im Leben von Klaus Mann spielen, anderes dagegen ist für das Verständnis der Hauptpersonen wichtig. Und so macht er es dem Leser schwer, der keine allzu große Lust hat, einen halben Satz des Haupttextes zu lesen, dann zur Fußnote zu springen, dann wieder einen Halbsatz zu lesen, ehe er sich mit der nächsten Fußnote auseinandersetzen muss. Auf diese Weise vergrault man auch gutwillige Leser.
Es ist schade um diesen Stoff. Thomas O. H. Kaiser hat offensichtlich genau recherchiert und viel Mühe aufgewandt, um den Spuren seines Helden quer durch Europa zu folgen. Es steckt eine Menge Arbeit in diesem Buch. Leider hat der Autor aber nicht die Form gefunden, das Leben von Klaus Mann so zu präsentieren, dass man bis zum Ende durchhält. ■
Thomas O. H. Kaiser: Klaus Mann – Ein Schriftsteller in den Fluten der Zeit, 500 Seiten, Books on Demand, ISBN 978-3738611410
.
.
Weitere Literatur-Rezensionen im Glarean Magazin
.
.
Frank Schuster: «Das Haus hinter dem Spiegel» (Roman)
.
Ein Schach-Roman für Carroll-Liebhaber
Sabine & Mario Ziegler
.
 Zu den großen Klassikern der Weltliteratur gehören zweifellos die beiden Romane «Alice im Wunderland» («Alice’s Adventures in Wonderland») und «Alice hinter den Spiegeln» («Through the Looking-Glass, and What Alice Found There»), verfasst in den Jahren 1865 und 1871 vom britischen Schriftsteller Lewis Carroll (eigentlich Charles Lutwidge Dodgson, 1832-1898). Wie kaum ein anderes Kinderbuch fanden Alice und ihre zahlreichen skurrilen Verbündeten und Widersacher Eingang in Literatur, Musik und Film. In die lange Reihe von Rezeptionen des Alice-Themas reiht sich auch Frank Schuster mit seinem Roman «Das Haus hinter dem Spiegel». Es handelt sich um die zweite Monographie Schusters nach dem Roman «If 6 Was 9» (Oldenburg 2003)
Zu den großen Klassikern der Weltliteratur gehören zweifellos die beiden Romane «Alice im Wunderland» («Alice’s Adventures in Wonderland») und «Alice hinter den Spiegeln» («Through the Looking-Glass, and What Alice Found There»), verfasst in den Jahren 1865 und 1871 vom britischen Schriftsteller Lewis Carroll (eigentlich Charles Lutwidge Dodgson, 1832-1898). Wie kaum ein anderes Kinderbuch fanden Alice und ihre zahlreichen skurrilen Verbündeten und Widersacher Eingang in Literatur, Musik und Film. In die lange Reihe von Rezeptionen des Alice-Themas reiht sich auch Frank Schuster mit seinem Roman «Das Haus hinter dem Spiegel». Es handelt sich um die zweite Monographie Schusters nach dem Roman «If 6 Was 9» (Oldenburg 2003)
Der Klappentext verspricht einen «fantastischen Roman für Jung und Alt», und die ersten Kapitel lassen an ein Jugendbuch denken: Kurze, überschaubare Kapitel, die Handlung entführt den Leser in die Welt der beiden zehnjährigen Schwestern Lorina und Eliza. Zum Leitmotiv der Geschichte wird eine Schachfigur aus dem Spiel des Vaters. Diese Figur, eine schwarze Dame, wird von einer Elster entwendet. Was zunächst lediglich wie ein kleines Missgeschick anmutet, wegen dem der Vater seine angefangene Fernschachpartie mit einem Freund nicht wird fortsetzen können, entpuppt sich bald als viel größeres Problem: Es existiert eine parallele Welt «hinter dem Spiegel», in der Elizas «Zwilling» Alice mit ihrer Familie lebt. Aus einem nicht näher bezeichneten Grund vertauschen Alice und Eliza ihre Plätze in der jeweils anderen Welt. Als Medium dieser Verwandlung dient ein großer Spiegel, den die Familie vor Jahren in England erstanden hatte, und der aus dem Viktorianischen Zeitalter stammt – just aus der Zeit, in der Carroll den Roman von «Alice hinter den Spiegeln» verfasste. Im weiteren Verlauf der Geschichte erfährt der Leser nach und nach immer mehr Details der unglaublichen Verwandlung von Eliza zu Alice. Für die Rückverwandlung am Ende ist – ähnlich wie bei Carroll – das Schachspiel von großer Bedeutung, das aber erst wieder in seinen Originalzustand zurückversetzt werden muss. Hier kommen der im gleichen Haus wie die Kinder wohnende Erfinder Herr Ritter, der Lehrer Herr Hundsen und der Psychologe Herr König ins Spiel. Nach vielen Schwierigkeiten gelingt es, eine Ersatzfigur für die schwarze Dame herzustellen, schließlich taucht auch das Original wieder auf, und zum guten Schluss kann die Rückverwandlung durchgeführt werden.
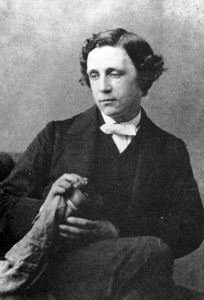
Lewis Carroll (Fotografie von 1863)
Zu diesem Zeitpunkt hat der Roman jedoch schon lange den Charakter eines Kinderbuchs verloren. Nicht nur werden die Kapitel zunehmend länger, auch die Wortwahl verändert sich. Wird zu Beginn auf Augenhöhe der Kinder berichtet, was etwa im Belauschen der Eltern (Kapitel 4) zum Ausdruck kommt, treten im Laufe der Erzählung zunehmend Wortspiele auf, die an die literarische Gattung des Nonsens erinnern, für den Carroll berühmt war. Das zentrale Kapitel ist das achte, in dem Eliza zur Verblüffung ihrer Mitschüler in Spiegelschrift folgendes Gedicht schreibt:
Verdaustig war’s, und glasse Wieben
rotterten gorkicht im Gemank.
Gar elump war der Pluckerwank,
und die gabben Schweisel frieben.
Es handelt sich hierbei um die erste Strophe des Gedichts «Der Zipferlake» («Jabberwocky») aus der Feder von Lewis Carroll, wie dem Vertretungslehrer Hundsen sofort klar ist. Frank Schuberts «Das Haus hinter den Spiegeln» ist voll von solchen Anspielungen: Der Goggelmoggel (im Original Humpty Dumpty) wird ebenso bemüht wie der Hutmacher aus Alice im Wunderland (in Gestalt der Deutschlehrerin «Frau Hutmacher» oder der weiße Ritter (in Gestalt des rettend eingreifenden Erfinders Herr Ritter). Neben solchen textimmanenten Andeutungen wird auf die historische Figur Carroll selbst verwiesen: Nicht zufällig ist «Karl-Ludwig Hundsen» die exakte Übersetzung seines bürgerlichen Namens Charles Lutwidge Dodgson (dieser Bezug wird auf S. 70 ausdrücklich hergestellt). Die Hinweise erschließen sich natürlich nur demjenigen, der Carrolls Biographie und seine Werke kennt. Für alle anderen bleibt vieles unverständlich und sogar verwirrend, etwa wenn in Kapitel 15 seitenlang Nonsenspoesie zitiert wird, die die Geschichte nicht voranbringt. Skurril wirkt, wenn Eliza als Gutenachtgeschichte eine weitere Nonsensballade aus der Feder von Carroll, «Die Jagd auf den Snark», vorgelesen wird.
Bisweilen verschwimmen die Ebenen: Eliza, das Ebenbild der Carroll’schen Alice, liest selbst Carrolls Roman (S. 79) – im Grunde also ihre eigene Geschichte.
Wie in der literarischen Vorlage so begegnen auch in Schusters Roman zahlreiche Schachbezüge, besonders in den letzten Kapiteln. Hierbei greift der Autor eine Stellung auf, die Carroll selbst zur Grundlage der Handlung in «Alice hinter den Spiegeln» machte. Folgendes Diagramm findet sich in der Ausgabe von «Through the Looking-Glass» aus dem Jahre 1871:

Dem Leser des Romans leuchten die Bezüge zu den Abenteuern der Alice sofort ein, wozu auch die Farbe «Rot» (statt «Schwarz») für den Nachziehenden passt; hier wird das Motiv der «roten Königin» wiederaufgegriffen, das sich bereits in «Alice im Wunderland» findet. Verwirrend ist allerdings – gerade für schachspielende Leser – dass diese Position aus der Fernpartie des Vaters stammen soll. Dies wird bereits auf S. 7 verdeutlicht, wo ausdrücklich zwei Elemente der Stellung genannt sind: «So konnte Papa einfach eine E-Mail an den Freund schicken, in der er zum Beispiel schrieb: ‚Weißer Bauer auf d2.‘ Und sein Freund mailte dann zurück: ‚Schwarze Königin von e2 auf h5.‘» Carroll selbst allerdings folgt bei den oben angegebenen Zügen bis zum Matt zwar den Schachregeln, nicht aber der Regel, beide Spieler abwesend ziehen zu lassen. Vielmehr stehen die Figuren auf dem Brett für die handelnden Personen in Carrolls Roman.
So würde der vollständige Ablauf bis zum Matt nach Carroll in heutiger Notation lauten:
1…Dh5 2.d4 und Dc4 3.Dc5 4.d5 und Df8 5.d6 und Dc8 6.d7 Se7+ 7.Sxe7 und Sf5 8.d8/D De8+ 10.Da6 (dieser Zug ist – schachlich betrachtet – illegal, da der weiße König im Schach der schwarzen Dame steht) 11.Dxe8#
Bei Schuster wird die Zugfolge nicht komplett wiedergegeben, aber durch die vorhandenen Anspielungen wird dem Carroll-kundigen Leser klar, dass für die Rückverwandlung von Alice in Eliza eben jene «Schachpartie» zu Ende gespielt werden muss.

Frank Schusters Schach-Roman «Das Haus hinter dem Spiegel» ist nicht ein eigentliches Kinderbuch, auch wenn die Hauptpersonen Kinder sind und die märchenhaften Motive geeignet wären, junge Leser anzusprechen. Liest man das Buch als mit dem Schach Vertrauter, ohne die Schachmotive aus Carrolls Werken zu kennen, ist man schnell ob der vermeintlichen «Fehler» verwirrt. Für Lewis Carroll-Fans öffnet der Schusters Roman aber eine wahre Schatzkiste an Bezügen und bietet eine moderne Neuinterpretation des vertrauten Stoffs.
Für wen ist also «Das Haus hinter dem Spiegel» geschrieben? Offensichtlich handelt es sich nicht um ein Kinderbuch, auch wenn die Hauptpersonen Kinder sind und die märchenhaften Motive geeignet wären, junge Leser anzusprechen. Liest man das Buch als mit dem Schach Vertrauter, ohne die Schachmotive aus Carrolls Werken zu kennen, ist man schnell ob der vermeintlichen «Fehler» verwirrt. Es bleiben die Fans und Liebhaber der literarischen Vorlagen von Lewis Carroll. Für solche Liebhaber öffnet «Das Haus hinter den Spiegeln» eine wahre Schatzkiste an Bezügen und bietet eine moderne Neuinterpretation des vertrauten Stoffs. ■
Frank Schuster: Das Haus hinter dem Spiegel, Roman, MainBook Verlag, 180 Seiten, ISBN 978-3944124728
.
.
.
__________________________________
Sabine Ziegler-Staub
Geb. 1982 im Saarland, Lehramtsstudium, Mitarbeit an einem Forschungsprojekt im Bereich Fachdidaktik der Mathematik, seit mehreren Jahren im Schuldienst und aktive Schachspielerin sowie Trainerin einer Schach-AG
Mario Ziegler
Geb. 1974 in Neunkirchen/Saarland, Studium der Geschichte und Klassischen Philologie, 2002 Promotion in Alter Geschichte, seither als Wissenschaftlicher Mitarbeiter im universitären Lehrbetrieb tätig. Langjähriger Schachtrainer sowie Autor und Herausgeber verschiedener Bücher zum Thema Schach
.
.
Weitere Schach-Rezensionen im Glarean Magazin
.
.
.
Szilárd Rubin: «Der Eisengel» (Roman)
.
Die Vampirin von Törökszentmiklós
Günter Nawe
.
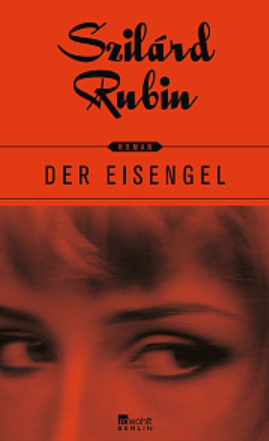 Was sich im ersten Augenblick wie ein veritabler Kriminalroman liest, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als eine Art literarischen Experiments, als ein Dokumentarroman. Unternommen hat diesen Versuch, der an dieser Stelle schon als gelungen zu bezeichnen ist, der ungarische Schriftsteller Szilárd Rubin (1927-2010). Dass er hierzulande relativ unbekannt ist– es gibt drei Werke in deutscher Übersetzung –, erweist sich zwar als ein Manko. Umso mehr freut sich der Leser jetzt über eine Neu- bzw. Wiederentdeckung. Denn Rubin ist ein hochinteressanter Autor, dessen Erzählen von großer Faszination ist, die sich nicht nur aus der Geschichte selbst ergibt, sondern auch aus der atmosphärischen Dichte dieser Prosa und eben dem schon genannten dokumentarischen Charakter der Romankonstruktion.
Was sich im ersten Augenblick wie ein veritabler Kriminalroman liest, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als eine Art literarischen Experiments, als ein Dokumentarroman. Unternommen hat diesen Versuch, der an dieser Stelle schon als gelungen zu bezeichnen ist, der ungarische Schriftsteller Szilárd Rubin (1927-2010). Dass er hierzulande relativ unbekannt ist– es gibt drei Werke in deutscher Übersetzung –, erweist sich zwar als ein Manko. Umso mehr freut sich der Leser jetzt über eine Neu- bzw. Wiederentdeckung. Denn Rubin ist ein hochinteressanter Autor, dessen Erzählen von großer Faszination ist, die sich nicht nur aus der Geschichte selbst ergibt, sondern auch aus der atmosphärischen Dichte dieser Prosa und eben dem schon genannten dokumentarischen Charakter der Romankonstruktion.
Wovon ist die Rede? Vom Roman «Eisengel». In Törökszentmiklós, einem ungarischen Provinznest, sorgt ein fünffacher Mord an jungen Mädchen für großes Aufsehen. Eine mehr als merkwürdige Geschichte – geschehen in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, in Zeiten des ungarischen Poststalinismus.
Lange, so weiß es das ausführliche Nachwort zu diesem Roman, hat sich Szilárd Rubin mit diesem authentischen Fall befasst, der weit über das kriminelle Geschehen hinaus auch eine politische Dimension hat. Aufmerksam geworden ist Rubin auf den «Fall» durch die Fotografie einer jungen Frau, die einige Jahre zuvor hingerichtet worden ist. Piroska Janscó ist / war eine anmutige, schöne junge Frau und war doch die «Vampirin von Törökszentmiklós». Ihr wird dieses grausige Verbrechen zugeschrieben.
Unser Autor, als Schriftsteller und Journalist auftretend, will jedoch mehr wissen, als die Aktenlage ausweist, will die Hintergründe einer Mordserie, die zwischen Oktober 1953 und August 1954 geschah, kennenlernen. Bizarre Morde, ein unvorstellbares Verbrechen, das seinerzeit hohe Wellen geschlagen hat – In Törökszentmiklós und darüber hinaus. Verdächtigt der Morde wurden erst einmal sowjetischen Soldaten, die in Ortsnähe in Garnison lagen. Auch tauchten plötzlich die uralten Verdächtigungen auf von Ritualmorden, begangen von – natürlich – den Juden auf. Oder waren es Fremde? Es kam sogar zu Massendemonstrationen gegen die vermeintlichen Täter. Wir kennen ganz aktuell die Mechanismen von Verdrängung, Verdächtigungen und Verleumdungen. Bis endlich klar wurde: Gemordet «aus niederträchtigen Gründen», hat Piroska. Und so wurde sie für fünffachen Mord und einmaligem Mordversuch zum Tode verurteilt und hingerichtet.
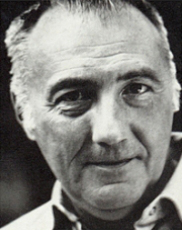
Rubin Szilárd (1927-2010)
So beginnt der Schriftsteller zu recherchieren. Er sucht die Tatorte auf, spricht mit den Familien, mit der Mutter der Mörderin, den Eltern der ermordeten Kinder und mit der Leiterin des Gefängnisses, in dem Piroska die letzten Stunden ihres Lebens verbracht hat. Nicht alle waren sehr auskunftsfreudig. Schon gar nicht die Polizei, die damals recht schlampig ermittelt hat, und sich immer noch nicht sehr auskunftsfreudig zeigt; genauso wenig wie die unantastbaren Russen.
Vieles in der Schilderung der «Zeugen» ist widersprüchlich. Der ermittelnde Schriftsteller entdeckt das Böse, das Grausige und Obsessive – gerade auch in der Bevölkerung. Ja, Piroska Janscó war eine Prostituierte, die bei den sowjetischen Soldaten ein- und ausging, sie kannte ebenso wie die Menschen um sie herum keine Moral. Wirklich nicht? Von der «Metaphysik der Sünde» spricht József Keresztesi und Freund des Autors in seinem klugen Nachwort. Und Szilard Rubin: « Und ich möchte nicht die existenzialistische These über die Unergründbarkeit der Welt darstellen, keine kafkaeske Parabel verfassen, sondern einen dem sozialistischen Geist verbundene, künstlerisch gut gelösten und authentischen Tatsachenroman schreiben.» Das ist Rubin unzweifelhaft gelungen, auch wenn manche Szene sich sehr kafkaesk liest und die «Unergründbarkeit der Welt» zweifelsfrei zu erahnen ist.

Der Roman «Der Eisengel» des ungarischen Autors Szilárd Rubin ist eine wunderbare und spannende Neuentdeckung. Die Geschichte der fünffachen Mörderin von Törökszentmiklós ist ein Krimi und doch mehr als das: eine faszinierende kleine literarische Sensation. Absolut lesenswert!”
Zurück zum «Fall» und zu Piroska, diesem «Eisengel», «kalt bis ans Herz hinan», liebende Mutter und gnadenlosen Mörderin, zu dieser Protagonistin eines außergewöhnlichen Romans. Mörderin und Heilige, der Engel und das Biest? Charakteristika, die stimmen und doch nicht stimmen. Folgen wir also dem Autor, der von seiner Heldin sagt: «Ich betrachte die Fotografie des Mädchens, unruhig und ratlos. Darüber stand: Die Täterin. Und unter dem Bild der Name Piroska Janscó. Dieses Bild vor mir erweckte zugleich Mitleid, Lust und Angst. In der Tiefe des trotzigen Blicks glühten die Falschheit und der Hochmut der Verführerin, in den katzenartigen Umrissen des Gesichts etwas, das sie auf rätselhafte und unheilverkündende Weise begehrenswert mache, und das konnte selbst durch die in ihren Zügen liegende Furcht eines in die Ecke gedrängten Raubtiers nicht gebannt werden.»
Gerade das also macht diesen Roman, bei dem so vieles im Ungefähren bleibt, trotz aller Brüche und Unschärfen, so einzigartig und lesenswert.
Der Leser, der einen Krimi erwartet hat, wird vielleicht enttäuscht sein. Der Leser, der sich auf das Abenteuer dieses Buches einlässt, hält einen brillanten, einen faszinierenden Roman in Händen, eine kleine literarische Sensation. ■
Szilárd Rubin: Der Eisengel, Roman, aus dem Ungarischen von Timea Tankó, Rowohlt Verlag, ISBN 978 3 87134 789 4
.
.
.
.
Michel Bergmann: «Alles was war» (Erzählung)
.
«Ins Leben. Unbeschwert»
Günter Nawe
.
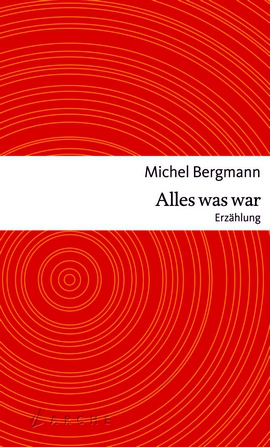 «Jedes jüdische Kind im Deutschland der Fünfziger Jahre wächst am Rande eines Massengrabs auf.» – Es lebt mit all den Opfern von Auschwitz, Majdanek und den vielen anderen Vernichtungslagern der Nazis: den nicht mehr existierenden Großeltern, Onkeln und Tanten. Es wächst auf mit den Tränen, die um die vielen, vielen Verwandten immer und immer wieder vergossen werden.
«Jedes jüdische Kind im Deutschland der Fünfziger Jahre wächst am Rande eines Massengrabs auf.» – Es lebt mit all den Opfern von Auschwitz, Majdanek und den vielen anderen Vernichtungslagern der Nazis: den nicht mehr existierenden Großeltern, Onkeln und Tanten. Es wächst auf mit den Tränen, die um die vielen, vielen Verwandten immer und immer wieder vergossen werden.
Von einem solchen Kind schreibt Michel Bergmann in seiner berührenden Erzählung «Alles was war». Es ist ein kleines großes Buch des Erinnerns – voller Trauer und voller Witz, melancholisch und heiter. Und er schreibt sicher von eigenem Erleben, denn dieser Michel Bergmann wurde 1945 als Kind jüdischer Eltern in einem Internierungslager geboren. Seine Kindheit verbrachte er in Paris und Frankfurt/Main. Es waren seine Jahre als jüdisches Kind, als jüdischer Junge, die er in den 50er Jahren im Nachkriegsdeutschland verbrachte. In einem Land, das einerseits vom schrecklichen Geschehen während der Naziherrschaft und des Krieges traumatisiert war; andererseits aber auch noch längst nicht «entnazifiziert» war.
Bergmann ist bereits durch drei wunderbare Bücher literarisch auffällig geworden. Und das im besten Sinne. Mit seinen Romanen «Die Teilacher», «Machloikes» und «Herr Klee und Herr Feld» hat er von den Erlebnissen der Juden erzählt, die sich wieder in Frankfurt niedergelassen habe. Sie alle tragen schwer an dem Schicksal, das ihnen die Geschichte, das ihnen die Deutschen angetan haben.
Und nun also die Erzählung eines alten Mannes, der auf seine Kindheit zurückblickt. Er erinnert sich an die Schulzeit, daran, das er, den Ranzen auf dem Rücken, losrennt: «Ins Leben. Unbeschwert. Es ist sein Tag! Wie jeder Tag sein Tag ist!» Arzt soll er werden, stellt sich jedenfalls die Mutter vor, die mühsam wieder ein annähernd normales Leben zurückgefunden hat als Geschäftsfrau.
Dass das nicht einfach würde – alle wussten es, die den Weg des Jungen begleiteten. Erst aber einmal wird «gelebt». So stromert das Kind durch die Trümmergrundstücke. Er hat Freunde und später Freundinnen. Oft allerdings nur solange, bis herauskommt, dass er Jude ist. Freunde und Freude hat er in und mit der Familie, der Mischpacha, mit Freunden, den Chaverim. Er feiert unter etwas Weihnukka – eine Mischung aus Weihnachten und Chanukka. Er gerät in den einen und anderen Schlamassel. Voller Witz auch die Schilderung der Bar Mizwa, die der Junge trotz erster religiöser Zweifel über sich ergehen lassen muss.
In dreizehn wundervoll erzählten Kapiteln, teilweise im leicht jiddisch eingefärbten Deutsch, schreibt der alte Mann, hinter dem wir getrost Bergmann vermuten dürfen, sein kleine, seine exemplarische Geschichte, die für den Leser auch eine Art Geschichtsunterricht wird. Nicht dröge und keinesfalls belehrend, aber einfühlsam und bei aller Schwere leicht und mit Witz und einem gehörigen Schuss Melancholie. Und immer gegenwärtig in diesem jungen Leben sind die, die nicht mehr sind. Schließlich ist er «am Rande eines Massengrabs» aufgewachsen.
Der Junge wird älter. Er verliebt sich, wird betrogen, schafft gerade mal so das Abitur, genießt seine Freiheit und verachtet alles Angepasstheit und – auch sie gibt es wieder – die saturierte Bürgerlichkeit. Was aber steht hinter all dem? Kasches, Fragen, werden gestellt – und bleiben oft unbeantwortet. Die jüdisch-deutsche Problematik, die Geschichte der Juden in Deutschland sollte für den Ich-Erzähler später einmal von existenzieller Bedeutung werden.
Erst einmal aber wird er Volontär bei den «Frankfurter Rundschau». Auch kein Traumjob, aber… Hier lernt er den Generalstaatsanwalt Fritz Bauer kennen. Dessen unermüdliches Engagement um den und im Auschwitz-Prozess ist beispielhaft gewesen. Mit großer Leidenschaft und großer Anteilnahme wird der junge Journalist.
Ein alter Mann erinnert sich. Auch daran, dass im Laufe der Jahre die Verbindung zur Mutter abgebrochen ist. Er erinnert sich an die Menschen, denen er in den Jahren seines Lebens begegnet ist. So trifft er bei der Beerdigung der Mutter einen alten Freund Marian wieder – und es war «wie am ersten Tag». Ihm wird er dieses kleine wundervolle Buch, diese auf ihrer Weise einzigartige Biografie widmen.

Die Geschichte einer jüdischen Kindheit im Deutschland der Nachkriegszeit – Michel Bergmann hat sie aufgeschrieben. Auch sie ein Kapitel deutscher Geschichte – wunderbar erzählt, heiter und witzig und voller Melancholie und Nachdenklichkeit. Ein kleines großes Buch, das traurig und zugleich glücklich macht.
Im letzte Kapitel, das bezeichnenderweise die Überschrift «Chaim – Leben» trägt, zitiert Michel Bergmann Søren Kierkegaard: «Das Leben kann nur nach rückwärts schauend verstanden, aber nur nach vorwärts schauend gelebt werden». In diesem Sinne hat Michel Bergmann dieses Buch geschrieben – und uns, seine Leser, auf wunderbare Weise beschenkt. ■
Michel Bergmann: Alles was war, Erzählung, Arche Verlag, ISBN 978-3-7160-2716-5
.
.
.
.
Klaus Merz: «Unerwarteter Verlauf» (Gedichte)
.
Lyrik vom Feinsten
Susanne Rasser
.
 In wenigen Worten alles sagen, aufs Wesentliche konzentriert. Fokussiert. Unaufgeregt. Nah bei sich. Nah an den Menschen. Doch dabei immer auf jenen Abstand bedacht, der Freiraum bietet, der ein Miteinander erst möglich macht.
In wenigen Worten alles sagen, aufs Wesentliche konzentriert. Fokussiert. Unaufgeregt. Nah bei sich. Nah an den Menschen. Doch dabei immer auf jenen Abstand bedacht, der Freiraum bietet, der ein Miteinander erst möglich macht.
Dem Schweizer Autor Klaus Merz gelingt genau das. Seit vielen Jahren schon. Und er stellt es mit seinem Lyrikband «Unerwarteter Verlauf» erneut unter Beweis, dass er ein Meister der punktgenauen Schnörkellosigkeit ist.
Der aus dem schweizerische Aarau stammende und in Unterkulm lebende Lyriker und Prosaschriftsteller gehört zu den Längst-Etablierten, erhielt zahlreiche Auszeichnungen, zuletzt den Basler Lyrikpreis und den Friedrich-Hölderlin-Preis (beide 2012). Zudem ehrt der Innsbrucker Haymon Verlag seinen Hausautor mit einer Werkausgabe, die seit 2011 im Halbjahresrhythmus erscheint und insgesamt sieben Bände umfassen soll.

Der Schweizer Autor Klaus Merz stellt es mit seinem Lyrikband «Unerwarteter Verlauf» erneut unter Beweis, dass er ein Meister der punktgenauen Schnörkellosigkeit ist.
Klaus Merz gehört zu den bedächtigen, sehr gesetzten Autoren. Das Laute, Aufgebauschte ist seine Sache nicht. Und weil das Sich-Vergewissern etwas mit Gewissen zu tun hat, schaut er sehr genau hin, sortiert mit Bedacht und setzt auf ein menschliches Maß.
Merz gewährt uns mit seiner Lyrik Einblick in eine Welt, die frei ist von Trubel, Kraftmeierei und Trendgeschrei:
Wir drücken die Stirn / ans Fensterglas und / spenden leise Applaus. ■
Klaus Merz: Unerwarteter Verlauf – Gedichte, mit Vignetten von Heinz Egger, 80 Seiten, Haymon Verlag, ISBN 978-3-7099-7093-5
.
____________________________
Geb. 1965, lebt als Autorin von Lyrik, Erzählungen und Drehbüchern in Rauris/A
.
.
.
.
.
.
.
.
Eleni Torossi: «Als ich dir zeigte, wie die Welt klingt» (Roman)
.
Sehnsucht nach griechischer Hühnersuppe
Günter Nawe
.
 Eleni Torossi ist sicher eine sehr verdienstvolle und interessante Autorin. Die deutsch-griechische Schriftstellerin, in Athen geboren, lebt seit 1968 in München. Sie schreibt in zwei Sprachen, hat mehrere Geschichten und Hörspiele geschrieben und zahlreiche Bücher – u. a. «Warum Iphigenia mir einen Korb schenkte» – veröffentlicht.
Eleni Torossi ist sicher eine sehr verdienstvolle und interessante Autorin. Die deutsch-griechische Schriftstellerin, in Athen geboren, lebt seit 1968 in München. Sie schreibt in zwei Sprachen, hat mehrere Geschichten und Hörspiele geschrieben und zahlreiche Bücher – u. a. «Warum Iphigenia mir einen Korb schenkte» – veröffentlicht.
Soviel zur Person, weil Eleni Torossi – wie man zu Recht vermuten darf – mit ihrem neuen Buch «Als ich dir zeigte, wie die Welt klingt» einen autobiografischen Roman geschrieben hat. Damit erhält die Geschichte, die sie erzählt, ein hohes Maß an Authentizität. Denn sie ist die Tochter, die in Athen in Zeiten der Militärdiktatur aufwächst; deren Mutter, eine Hutmacherin, taub ist. Wie es sich lebt in diesen unruhigen Zeiten und warum beide Athen und eine Reise ins Ungewisse – nach Deutschland – antreten. Und wie es sich in Deutschland leben lässt.
Im Vordergrund ihrer Geschichte steht die Beziehung zwischen der tauben Mutter und der Tochter. Eine Beziehung, die sozusagen «wortlos» ist. Denn Eleni verständigt sich mit ihrer eleganten Mutter durch Gesten und Zeichen und mit Augen und Händen. Ein schwieriges Verfahren, das viel Geduld von beiden Seiten und große Vertrautheit miteinander erfordert. Und das dennoch weitestgehend gelingt. Auch wenn es Schwierigkeiten, immer wieder Verständigungsprobleme, Ängste und Schuldgefühle zu überwinden gilt – die Liebe zueinander widersteht allem. Es ist ein symbiotisch anmutendes Verhältnis, das Mutter und Tochter miteinander verbindet.

Der Roman «Als ich dir zeigte, wie die Welt klingt» von Eleni Torossi erzählt über die außergewöhnliche Beziehung eines Kindes und einer jungen Frau zu ihrer tauben Mutter. Und erzählt von einer Reise ins Ungewisse in den 60iger Jahren – von Athen nach München. Doch er zeigt dem Leser – das Buch hat doch einige Schwächen – kaum überzeugend, «wie die Welt klingt». Tiefenschärfe und Nachhaltigkeit gehören nicht zu den Stärken dieses Romans.
Eleni Torossi erzählt diese Geschichte mit sehr viel Einfühlungsvermögen und sehr einem sehr persönlichen und psychologischen Feingefühl. Das allerdings ist nur die eine Erzählebene des Romans. Die andere behandelt das «historische» Geschehen. Spielt sich doch die Lebensgeschichte dieser beiden Frauen im Kontext der Zeit ab. Eleni erlebt den Widerstand gegen die politischen Verhältnisse in Athen, ist teilweise auch in diesen Widerstand eingebunden. Die Folge: Die als Hutmacherin erfolgreiche Mutter und ihre Tochter machen sich irgendwann auf die Reise ins Ungewisse – nach Deutschland, nach München.
Hier gibt es andere, gänzlich neue Probleme: Sprachkenntnisse, Aufenthaltsgenehmigung, Arbeitserlaubnis. Die Mutter arbeitet als Küchenhilfe, die Tochter beginnt ein Studium. Herausforderungen, mit denen in den 60-iger Jahre alle Gastarbeiter und Migranten zu tun hatten. Caruso, Freund des Hauses, hilft, wo er nur kann. Parallel dazu engagiert sich Eleni in einer linken Exilantengruppe, die sich dem Kampf gegen die griechische Diktatur verschrieben hat. Was die Integration in Deutschland nicht leichter macht. Beide, Mutter und Tochter, erfahren auf höchst unterschiedliche Weise, «wie die Welt klingt». Und das sind nicht immer harmonische Klänge.
Trotzdem führen Mutter und Tochter kein schlechtes Leben. Es öffnen sich neue Türen in dieses neue Leben, und bald sind sie – die Geschichte zieht sich bis in die 90-ger Jahre – wie man so sagt: integriert. Was aber bleibt, ist die Zerrissenheit zwischen alter und neuer Heimat, die stille Sehnsucht nach dem Zurück, die «Sehnsucht nach der griechischen Hühnersuppe».
Das ist alles sehr schön und interessant und von Eleni Torossi gut erzählt. Dennoch bleiben ihre Figuren seltsam blass. Vor allem die Tochter. So erfahren wir zwar von ihrer Mitgliedschaft in linken Gruppierungen sowohl in Athen als auch in München. Wenig aber von ihren eigentlichen Überzeugungen, von ihrer inneren Verfassung. Die politischen und sozialen Gegebenheiten für die Gastarbeiter in Deutschland werden recht einseitig-kritisch beleuchtet. Es fehlt die Tiefenschärfe. Und so überzeugt dieser Roman insgesamt nur bedingt, er lässt beim Leser Fragen offen und lässt Nachhaltigkeit vermissen. ■
Eleni Torossi: Als ich dir zeigte, wie die Welt klingt, Verlag Langen Müller, ISBN 978-3-7844-3356-1
.
.
.
.
.
Jörg Schuster: «Kunstleben – Zur Kulturpoetik des Briefs um 1900»
.
Der Brief als artifizieller Schutzraum und schriftliche Selbststimulation
Dr. Karin Afshar
.
 1. Vorwort zu einer Besprechung
1. Vorwort zu einer Besprechung
Vor mir liegt eine Habilitationsschrift, ein Buch von 396 Seiten, ohne Literarturverzeichnis. «Kunstleben» heißt dieses Buch – der Untertitel lautet: Zur Kulturpoetik des Briefs um 1900 – Korrespondenzen Hugo von Hofmannsthals und Rainer Maria Rilkes. Auf dem Einband: Rilke – schreibend.
Abgesehen davon, dass ich einen Vorteil habe (ich muss und werde nie eine Habil-Arbeit verfassen), habe ich ein Problem: ich kann das Thema und das Buch nicht auf einer Seite besprechen. Machen Sie sich auf ein längeres Verweilen-Müssen gefasst. Ferner hoffe ich, dass sowohl Jörg Schuster als auch der Wilhelm Fink Verlag Verständnis dafür haben, wenn ich die Rezension so gestalte, dass sie auch für Nicht-Wissenschaftler lesenswert und informativ wird. Deshalb werde ich meinen Text nicht als Literaturwissenschaftlerin oder auch nur annähernd als Germanistin verfassen, sondern als neugierige Leserin, die wissen will, was es mit dem Briefeschreiben um 1900 (zugegebenermaßen interessiert mich Rilke mehr als Hofmannsthal) auf sich hat.
Ich hoffe außerdem, dass auch jene meine Rezension lesen, die vielleicht niemals das Fachbuch – ein ausgezeichnetes Kompendium voller Details und Verknüpfungen – in die Hände bekommen.
Es geht also um Briefe, und um eine bestimmte Art von Briefen, die zu einem bestimmten Zweck und mit bestimmten Inhalten mit ganz bestimmten Mitteln geschrieben wurden. Die Aufgabe, dieses «bestimmt» zu beschreiben, hat sich Jörg Schuster gesetzt. Der Mann hat Neuere deutsche Literatur, Allgemeine Rhetorik und Philosophie studiert. Seine Dissertation hat er in Tübingen über die «Poetologie der Distanz – Die ‘klassische’ deutsche Elegie 1750-1800» verfasst. Das war 2001, 2012 legte er in Marburg, wo er an der Philipps-Universität als Wissenschaftlicher Mitarbeiter wirkte, seine Habilitationsschrift vor. Wie ich dem Netz entnehmen kann, lehrt er zur Zeit am Germanischen Institut der Westfälischen Wilhelms-Universtät in Münster.
2. Wer waren Hugo von Hofmansthal und Rainer Maria Rilke?
Sie lesen diese Rezension bestimmt deshalb, weil Sie einen der beiden Herren kennen? Bevor ich zu den Briefen komme, erlauben Sie mir, Ihnen einige Angaben zu Hugo von Hofmannsthal und Rainer Maria Rilke ins Gedächtnis zurückzurufen. Ersterer lebte von 1874 bis 1929, war österreichischer Schriftsteller, Dramatiker und Librettist. Er wird als der Repräsentant des fin de siècle und der Wiener Moderne schlechthin bezeichnet und hat – «Triumphpförtner» österreichischer Kunst – die Salzburger Festspiele (1918/1919) mitgegründet, die vielleicht nicht eine Gegenidee, so doch aber Entwurf zu einer Alternative zur Wiener Moderne sein wollte: klerikal, antidemokratisch, antiaufklärerisch.1)
Hugo von Hofmannsthal hatte bereits promoviert und habilitiert, als er um 1900 in eine persönliche Krise stürzte. Am 18. Oktober 1902 erschien Ein Brief («Chandos-Brief» – ein fiktiver Brief eines Lord Chandos, der seine Zweifel an den Möglichkeiten des sprachlichen Ausdrucks niederschreibt) in der Berliner Literaturzeitschrift Der Tag. Der Chandos-Brief zeigt, aus welchen Gedanken heraus Hofmannsthal die Poetologie seiner Jugend ablegt, und markiert eine Zäsur in Hofmannsthals Kunstkonzept. Rückblickend erscheint ihm das bisherige Leben als bruchlose Einheit von Sprache, «Leben» und Ich. Nun aber kann das Leben nicht mehr durch Worte repräsentiert werden; es ist vielmehr direkt in den Dingen präsent… Neben lyrischen und theatralischen Werken ist eine umfangreiche Korrespondenz Hofmannsthals in Höhe von etwa 9’500 Briefen an nahezu 1’000 verschiedene Adressaten überliefert.
Rainer Maria Rilke (1875 – 1926) gilt als bedeutendster Lyriker Deutschlands. 1895 bestand er die Matura und begann Literatur, Kunstgeschichte und Philosophie in Prag zu studieren, wechselte 1896 zur Rechtswissenschaft und studierte ab September 1896 in München weiter. Etwa von 1910 bis 1919 hatte Rilke eine ernste Schaffenskrise, der dann allerdings eine um so intensivere Schaffenszeit folgte. Er vollendete innerhalb weniger Wochen im Februar 1922 die Duineser Elegien. In unmittelbarer zeitlicher Nähe entstanden auch die beiden Teile des Gedichtzyklus Sonette an Orpheus. Beide Dichtungen zählen zu den Höhepunkten in Rilkes Werk. Sein umfangreicher Briefwechsel – wird mit mehr als 10’000 Briefen angegeben – bildet einen wichtigen Teil seines Schaffens. Es wurden mittlerweile 70 Bände mit Rilke-Briefen herausgegeben. Allein eine Ausgabe von 2009 umfasst 1134 «Briefe an die Mutter», darin enthalten sind die Briefe aus der Kinder- und Jugendzeit. Es hat den Anschein, als hätte Rilke in seinen Briefen gelebt. Hofmannsthal wie Rilke waren «manische» Briefeschreiber.
3. Warum Briefe untersuchen?
Bevor ich weiter auf ausgewählte Themen eingehe, die Schuster in seiner Arbeit herausarbeitet, wende ich mich an Sie. – Schreiben Sie (noch) Briefe? – Würde ich gefragt werden, würde ich antworten: ich habe früher viel geschrieben, heute greife ich kaum noch zu Papier und Stift und schreibe einen Brief von 10 oder 12 Seiten. Meine heutigen Briefe beschränken sich auf in die Tastatur geschlagene Buchstaben in Mails, die ausgedruckt allerhöchstens die Länge einer halben DIN A 4-Seite erreichen.
Briefe sind ein Medium, das uns zur Verfügung steht, um zu Papier zu bringen, was an Gedanken mehr oder weniger geordnet in uns herumschwirrt. Briefe schreiben wir, weil und wenn unser Gegenüber abwesend ist. Der Gesprächspartner, mit dem wir uns im Dialog befinden, ist räumlich oder zeitlich von uns getrennt – wir möchten ihm etwas mitteilen. In diesem Wunsch, mitzuteilen, schreiben wir von uns, von dem, was uns zugestoßen ist, was wir gedacht, gefühlt und getan haben. Im Schreiben erwachen Empfindungskräfte – wir empfinden uns als uns, wir finden unsere Identität und – auch das ist möglich, unsere Individualität. Tagebuchschreiben und das Schreiben von Briefen haben diese identitätssteigernde Kraft.
Briefe zeugen vom Schreiber und seiner Autobiographie; sie entstehen nie in einem Vakuum. Manche Briefe sind als Liebesbriefe exklusiv, und zwei Menschen und deren Beziehung zueinander vorbehalten, andere sind Abbildungen der Alltäglichkeit, vielleicht Beschreibungen der Lebens- und Gedankenwelt, andere Briefe gehen über Schreiber und Leser hinaus und sind Abbilder der Zeit und Umstände, Abbilder der Problemlösungsfindungen dieser Menschen, noch andere sind Korrespondenzen zwischen Lehrer und Schüler, Ratgeber und Ratsuchender.
Und manchmal sind die Umstände, unter denen man schreibt, kritisch – dann sind die Briefe «Krisensymptome» (vgl. Angelika Ebrecht 2000) des Selbst wie auch der Zeitepoche.
Briefe können inspirieren, d.h. der Gedanke, jemandem darüber zu schreiben, woran man gerade arbeitet, kann neue Ideen freisetzen, zu Höhenflügen bringen. Je nach Briefpartner stachelt man sich gegenseitig an, oder zieht sich herunter.
Das Gros der Literaturwissenschaftler hat jedenfalls die Korrespondenzen von um 1900 als Spiegel von «Krisensymptomen» gelesen und bezeichnet: Als Ausdruck der Unsicherheit, die «das Bürgerliche» erfasst hatte. Die Modernisierungsprozesse sind eine nächste Interpretationssicht auf die Bedeutung der Briefe: Was machte die Urbanisierung, Industrialisierung, die Steigerung der Mobilität und die Beschleunigung mit den Menschen überhaupt? Jörg Schuster jedenfalls fragt in seinem Buch nach einer noch «anderen» Funktion der Briefe – nach der produktiven kulturpoetischen, und er hat sich zur Beantwortung seiner Frage der Briefwechsel jeweils von Hofmannsthal und Rilke angenommen.
Was findet er? – Analog zum Jugendstil in der Bildenden Kunst und Architektur findet er Briefe als Form der «Gebrauchskunst». Diese Art von Kunst reagiert auf anstehende Modernisierung. Inwieweit es sich um die Konstruktion einer Text- und Lebenswelt, die nur als ästhetische zu ertragen ist, handelt, ist Gegenstand von Schusters Buch. Er studiert und analysiert genauer hin, er nimmt «Versuche literarischer Kreisbildung» und Experimente «ästhetischer Erziehung» ebenso unter die Lupe wie die Ökonomie des Briefs und – im Kontext einer Kulturpoetik des (Innen-)Raums um 1900 – Konzepte des «epistolaren Interieurs». (Zugegeben, das habe ich dem Ankündigungstext entnommen.)
Das Buch ist, wie bereits gesagt, umfangreich. Ich greife deshalb nur einzelne Kapitel heraus und stelle Sie Ihnen genauer vor.
4. Hofmannsthals bitterer Briefwechsel mit Stefan George –
symbolisches Experiment am Vorübergehenden
Schuster beginnt mit einem Gedicht Hofmannsthals2) – George nach einem Treffen überbracht –, in dem es zunächst unverfänglich um eine poetische Standortbestimmung geht, bei der George vom Jüngeren die Rolle des Lehrers zugewiesen bekommt. Hofmannsthal ist 17, George 23 Jahre alt. Dem Gedicht ist ein Geschenk vorangegangen: George hat Hofmannsthal seinen ersten, im Vorjahr erschienenen Gedichtband Hymnen geschenkt und ihm vermutlich auch Einblick in seine Übersetzungen aus dem Französischen gegeben. Der Ältere erläutert dem Jüngeren das Pariser Vorbild einer «poésie pure», die mit der Tradition der Weltabbildung in der Literatur radikal gebrochen hat: das Gedicht ist nunmehr subtiles Gewebe von bildlichen Übergängen, von Klängen und rhythmischen Einheiten, ein autonomes Gebilde, das die Möglichkeiten der Sprache und nicht die Zwänge der Wirklichkeit offenbart. Hofmannsthal lernt schnell. Schon wenige Tage später, am 21. Dezember 1891, schickt er George dann sein Gedicht, das von Anspielungen auf die ausgetauschten und besprochenen Texte durchsetzt ist.
Das Gedicht ist eine klingende Antwort auf ein Vorübergehen, das steht fest, und es gleicht einem Gedicht Baudelaires «À une passante», das George übersetzt hatte. Was ist die Absicht Hofmannsthals? Meint er mit dem Vorübergehenden George, oder sich selbst? – Viele Andeutungen, über die sich zu lesen lohnt, und ein flüchtiges Erlebnis als Inspiration zur Kunst. – Interessanterweise gibt es dieses Gedicht in zwei Versionen. Eine in deutscher Schrift, mit großen Anfangsbuchstaben und Interpunktion auf Papier mit dem Wappen Hofmannsthals. Das andere in lateinischer Schrift, mit kleinen Anfangsbuchstaben, ohne Interpunktion. Diese Version zitiert Georges Schriftstil und dieses ist es, was Hofmannsthal ihm überreicht.
Gedicht an einen Vorübergehenden ist ein Widerspruch an sich, aber er wirkt. Hofmannsthal selbst gibt an, dass es ein persönliches Bekenntnis sei – er selbst sei der Vorübergehende, der Inspirierte. George allerdings fasst das Gedicht als Ausblick auf eine festere, dauerhaftere Zusammenarbeit auf – als ein Angebot zu Nähe. Es kommt zu einem Missverständnis, das die beiden Männer anschließend immer weiter bearbeiten. Jörg Schuster geht nun dem darauf folgenden Briefwechsel nach und findet «den Haken» in der Beziehung zwischen den beiden Männern und spannt einen Bogen zur Funktion des Briefes.
Auch der Briefwechsel hat den Charakter eines Gesprächs zwischen Meister (George) und Jünger (Hofmannsthal): der Meister ist in Besitz des Geheimnisses des mit der künstlerischen Produktion verbundenen Leidens (S. 49), das er nach und nach lüften wird, indem er Andeutungen macht. Die Briefe nun atmen die Sehnsucht nach poetischer Inspiration auf beiden Seiten, für George noch essentieller als für Hofmannsthal. Im Verlaufe des Briefwechsels kehrt George von der «verletzbaren Gewalt» (ein Bekenntnis, das er abgelegt hat) zu einem vornehmen Pathos der Distanz zurück, woraufhin Hofmannsthal ratlos nachfragt, was geschehen sei. Dazu verweigert George die weitere Kommunikation und bricht in ein Schweigen ab.
Hofmannsthal schreibt einen nächsten Brief an George: «Ich kann auch das lieben, was mich ärgert», bekennt er. George findet diesen Brief zu diplomatisch, zu glatt und neutral. Hofmannsthal halte sich bedeckt. Die Korrespondenz eskaliert, und mündet in Georges Androhung zum Duell. Wie nun rettet sich Hofmannsthal? – Er beruft sich auf seine Nerven («Verzeihen Sie meinen Nerven […] jede vergangene Unart»). Die Nerven erlauben dem reizbar-sensitiven Künstler alles. George hat allerdings mit der Androhung übertrieben, und versucht in der Folge abzuwiegeln. Dabei wirkt er beinahe «komisch» (S. 53), Hofmannsthal kann das nicht einordnen – der Bruch in der Beziehung ist nicht zu vermeiden.
Hofmannsthal und George ringen in ihrem Briefwechsel um Distanz und Nähe. Sie kennen sich aus Briefen, haben sich aber nur selten getroffen, in ihrer distanzierten Nähe sind Briefe ihr Medium zum Austausch von Lebenszeichen. – Nun ist George aber der, der die Regeln vorgibt. Der Jüngere entzieht sich, bleibt auf «orientalisch» (S. 55) und auf einschmeichelnde Art konsequent und virtuos. Hofmannsthal beherrscht schon hier die Kunst der «epistolaren insinuatio» (rhethorisches Mittel, das jemand verwendet, wenn er von vorneherein davon ausgeht, dass sein Zuhörer gegen ihn ist): er entzieht sich, macht sich klein, gibt vor, dem Gegner nicht gewachsen zu sein.
Alles in allem betrachtet, ist dieser Briefwechsel das Land, in dem die Krise (die je eigene der beiden und die ihrer Beziehung) in gegenseitigem Bekennen, Fordern, Ausweichen, Vereinnahmungsversuchen als Krisenbriefwechsel ausgetragen wird.
5. Die einsame Imagination, Lebensverdächtigung und ein
verfehlter Geburtstagsbrief – Der Briefwechsel mit Richard Beer-Hofmann
In den vorangehenden Kapiteln hat Schuster bereits eine «Brüchigkeit» in Hofmannsthals Briefen herausgearbeitet. Im Briefwechsel mit Richard Beer-Hofmann tritt eine neue Qualität hinzu.
Mit Beer-Hofmann verbindet Hofmannsthal «große menschliche Vertrautheit» (S. 118), die beiden kennen einander gut und treffen sich häufig. Auch sie sind junge Männer, als sie sich (um 1896/97) kennenlernen: Beer-Hofmann ist etwa 31 und Hofmannsthal 23 Jahre alt. Ihre Begegnungen haben für beide einen hohen Stellenwert, es gibt viele Gespäche über Machtverhältnisse und die Rollenverteilung. In diesem (im Vergleich zu dem mit George) Briefwechsel ist Hofmannsthal der Zudringlichere und Beer-Hofmann der Zurückhaltende. Ausgerechnet der Ästhet Hofmannsthal lässt sich hinreißen und schreibt «Hässliches, ja Ekelhaftes» (S. 119). Hofmannsthal sucht die Konfrontation und provoziert. «Epistolares Imponiergehabe», heißt es bei Schuster, lege er an den Tag. Er trifft auf einen, der sich nicht zwingen lässt: «Ich weiß, Sie nehmen es mit mir nicht genau; Briefe «schuldig sein» ist ja auch nur ein Bourgois-Begriff.» (S. 120). Doch Hofmannsthal nimmt es sehr genau, und ärgert sich. «Warum schreiben Sie mir nicht?» – Beer-Hofmann verweigert sich. Er will nicht als «Inspirationsmittel» für die poetische Produktion jüngerer Kollegen fungieren. Er identifiziert sich mit der Rolle des «Hemmschuhs». Hofmannsthal wiederum fühlt sich nicht geachtet genug. Es deprimiert ihn, dass die Beziehung sich nicht als ideale poetische Lebens- und Arbeitsgemeinschaft entwickelt bzw. gestaltet. Es gelingt ihm nicht, Beer-Hofmann aus dem Leben hinein in seine Briefwelt zu ziehen (S. 124), schreibt in einer Mischung aus Zudringlichkeit und Ich-Bezogenheit.
In einem Geburtstagsbrief (vom 6. Juli 1899) an Beer-Hofmann bricht – völlig deplaziert und verfehlt – die Erwartung aus Hofmannsthal heraus. Hier liegt ein Konflikt, so schreibt Schuster, zwischen dem Menschlichen (dem Leben) und der produktiven Fähigkeit (bzw. der Poesie) vor. Das Leben kann sich uns im Brief nur in Form von Schrift und Imagination nähern, wobei die Imagination eine emphatische ist. Einfühlung ist hier das Stichwort – paradoxerweise fühlt sich Hofmannsthal so sehr in Beer-Hofmann ein, dass er ihm mit seiner Kritik und den Vorwürfen zu nahe tritt und die Grenze des guten Anstands überschreitet. Beer-Hofmann antwortet lakonisch: «Lieber Hugo, Sie haben Recht, nur […] an einen Arzt oder Medikamente glaube ich bei diesen Dingen nicht.» – Bündiger, so Schuster, könne die eigene Resignation, aber auch das Zurückweisen der selbstbezogenen Zudringlichkeit Hofmannsthals nicht ausgedrückt werden (S. 126). Briefe – so sehen wir hier – können und werden im Sinne einer «Distanzmedizin» geschrieben (S. 181).
«Medizinbriefe» wie die an Beer-Hofmann sind einseitig – sie sind und bleiben Hofmannthals «Welt in der Welt». Anders als der Poet Hofmannsthal beherrscht der Briefschreiber Hofmannsthal etliches nicht: souveränes, prägnant-wirkungssicheres sprachliches Übertragen und Hervorrufen von Stimmungen. – Dass und wie es im Briefwechsel zu einer Wende kam, ist im Buch nachzulesen – die Auflösung auf Seite 147. In dieser Art, ausführlicher und noch mehr Hintergründe heranziehend, geht Schuster die Briefe durch, die er in größere und kleinere Kategorien zusammenfasst.
6. Rilkes transportable Welt und sein fein verteiltes Irgendwo-Sein
Wussten Sie, dass Rilke täglich durchschnittlich an die zehn Briefe schrieb? – Stellen Sie sich vor, Sie schrieben heutzutage täglich an 10 Personen aus Ihrem Bekanntenkreis 10 Seiten!? An manche dieser Personen zweimal pro Woche.
Rilke produziert in guten Zeiten Briefe «mit Dampf» – und vermerkt außerdem noch alle Daten rund um die Briefe. Ist er ein Maniker? Ist er nicht – schon einmal vorweggenommen. Hätte es damals facebook oder überhaupt das Internet gegeben – Rilke hätte es genutzt: um ein Netzwerk aufzubauen, um seine Werke vorzubereiten und sich selbst zu vermarkten. Er war ein Öffentlichkeitsarbeiter.
Wir erfahren, dass Rilke Wert auf das Aussehen seiner Briefe legte: Briefpapier wird von ihm speziell ausgewählt, er schreibt in einer besonderen Handschrift («th» und «y» schreibt er auf unverwechselbare Weise und lädt sie mit einer besonderen Bedeutung auf). Rilkes Briefe sind Gesamtkunstwerke, die gleichzeitig den Alltag poetisieren und entpragmatisieren – und die doch wieder nützlich werden. Im Kreis des literarischen Betriebs Fuß zu fassen, ist Rilkes Absicht. Die Briefe dienen ihm als Ersatz für noch nicht erlangten Erfolg vor größerem Publikum. Er schafft sich einen Kreis, in dem die Briefe einen Heimatersatz für ihn, den Ortlosen, bilden. Doch das «Irgendwo», das er sich damit verschafft (dazu mehr weiter unten), ist nicht der letzte Aspekt dieser Briefe.
Für Rilke ist der Brief nicht Medium der Intimität, sondern Vorzeigeobjekt. Das epistolare Subjekt Rilke – so Schuster – bildet eine Funktionsstelle ähnlich einer Durchgangsstation, eines Relais (S. 222). Rilkes Briefe sind nämlich öffentlich: sie dürfen und sollen von den Adressaten anderen im Bekanntenkreis gezeigt werden. Auch das «Subjekt des Empfängers» wird somit zur Funktion: er soll multiplizieren.
Rilke, der Vielschreiber, versteht die an einem Tag geschriebenen Briefe als eine Einheit – und als Werk an sich, das erlaubt, das Leben ätherisch und literalisiert zu «rezipieren und zu modellieren» (S. 224).
Ganz abgesehen davon macht Rilke das, was auch heute die Selfpublisher mit ihren selbstveröffentlichten Werken tun: Sie probieren Entwürfe und Vorarbeiten im Netz aus. Sie achten auf ihre Wirkung und Rückmeldung, nehmen Anregungen auf, ändern ab. – Vorab in den Briefen Rilkes öffentlich gemachte Textabschnitte finden sich in seinen literarischen Werken wieder. Rilke inszeniert den Schaffensprozeß in seinen Briefen.
7. Esoterik der Briefe und die Exoterik der Konversation
Dass Rilke zwischen einem Gespräch und einem Brief einen großen Unterschied macht, ist bereits mehrfach durchgeschimmert. Das Konkurrenzverhältnis der beiden «Medien» zueinander ist über Jahrzehnte sein Thema (S. 224): Dem Draußen des Gesprächs steht das einsame Drinnen des Briefs entgegen. Briefe zu schreiben, ist ein Sich-Sammeln. «Als ob Du bei mir eintreten könntest» ist der Titel eines Abschnitts (S. 249ff), in dem Schuster sich mit einem Brief Rilkes an Lou Andreas-Salomé und dem nachfolgenden Briefwechsel beschäftigt. Der Brief, um den es gehen wird, ist vom 13. Mai 1897. Es ist Rilkes erster Brief an die 10 Jahre ältere Frau, die später 30 Jahre lang erst seine Geliebte, dann Vertraute und «Beichtmutter» sein wird. Ohne Lou Andreas-Salomé wäre Rainer Maria Rilkes Leben anders verlaufen, heißt es. Er lernt sie in München, wo er studiert und Kontakte zur literarischen Szene sucht, im Mai 1897 eher zufällig kennen. Er ist 26 Jahre alt, Lou Andreas-Salomé bereits renommierte Autorin. Man kennt ihre Erzählungen und Romane, ihr Buch über Ibsen. Sie hat gerade einen Heiratsantrag von Nietzsche abgewiesen. Der erste Brief, den Rilke schreibt, verrät eine geradezu religiöse Verehrung und er verfolgt eine deutliche Absicht: er möchte ein exklusives Verhältnis zu ihr haben, schreibt sie persönlich und sehr höflich an, versichert ihr, dass es eine «Auszeichnung» sei, sie kennenzulernen – und möchte ihr imponieren (S. 249). Was Rilke dabei schon damals «beherrscht» ist, was man heute «name-dropping» nennt.
Rilke hatte die Dame am Vortag getroffen und möchte – enttäuscht von der mündlichen Kommunikation – seine Bewunderung auf dem brieflichen Weg ausdrücken. Der Brief, so Schusters Hypothese, stiftet somit eine Beziehung zu Lou Andreas-Salomé im Sinne «eines der Exoterik des gesellschaftlichen Gesprächs entgegengesetzten esoterischen Mediums» (S. 250).
In diesem Fall sehen wir den Brief als «Medium der Nähe und der Intimität», wobei er dem Gespräch, der vollständigeren Form der Kommunikation, unterlegen ist. Die bereits angedeutete Thematik «Gespräch vs. Brief» bleibt während der Korrespondenz und im Verlauf der Liebesbeziehung zu Lou Andreas-Salomé bestehen. Nach Abbruch und Wiederaufnahme der Beziehung gilt jeder Brief, den er ihr schreibt, dem Wunsch nach dem Gespräch. Da dieses zwischen beiden schwierig ist, sehnt sich Rilke alsbald nach an einem Ort, nach einer Wohnung, an dem und in der er das nötige «setting» findet, den Ruheort, um die nötigen Briefe schreiben zu können. Überhaupt fehlt Rilke eine «Stube», also erbaut er sich eine («ein Stück Stube […], die ich mir damals erbaut habe» (S. 257) – er arrangiert sich ein Stück Wirklichkeit. Der Nachteil dieser Wirklichkeit besteht darin, dass es sich nicht um Lebenswirklichkeit handelt, sondern um das Hervorbringen von Schrift und Poesie. Der Verfasser der Schriften jedoch ist nicht mehr als eine «zerbrochene Schneckenschale». Das Briefeschreiben wird nicht nur zum Ausweg aus der Suche nach dem (Schreib-) Ort sondern auch aus Rilkes Dilemma. Im Laufe des Briefwechsels mit Lou Andreas-Salomé wird der Brief immer mehr der Ort der Ruhe, die Schreibsituation des Briefes verwirklicht seine Sehnsucht – und das ersehnte Gespräch damit schließlich überflüssig (S. 264). Wie es nun im Einzelnen mit Rilke und AS endete, kann dem Buch entnommen werden. Soviel an dieser Stelle. Zusammenfassend kann gesagt werden: auch wenn zwar im Falle dieses Briefwechsels ein «Ausschluss der Öffentlichkeit» vorliegt, ordnet Schuster den Brief bzw. den Briefwechsel in letzter Konsequenz doch eher dem «Zweck einer Stimulation» zu.
8. Lebenspraxis + Briefpoesie = die kleine Lebenshilfe?
Die vorangegangenen Seiten haben lediglich einen kleinen Ausschnitt aus dem Gesamtwerk gezeigt. Es gibt ungleich mehr zu entdecken. Der ältere Hofmannsthal schreibt in seinen Briefen anders und über anderes, ebenso der ältere Rilke, der viele Briefe von männlichen wie weiblichen Lesern erhält und «Lehrbriefe» schreibt. Schuster analysiert etliche dieser Briefwechsel. Zu kurz gekommen in der Rezension ist der Lebens- und Schaffenshintergrund der Beteiligten, der Briefe zu Ratgebern werden lässt. Dieses und eine akribische Untersuchung der dichterischen Sprache habe ich links liegen gelassen.
Zu Anfang hatte sich Schuster die Frage gestellt, inwieweit die Briefkultur um 1900 symptomatisch für die kulturgeschichtliche Situation des fin de siècle und des frühen 20. Jahrhunderts ist. Was leisten Briefe dieser Zeit, was bringen sie auf kommunikativem Weg hervor? (S. 388)
Die Funktion der Briefe ist – alles in allem und zusammenfassend – dass sie dem Zweck dienen, Distanz zu schaffen und zu wahren. In dieser Distanz werden sie zu Repräsentanten des «Jugendstils» und damit – Gebrauchskunst (S. 389), mit der die Autoren die «artifizielle Innen-Einrichtung ihrer sozialen Welt» gestalten.
Hoffmannsthal arrangiert sich die Wirklichkeit, wie man einen Ausstellungsgegenstand hinstellt und arrangiert (S. 388), und Rilke verwebt sich, mittels seiner Briefe kontinuierlich in den Kokon einer Einrichtung.
Die Briefe fungieren als zugleich «private» wie auch höchst artifizielle Schutzräume, statt eines tatsächlichen Zusammenwirkens herrschen einsame Imagination und schriftliche Selbst-Stimulation vor, bei denen die Adressaten als Vorwand dienen (S. 392). Bei Rilke haben wir noch den Eindruck, wir könnten jederzeit eintreten, dennoch hält er eine tatsächliche Begegnung in der Schwebe.
Zwei Repräsentanten ihrer Zeit – und es bleibt mir nach der Lektüre die traurige Frage (sie wird hoffentlich erlaubt sein): Was wohl, wenn wir unsere heutigen Briefwechsel ähnlich akribisch unter die Lupe nähmen und eine Anamnese vornehmen würden, die Diagnose ergäbe? Für mich ganz persönlich nehme ich mit, dass ich in puncto Rilke die richtige, hier bereits angedeutete, Vermutung hatte. Leider konnte ich nicht auf all die anderen Fragen eingehen, die im Buch aufgeworfen und beantwortet werden. Leider, auch das bereits angedeutet, bin ich zu wenig Literaturwissenschaftlerin, um Schusters Werk für die Literaturwissenschaft würdigen zu können. Es sei dennoch ans Herz gelegt: wenn wir unsere Geschichte verstehen, verstehen wir auch die Gegenwart! ■
Jörg Schuster: Kunstleben – Zur Kulturpoetik des Briefs um 1900 – Korrespondenzen Hugo von Hofmannsthals und Rainer Maria Rilkes, 428 Seiten, Wilhelm Fink Verlag, ISBN 978-3770556021
.
1) Norbert Christian Wolf: Eine Triumphpforte österreicherischer Kunst – Hugo von Hofmannsthals Gründung der Salzburger Festspiele, Jung und Jung (Salzburg)
2) Herrn Stefan George
einem, der vorübergeht
du hast mich an dinge gemahnet
die heimlich in mir sind
du warst für die saiten der seele
der nächtige flüsternde wind
und wie das rätselhafte
das rufen der athmenden nacht
wenn draussen die wolken gleiten
und man aus dem traum erwacht
zu weicher blauer weite
die enge nähe schwillt
durch pappeln vor dem monde
ein leises zittern quillt
.
Karin Afshar im Glarean Magazin
.
.
.
.
.
Anne Carson: «Decreation» (Gedichte – Oper – Essays)
.
«Die Liebe ist immer du»
Günter Nawe
.
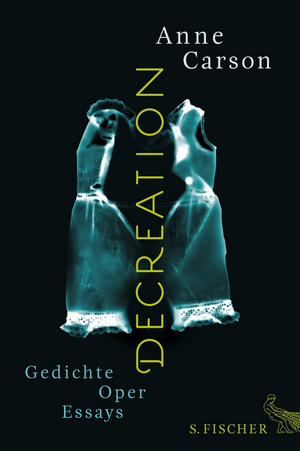 Den Titel ihres neuen Buches hat die kanadische Autorin Anne Carson von der französischen Philosophin Simone Weil übernommen. Für Weil – sie hat diesen Begriff geprägt –, von der sich die Carson stark beeinflusst sieht, bedeutet «décréation» einerseits Analyse der Selbstreflexion des Menschen und zugleich «Rückschöpfung», also eine «Ent-Schaffung»; anders: alles Erschaffene noch einmal ins Unerschaffene zu überführen.
Den Titel ihres neuen Buches hat die kanadische Autorin Anne Carson von der französischen Philosophin Simone Weil übernommen. Für Weil – sie hat diesen Begriff geprägt –, von der sich die Carson stark beeinflusst sieht, bedeutet «décréation» einerseits Analyse der Selbstreflexion des Menschen und zugleich «Rückschöpfung», also eine «Ent-Schaffung»; anders: alles Erschaffene noch einmal ins Unerschaffene zu überführen.
Aus diesem philosphisch-religiösen Gedankengut und in diesem Kontext der Simone Weil speist sich im Wesentlichen die Literatur der Anne Carson – vor allem, was das neue Buch «Décréation» betrifft. Es enthält Gedichte, Essays und ein Opernlibretto (nicht zu vergleichen mit einem herkömmlichen Libretto). Sehr unterschiedliche Spielarten der Literatur also, die jedoch bei Anne Carson in ihrem Innersten zusammenhängen. Auch der Lyrikerin geht es darum, eine Art «Rück-schöpfung» zu «inszenieren», indem sie ihre Vorstellung davon als Frage formuliert. Und dies Genre-übergreifend, sozusagen als Brückenschläge.
So in den Gedichten, die vor allem ihrer Mutter gewidmet sind. Sie ist «die Liebe meines Lebens». Mit ihr redet sie in ihren Versen: «Wenn ich mit meiner Muter spreche, mache ich es schön…». Von ihr hat die Dichterin gelernt: «Die letzte Lektion einer Mutter in einem Haus im letzten Licht / bringt den Ruin der Welt und den Handel zum Erliegen…». «Diese Stärke, Mutter: hervorgewühlt. Gehämmert, gekettet, / geschwärzt, gesprengt, heult, holt aus…».
Anne Carson, 1950 in Toronto geboren, ist im deutschen Sprachraum bisher durch die Bücher «Glas, Ironie und Gott» (Gedichte, 2000) und «Rot: Ein Roman in Versen» (2001) bekannt geworden Jetzt also «Décréation», und im Herbst wird der Band «Anthropologie des Wassers» erscheinen. Alle Bücher dieser Dichterin überzeugen durch die Klang- und Aussagekraft ihrer Poesie, durch die Intensität ihre Sprache, durch den Verzicht auf jegliches Pathos und die Bandbreite ihrer Themen. Großes Lob an dieser Stelle für Anja Utler, die «Decreation» aus dem Amerikanischen sehr feinfühlig ins Deutsche übersetzt hat. «Decreation» ist so eine weitere Möglichkeit, ein Versuch der Annäherung an eine der bedeutendsten Lyrikerinnen unserer Zeit.
Die lyrische Diktion dieser Autorin ist oft experimentell – auch von der formalen Struktur der Gedichte her. Ihr poetisches Credo: «Du kannst nie genug wissen, nie genug arbeiten, niemals die Infinitive und Partizipien auf genügend befremdliche Art verwenden, nie die Bewegung brüsk genug ausbremsen, nie den Geist schnell genug hinter dir lassen.» Das gilt – hervorragend umgesetzt – für die Verse, für ihre Essays und das Opernlibretto: zusammengefasst in diesem wunderschönen Band.
In dem kleinen Text «Jedes Abgehen ist ein Anfang» dekliniert Anne Carson zum Beispiel die verschiedenen Lesarten des Schlafs. Und bemüht dabei Aristoteles, Kant und Keats, um sich am Ende ausführlich Virginia Woolf zu widmen. Und so lesen wir «O zarter Salber stiller Mitternacht… Beschütz mich dann, dass nicht der Tag erneut / Aufs Kissen scheint, der mich so leiden ließ; …».

«Décréation» ist ein außergewöhnliches Buch einer außergewöhnlichen Dichterin. Klug, anregend und voller sublimer Erkenntnisse. Anne Carson gehört zweifellos zu den bedeutendsten zeitgenössischen Lyrikerinnen – und «Decreation» ist bis jetzt eines ihrer wichtigsten Werke.
Ihr großartiger Essay «Decreation – Wie Sappho, Marguerite Porete und Simone Weil Gott sagen» setzt die gelernte Gräzistin sich mit drei großen Frauen und ihren «spirituellen Erlebnissen» auseinander. Sappho, die die Liebe pries und diesen Lobpreis der Göttin Aphrodite weihte; Marguerite Porete hat über die Liebe Gottes geschrieben und wurde dafür 1310 als Ketzerin verbannt; Simone Weil, die «Erfinderin» des Begriffs der «décréation», Altphilologin und Philosophin hatte, wie die Carson schreibt, «ein Programm, mit dem sie ihr Selbst aus dem Weg schaffen wollte, um zu Gott zu gelangen. Um Liebe also geht es diesen drei Frauen, um Liebe auch geht es auch Anne Carson. Auch im Operntext, der ebenfalls den Titel «Decreation» trägt. So lässt sie Hephaistos singen: «Die Liebe ist immer du, / wenn sie frisch ist. / Wenn du da bist, wenn sie frisch ist, wenn sie frisch ist, wenn du da bist, / die Liebe ist immer, / immer / wenn du da bist.». Oder, wenn im 3. Teil des Librettos Simone die «Arie des Rückschöpfens» singt.
Und um «Erhabenes», einer Art Gedichtzyklus, in dem die Autorin in teilweise enigmatische «Versen» Kant eine Frage zu Monica Vitti stellen und Longinus von Antonioni träumen lässt.
Was aber ist dieses Erhabene, was ist die Seele und welcher Schlaf ist Befreiung vom Selbst? Zu erfahren vielleicht im Gespräch mit Gott, das wie Simone Weil auf andere Art auch Anne Carson führt. Es ist ein nahezu undurchdringliches Geflecht, das Anne Carson anbietet. Für den Leser aber, der sich lesend an die «Entflechtung» wagt, ein unendlicher Gewinn. ■
Anne Carson: Decreation – Gedichte, Oper, Essays, 250 Seiten, S. Fischer Verlag, ISBN 978-3-10-010243-0
.
.
.
.
.
Emma Goldman: «Anarchismus» – Essays
.
«Um von Tauben gehört zu werden, braucht man eine laute Stimme»
Sigrid Grün
.
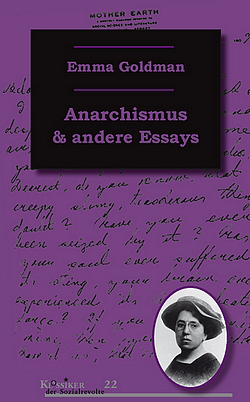 Emma Goldman gilt als Ikone der anarchistischen Bewegung. Sie wurde 1869 im damals russischen (heute litauischen) Kowno geboren und setzte sich Zeit ihres Lebens für Frieden und Gerechtigkeit ein. Im Alter von 16 Jahren floh sie aus Russland, um im «Land der unbegrenzten Möglichkeiten» einer von ihren Eltern arrangierten Ehe zu entgehen. Doch in den USA fand sie ebenso unhaltbare politische Zustände vor, die anzuprangern sie nicht müde wurde. Von ihren Gegnern mehrfach als Aufrührerin und Unruhestifterin, die unter anderem auch für politisch motivierte Morde mitverantwortlich sein sollte, verurteilt, verbüßte sie in den USA mehrfach Gefängnisstrafen und wurde schließlich nach Russland deportiert. Nach Aufenthalten in England, Frankreich und Spanien verstarb sie 1940 im kanadischen Toronto.
Emma Goldman gilt als Ikone der anarchistischen Bewegung. Sie wurde 1869 im damals russischen (heute litauischen) Kowno geboren und setzte sich Zeit ihres Lebens für Frieden und Gerechtigkeit ein. Im Alter von 16 Jahren floh sie aus Russland, um im «Land der unbegrenzten Möglichkeiten» einer von ihren Eltern arrangierten Ehe zu entgehen. Doch in den USA fand sie ebenso unhaltbare politische Zustände vor, die anzuprangern sie nicht müde wurde. Von ihren Gegnern mehrfach als Aufrührerin und Unruhestifterin, die unter anderem auch für politisch motivierte Morde mitverantwortlich sein sollte, verurteilt, verbüßte sie in den USA mehrfach Gefängnisstrafen und wurde schließlich nach Russland deportiert. Nach Aufenthalten in England, Frankreich und Spanien verstarb sie 1940 im kanadischen Toronto.
 Bereits in den 1890er Jahren hielt Emma Goldman glühende Reden in deutscher und englischer Sprache und erreichte mit diesen Vorträgen tausende Anhänger. Die in diesem Band vorliegenden Essays stammen überwiegend aus dem Jahr 1910. Bereits vier Jahre vor Ausbruch des 1. Weltkrieges analysierte die Vorreiterin der Friedensbewegung die stark um sich greifenden Phänomene des Patriotismus und Militarismus. Die Essays zeugen von einem messerscharfen Verstand und umfassender Bildung – einer Melange, die die Herrschenden verständlicherweise nervös machte. Sie versteht es hervorragend Zusammenhänge zu erklären und Rückschlüsse zu ziehen, die zum damaligen Zeitpunkt ganz klar auf die sich anbahnende Katastrophe mehrerer Kriege hindeuteten. Der Ton ist selbstbewusst, die Stimme laut, denn wie Goldman in ihrem Essay «Die Psychologie politischer Gewalt» konstatiert: «Um von Tauben gehört zu werden, braucht man eine laute Stimme.» Sie ruft zum radikalen Umsturz auf, zur absoluten Befreiung vom Joch der Herrschaft und Unterdrückung. Selbst nach ihren Haftstrafen investiert sie ihre gesamte Kraft in die agitatorische Arbeit.
Bereits in den 1890er Jahren hielt Emma Goldman glühende Reden in deutscher und englischer Sprache und erreichte mit diesen Vorträgen tausende Anhänger. Die in diesem Band vorliegenden Essays stammen überwiegend aus dem Jahr 1910. Bereits vier Jahre vor Ausbruch des 1. Weltkrieges analysierte die Vorreiterin der Friedensbewegung die stark um sich greifenden Phänomene des Patriotismus und Militarismus. Die Essays zeugen von einem messerscharfen Verstand und umfassender Bildung – einer Melange, die die Herrschenden verständlicherweise nervös machte. Sie versteht es hervorragend Zusammenhänge zu erklären und Rückschlüsse zu ziehen, die zum damaligen Zeitpunkt ganz klar auf die sich anbahnende Katastrophe mehrerer Kriege hindeuteten. Der Ton ist selbstbewusst, die Stimme laut, denn wie Goldman in ihrem Essay «Die Psychologie politischer Gewalt» konstatiert: «Um von Tauben gehört zu werden, braucht man eine laute Stimme.» Sie ruft zum radikalen Umsturz auf, zur absoluten Befreiung vom Joch der Herrschaft und Unterdrückung. Selbst nach ihren Haftstrafen investiert sie ihre gesamte Kraft in die agitatorische Arbeit.

Emma Goldmans Essay-Sammlung “Anarchismus” ist eine beeindruckende Lektüre. Es ist erschreckend, wie aktuell diese Texte heute noch sind – und wie wenig sich eigentlich geändert hat. Die Aufsätze sind auf alle Fälle Klassiker der Sozialrevolte, die man gelesen haben sollte.
Die zentralen Themen der Texte sind Eigentum, Regierung, Militarismus, Rede- und Pressefreiheit, Kirche, Liebe und Ehe sowie Gewalt. Im Mittelpunkt steht – wie sollte es im Anarchismus auch anders sein – stets der freie Mensch. Manche Essays mögen dem Leser zunächst befremdlich und gewagt erscheinen, etwa «Gefängnisse – Inbegriff gesellschaftlichen Verbrechens und Versagens», folgt man jedoch der Argumentationslinie, wird deutlich, wie kläglich ein System, das auf einer stetigen Negativspirale des Verbrechens basiert, versagt. Hier, wie in sämtlichen anderen Texten, wird schnell klar, welches Menschenbild hinter solchen Systemen steckt. Andererseits macht die Friedensaktivistin aber auch Mut, denn sie widmet sich in einigen Essays auch Vorreitern auf dem Gebiet der Friedensbewegung und des Anarchismus. Etwa dem katalanischen Reformpädagogen Francisco Ferrer, der wie viele andere Anarchisten zum Tode verurteilt wurde, weil ihm die Verwicklung in einen Aufstand unterstellt wurde. Entlastende Zeugenaussagen wurden nicht gehört und obwohl bereits seine Unschuld erwiesen war, wurde der Begründer der «Escuela Moderna» (Modernen Schule) hingerichtet. Von seinem und dem Tod vieler anderer Aktivisten berichtet Goldman in zahlreichen Essays und zeigt damit, welche Furcht die Herrschenden vor dem Anarchismus gehabt haben müssen.
Emma Goldmans Essays sind eine beeindruckende Lektüre. Es ist erschreckend, wie aktuell diese Texte heute noch sind – und wie wenig sich eigentlich geändert hat. Die Aufsätze sind auf alle Fälle Klassiker der Sozialrevolte, die man gelesen haben sollte. ■
Emma Goldman: Anarchismus & andere Essays – Klassiker der Sozialrevolte (22), 256 Seiten, Unrast Verlag, ISBN 978-3-89771-920-0
.
.
.
.
Elif Shafak: «Ehre» (Roman)
.
Rosarotes Schicksal und Genug Schönheit
Günter Nawe
.
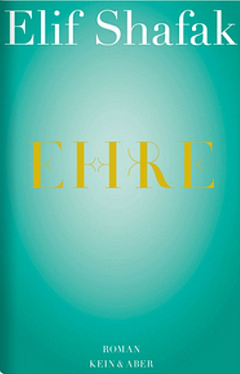 Sie heißen Pembe Kader und Jamila Yeter – die Zwillingsschwestern. «Namen wie Zuckerwürfel», findet ihr Vater, «süß und geschmeidig und ohne scharfe Kanten». Übersetzt bedeuten die Namen Rosarotes Schicksal und Genug Schönheit. Nomen est omen. Die Schwestern wurden 1945 «in einem Dorf an den Ufern des Euphrat», in Kurdistan, geboren. Ihre Geschichte erzählt die preisgekrönte türkische Autorin Elif Shafak in ihrem neuen Roman «Ehre». Und sie macht dies auf meisterhafte Weise.
Sie heißen Pembe Kader und Jamila Yeter – die Zwillingsschwestern. «Namen wie Zuckerwürfel», findet ihr Vater, «süß und geschmeidig und ohne scharfe Kanten». Übersetzt bedeuten die Namen Rosarotes Schicksal und Genug Schönheit. Nomen est omen. Die Schwestern wurden 1945 «in einem Dorf an den Ufern des Euphrat», in Kurdistan, geboren. Ihre Geschichte erzählt die preisgekrönte türkische Autorin Elif Shafak in ihrem neuen Roman «Ehre». Und sie macht dies auf meisterhafte Weise.
Ehre! – «Männer besaßen Ehre… Frauen besaßen keine Ehre, sie besaßen Scham. Und ‚Scham’, das wusste jeder, wäre ein ziemlich schlechter Name». Und die Geschlechter haben eine Farbe: Männer sind schwarz, Frauen sind weiß. Und die weiße Fläche verzeiht keinen Schmutz. Jeder Fleck an fehlender Bescheidenheit und Unterwürfigkeit, jede Abweichung von der Keuschheit ist sofort für alle sichtbar. Das werden auch die beiden Schwestern erfahren. Pembe wird «aus Ehre» mit Adem verheiratet, verlässt ihre Heimat in Richtung Istanbul und geht dann endgültig mit ihrer Familie nach London. Ihre Schwester dagegen bleibt «ehrenhaft» in ihrer Heimat und lebt dort ein Leben als eine unverheiratete Frau, gefangen in den alten Traditionen.
Pembe versucht, im fernen London mit ihrem Mann und ihren drei Kindern ein erfülltes Leben in einem anderen, in einem modernen Kulturkreis zu leben. Dass dies nicht gelingt, macht die Tragik dieses Romans aus. Gescheiterte Hoffnungen, Verrat und Verlust – ein schöner Traum ist sehr schnell ausgeträumt. Da ist einmal die fremde Welt, die mit ihrem liberalen und freizügigen Lebensverständnis verstört. Da sind andererseits die Familie und die patriarchalischen Strukturen. Die Kinder werden «flügge», ihr Mann ist ein Zocker, der sich zudem noch in einer anderen Frau, einer Nackttänzerin, verfällt und die Familie verlässt. Und Pembe begegnet einem heimatlosen Koch, Sie verliebt sich in ihn, sie trifft sich heimlich mit ihm – und weiß, dass sie damit gegen den Ehrencodex ihrer Religion und Kultur verstößt. Kein «rosarotes Schicksal» also. Und am Ende steht ein unbegreiflicher Mord aus «Ehre» – begangen von dem Sohn Iskender an seiner Mutter. Eine «Ehrensache»!
 Elif Shafak (Bild) schreibt eine wunderbar klare, eine nahezu sinnliche Sprache, die den Leser sofort gefangen nimmt. Sehr sensibel und mit viel Empathie begleitet sie ihre Figuren durch das Romangeschehen. Und packend und ausdrucksstark schildert die wunderbare Autorin den Kontrast zwischen türkisch-islamischer Tradition und britisch-westlicher Lebenswelt.
Elif Shafak (Bild) schreibt eine wunderbar klare, eine nahezu sinnliche Sprache, die den Leser sofort gefangen nimmt. Sehr sensibel und mit viel Empathie begleitet sie ihre Figuren durch das Romangeschehen. Und packend und ausdrucksstark schildert die wunderbare Autorin den Kontrast zwischen türkisch-islamischer Tradition und britisch-westlicher Lebenswelt.
Im fernen Kurdistan lebt Jamila «Genug Schönheit» – auch sie gefangen in ihrer Lebenswelt – ein anderes Leben als Hebamme und Heilerin, fest verwurzelt in den Traditionen einer islamischen Männergesellschaft. Einst war sie verliebt in Adem und er in Jamila. Aber diese Verbindung durfte nicht sein, weil auch ihre Ehre «beschmutzt» war. So geht es in diesem Leben auch für sie nicht ohne Verletzungen ab.
Im ständigen Kontakt der Zwillingsschwestern weiß Jamila um das Leben von Pembe. Und so ahnt die sensible Jamila, dass sich in London, dass sich für Pembe Unheil anbahnt. Sie macht sich aus schwesterlicher Liebe auf nach London. Ob sie retten kann, was nicht zu retten ist, sei an dieser Stelle dahingestellt.
Elif Shafak erzählt diese Geschichte als ein Familienepos und einen Generationsroman, fast in Episodenform und wechselt häufig die Zeitebenen und die Sichtweisen auf das Geschehen. So hält sie den Spannungspegel hoch. Die Schilderung des Lebens der Protagonisten, alle durchweg sehr komplexe Charaktere, im Widerstreit zwischen Islam und westlichen Lebensstilen gelingt der erfolgsgewohnten türkischen, in Straßburg geborenen Schriftstellerin hervorragend. ■

Elif Shafak hat mit «Ehre» einen wunderbaren Roman geschrieben, in dem sie das Schicksal zweier Schwestern zwischen den Traditionen von islamischer Religion und moderner Lebenswelt auf unnachahmliche Weise thematisiert und zu einer spannenden und berührenden Familiengeschichte gestaltet. Lesenswert!
Elif Shafak: Ehre, Roman, Kein&Aber-Verlag, 528 Seiten, ISBN 978-3036956763
.
.
.
.
.
Clara Paul (Hrsg): «Gedichte, die glücklich machen»
.
Lyrik – von einer gewissen Leichtigkeit
Bernd Giehl
.
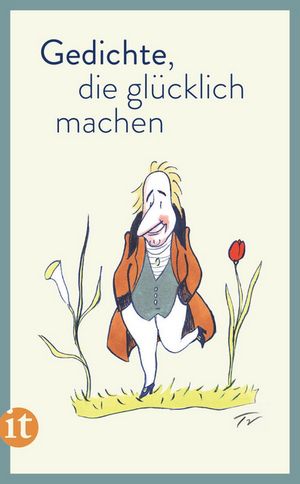 Nein, ich werde jetzt nicht in die Diskussion einsteigen, was «Glück» eigentlich ist. Und wie man es findet. Wenn ich mich darauf einließe, müsste ich entweder einen philosophischen Aufsatz von mindestens 20 Seiten schreiben, oder ich würde auf dem Niveau der Ratgeberliteratur landen.
Nein, ich werde jetzt nicht in die Diskussion einsteigen, was «Glück» eigentlich ist. Und wie man es findet. Wenn ich mich darauf einließe, müsste ich entweder einen philosophischen Aufsatz von mindestens 20 Seiten schreiben, oder ich würde auf dem Niveau der Ratgeberliteratur landen.
Dennoch, die Frage ist nicht von der Hand zu weisen: Gibt es «Gedichte, die glücklich machen?» Der Titel des Buches erinnert mich an ein anderes Buch, ebenfalls aus dem Insel-Verlag mit dem schlichten Titel «Die Romantherapie – 253 Bücher für ein besseres Leben» (6. Auflage 2013) Dort kann der geneigte Leser Tipps zur Bekämpfung jeder Art von Leiden finden, die man sich zuziehen kann, seien es Zahnschmerzen oder eine unerwiderte Liebe. Das Buch enthält Kurzfassungen von Romanen, die angeblich einen besseren Umgang mit jeder Art von negativen Gefühlen ermöglichen sollen. Wenn’s hilft…
Womöglich muss man den Titel also mit einem Augenzwinkern lesen. Und im übrigen ist das Wort «Glück» natürlich auch ungemein verkaufsfördernd, denn wer, bitte, braucht schon «Anleitungen zum Unglücklich sein»? Das können wir doch ganz allein und ohne Anleitung durch einen anderen. Was ja noch nicht heißt, dass die anderen nicht gern das ihre dazu tun. – Mein Gott, sind wir heute wieder misanthropisch. Also schnell mal einen Blick in die «Gedichte, die glücklich machen» werfen.
Eingeleitet wird der Band von einem Gedicht von Joachim Ringelnatz: «Morgenwonne: Ich bin so knallvergnügt erwacht. / Ich klatsche meine Hüften. / Das Wasser lockt. Die Seife lacht, Es dürstet mich nach Lüften. // Ein schmuckes Laken macht einen Knicks / Und gratuliert mir zum Baden. / Zwei schwarze Schuhe in blankem Wichs / Betiteln mich ‚Euer Gnaden‘. // Aus meiner tiefsten Seele zieht / Mit Nasenflügelbeben / Ein ungeheurer Appetit / nach Frühstück und nach Leben.»
So einfach is das Glück also zu finden. Nur muss man dazu auch bereit sein. Ein gelungener Einstieg, wie ich finde. Leicht, frech, ironisch; warum nicht.
Einen anderen Ton, wenn auch ähnlich frech hat Wolf Biermanns «Lied vom donnernden Leben: Das kann doch nicht alles gewesen sein / Das bißchen Sonntag und Kinderschrein /das muß doch noch irgendwo hin gehn / hin gehn // Die Überstunden, das bißchen Kies / und aabns inner Glotze das Paradies / da in kann ich doch keinen Sinn sehn / Sinn sehn… / Das soll nun alles gewesn sein / Das bißchen Fußball und Führerschein / das war nun das donnernde Leebn / Leebn. // Ich will noch ‘n bißchen was Blaues sehn / und will noch paar eckige Runden drehn / und dann erst den Löffel abgebn / eebn.»
Das Gefühl kennt man. Nicht dass es glücklich macht. Aber vielleicht hilft’s ja, wenn man weiß, dass andere es teilen.
So könnte ich fortfahren. Viele Gedichte sind dabei, die ich kenne. Natürlich dürfen Hermann Hesses «Stufen» nicht fehlen, ebensowenig Joseph von Eichendorffs «Mondnacht» («…und meine Seele spannte / Weit ihre Flügel aus».) Ebensowenig Rilkes schönes Gedicht aus dem «Mönchischen Leben»: «Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen».
Natürlich vermisse ich auch das eine oder andere Gedicht, das ich – wäre ich der Herausgeber – ganz sicher mit in die Sammlung hineingepackt hätte (z.B. «Du Nachbar Gott» vom schon erwähnten Rainer Maria Rilke, oder das eine oder andere Gedicht von Sarah Kirsch – bei der nächsten Ausgabe bitte unbedingt an «Im Juni» denken, und der «Meropsvogel» darf auch auf keinen Fall noch einmal fehlen) – aber wie gesagt: Sie haben mich ja nicht gefragt, und das haben Sie jetzt davon!
Aber Scherz beiseite: Wahrscheinlich hat jeder, der Gedichte liebt, seine ganz eigenen Gedichte, die ihm (oder ihr – ich bitte um Verzeihung, wenn ich das nicht immer mitschreibe), die also der verehrten Leserin oder dem geschätzten Leser ein Lächeln auf die Lippen zaubern.

Nach längerem Lesen in Clara Pauls Buch “Gedichte, die glücklich machen” muss ich meiner Skepsis, ob es so etwas wie Gedichte gibt, die (mich) glücklich machen, also doch Lebewohl sagen. Und so sage auch ich «Vielen Dank» – an wen auch immer: Die Dichter, die diese schönen Gedichte geschrieben haben; die Situationen, aus denen heraus sie entstanden, die Umstände, die sie ermöglichten – oder die sonderbaren Gehirne, die vielleicht nicht immer alltagstauglich waren, dafür aber wunderschöne kleine und große Kunstwerke hervorgebracht haben.
Natürlich haben all die ausgewählten Gedichte eine gewisse Leichtigkeit. Und natürlich kann man von einen solchen Band keine schwer verrätselten oder hermetischen Gedichte erwarten. Manche Namen setzen einen aber dennoch – oder gerade deswegen – in Erstaunen: Paul Celan z.B. oder Rose Ausländer. Und manche Autoren, die man zwar dem Namen nach kannte, von denen man aber noch wenig gelesen hat, lassen den Wunsch aufkommen, sich noch einmal etwas intensiver mit ihnen zu beschäftigen. So jedenfalls ging es mir mit den Gedichten von Hans Magnus Enzensberger, die in diesem Band abgedruckt sind. Schön, wie er in «Empfänger unbekannt – Retour a l’expediteur» das Glück der einfachen Dinge beschreibt: «Vielen Dank für die Wolken. Vielen Dank für das Wohltemperierte Klavier / und, warum nicht, für die warmen Winterstiefel. / Vielen Dank für mein sonderbares Gehirn… Vielen Dank für die vier Jahreszeiten, / für die Zahl e und das Koffein, und natürlich für die Erdbeeren auf dem Teller, / gemalt von Chardin, sowie für den Schlaf / für den Schlaf ganz besonders, / und, damit ich es nicht vergesse, für den Anfang und das Ende / und die paar Minuten dazwischen / inständigen Dank, / meinetwegen auch für die Wühlmäuse draußen im Garten.»
Nach längerem Lesen in diesem Buch muss ich meiner Skepsis, ob es so etwas wie Gedichte gibt, die (mich) glücklich machen, also doch Lebewohl sagen. Und so sage auch ich «Vielen Dank» an wen auch immer: Die Dichter, die diese schönen Gedichte geschrieben haben; die Situationen, aus denen heraus sie entstanden, die Umstände, die sie ermöglichten – oder die sonderbaren Gehirne, die vielleicht nicht immer alltagstauglich waren, dafür aber wunderschöne kleine und große Kunstwerke hervorgebracht haben. ■
Clara Paul (Hrsg): Gedichte, die glücklich machen, Lyrik-Anthologie, 186 Seiten, Insel-Suhrkamp-Verlag, ISBN 978-3-458-35997-5
.
.
Weitere Literatur-Rezensionen im Glarean Magazin
.
.
Reinhard Wosniak: «Felonie» (Roman)
.
Das Motiv der Freiheit
Dr. Wolfgang Dalk
.
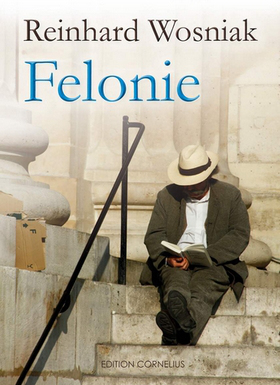 Der Frohburger Schriftsteller Reinhard Wosniak legt mit «Felonie» eine umfängliche Familiensaga vor. Doch 555 Seiten sind noch nicht genug. Er verweist darauf, dass «Felonie» das «erste Buch» sei. Das heißt auf eine Fortsetzung hoffen. Das ist auch gut so. Denn die Geschichte von Begegnung und Trennung, Entfremdung und Verlust, Treue und Verrat wirkt noch nicht vollendet. Es bleiben Fragen. Wenn die in einem weiteren Band angegangen werden, schlösse sich ein Kreis, den Wosniak sehr behutsam geöffnet hat, um seine Leser mit Worten und Sätzen in die Geschichte des Max Guttentag und seiner Familie hineinzuziehen und nicht gleich wieder zu entlassen. Da reflektiert der Leser wohl zu Recht auf ein weiteres Leseabenteuer. Ja, es ist ein Abenteuer. Wosniak präsentiert seine Saga in so ungewöhnlichen Bezügen, dass es abenteuerlich wird. Aber auch sein Sprachumgang lässt aufmerken. Es ist vor allem einer, der auf berückende Weise Sprache verdichtet, sie zum Klingen bringt, sie eben zu etwas immer Neuem macht.
Der Frohburger Schriftsteller Reinhard Wosniak legt mit «Felonie» eine umfängliche Familiensaga vor. Doch 555 Seiten sind noch nicht genug. Er verweist darauf, dass «Felonie» das «erste Buch» sei. Das heißt auf eine Fortsetzung hoffen. Das ist auch gut so. Denn die Geschichte von Begegnung und Trennung, Entfremdung und Verlust, Treue und Verrat wirkt noch nicht vollendet. Es bleiben Fragen. Wenn die in einem weiteren Band angegangen werden, schlösse sich ein Kreis, den Wosniak sehr behutsam geöffnet hat, um seine Leser mit Worten und Sätzen in die Geschichte des Max Guttentag und seiner Familie hineinzuziehen und nicht gleich wieder zu entlassen. Da reflektiert der Leser wohl zu Recht auf ein weiteres Leseabenteuer. Ja, es ist ein Abenteuer. Wosniak präsentiert seine Saga in so ungewöhnlichen Bezügen, dass es abenteuerlich wird. Aber auch sein Sprachumgang lässt aufmerken. Es ist vor allem einer, der auf berückende Weise Sprache verdichtet, sie zum Klingen bringt, sie eben zu etwas immer Neuem macht.
In herausgeputzten Sätzen und Wörtern, rätselhaftem Sprachmaterial erzählt er so, dass der Leser erstaunt die Augenbraue hisst und seine Aufmerksamkeit inhaltlich wie sprachlich befeuert wird. Schon mit dem Buchtitel versucht er, Interesse zu wecken und eine bestimmte Erwartungshaltung zu erzeugen: «Felonie». Ich gebe gern zu, dass ich nachschlagen musste, um auf die Erklärung «Untreue, Treuebruch, Verrat» zu kommen, auf einen Begriff also, der mit Bedacht auch noch «den Bruch des Lehnseides; die Verweigerung der mittelalterlichen Lehnsdienste» einschließt. Die Ergänzung ist insofern wichtig, als im Verlaufe des Romans viele Facetten gerade dieses begrifflichen Nachklangs in das klug durchdachte Erzählgerüst eingebracht werden, um die Tiefen und Höhen des Geschehens in einem eigentümlichen Verbund mittelalterlicher und neuzeitlicher Ehrbegriffe zu fixieren.
«Felonie» ist ein Zeitgeschichtsroman, der den Zug schlesischer Familien durch die jüngste Zeit aufnimmt und in den Mittelpunkt Max Guttentag und dessen unruhige Suche nachdem stellt, was er nicht «Freiheit» nennen, aber auch nicht das «Frei sein» heißen mag. Es ist etwas, das ihn treibt, ohne gleich Auskunft zu geben wohin, wozu, weshalb. Und so stürzt alles in ihm und um ihn herum auf ein Ende zu, dem Felonie innewohnt. Er weiß es. Er muss den Lehnseid brechen, den Lehnsdienst aufkündigen, um «die höchste Form von Freiheit» erreichen zu können, die mit dem Selbstbewusstsein der Offensive wünscht, «alles selbst in der Hand zu haben».

«Komplexe poetische Studien über Einsamkeit und verheerende Seelenzustände»: Schriftsteller Reinhard Wosniak (*1953)
Mit den Überlegungen, Freiheit wozu, Freiheitssehnsucht mit welchem Ziel, Freiheit-f-Moll wohin und warum, ist Max Guttentag keineswegs am Ende, als er seinen Verrat begeht an Ehefrau, Sohn, Stadt, Land, an Freunden und an sich. So schweigt er in einer stillen «Übereinkunft unter Schweigenden.» Doch eben nicht immer. Im Diesseits durch Krieg, Flucht und Nachkrieg entwurzelt, wirft er Fragen auf, die uns die Zeitläufte stellen, nach dem etwa, was die deutsche Vergangenheit an Ablagerungen in der Seele hinterlassen hat, Fragen auch, die das Leben an jeden immer und überall stellt, wie es denn zu leben sei, in diesem Deutschland, das sein Selbstvertrauen verloren hatte und noch unter Mühen dabei ist, es wiederzufinden.
Drei deutsche Welten zwischen denen sich die Handlung spannt. Einmal die schlesische Welt, eher als Abgesang vergangener Zeit, die ostdeutsche und DDR-Welt als Hoffnungsentwurf für die einen, als bloßer Abklatsch bekannter Diktatur für die anderen und die westdeutsche Welt, so als materiell bestimmter Gegenentwurf zu den brotarmen Idealen des Ostens. Dafür schafft Wosniak Standbilder, an denen sich der Leser festhalten kann. Das schlesische Heimatsehnen, das bröckelnde Ost-Schloss mit seinen möglichen Aus- und Einsichten und West-Klischees, die gut beobachtet und beschrieben sind. Dazu gehören auch eindringliche Menschenbilder, Landschaftsbeschreibungen, Naturschilderungen und Behausungen. Häuser werden in Gärten gebettet. Und immer mal wieder rücken Gartenarbeit, Gartenstücke, Gärtnereien ins Erzählzentrum in Sinne von «cultus» (Anbau und Pflege von Pflanzen), auch von «kultivieren» (bebauen, urbar machen). Ein guter Griff in die Sinnbilder.
Zimmer werden ausgestaltet, meist karg, aber funktionsgebunden. Räume erschließen sich in den Bewegungen der Menschen, die sie mit ihren Schritten und Erleben vermessen. Konkrete Orte also. Und doch sind sie auch Nicht-Orte, die wirken, als wären sie zu den Rändern hin undicht. Es sind nicht beheimatende Orte, es ist, als öffne sich unter ihnen ein Abgrund, es ist, als wäre die Wirklichkeit nur ein Raster – darunter drohendes Dunkel, auf dem auch überfallartig so etwas aufkommen kann wie der entsetzliche «Rotbart»-Mord gegen Ende des 1. Bandes.
Reinhard Wosniak erregte die Aufmerksamkeit einer historisch interessierten Leserschaft bereits mit dem Roman «Stilicho» (1989), mit der deutsch-deutschen Einheitsgeschichte «Sie saß in der Küche und rauchte» (1995) sowie dem Essay-Band «Morbis» – eine Krankheit in Europa (1998).
In «Felonie» ist es Max Guttentag, der in den Bann zieht. Zieht er auch Sympathie auf sich? Heute hieße die Antwort wohl so mancher Leser «nicht wirklich» und meint, dass die Zentralfigur des Romans kein Held in der Rolle des Sympathieträgers sei. Zu bekannt will dem Leser die Freiheitssehnsucht scheinen und zeitgleich so fremd. Erst recht die Konsequenz. Der Verrat. Zu schweigsam, zu verklemmt ist die Hauptfigur, um ein sympathischer Held zu sein. Max Guttentag wirkt wie eine Figur, die nie in der Gegenwart ankommen kann. Zu viel hat sie zu jung erlebt und nicht verarbeiten können. So ist er bei aller Straffheit und allem Geradeaus-Denken ein irrlichternder Mann mit seinen Unsicherheiten, die er auch wissentlich anderen auflädt. Natürlich seiner Frau. Diese toughe, praktisch orientierte und tätig zugreifende Hanna, die nicht nachzuvollziehen vermag, was diesen Mann an ihrer Seite so bodenlos schwebend hält. Von den Notwendigkeiten des Alltags fern. Auch als Vater eher ein Nehmender als ein Gebender. Abgehoben eben. Es scheint dem Leser schon etwas verwegen, mit diesem Typen eine Handlung zu weben, ja mit ihm eine fesselnde Familiensaga zu beginnen – doch das Erstaunliche gelingt Wosniak. Denn der Autor lässt in einer Art Suchbewegung durch die Biographie der Familien diesen Mann auf Suche sein. Daraus werden Studien über Einsamkeit und über verheerende Seelenzustände, wo Gemütsschäden scharf ausgeleuchtet werden. Max gerät dabei langsam, aber folgerichtig zu einem Menschen, der vor sich selber auf der Couch liegt und dem niemand zuhört, abgesehen von ihm selbst. Etwas in ihm beginnt, innere Tapeten abzugreifen, als sei er selber ein leerer Raum mit altmodischen Mustern der Vergangenheit beklebt. Die gilt es abzureißen, als könnte das einen Neuanfang basieren.

Reinhard Wosniaks poetische Verfahren in seinem neuen Roman “Felonie” sind komplex. Ein Buch aber auch, das zum Verweilen bei Formulierungen, Wortbezügen, Bildern einlädt, vor allem zum Sinnieren über das zentrale Motiv der Freiheit, des Frei-Seins, des Sich-Verweigerns, des angepassten Mit-Tuns und schließlich des Dazwischen-Seins.
Wosniaks poetische Verfahren sind komplex. Er lockt mit der Familie Wildenschwert und deren Sound des schlesischen Gemüts in die Alltäglichkeit, steigt mit Hieronymus Stamer in hochgeistige Sphären und mit Prof. Huldreich Webersinke gar in wissenschaftliche Dimensionen. Dazwischen finden sich herrliche Formulierungen wie «die unschlesische Schmallippigkeit ihres Mundes» oder «sich mit dem überschaubaren Erfolg seiner Bemühungen abfinden» oder «Wolkenfetzen von widerlicher Unentschlossenheit».
Ein Buch, das zum Verweilen bei Formulierungen, Wortbezügen, Bildern einlädt, vor allem natürlich zum Sinnieren über das zentrale Motiv der Freiheit, des Frei-Seins, des Sich-Verweigerns, des angepassten Mit-Tuns und schließlich das Dazwischen-Seins. Und (zum Schluss nochmals betont): ein Buch, das auf eine Fortsetzung hoffen lässt. ■
Reinhard Wosniak: Felonie – Roman, Edition Cornelius, 555 Seiten, ISBN 978-3954863679
______________________________________
 Dr. Wolfgang Dalk
Dr. Wolfgang Dalk
Geb. 1943, nach dem Abitur Armeezeit und Studium Germanistik/Geschichte in Rostock, Promotion zur Synonymie des Verbs, zahlreiche Veröffentlichungen zu Werken der darstellenden und bildenden Kunst sowie von Buchrezensionen, lebt in Rostock/D
.
.
.
.
.
.
Pierangelo Maset: «Wörterbuch des technokratischen Unmenschen»
.
Von «Beschulung» bis «Humankapital»
Dr. Rainer Wedler
.
 «Wörterbuch des technokratischen Unmenschen» – der Titel lässt aufhorchen. Ein Desiderat, denkt man, die längst fällige Fortschreibung der Tradition von Victor Klemperers «Lingua tertii imperii», Karl Korns «Die Sprache in der verwalteten Welt» und dem Gemeinschaftswerk «Aus dem Wörterbuch des Unmenschen» von Gerhard Storz, Wilhelm E. Süskind und Dolf Sternberger, den in Heidelberg zu hören der Rezensent das Glück hatte. Doch um es vorwegzunehmen: der Leser wird ein wenig enttäuscht.
«Wörterbuch des technokratischen Unmenschen» – der Titel lässt aufhorchen. Ein Desiderat, denkt man, die längst fällige Fortschreibung der Tradition von Victor Klemperers «Lingua tertii imperii», Karl Korns «Die Sprache in der verwalteten Welt» und dem Gemeinschaftswerk «Aus dem Wörterbuch des Unmenschen» von Gerhard Storz, Wilhelm E. Süskind und Dolf Sternberger, den in Heidelberg zu hören der Rezensent das Glück hatte. Doch um es vorwegzunehmen: der Leser wird ein wenig enttäuscht.
Dem Technokraten, ein generalisierender Begriff, wird Unmenschlichkeit unterstellt. Niemand wird bestreiten wollen, dass ungebremstes Gewinnstreben und oft unreflektierter technologischer Fortschritt eine sichtbare Gefahr für unsere Gesellschaft darstellen, aber daraus über den Titel eine Assoziation zum totalitären System des Nationalsozialismus herzustellen, geht über das Ziel hinaus.
Dazu einzelne Stichwörter.
– alternativlos: Das kann phantasielos sein, denkfaul, unmenschlich ist es gewiss nicht.
– Benchmarking: Am Anglizismus mag man sich stören, auch daran, dass Objektivität oft nur vorgetäuscht ist, überzogen die Schlussfolgerung: Für den technokratischen Unmenschen hingegen ist das «Benchmarking» ein wunderbares Instrument «zur Optimierung der von ihm erstrebten Herrschaftsform» (S. 35).
– Engagement: Es bedarf schon einiger Gedankenwindungen, um diesen Begriff ins Unmenschenwörterbuch zu befördern. Dass mit einiger Mühe jeder Begriff ins Negative gewendet werden kann, beweist der Autor auch hier. «Engagement» wird dann nämlich zu einem Instrument, das «Ausfallerscheinungen in Staat und Gesellschaft kostengünstig korrigieren soll». (S. 59) Über diesen Satz kann man diskutieren, man sollte es, dennoch gehört «Engagement» nicht in dieses Wörterbuch.
Die Liste ließe sich leicht fortsetzen, wir wollen aber nun zwei gelungene Beispiele vorstellen.
– Audit: Ein furchtbares Wort, das zu Recht dem Unmenschen zugeschrieben werden kann.
– Beratung/Consulting: Ein camouflierender Begriff, unmenschlich wäre auch hier zu stark. «McKinsey und Konsorten haben den Umbau der Gesellschaft mitbewirkt und sehr viel Geld aus Behörden und Unternehmen herausgezogen, die nicht selten nach einer ‘Beratung’ am Boden liegen» (S. 37). Dem ist nichts hinzuzufügen.

Wäre nicht der fatale «Unmensch» in den Titel geraten, man hätte Pierangelo Masets neues «Wörterbuch des technokratischen Unmenschen» mit ganz anderen Augen gelesen, denn den meisten kritischen Bemerkungen des Autors ist zuzustimmen. Ein schmales Buch, das manches erhellt, dem aber zu wünschen wäre, dass es für die zweite Auflage gründlich überarbeitet würde.
Wäre also nicht der fatale «Unmensch» in den Titel geraten, man hätte mit ganz anderen Augen gelesen, denn den meisten kritischen Bemerkungen des Autors ist zuzustimmen. Gelungene Beispiele sollen genannt werden:
Beschulung, Corporate Identity/Corporate Design, Eindringtiefe, Humankapital, Kreativität/Kreativwirtschaft, Philosophie, Update/Upgrade.
Trotz aller Kritik: Ein schmales Buch, das manches erhellt, dem aber zu wünschen wäre, dass es für die zweite Auflage gründlich überarbeitet würde. ■
Pierangelo Maset: Wörterbuch des technokratischen Unmenschen, Radius-Verlag Stuttgart, 144 Seiten, ISBN 978-3871739491
.
.
.
.
.
.
Sema Kaygusuz: «Schwarze Galle» (Kurzprosa)
.
Anstupsen, um aufzuwecken? – oder:
Von Hüzünlern und Gramerfüllten
Dr. Karin Afshar
.
 Das Wesen der Melancholie ist überaus schillernd, ihr Ausdruck nicht minder, und ihr Lockruf, sich im Ringen um den Platz und den Sinn des eigenen Ich im Weltengefüge, mit sich und der Welt auseinanderzusetzen, führt meistens zu Fluchttendenzen, namentlich zur Flucht nach innen. Dort finden der und die von Schwermut Heimgesuchte (von nicht wenigen ist sie nicht erworben, sondern als Anlage immer schon da) viel Leidvolles; Melancholiker leiden an der Welt, und wenn sie hernach aus sich heraustreten und in die Welt blicken, sich wieder in sie hineintrauen, um auf ein Neues aktiver Teil in ihr zu sein – sind sie noch fremder als jemals zuvor. Sie sind weit gegangen und dabei der «Welt abhanden gekommen» (Text Friedrich Rückert, in den «Rückert-Liedern» von Gustav Mahler vertont). Nur manchmal begegnen sie Gleichgesinnten, Gleich»gestimmten», und erkennen sich als Heimatlose und Suchende.
Das Wesen der Melancholie ist überaus schillernd, ihr Ausdruck nicht minder, und ihr Lockruf, sich im Ringen um den Platz und den Sinn des eigenen Ich im Weltengefüge, mit sich und der Welt auseinanderzusetzen, führt meistens zu Fluchttendenzen, namentlich zur Flucht nach innen. Dort finden der und die von Schwermut Heimgesuchte (von nicht wenigen ist sie nicht erworben, sondern als Anlage immer schon da) viel Leidvolles; Melancholiker leiden an der Welt, und wenn sie hernach aus sich heraustreten und in die Welt blicken, sich wieder in sie hineintrauen, um auf ein Neues aktiver Teil in ihr zu sein – sind sie noch fremder als jemals zuvor. Sie sind weit gegangen und dabei der «Welt abhanden gekommen» (Text Friedrich Rückert, in den «Rückert-Liedern» von Gustav Mahler vertont). Nur manchmal begegnen sie Gleichgesinnten, Gleich»gestimmten», und erkennen sich als Heimatlose und Suchende.
In Sema Kaygusuz‘ Buch «Die schwarze Galle» treffen wir auf Melancholiker, und dies u.a. in Gestalt von drei Frauen, die den Rahmen für noch andere Charaktere bilden: Birhan ist eine Istanbuler Dichterin, Sema ist die Ich-Erzählerin, und Yasemin wiederum eine Bekannte von Birhan. Alle drei hören Geräusche, und entlang dieser Geräusche steigen auch wir Leser von Anfang an in die Innenräume ihrer Seelen mit hinab.
Beim Gang durch die Unterwelten versteht es Sema Kaygusuz, den Leser ebenso mit eingebetteten Essays, z.B. über den Unterschied zwischen dem türkischen «hüzün» (das sie meint nicht mit der «Schwermut» gleichsetzen zu können) und der Gram, in der der Schwermütige haust, wie mit Intermezzi von Reflektionen über das Schreiben zu fesseln. Dann wieder erzählt sie parabelhaft die Begegnung eines jungen Mannes mit einer Schneiderin, in vorderorientalischer Erzähltradition von Ezel und Zühal, vom Gärtner und den Hunden, von Musa… Es erwartet die Leserin (und ich glaube, es ist ein Buch für Frauen mehr als für Männer) Schwermütiges, aber das satirisch, lustig, paradox, kurzweilig. Trotz allen zur Sprache kommenden Leides will mir scheinen, als schwebe ein Hauch von Selbstironie über dem Erzählten.
Sema Kaygusuz‘ Sprache trägt zu diesem von mir gefühlten Hauch bei. Wie sie auf Türkisch schreibt, kann ich nicht beurteilen (die deutsche Übersetzung ist in sich und im Ganzen stimmig). Die gewählten Bilder, die Art der Erzählanfänge und das Verweben, die Verweise auf weitere Ebenen, erinnert an – und das wiederum kann ich ein wenig beurteilen – die mündliche wie schriftliche Erzähltradition auch im Iran, in der persischen Literatur. Meister-Schüler-Geschichten, Derwisch-Lehr-Erzählungen, Nasreddin Hodscha. Ihre Sprache ist Empfindungssprache mehr denn Denksprache, und bringt gerade deshalb zum Denken. Leider fallen dann doch einige Formulierungen auf – viele sind es nicht – aber sie sind da, ob nun absichtlich oder unbeabsichtigterweise. Vielleicht sollen diese funktional-intellektuellen Seitenschritte den Bruch bekräftigen, nachgerade die Leserin darauf stoßen, dass wir in Zeiten leben, in denen sich gerade vieles auflöst. Denn in den Erzählungen geht es auch um die Auflösung der Illusion, dass Zeit linear verläuft. Diese Linearität war niemals gegeben, man hatte sie sich konstruiert, weil man meinte, die Vorstellung zu brauchen. Brüche jedweder Art werden erst spür- und anschließend auch sichtbar, wenn die Selbstverständlichkeit des einen auf die des anderen trifft und sich Unvereinbarkeit abzeichnet.

In der Kurzprosa-Sammlung «Schwarze Galle» von Sema Kaygusuz erwartet die Leserin (und ich glaube, es ist ein Buch für Frauen mehr als für Männer) Schwermütiges, aber das satirisch, lustig, paradox, kurzweilig. Trotz allen zur Sprache kommenden Leides schwebt aber ein Hauch von Selbstironie über dem Erzählten.
Jeder Text ist Spiegel seiner «Gegenwart»: Kaygusuz‘ Texte spiegeln das Hin- und Herwandern von Menschen, das Überqueren von Grenzen (was allerdings ein zeitloses Thema ist). Die Möglichkeit unserer Tage indes, Räume innerhalb kürzester Zeit durchqueren zu können und auch zu müssen, bleibt nicht ohne Effekt auf uns; die Schnelligkeit der Wechsel lässt das Empfinden kaum noch nachkommen. Real, fast körperlich, spüren inzwischen die meisten von uns, was es mit der Beschleunigung auf sich hat: sie lässt uns herausfallen.
«Feinstofflich» kann man Sema Kaygusuz‘ Sprache nennen, was Wortwahl und das Gespinst der Worte angeht, gleichzeitig ist der Text durchstrukturiert und doch fragil. Fragil sind natürlich auch die Figuren. Die Sonderlinge von Sema Kaygusuz heißen Yakup, Bora und Helin, Ruth, ja, selbst Gülayşe, die derb und übergriffig in den Lebensraum der Erzählerin einbricht, und sie erinnern mich unwillkürlich an die der deutschen Früh-/Spät-Romantik: Lenz (Georg Büchner), Eduard aus dem «Stopfkuchen» (Wilhelm Raabe), an den Nachtwächter (Bonaventura), an Friedrich Mergel (Annette von Droste-Hülshoff). Oh, wo waren denn da die Frauen?
Lassen Sie sich also auf eine Reise ganz anderer Art mitnehmen und legen Sie das Buch sachte weg, nachdem «Himmel und Erde aufgestöhnt haben». – Gestöhnt habe auch ich ein wenig, das muss ich hier noch anbringen. Ich hätte das Nachwort nicht lesen sollen/dürfen, denn es hat etwas zugebaut, was Sema Kayguzus so leichtfüßig offengehalten hat: Sie hatte Freiräume gelassen, und nicht zuviel angestupst. («Uns braucht niemand anzustupsen, nicht wahr, Birhan, wir wachen von allein auf.») Aber vielleicht brauchen ja andere Leserinnen eine Anleitung, und das Nachwort ist gut gemeint. ■
Sema Kaygusuz: Schwarze Galle, Geschichten, 140 Seiten, Matthes & Seitz Verlag, ISBN: 978-3-88221-049-1
.
Karin Afshar im Glarean Magazin
.
.
.
.
.
Sabine Ludwigs: «Meine Seele weiß von dir» (Roman)
.
Für ein paar sorgenfreie Stunden
Bernd Giehl
.
 «Und denken Sie daran: Alles wird gut.» An diesen Satz erinnere ich mich noch. Er scheint einem anderen Zeitalter entsprungen zu sein, und dennoch war er vor nicht allzu langer Zeit fast ein geflügeltes Wort: «Alles wird gut.» Ob der Satz am Ende des «heute-journals» stand? Oder ob der Moderator einer Talkshow mit ihm sein Publikum in die Nacht entließ? Ich weiß es nicht mehr.
«Und denken Sie daran: Alles wird gut.» An diesen Satz erinnere ich mich noch. Er scheint einem anderen Zeitalter entsprungen zu sein, und dennoch war er vor nicht allzu langer Zeit fast ein geflügeltes Wort: «Alles wird gut.» Ob der Satz am Ende des «heute-journals» stand? Oder ob der Moderator einer Talkshow mit ihm sein Publikum in die Nacht entließ? Ich weiß es nicht mehr.
«Meine Seele weiß von dir» von Sabine Ludwigs fängt mindestens so dramatisch an wie das «heute-journal». Er beginnt mit der Szene eines Ertrinkens: «Das Wasser war schwarz, kalt und schmeckte durchdringend nach Chlor. Ich versank darin. Ich versank und konnte nichts dagegen tun.»
Das klingt wirklich dramatisch. Aber man ahnt doch, dass das noch nicht das Letzte sein kann. Nicht, wenn der Roman mit «ich» anfängt. Würde dieses «Ich» jetzt tatsächlich sterben, dann hätte die Erzählung ihr Ende gefunden, ehe sie wirklich angefangen hat. Und außerdem: Wie könnte die Person jetzt weitererzählen, wenn sie doch tot ist?
Aber glücklicherweise ist es nur der Prolog. Obwohl es den strenggenommen gar nicht geben dürfte. Denn im nächsten Kapitel wird erzählt, dass dieses «Ich», das hier berichtet, eine Frau mit Namen Sina-Mareen, sich an nichts mehr erinnert. Auch nicht an den Badeunfall. Alles was sie weiß, weiß sie von anderen. Vor allem von einem Mann, der behauptet, er heiße Leander und sei mit ihr verheiratet – nur dass sie sich auch nicht an ihn erinnert. Und auch nicht daran, wie sie in die Wohnung geraten ist, in der sie sich jetzt beide aufhalten. Vor ihm hat sie sich in die Sicherheit eines begehbaren Kleiderschranks zurückgezogen, durch dessen geschlossene Tür sie mit dem Fremden spricht.
Auch wenn man von Psychotherapie nicht viel versteht, so ahnt man doch schnell, dass Sina-Mareen, die Ich-Erzählerin Angst hat. Ihre Welt ist zusammengeschrumpft auf die Größe eines Kleiderschranks. Dort wird sie zunächst einmal bleiben und sich anhören, was der Mann vor der Schiebetür ihr zu sagen hat. Zunächst ist unklar, ob sie sich vor diesem Mann fürchtet, vor der Welt, der sie nicht mehr anzugehören scheint oder vor der eigenen Vergangenheit, an die sie sich partout nicht erinnern kann. Das ist ja auch plausibel, denn zumindest kann man sich vorstellen, dass Menschen nach einem schweren Unfall das Gedächtnis verlieren.
In den ersten Kapiteln hört sie dem Mann vor dem Schrank zu, zunächst durch die geschlossene Tür. Später öffnet sie die Tür einen Spalt weit. Der Mann behauptet, mit ihr verheiratet zu sein. Die Ich-Erzählerin weiß davon nichts, aber schnell verliebt sie sich in den Klang seiner Stimme und später auch in sein gutes Aussehen. Da Sabine Ludwigs ihr Handwerk versteht, klärt sie den Leser so schnell nicht auf. So wie Sina-Mareen zunächst nur kleine Schritte in die Welt außerhalb ihres Schranks unternimmt, so wird sie auch nur Schritt für Schritt an die Wahrheit herangeführt. Sie erfährt, dass der Mann, der behauptet, mit ihr verheiratet zu sein, nicht mehr in der gemeinsamen Wohnung lebt, dass er eine Freundin hat, und dass das Zerwürfnis wohl seinen Anfang in einer Abtreibung genommen hat, von der er erst hinterher erfahren hat. Es ist der Anblick von ein paar Sektflaschen in einem Lebensmittelladen, bei dem die Erinnerung plötzlich einsetzt und dann setzt sich diese Erinnerung wie ein Puzzle zusammen.

Themen, die die vielleicht Widerhaken in unser Denken schlagen, suchen wir in Sabine Ludwigs’ “Meine Seele weiss von dir” vergebens. Trotzdem, der Roman ist spannend, sehr unterhaltsam – ein Buch für sorgenfreie Stunden.
Das Buch ist spannend, keine Frage. Und dennoch weiß man von Anfang an: Es wird gut ausgehen. Menschen, die bei allen Fehlern, die sie machen, so sympathisch sind, so begabt, so erfolgreich und gut aussehend (zumindest über den männlichen Helden wird das dem Leser pausenlos eingehämmert) – also kurz und gut: da muss es einfach ein Happy End geben. Obwohl die Autorin ihren Figuren ja wirklich reichlich Hindernisse in den Weg stellt. Aber das, sowie das Nichtwissen, das der Leser mit Sina-Mareen teilt, erhöht ja nur die Spannung.
So ist das eben in Unterhaltungsromanen: Im Unterschied zum wahren Leben können wir uns darauf verlassen, dass sie gut ausgehen. Und uns dabei ein paar vergnügliche Stunden bereiten. Die Themen, die uns länger beschäftigen, die vielleicht Widerhaken in unser Denken einschlagen, die müssen wir uns eben in anderen Romanen suchen. ▀
Sabine Ludwigs: Meine Seele weiß von dir, Roman, 376 Seiten, Hansanord Verlag, ISBN 978-3940873439
.
.
Weitere Literatur-Rezensionen im Glarean Magazin
.
.
Jürgen Fürkus: «Literarische Eigenblicke» (Lyrik & Kurzprosa)
.
Was Jürgen Fürkus mit Havergal Brian zu tun hat
Dr. Karin Afshar
.
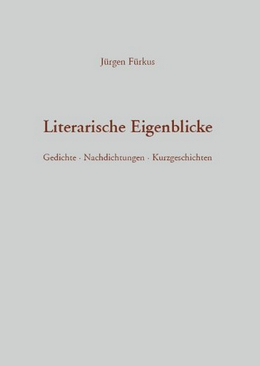 Schon vor Tagen war es angekommen – das Buch, um das es heute geht. Sein Verfasser hat es mir zur Besprechung persönlich zugeschickt. Im Briefkasten am selben Tag auch eine CD mit Kompositionen jenes in der Überschrift ebenfalls genannten Havergal Brian. William Havergal Brian lebte von 1876 (in Dresden, Staffordshire geboren) bis 1972 und war den Großteil seines Lebens als Komponist (hauptsächlich von Wiener Klassik inspiriert, mit Elementen dissonanter Harmonik und Atonalität) eher unbekannt, ja unbedeutend. Legendär indes ist, dass er 21 seiner insgesamt 32 Sinfonien jenseits seines 80. Geburtstags komponierte. 1961 – da war er bereits 85 Jahre alt, wurde seine 1. Sinfonie (die «Gothische») in Westminster aufgeführt. Ich höre sie, während ich dies schreibe, und habe gelesen, dass sie – was den Orchesterapparat angeht – sogar die Anforderungen von Gustav Mahler und Arnold Schönberg übertreffen soll. Nach dem Aufflackern in den 60ern verschwand Brians Werk wieder in den Kreisen seiner wenigen, aber sehr enthusiastischen Anhänger. William Brian, obwohl er sein Leben lang komponierte, erreichte nie die Popularität eines Ralph Vaughan Williams. Wohl aber wusste er sein Handwerkzeug, das er sich autodidaktisch angeeignet hatte, einzusetzen, und war darin alles andere als laienhaft.
Schon vor Tagen war es angekommen – das Buch, um das es heute geht. Sein Verfasser hat es mir zur Besprechung persönlich zugeschickt. Im Briefkasten am selben Tag auch eine CD mit Kompositionen jenes in der Überschrift ebenfalls genannten Havergal Brian. William Havergal Brian lebte von 1876 (in Dresden, Staffordshire geboren) bis 1972 und war den Großteil seines Lebens als Komponist (hauptsächlich von Wiener Klassik inspiriert, mit Elementen dissonanter Harmonik und Atonalität) eher unbekannt, ja unbedeutend. Legendär indes ist, dass er 21 seiner insgesamt 32 Sinfonien jenseits seines 80. Geburtstags komponierte. 1961 – da war er bereits 85 Jahre alt, wurde seine 1. Sinfonie (die «Gothische») in Westminster aufgeführt. Ich höre sie, während ich dies schreibe, und habe gelesen, dass sie – was den Orchesterapparat angeht – sogar die Anforderungen von Gustav Mahler und Arnold Schönberg übertreffen soll. Nach dem Aufflackern in den 60ern verschwand Brians Werk wieder in den Kreisen seiner wenigen, aber sehr enthusiastischen Anhänger. William Brian, obwohl er sein Leben lang komponierte, erreichte nie die Popularität eines Ralph Vaughan Williams. Wohl aber wusste er sein Handwerkzeug, das er sich autodidaktisch angeeignet hatte, einzusetzen, und war darin alles andere als laienhaft.
Während ich das Buch von Fürkus umdrehe und auf dem rückwärtigen Einband zu lesen beginne, geht mir die Koinzidenz der Ankunft durch den Kopf. «In den Gedichten», steht dort, « greift er [Fürkus] vielfältige Momente des Lebens auf und setzt mit dem Reiz von Lyrik Akzente zum Nachdenken und Verweilen.» Ich blättere nach vorne. Erstes Gedicht:
«Der Schatten»
In der Höhe nicht zu messen,
nur als Fläche existent.
Wie von Zauberei besessen,
Projektionen kongruent.
Abbild aller Dimensionen,
stets dem Lichte zugewandt,
plattgewalzt wie Druckschablonen,
auch als Schattenspiel bekannt.
…
Das liest sich gefällig, und ist gereimt. Die Seiten danach lesen sich nicht mehr ganz so gefällig. Da beginnt es zu holpern. Das liegt nicht an den Themen, sondern an der spürbaren Anstrengung, sie in Reimen und Versen bändigen zu wollen. Dabei bleibt die Tiefe auf der Strecke, die Essenz und der Fluss kommen abhanden. Es sind tagesaktuelle Themen wie auch philosophische Betrachtungen unter den Gedichten: Selbstfindung, Erinnerungen, Impressionen, Lebens- und Leidenserfahrung, sowie Reflektionen über Politik – auch Atomkraft – und: ein «lyrischer Exkurs zur deutschen Geschichte». Spätestens hier breche ich ab, überfliege die Nachdichtungen englischer Songtexte, blättere in die Kurzgeschichten (Der Tag in Hallstatt und Krippenstein, Beim Orthopäden, Die Fahrradtour) hinein, und lege dann das Buch weg. Schade. Das war eine verschenkte Stunde. Wenn ich eins mitnehme, dann bestenfalls: hier hat jemand geschrieben und das ist an und für sich nicht zu bewerten. Das Geschriebene kann für einen kleinen Kreis, vielleicht den der Familie, durchaus stimmig sein. Da ist er dann zuständig. Schreiben klärt, Schreiben bringt im Akt des Artikulierenmüssens und -wollens zum Hin- und Einsehen.
Die Absicht einer Publikation, sprich einer Veröffentlichung ist, einen größeren Leserkreis zu erreichen. Den Weg, damit dieser größere Kreis erreicht werde, ebnen Verlage, das ist – unter anderen – ihre Aufgabe. Für das Schreiben für eine Leserschaft außerhalb der Familie oder des weiteren Freundeskreises bedarf es allerdings noch einiger Dinge mehr. Und außerdem einer anderen, weiteren Zuständigkeit.
In dieser Zuständigkeit sollte der Schreibende das Werkzeug beherrschen; er muss es so einsetzen können, dass selbst in einem Anderen, den er nicht von Angesicht kennt, etwas angesprochen wird. Schreiben ist eben doch nicht nur das Herausschreiben dessen, was man in sich selbst findet, sondern auch das An- und Aussprechen der Welt für die Welt.

In Jürgen Fürkus’ «Literarischen Eigenblicken» fehlen nicht nur das Feuer und der Genius, sondern auch der professionelle Umgang mit Sprache. Dem Buch können Güte, Menschlichkeit und Zuversicht nicht abgesprochen werden – aber Literatur ist das nicht…
In Verlagen arbeiten Lektoren, Menschen, die sich der Sprache, des Werkzeugs des Dichters annehmen. Wenn er dieses selbst noch nicht virtuos an den Stoff anlegen kann, zeigen sie ihm zweierlei auf: entweder, wie es gehen könnte (Talent vorausgesetzt, und der Dichter findet im gegenseitigen Prozess seinen Ton, wird eigenständig und wiedererkennbar) oder dass «es» so nicht geht und alle Müh vergebens sein wird (weil ein anderes, nicht aber das Talent zum Schreiben vorliegt).
Bei Book-on-demand bzw. ProBusiness gibt es offenbar kein Lektorat, oder – eine Recherche diesbezüglich ist noch nachzuholen – man muss es extra bezahlen, wenn man sein Buch dort in Druck gibt. Ich habe etliche Schreibbegeisterte erlebt, die glaubten, ihre Texte seien bereits «druckreif» – und ein kostenspieliges Lektorat für überflüssig hielten. Jürgen Fürkus‘ Sprache ist durchsetzt mit Irrtümern über das Lyrische, seine Wortwahl nah am Umgangssprachlich-Funktionalen, mit dem nicht er spielt, sondern das mit ihm spielt. – Das Wesen des Lyrischen ist die Verdichtung. Auch das Genre Kurzgeschichte lebt vom Verdichten. Eine einzelne wahre (vielfach banale) Begebenheit «genügt» einfach nicht, daraus eine Geschichte zu machen.
Indem ich das Buch zuklappe, denke ich das Wort «schal». Es fehlen das Feuer und der Genius. Dass aus den «Eigenblicken» Güte, Menschlichkeit und Zuversicht sprechen, kann und soll ihnen nicht abgesprochen werden; dass sie «literarisch» seien, indes schon. Schreiben sollte man dann doch denen überlassen, die es können. Lesen kann auch etwas sehr Schönes sein. ■
Jürgen Fürkus: Literarische Eigenblicke – Gedichte, Nachdichtungen, Kurzgeschichten, 144 Seiten, ProBusiness GmbH, ISBN 978-3-86386-465-1
.
Weitere Rezensionen von Karin Afshar im Glarean Magazin
.
.
.
.
.
Clemens Berger: «Ein Versprechen von Gegenwart» (Roman)
.
Entfremdete Tagleben
Dr. Karin Afshar
.
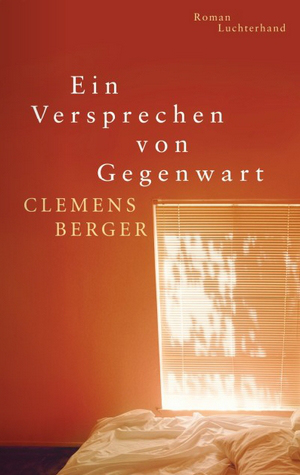 Wie ist es mit Ihnen: Suchen Sie sich Ihren Lesestoff nach Titeln aus? Oder nach Autoren, was heißt, Sie haben Lieblingsautoren und lesen deren Bücher, sobald sie auf dem Markt sind? Arbeiten Sie Bestsellerlisten ab, z.B. solche, die einem aus Illustrierten und Magazinen entgegenprangen? Oder lesen Sie ein Buch, weil Sie eine Besprechung dazu besonders anspricht?
Wie ist es mit Ihnen: Suchen Sie sich Ihren Lesestoff nach Titeln aus? Oder nach Autoren, was heißt, Sie haben Lieblingsautoren und lesen deren Bücher, sobald sie auf dem Markt sind? Arbeiten Sie Bestsellerlisten ab, z.B. solche, die einem aus Illustrierten und Magazinen entgegenprangen? Oder lesen Sie ein Buch, weil Sie eine Besprechung dazu besonders anspricht?
Für den Fall, dass Sie jemand aus der letzten Kategorie sind: hier ist mein Leseeindruck von Clemens Bergers Roman «Ein Versprechen von Gegenwart» für Sie. Kleinformat, 11,8 x 18,7 cm, Hardcover mit Schutzumschlag, terracottafarben, 160 Seiten so lesefreundlich formatiert, wie nur ein gedrucktes Buch zu sein vermag. Mal sehen, ob der Klappentext hält, was er verspricht.
Auf dem rückwärtigen Einband lesen Sie u.a. das Wort «Erotik»; ja – um es vorwegzunehmen – es gibt auch Sex in der Geschichte; die Erotik dieses Buches besteht allerdings in jener Art Erotik, die dem Unerreichbaren innewohnt. – Man kann die Erzählung unter diesem Gesichtspunkt lesen, oder unter noch anderem!
Dem Erzähler (erzählt in der Ich-Form), Kellner in einem Restaurant, fällt ein Paar auf, das in regelmäßigen Abständen zu später Stunde – in der Spanne von kurz vor und kurz nach Mitternacht – auftaucht. Das Paar: eine – und damit wir verstehen, wie es gemeint ist, mehrfach betont – schöne Frau namens Irina und ein Mann, der uns als «Löwe» vorgestellt wird. Was diese beiden verbindet, oder auch nicht verbindet, aber aneinanderhält, ahnen wir bald.
Der Kellner verfällt den beiden, sie beflügeln seine Phantasie, werfen ihn in eigene Erinnerungen; er lässt sich besetzen. Und er lässt den Leser an seinem vorgestellten und halb ausgelebten Voyeurismus, bei dem sich Grenzen verwischen, man nicht weiß: ist er es vielleicht doch selbst? Haben wir es mit einer Spaltung zu tun? – teilhaben. Erzählt wird die Geschichte dieser Liebesbeziehung, die keine ist, als Rückschau, aus der Perspektive von «Löwe» (Berger bedient sich dabei eines «Kniffs» – er spricht ihn als «du» an) und der der «Wildkatze» (ebenso), dann wieder vorgreifend… Der Leser wird in der Zeit umhergeworfen wie die beiden Protagonisten in der ersten und der zweiten Welt. Natürlich wird es eine Katastrophe geben. Sie wird mehrfach angedeutet. Das Wort Auflösung drängt sich mir beim Lesen auf. Ein Versprechen von Gegenwart wird nicht eingelöst und bleibt ein Versprechen. Am Ende dann mein Empfinden, nicht verstanden zu haben, worum es geht, und ich erschrecke. Ich lege das Buch irritiert weg.
Ich komme aus einer Gegenwart, die inzwischen Vergangenheit geworden ist, und das viel schneller als ich mir je hatte träumen lassen. Junge Autoren gehen ganz neu mit Sprache um, sie schreiben über Themen, die ich längst nicht mehr aufrollen muss, die ich hinter mir gelassen habe und über neue Themen, die sich mir nicht mehr stellen werden. Jetzt ist eine andere Gegenwart. Meine Vorlieben für eine bestimmte literarische Sprache ist von meiner gewesenen Gegenwart geprägt. Dass ich diese Vorlieben habe, hat u.a. mit mir zu tun. Schreibstil ist auch eine Charaktersache…
Abgesehen davon schreiben die Autoren von heute anders. Berger schreibt so anders. Daher kommt die Fremdheit. Er hat eine Sprache gefunden, die der aufgelösten (vormals konstruierten) Linearität unserer Moderne entspricht. Manche seiner Sätze fangen so an, wie ich es kenne, und bauen meine Erwartung auf, dann wird sie zerschlagen, endet in einer Sackgasse – der Satz, ein ganzer Absatz scheinen mir unverständlich. Noch einmal zurück, noch einmal von vorne lesen – und jetzt hab ich den Faden wieder. Klar, jetzt verstehe ich. Bis zum nächsten Ruck.
Neben Linearität bzw. deren Aufhebung verspüre ich die Abwesenheit von Kontinuität. An den Strand unserer Gegenwarten (jeder Mensch hat je eigene) schlagen heutzutage heftige Wellen. Sie kommen in kürzeren Abständen, sind stakkatohaft, alles ist beschleunigt. Die eine lange Welle, die aus den zusammengeschichteten Gegenwarten von einer in die andere übergeht, scheint es nicht mehr zu geben. Das Tagleben ist in Episoden zerlegt, die Menschen darin sich entfremdet. Das Tagleben ermöglicht vieles, verhindert aber auch anderes, und das ist dann allenfalls in der Nacht, kurz vor und kurz nach Mitternacht, möglich, in der Grauzone, in der die Grenze liegt, die man übertritt, übertreten kann. Sehe ich es so, verstehe ich durchaus.

Clemens Berger hat in seinem Roman «Ein Versprechen von Gegenwart» eine Sprache gefunden, die der aufgelösten (vormals konstruierten) Linearität unserer Moderne entspricht. Für eine flüchtige Lektüre zwischendurch ist das Büchlein fast zu schade. Auch wenn es sich schnell liest, hat es verdient, mindestens drei-viermal in die Hand genommen zu werden. Von diesem Autor sollten wir noch mehr zu lesen bekommen.
Eine Grenze übertreten sowohl der Ich-Erzähler als Kellner in seinem Tagleben, als auch «Löwe» in seinem „inoffiziellen» Leben mit Irina. Beide gehen zu weit und die Auflösung tritt – wie immer – in Gestalt von Unordnung ein. Die anfängliche Genauigkeit im Beschreiben auf den ersten Seiten, übervoll mit Details, das akribische Beobachten, die ein Stillstehen suggerieren, ein Verweilen in Gegenwart aufbauen, weichen zum Höhepunkt hin mehr und mehr. Nach dem Eklat ist die Sprache fragmentarisch, nicht gerade einfacher dadurch.
Für eine flüchtige Lektüre zwischendurch ist das Büchlein fast zu schade. Auch wenn es sich schnell liest, hat es verdient, mindestens drei-viermal in die Hand genommen zu werden. Von Clemens Berger sollten wir noch mehr zu lesen bekommen. Das hoffe ich doch schwer. ■
Clemens Berger: Ein Versprechen von Gegenwart, Roman, 160 Seiten, Luchterhand Verlag, ISBN 978-3-630-87410-4
.
Weitere Rezensionen von Karin Afshar im Glarean Magazin
.
.
.
.
.
Interessante Literatur-Novitäten – kurz vorgestellt
.
Clemens Umbricht: «Museum der Einsichten»
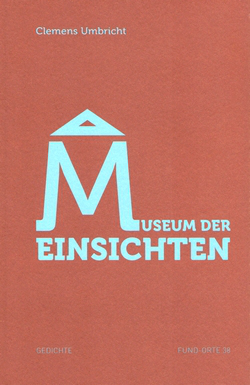 Seit seiner frühen Lyrik-Veröffentlichung «Der Abstand der Wörter» vor rund 20 Jahren zählt der im Luzernischen Reiden geborene Schriftsteller und Verleger Clemens Umbricht zu den gewichtigen Poesie-Stimmen der Schweiz. Nun legt der inzwischen verschiedentlich mit Preisen prämierte Lyriker seine neue Sammlung «Museum der Einsichten» als 38. Ausgabe der Reihe «Fund-Orte» im Zürcher Orte-Verlag vor.
Seit seiner frühen Lyrik-Veröffentlichung «Der Abstand der Wörter» vor rund 20 Jahren zählt der im Luzernischen Reiden geborene Schriftsteller und Verleger Clemens Umbricht zu den gewichtigen Poesie-Stimmen der Schweiz. Nun legt der inzwischen verschiedentlich mit Preisen prämierte Lyriker seine neue Sammlung «Museum der Einsichten» als 38. Ausgabe der Reihe «Fund-Orte» im Zürcher Orte-Verlag vor.
«Museal» waren Umbrichts Gedichte noch nie – noch nicht mal das Etikett «regional» gilt (ein die Schweizer Lyrik oft treffendes Vorurteil). Vielmehr durchmessen Umbrichts «Einsichten», poetisch verwandelt und geadelt, ein reiches Themata-Spektrum vom «Austernfrühstück» bis zum «Spaziergang in Venedig», von «Atlantis» bis zur «Osterinsel». Gegliedert ist der vom Verlag sehr qualitätsvoll realisierte Band in die fünf Abschnitte «Leer vom Hunger nach Licht» , «Der Kontinent, den niemand kennt», «Doppelgänger beim Frühstück», «Britische und andere Impressionen» und «Anwesenheit, Abwesenheit». Umbricht breitet hier eine sehr bildreiche, oft packende, manchmal still-eindringlich wirkende Palette von Poesie, lyrischen Impressionen und Aphoristischem aus. Lesenswert. (we) ■
Clemens Umbricht: Museum der Einsichten, Gedichte, 74 Seiten, Orte Verlag, ISBN 3-85830-166-6
.
.
Rainer Wedler: «Es gibt keine Spur»
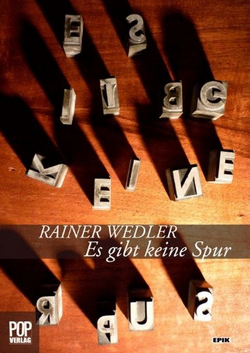 Im Gegensatz zu seinen früheren Prosa-Publikationen schöpft der Karlsruher Schriftsteller Rainer Wedler (geb. 1942) in seinem jüngsten Belletristik-Band «Es gibt keine Spur» nur schon äusserlich diesmal aus dem Vollen: Auf üppigen 330 Seiten fächert Wedler ein thematisch wie sprachlich beeindruckendes Kaleidoskop von ultrakurzen bis ellenlangen Prosastücken auf.
Im Gegensatz zu seinen früheren Prosa-Publikationen schöpft der Karlsruher Schriftsteller Rainer Wedler (geb. 1942) in seinem jüngsten Belletristik-Band «Es gibt keine Spur» nur schon äusserlich diesmal aus dem Vollen: Auf üppigen 330 Seiten fächert Wedler ein thematisch wie sprachlich beeindruckendes Kaleidoskop von ultrakurzen bis ellenlangen Prosastücken auf.
Den weit über 50 Erzählungen – sie stammen teils aus früheren Schaffensjahren – eignet durchwegs enorme sprachliche Virtuosität und eine Varianz der Diktion, die verblüfft: Vom Staccato beim Darstellen «objektiver philosophischer Zustände» bis hin zum epischen Legato beim Schildern emotionaler Untiefen findet der wort- und bildverliebte Autor den adäquaten Sprachfluss. Über bzw. unter allem schimmert dabei eine (durchaus auch selbst-)ironische Nuance durch, die alle Intellektualität literarisch durchwächst. Keine einfache, eine anstrengende Lektüre, die desto stärker fesselt, je konzentrierter man sie zu sich nimmt. Empfehlenswert. (we) ■
Rainer Wedler: Es gibt keine Spur, Prosastücke, 330 Seiten, Pop Verlag, ISBN 978-3863560522
.
.
Weitere Literatur-Rezensionen im Glarean Magazin
.
.
.
.
.
.
Gesina Stärz: «Die Verfolgerin» (Roman)
.
«Heute Nacht bin ich gestorben»
Günter Nawe
.
 Was wäre, wenn… man einfach einen Menschen töten würde. Einfach so – auf der Straße? Traum oder Albtraum – oder gar Wirklichkeit? Ein solcher Gedanke jedenfalls wird für Jossi zu einer Art Obsession. Dabei ist Jossi, Anfang vierzig, eine eigentlich recht unauffällige Frau, die in sogenannten gutbürgerlichen Verhältnissen lebt. Ihr Mann ist Kardiologe, die beiden Söhne studieren, sie verdient sich ihr Geld als Texterin.
Was wäre, wenn… man einfach einen Menschen töten würde. Einfach so – auf der Straße? Traum oder Albtraum – oder gar Wirklichkeit? Ein solcher Gedanke jedenfalls wird für Jossi zu einer Art Obsession. Dabei ist Jossi, Anfang vierzig, eine eigentlich recht unauffällige Frau, die in sogenannten gutbürgerlichen Verhältnissen lebt. Ihr Mann ist Kardiologe, die beiden Söhne studieren, sie verdient sich ihr Geld als Texterin.
Wäre da nicht… Von ihrem Mann, der im Roman nur als «der Ehemann» oder «der Mann» bezeichnet wird, fühlt sie sich nach zwanzig Jahren Ehe nicht mehr genügend beachtet, ja verlassen – und wird es letztendlich auch. Ihre Liaison mit Till ist mehr oder minder oberflächlich. Bleibt nur der Schmerz, das Unausgefülltsein. Am Ende hat der Leser ein großartiges Psychogramm einer Frau gelesen.
«Heute Nacht bin ich gestorben», so heißt es zu Beginn des Romans. «Innerlich… Der Mann neben mir im Bett hat geschnarcht…« Ein Whiskey sour lässt «alle Zellen in mir in Schneekristalle verwandeln. Ich weiß nicht, ob ich das geträumt habe, aber ich fühlte mich besser, und etwas in mir wusste, dass dieser Zustand anhalten würde.»
Soweit also die «psychologischen» Voraussetzungen in dem Roman «Die Verfolgerin» von Gesina Stärz. Die Autorin, sie ist in Sachsen geboren, lebt in München und hat mit «kalkweiss» bereits 2011 einen beachtlichen und beachteten Roman veröffentlicht. In ihrem neuen Roman gelingt es ihr auf sehr subtile Weise, Fiktion und Wirklichkeit in Einklang zu bringen, ein spannendes Geflecht von Traum und realem Erleben herzustellen.
Jossi «erfindet» sich ein neues Leben außerhalb der bisherigen Lebenswirklichkeit. Sie verstrickt sich in die Gedankenwelten von Mörderinnen und Mördern, plant gedanklich den perfekten Mord. Motiv: Fehlanzeige. Ihre «Opfer»: Zufallsbegegnungen und Menschen, auf deren Gesichtern alle Empfindungen gelöscht sind. Sie wird zur «Verfolgerin» – auf der steten Suche nach ihren Opfern.
Hier bekommt der Roman einen interessanten kriminalistischen Touch. Jossi recherchiert bis ins kleinste Detail eine Tötungsmethode, die keine Spuren hinterlässt. Ein Gift, das nicht oder kaum nachweisbar ist, wird über eine komplizierte Konstruktion durch einen Stock für das Opfer kaum wahrnehmbar injiziert wird.

Gesina Stärz hat einen schönen und spannenden Roman geschrieben, der angesiedelt ist zwischen Psychologie und Kriminalistik, zwischen Traum und Wirklichkeit – und zugleich eine interessante psychologische Studie darstellt über Fiktion und Realität
Die «Planungen» der Morde, die Recherche nach einem seltenen Gift, die Konstruktion der «Waffe», die «Durchführung» (Jossi hat 17 Morde begangen, und niemand hat es bemerkt) – dies alles steht in direktem Zusammenhang mit dem realen Leben der Verfolgerin. Nach außen sieht es so aus, als gelte der ganze Aufwand einem Romanprojekt. Familie, Freundinnen, der Liebhaber – sie alle werden auf raffinierte Art und Weise getäuscht. Alles andere bleibt offen. Fiktion oder Realität? Am Ende bekennt die Verfolgerin: «Ich wollte nicht, das der Ehemann geht. Ich wollte, dass er mich sieht, dass er mich spürt, dass er mir die Hand reicht.». Gibt es hier doch das, was Psychologen und Kriminologen ein Motiv nennen?
Am Ende steht auch ein Satz, der diesen Roman in sprachlicher Hinsicht charakterisiert: «Ihr Ton ist sachlich und wirkt streng.» Das gilt auch für Gesina Stärz’ Sprache, die fast emotionslos ist und wie ein Dossier gelesen werden kann. Die Spannung bezieht das interessante Werk aus seiner gelungenen Mischung von Traum und Wirklichkeit – und tieferer Bedeutung. ■
Gesina Stärz: Die Verfolgerin, Roman, edition 8, 174 Seiten, ISBN 978-3-85990-183-4
.
.
.
.
Nico Bleutge: «Verdecktes Gelände» (Gedichte)
.
Moderne Lyrik – mit Voraussetzungen
Bernd Giehl
.
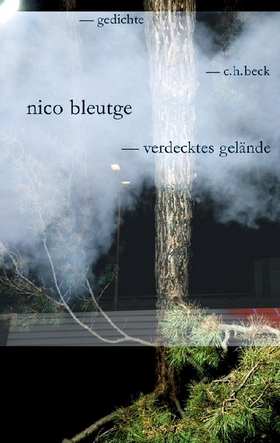 Wer schreibt heute eigentlich noch Naturgedichte? Ich muss gestehen: Ich bin nicht auf dem Laufenden. Jedes Jahr erscheinen so viele Lyrikbände, da kann man schon mal den Überblick verlieren – Sarah Kirsch fällt mir ein oder Wulf Kirsten, aber sonst? Gibt es auch noch jüngere Autoren, die die Natur zu ihrem Gegenstand wählen? Ich habe ein wenig im 25. Jahrbuch der Lyrik (S. Fischer 2007) geblättert. Ein paar habe ich im Teil von 1998 gefunden (Jürgen Becker, Friederike Mayröcker). Sonst: nicht viel. Naturlyrik scheint gerade nicht «in» zu sein. Dabei vereint dieser Band doch die Gedichte unterschiedlichster Autoren aus den Jahren 1979-2006.
Wer schreibt heute eigentlich noch Naturgedichte? Ich muss gestehen: Ich bin nicht auf dem Laufenden. Jedes Jahr erscheinen so viele Lyrikbände, da kann man schon mal den Überblick verlieren – Sarah Kirsch fällt mir ein oder Wulf Kirsten, aber sonst? Gibt es auch noch jüngere Autoren, die die Natur zu ihrem Gegenstand wählen? Ich habe ein wenig im 25. Jahrbuch der Lyrik (S. Fischer 2007) geblättert. Ein paar habe ich im Teil von 1998 gefunden (Jürgen Becker, Friederike Mayröcker). Sonst: nicht viel. Naturlyrik scheint gerade nicht «in» zu sein. Dabei vereint dieser Band doch die Gedichte unterschiedlichster Autoren aus den Jahren 1979-2006.
Viele Gedichte Nico Bleutges handeln vom Erleben der Natur. Aber es ist keine idyllische Natur, sondern eine eher fremdartige, vom Menschen unter seine Herrschaft gezwungene, die Bleutge beschreibt:
«am ufer ankommen, wach/ unter dem schwelgeruch der flure, ruß-/ wasser, wandernder austritt, der sog/ lief langsam in sich zurück. keller / die nachhallten, gänge, einfach überwölbt, / von feuchte durchzogen, sie zeigte sich vorne, / bewegte sich im hintergrund, kaltluft drang nach, / infiltrierte die stufen, moos, die rohe verflechtung/ löste sich aus dem raum, löste sich auf im gehen/das schon innen war, wände verschwammen, zellen/ wuchsen in die gänge ein, porig, vertraut/ mit den fugen, ließen sie, ringsum verlängert / pflanzen austreiben, wuchernde blattformen/ führten tiefer ins ufer hinab.»
Bleutges Technik ist die der Überblendung. Bilder schieben sich ineinander. Da ist zum einen das Bild eines Bach- oder Seeufers und zum anderen das Bild eines alten bemoosten Kellergewölbes oder Kellergangs, und beide werden bis zur Ununterscheidbarkeit vermischt. An anderen Stellen beschreibt Bleutge nur Natur, aber er geht so nah heran, dass das Bild verschwimmt:
«wasser im sinn haben, steine, / das rundumlaufende licht/ auf den schichten des piers// meeresbeweglichkeit, kurzes/ sprühen, austausch von wärme/ und gewicht, denken an//
Witterung, kiemen, brüchiges/, holz, das sich ablöst, gleich/ wieder angesaugt wird//
von den pfosten am pier./ fischsilber, mölekulares/ glänzen, rohglas, zersplittert//
und doch aufgenommen, vermischt/ mit der entfernung zum hafen/ die masse durchdringt sich, wasser//
in wasser, ein drängen so eins/ in sich, so unterschieden/ wie die steine, die gleiten, leicht//
ihre schuppen verlieren, sinken/ versenken zinkweiße strömung/ aus spannung und klang//
die nicht nachläßt/ sich formt/ im gedanken an flutwechsel, / dämmerungsdichte am hafen.»
Natur wie fotografiert vom Makroobjektiv. Der Pointillismus fällt mir ein, eine Strömung, die sich Ende des 19. Jahrhunderts aus dem Impressionismus entwickelte, und dessen Bilder man nur erkennen kann, wenn man Abstand nimmt.
Aber keine Regel ohne Ausnahme. Es gibt auch andere Gedichte, die fast schon verständlich sind beim ersten Lesen. Gedichte, von denen man den Eindruck hat, man könne ihren Inhalt in eigenen Worten wiedergeben.(«die augen meiner Mutter waren hinter glas», S.36, «und manchmal nachts da geht der atem leise, S.40) Das sind dann keine Gedichte über die Natur, sondern über das eigene Bewusstsein.

Die Gedichte Nico Bleutges handeln vom Erleben der Natur. Aber es ist keine idyllische Natur, sondern eine eher fremdartige, vom Menschen unter seine Herrschaft gezwungene, die Bleutge beschreibt. Komplexe Sprachgebilde, die gewisse Kenntnisse der modernen Literatur voraussetzen.
Gedichte, so habe ich es schon mehrfach behauptet, sagen nicht unmittelbar, was sie meinen, sondern sie sprechen in Bildern, und manchmal stellen sie ihre Leser auch vor Rätsel. So betrachtet sind diese Gedichte durchaus lesenswert. Allerdings sollte man schon eine Ahnung von moderner Lyrik haben, ehe man sich mit ihnen befasst… ▀
Nico Bleutge: Verdecktes Gelände, Lyrik, C.H. Beck Verlag, 68 Seiten, ISBN 978-3406646782
.
Interessante Buch-Novitäten – kurz vorgestellt
.
Ferdinand Wedler: «stARTistik» – Die Welt in Kunstkuchen
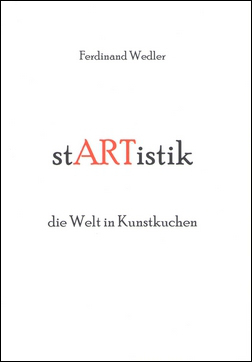 Der deutsche Philologe und technische Software-Redakteur Ferdinand Wedler (geb. 1979) ist als freiberuflicher Illustrator und Karikaturist vielseitig tätig. In seiner jüngst erschienen «stARTistik» knöpft er sich die oft verräterisch skurrile Welt der Zahlen, Statistiken, Umfragen vor. Als «erzählte Zählungen» will er seine «Welt in Kunstkuchen» verstanden wissen: Seine Kuchendiagramme – jeweils durch eine stilisierte Zeichnung illustriert – haben einen teils direkten, teils mehrdeutigen und auch erst zu enträtselnden Sprachwitz. Vor Wedlers humorvollem Zugriff ist dabei kein Alltagsbereich sicher; das Bändchen ist unterteilt in die Segmente: leben, wohnen und essen, lieben, denken, arbeiten, reisen, sehen-hören-lesen. Denn wie meint der Autor: «An allen Schauplätzen des Lebens lassen sich aus dem Erlebten Kuchenstücke bilden. Teile eines Kuchens, der Raum für das Gedachte öffnet». – Originell. ■
Der deutsche Philologe und technische Software-Redakteur Ferdinand Wedler (geb. 1979) ist als freiberuflicher Illustrator und Karikaturist vielseitig tätig. In seiner jüngst erschienen «stARTistik» knöpft er sich die oft verräterisch skurrile Welt der Zahlen, Statistiken, Umfragen vor. Als «erzählte Zählungen» will er seine «Welt in Kunstkuchen» verstanden wissen: Seine Kuchendiagramme – jeweils durch eine stilisierte Zeichnung illustriert – haben einen teils direkten, teils mehrdeutigen und auch erst zu enträtselnden Sprachwitz. Vor Wedlers humorvollem Zugriff ist dabei kein Alltagsbereich sicher; das Bändchen ist unterteilt in die Segmente: leben, wohnen und essen, lieben, denken, arbeiten, reisen, sehen-hören-lesen. Denn wie meint der Autor: «An allen Schauplätzen des Lebens lassen sich aus dem Erlebten Kuchenstücke bilden. Teile eines Kuchens, der Raum für das Gedachte öffnet». – Originell. ■
Ferdinand Wedler: stARTistik – Die Welt in Kunstkuchen, 72 Seiten, epubli Berlin, ISBN 978-3844216349
.
.
Carola Vahldiek: «Ein Tag wie ein Schmetterling»
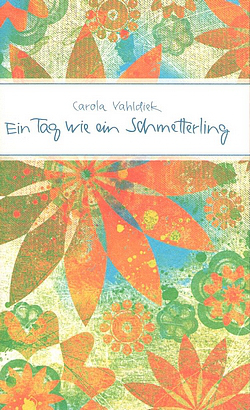 «Das weiße Blatt / des Tages mit / Worten / beschreiben: / “Guten Morgen!” / Den Morgen gut sein lassen» – so eröffnet die Lyrikerin und bekannte norddeutsche Naturphotographin Carola Vahldiek ihr jüngstes kleines «Wohlfühl-Bändchen» namens «Ein Tag wie ein Schmetterling». Und ebenso leicht-luftig kommen alle anderen Sprüche und Illustrationen auf diesen schmuck gestalteten, betont positiv gehaltenen “Frühlingsblättern” daher. Innehalten, aber auch Wandlung sind dabei zwei zentrale inhaltliche Leitmotive des auch kalligraphisch hübsch konzipierten Büchleins. Problembewusstsein oder philosophische Schwere findet sich nirgends auf diesen paar farbhellen Seiten – dafür viel guter Zuspruch und die Aufforderung zum Wahrnehmen des Moments: «Am Ende / mit blauen Stiften / Nacht / einkehren lassen / und einen / Stern». – Wellness. ■
«Das weiße Blatt / des Tages mit / Worten / beschreiben: / “Guten Morgen!” / Den Morgen gut sein lassen» – so eröffnet die Lyrikerin und bekannte norddeutsche Naturphotographin Carola Vahldiek ihr jüngstes kleines «Wohlfühl-Bändchen» namens «Ein Tag wie ein Schmetterling». Und ebenso leicht-luftig kommen alle anderen Sprüche und Illustrationen auf diesen schmuck gestalteten, betont positiv gehaltenen “Frühlingsblättern” daher. Innehalten, aber auch Wandlung sind dabei zwei zentrale inhaltliche Leitmotive des auch kalligraphisch hübsch konzipierten Büchleins. Problembewusstsein oder philosophische Schwere findet sich nirgends auf diesen paar farbhellen Seiten – dafür viel guter Zuspruch und die Aufforderung zum Wahrnehmen des Moments: «Am Ende / mit blauen Stiften / Nacht / einkehren lassen / und einen / Stern». – Wellness. ■
Carola Vahldiek: Ein Tag wie ein Schmetterling, 24 Seiten, Verlag am Eschbach, ISBN 978-3-86917-216-3
.
.
Johanna Adorjan: «Meine 500 besten Freunde»
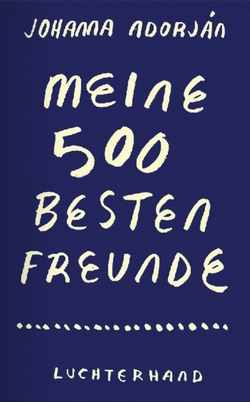 Die bekannte FAZ-Feuilletonistin Johanna Adorján präsentiert mit ihrem Band «Meine 500 besten Freunde» nun bereits ihre dritte grössere Belletristik-Novität – nach dem Theaterstück «Die Lebenden und die Toten» (2004) und nach «Eine exklusive Liebe» (2009).
Die bekannte FAZ-Feuilletonistin Johanna Adorján präsentiert mit ihrem Band «Meine 500 besten Freunde» nun bereits ihre dritte grössere Belletristik-Novität – nach dem Theaterstück «Die Lebenden und die Toten» (2004) und nach «Eine exklusive Liebe» (2009).
Der Band versammelt 13 eher lose miteinander verknüpfte Erzählungen aus und über Deutschlands Hauptstadt. Die 1971 in Stockholm geborene Autorin breitet dabei ein durchaus sensibel beobachtetes Kaleidoskop von Berliner Protagonisten aus, deren Leben sich extrem widersprüchlich zwischen Sein und Schein abspielt, gespiegelt in der oft scharf formulierten Ironie Adorjans. Die skurrile bis abstruse Welt der Berliner Schickeria und ihren Modemachern, Regisseuren, Schauspielern und Journalisten – hier wird sie literarisches Ereignis. – Lesevergnügen. ■
Johanna Adorján: Meine 500 besten Freunde, Erzählungen, 256 Seiten, Luchterhand Verlag, ISBN 978-3-630-87354-1
.
.
.
Weitere Rezensionen im Glarean Magazin
.
.
.
.
.
.
Gisela Elsner: «Zerreissproben» (Erzählungen)
.
Nichts für zarte Gemüter
Dr. Karin Afshar
.
 Bestimmt haben Sie als Leser oder Leserin mehr als einmal darüber nachgedacht, zu welcher Gruppe Leser Sie wohl gehören würden, wenn es in Buchhandlungen nicht die üblichen Sparteneinteilungen in Sachbücher, Romane, Fantasy, Frauenromane etc. gäbe, sondern Einteilungen wie z.B. in Kundensparten: «Interessiert sich für die politische Richtung eines Autors», oder «Meint, kein Autor schreibe anders als autobiografisch», oder «Interessiert sich für in Widersprüche verstrickte Autoren», zu deren Regale Sie dergestalt orientiert Ihre Schritte lenken könnten, um sicherzustellen, dass Sie auch genau die Bücher, die Sie interessieren, in die Hände bekämen und nicht unnötigerweise – das Leben hält genug schlechte Überraschungen bereit – solche, die sie enttäuschen würden. Die Sparten in Kombination würden Ihnen jenes Buch auswerfen, um das es in den nächsten Absätzen gehen wird.
Bestimmt haben Sie als Leser oder Leserin mehr als einmal darüber nachgedacht, zu welcher Gruppe Leser Sie wohl gehören würden, wenn es in Buchhandlungen nicht die üblichen Sparteneinteilungen in Sachbücher, Romane, Fantasy, Frauenromane etc. gäbe, sondern Einteilungen wie z.B. in Kundensparten: «Interessiert sich für die politische Richtung eines Autors», oder «Meint, kein Autor schreibe anders als autobiografisch», oder «Interessiert sich für in Widersprüche verstrickte Autoren», zu deren Regale Sie dergestalt orientiert Ihre Schritte lenken könnten, um sicherzustellen, dass Sie auch genau die Bücher, die Sie interessieren, in die Hände bekämen und nicht unnötigerweise – das Leben hält genug schlechte Überraschungen bereit – solche, die sie enttäuschen würden. Die Sparten in Kombination würden Ihnen jenes Buch auswerfen, um das es in den nächsten Absätzen gehen wird.
Wenn Sie den Eingangssatz durchdrungen haben, stehen Sie bereits mitten in einem Labyrinth; so ist es zumindest bei Gisela Elsner. Besagter Satz ist nur ein fader Abklatsch dessen, was sie zu Papier bringt. Die kafkaeske Art ist ihr Stil, ihr Markenzeichen: sie konstruiert Sätze, die erstaunen, zum Lachen bringen, ungeduldig, atemlos, ja, wütend machen. Sie wiederholt, insistiert, ist akribisch, sie zählt auf, spitzt zu, zerpflückt, zerteilt… Dieser Erzählstil unterstreicht natürlich Inhalte, und die sind nicht lustig. Ihre Texte handeln von der Künstlichkeit einer bürgerlichen Welt, die einerseits die Schrauben immer fester anzieht, andererseits verschroben daher kommt.
Elf Erzählungen Elsners hat die Herausgeberin Christine Künzel neu choreographiert, und die Abfolge ist gelungen. Christine Künzel betreut seit 2002 die Werkschau Gisela Elsners im Verbrecher Verlag Berlin: «Die Zähmung», Roman (2002), «Das Berührungsverbot», Roman (2006), «Heilig Blut», Roman (2007), «Otto der Großaktionär», Roman (2008) und «Fliegeralarm», Roman (2009) sind bereits erschienen. Gisela Elsner erhielt etliche internationale Auszeichnungen, darunter den Prix Formentor für ihren ersten Roman «Die Riesenzwerge» (1964), an dessen Erfolg sie nicht wieder anknüpfen konnte. Sie veröffentlichte Romane, Erzählungen, Aufsätze, Hörspiele und das Opernlibretto «Friedenssaison».
Elsner beschreibt in den vorliegenden Erzählungen vor allem Menschen, die sie aus dem Kollektiv herausarbeitet, wie man einen 3D-Abdruck aus einem Nagelbild herausarbeitet: hinten wird gedrückt und vorne entsteht das Bild. Sie beschreibt das Kollektiv, die Welt der Oberfläche, die sie sodann demaskiert, damit das Darunter – das Scheinheilige – zum Vorschein kommt. Die Geschichten verlangen starke Nerven, denn Elsner zerlegt und karikiert so gründlich, dass sie sich selbst und dem Leser den Boden unter den Füßen wegzuziehen vermag.
In «Die Zerreißprobe» (der ersten Erzählung im Band 2) geht es um eine Frau, die sich – als Terroristin verdächtigt – im Fadenkreuz des Verfassungsschutzes glaubt. Ihre Wohnung wird beobachtet. Wenn sie nicht zuhause ist, kommen «sie», schalten Tischlampen aus, verrücken Möbel und schneiden von Kleidungsstücken Stofffetzen ab. Von einem Nachbarn, dem Vormieter dieser Wohnung, in der sie nun lebt, erfährt sie, dass in der Wohnung in erst kürzlich zurückliegender Vor-Nach-Stammheimer Zeit Terroristen untergeschlüpft sein sollen. Der Verdacht – so vermutet die Erzählerin, die auch in der Erzählung Schriftstellerin ist – fällt jetzt auf sie, aber sie geht der Sache auf den Grund.
In «Der Maharadscha-Palast» mokiert sie sich über eine Reisegesellschaft, die am Ort ihrer Unterkunft mit einigen Überraschungen konfrontiert ist: keiner der Betroffenen wird sich – zurück in Deutschland – die Blöße geben und zugeben, sich angesichts des Vorgefundenen entlarvt zu haben.
«Der Selbstverwirklichungswahn» verhöhnt nicht nur die Selbstfindungswelle der frühen 80er Jahre, sondern nimmt die Auswüchse der «Grünlichen» aufs Korn, und dabei nicht weniges vorweg. Wie überhaupt die spitz gezeichneten Bilder sowohl allesamt Abbilder der 70er und 80er sind, als auch eine Vorwegnahme, die wir jetzt – 2013 – im Nachhinein in voller Tragweite bestätigen können. Elsners Geschichten sind meiner Meinung nach mehr als Satire. Unsere Zeit hat die Satire längst eingeholt, und bei manchen Erzählungen ereilt mich der Verdacht, Elsner habe geahnt, worauf es hinausläuft, und ist Opfer ihres persönlichen Minenfeldes geworden. Damit musste sie eine Herausgefallene werden!
In «Der Sterbenskünstler» geht es um die Friedensbewegung und ihre Abstrusitäten, in «Der Antwortbrief Hermann Kafkas auf Franz Kafkas Brief an seinen Vater» bricht sie mit ihrem «Gott» Franz, an dem sich orientieren zu können sie in jungen Jahren glaubte: «Du schreibst, Du wärest mir als das Ergebnis meiner Erziehung peinlich. […] Viel peinlicher indes als das Ergebnis meiner Erziehung ist für mich die Tatsache, dass ich es durch Dich mehr und mehr verlerne, nicht allein die Welt zu begreifen, sondern auch mich. […]» Kafka, ohne dies ergiebig zu vertiefen, lebte vor den Toren zur Gegenwart und trat nicht über die Schwelle ins Jetzt. Seine Hauptthemen waren durchweg voller Anklage an jene, von denen er glaubte, sie verhinderten ihn. Das wiederum übte eine gewisse Faszination – nicht nur auf Elsner – aus.

In ihrem zweiten Erzählband “Zerreissproben” legt Gisela Elsner ein Zeugnis ihrer selbst ab, und das so fundamental und radikal, dass es einem die Luft abdrehen kann. Wir blicken in Abgründe…
«Die Zwillinge» und «Vom Tick-Tack zum Tick» kommen im Vergleich zu «Die verwüstete Glückseligkeit» harmlos daher, zeugen aber gerade deshalb von Elsners – es Talent zu schreiben zu nennen, wäre eine Beleidigung – mal lauter, mal leiser Demontierungswut und Wortgewalt. Elsner geht auch mit sich selbst hart ins Gericht, demontiert sich selbst und erwartet anscheinend doch unendlich viel – oder gar nichts mehr? Was weiß man von dieser Frau? Muss man etwas über sie wissen? Ich finde ja: man muss! Sie ist gegen die Friedensbewegung, sie lehnt die Errungenschaften von 68 radikal ab, sie bekennt sich zum Kommunismus, ist aber doch wankelmütig (Eintreten, dann Austreten, dann Wiedereintreten in die DKP), sie will nicht Dichterin genannt werden, … Sie inszeniert sich selbst und später – als das nicht mehr reicht – ihre Selbstzerstörung. Sie hadert mit sich, ist unzufrieden, gehört nirgendwo dazu, und braucht das vielleicht doch sehr dringend? «Irgendwie» besteht die «reine Möglichkeit», dass das Ende der ganzen Kette von Missständen, dem Abstrusen, dem verhassten Kapitalismus, der Kleinbürgerlichkeit … ein anderes Leben bedeuten könnte – bis es jedoch soweit ist, fehlt ihr eine wirklich positive Perspektive. Gisela Elsner wird 1937 in Nürnberg geboren, und nimmt sich 1992 das Leben.
Im Buch enthalten sind Erklärungen zu Elsners erzählerischem Werk, editorische Notizen zur Historie der einzelnen Erzählungen sowie deren Verortung im Gesamtwerk. Niemand schreibt anders als autobiografisch – zu dieser Ansicht bin ich im Laufe meines Lebens gelangt. Das Herausstechendste an Elsners hier vorgelegten Erzählungen ist: sie legt ein Zeugnis ihrer selbst ab, und das so fundamental und radikal, dass es einem die Luft abdrehen kann. Wir blicken in Abgründe. Nicht viel Spaß wünsche ich nun beim Lesen, sondern viele Erkenntnisse! ●
Gisela Elsner: Zerreissproben, Erzählungen (Band 2), 224 Seiten, Verbrecher Verlag, ISBN 9783943167054
.
.
.
.
.
Hanns-Josef Ortheil: «Das Kind, das nicht fragte»
.
«Kennst du das Land / Wo die Zitronen blühn?»
Christian Busch
.
 Milde, sanfte Zephirwinde, verzaubernder Duft, im Sonnenlicht gereifte Zitrusfrüchte, melodienschöne Klänge fremder Sprache, in Olivenöl getauchte, mediterrane Speisen, antike, sagenumwobene Kulissen, historische Schätze beherbergende Stätten, die zu den Wurzeln abendländischer Kultur führen: Das alles ist Italien, das Land der Sehnsucht und Objekt germanischen Fernwehs. Der nicht erst seit Goethes Mignon vielbeschworene literarische Topos figuriert in der Gestalt Siziliens auch in Hanns-Josef Ortheils neuem Roman «Das Kind, das nicht fragte» als magischer Ort, der den Lauf der Dinge und der Menschen verändert.
Milde, sanfte Zephirwinde, verzaubernder Duft, im Sonnenlicht gereifte Zitrusfrüchte, melodienschöne Klänge fremder Sprache, in Olivenöl getauchte, mediterrane Speisen, antike, sagenumwobene Kulissen, historische Schätze beherbergende Stätten, die zu den Wurzeln abendländischer Kultur führen: Das alles ist Italien, das Land der Sehnsucht und Objekt germanischen Fernwehs. Der nicht erst seit Goethes Mignon vielbeschworene literarische Topos figuriert in der Gestalt Siziliens auch in Hanns-Josef Ortheils neuem Roman «Das Kind, das nicht fragte» als magischer Ort, der den Lauf der Dinge und der Menschen verändert.
Seine autobiographische Züge tragende Hauptfigur ist ein Benjamin, der Ethnologe Benjamin Merz, das von klein auf unterdrückte, jüngste Kind einer siebenköpfigen bürgerlichen Familie. Von Köln bricht er im Frühjahr auf zu neuen Ufern – nach Mandlica, einer (fiktiven) sizilianischen Kleinstadt. «Gedankenleser» – so werden die Einwohner Mandlicas ihn auf Grund seiner Begabung, den Menschen zuzuhören, ihnen in ihren Erzählungen zu folgen und sie auf diesem Weg zu erforschen, in respektvoller Verehrung nennen, wenn sie sich ihm öffnen. Dass ihn sein wissenschaftliches Forschungsprojekt nicht nur weg von den eigenen morbiden Wurzeln seiner Familiengeschichte und der Enge der Heimat führen wird, sondern auch zu den eigenen tief in ihm vergrabenen Ursprüngen seiner ethnologischen Studien, ahnt man. «Wenn ich die Augen schließe und an Deutschland denke, sehe ich ein Land der Quiz- und Kochsendungen, der überdrehten, wichtigtuerisch vorgetragenen Wetterberichte und der sich täglich ins Kleinste verlaufenden politischen und ökonomischen Kommentare, die ein immerwährendes Unwohlsein verbreitet und dieses Unwohlsein kultivieren.»
So bezieht Benjamin sein Quartier in einer kleinen Pension und beginnt die Wege und Gespräche der Menschen zu suchen. In der Pension trifft er zunächst auf ausgewanderte Landsleute, die den Reizen Siziliens bereits erlegen und verbunden sind: die redselige Maria mit ihrer verschlossenen herb-schönen Schwester Paula, welche zugleich Übersetzerin und Hüterin des Hauses des sizilianischen Nobelpreisträger für Literatur. Schritt für Schritt findet er Zugang zu den bedeutenden und geheimnisvollen Gestalten des Ortes und zu ihren Geheimnissen. Da ist der Buchhändler Alberto, Lucio mit den feuchten und weit geöffneten Augen, Besitzer eines klassischen, traditionellen Ristorante, der für windige EU-Projekte eintretende Bürgermeister Enrico Bonni, seine außergewöhnliche Tochter Adriana und zuletzt die weise Signora Vulpi mit ihrem «gefühligen» Sohn Matteo.
Der zunächst eher karg und verhalten beginnende Roman gewinnt durch die beständige Ich-Perspektive und die stets Unmittelbarkeit des Geschehens evozierende Gegenwart zunehmend an atmosphärischer Dichte. Die dadurch erzeugte Sogkraft hilft dabei, den doch sehr glatt reüssierten Siegeszug der Hauptfigur zu übersehen und dem durchweg photogen und mit sinnlichem Gespür für sizilianische Wirklichkeit erzählten Geschehen treu zu bleiben, bis man ihm schließlich atemlos erlegen ist. Hier erweist sich Hanns-Josef Ortheil erneut als kunstvoller und bis ins Detail ausgefeilter, souveräner Erzähler einer sehr erzählenswerten, zuweilen auch märchenhaft anmutenden Geschichte.
Wendepunkt im Roman ist die nicht gänzlich überraschende Beziehung zu Paula, die als charakterstarke Deutsch-Sizilianerin das nicht gesuchte, aber benötigte Pendant zu «Beniamino» und eine neue Qualität menschlicher Beziehung darstellt: «Das Leben mit Paula ist also ein Erzählstrom eigener lebendiger und heftigerer Art, im Grunde ist es ein erotisches Sprechen, das unsere Vereinigungen vorbereitet oder sogar begleitet.»

Hanns-Josef Ortheils «Das Kind, das nicht fragte» ist ein geradezu klassischer Reiseroman mit Bildungs-, Entwicklungs- und Liebesgeschichte – ein wunderbares Buch für alle fernab des Konsum-Tourismus reisenden Menschen.
So ist Ortheils Roman ein geradezu klassischer Reiseroman mit Bildungs-, Entwicklungs- und Liebesgeschichte, ein wunderbares Buch für alle fernab des Konsum-Tourismus reisenden Menschen, die mit beiden Beinen fest auf dem Teppich stehen, ohne die Hoffnung zu verlieren, dass er fliegen lernt: «Letztlich waren es die Menschen, die ihre Zurückhaltung und Schüchternheit im Umgang mit der Fremde zunehmend verloren. Genau deshalb gingen sie ja in die Fremde: Um dort die störenden Eigenschaften ihrer früheren Identität gegen eine neue, von der Fremde begründete und geformte Identität einzutauschen. In der Fremde verwandelten sie sich, blühten auf und spürten die positiven Auswirkungen ihrer Forschungen am eigenen Leib und an der eigenen Seele.»
Am Ende des Romans färben die etwas altbacken wirkenden Reminiszenzen an Don Camillo und Cinema paradiso den Roman ein wenig rosa – kleine, sympathische Schönheitsflecke in einem nicht nur Sehnsucht nach Sizilien, dem Schmelztiegel zwischen römisch- und griechisch-antiker Kultur weckenden großen Roman über «Das Kind, das nicht fragte». ■
Hanns-Josef Ortheil: Das Kind, das nicht fragte, Roman 426 Seiten, Luchterhand Verlag, ISBN 978-3-630-87302-2
.
.
.
.
.
Interessante Buch- und Musik-Novitäten – kurz vorgestellt
.
«Hit-Session»: Weihnachtslieder für Keyboard
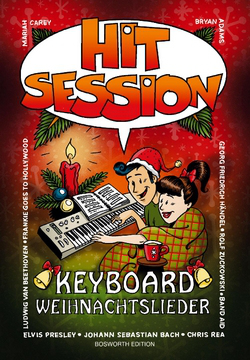 In Fortsetzung seiner neuen, bereits umfangreichen Serie «Hit-Session» veröffentlichte der Musik-Verlag Bosworth nun unter dem Titel «Keyboard – Weihnachtslieder» eine Sammlung der beliebtesten Christmas-Songs aus aller Welt. Neben zahlreichen traditionellen, vorwiegend europäischen Weisen – von «Adeste Fideles» bis «Zu Bethlehem geboren», von «Feliz Navidad» bis zu «Stille Nacht» – versammelte der Verlag auch eine Fülle englischsprachiger bzw. amerikanischer Christmas-Hits. Als Autor(inn)en fungieren hier so berühmte Song-Makers wie Mariah Carey, Boney M, John Lennon, Bryan Adams, Elvis Presley, Chris Rea oder Celine Dion, um nur wenige zu nennen, und Titel wie «Last Christmas», «Jingle Bell Rock», «Driving home for Christmas», «Happy X-mas (War is over)», «Sleigh ride», «Rudolph, the red-noised Reindeer», «Winter wonderland» oder «Let it snow» gehören auch hierzulande längst zum festen Weihnachtslieder-Kanon. Jeder Song beinhaltet neben den obligaten Akkord- und Tempo-Angaben auch die Strophentexte, er ist ausserdem in handlichem Format gedruckt und mit sehr praktikabler Spiralheftung versehen. Für Unterrichtszwecke hätte man sich noch die Fingersätze der einstimmigen Keyboard-Notationen gewünscht, aber insgesamt: Empfehlenswert. ■
In Fortsetzung seiner neuen, bereits umfangreichen Serie «Hit-Session» veröffentlichte der Musik-Verlag Bosworth nun unter dem Titel «Keyboard – Weihnachtslieder» eine Sammlung der beliebtesten Christmas-Songs aus aller Welt. Neben zahlreichen traditionellen, vorwiegend europäischen Weisen – von «Adeste Fideles» bis «Zu Bethlehem geboren», von «Feliz Navidad» bis zu «Stille Nacht» – versammelte der Verlag auch eine Fülle englischsprachiger bzw. amerikanischer Christmas-Hits. Als Autor(inn)en fungieren hier so berühmte Song-Makers wie Mariah Carey, Boney M, John Lennon, Bryan Adams, Elvis Presley, Chris Rea oder Celine Dion, um nur wenige zu nennen, und Titel wie «Last Christmas», «Jingle Bell Rock», «Driving home for Christmas», «Happy X-mas (War is over)», «Sleigh ride», «Rudolph, the red-noised Reindeer», «Winter wonderland» oder «Let it snow» gehören auch hierzulande längst zum festen Weihnachtslieder-Kanon. Jeder Song beinhaltet neben den obligaten Akkord- und Tempo-Angaben auch die Strophentexte, er ist ausserdem in handlichem Format gedruckt und mit sehr praktikabler Spiralheftung versehen. Für Unterrichtszwecke hätte man sich noch die Fingersätze der einstimmigen Keyboard-Notationen gewünscht, aber insgesamt: Empfehlenswert. ■
Hit-Session: Keyboard Weihnachtslieder, 100 Weihnachtslieder, 140 Seiten, Bosworth Musikverlag, ISBN 978-3-86543-703-7
.
.
Hans Sahl: «Der Mann, der sich selbst besuchte» – Erzählungen
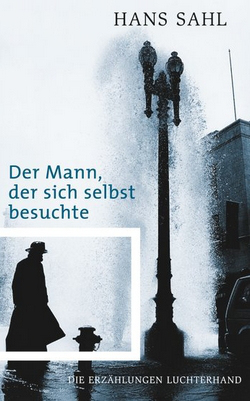 Mit dem vierten Sahl-Band «Der Mann, der sich selbst besuchte» schließt der Luchterhand-Verlag seine sehr verdienstvolle Werkausgabe Hans Sahls ab. Das Buch, basierend auf dem bereits vor 25 Jahren in deutscher Sprache publizierten Band «Umsteigen nach Babylon», enthält sämtliche Erzählungen des Autors, darunter auch eine Reihe von bislang unveröffentlichten Texten aus dem Nachlass, sowie seine bereits zu Sahls Lebzeiten bekanntgewordenen Glossen. Diese oft an entlegenen Stellen veröffentlichten Miniaturen in dieser Ausgabe wieder verfügbar zu machen ist ein besonderes Verdienst dieser jüngsten und letzten Sahl-Anthologie. Zurecht ist der Verlag stolz darauf, mit dieser Edition das erzählerische Werk Sahls in seiner Gesamtheit neu erschlossen zu haben – und damit das Werk «eines großen Autors», der in die Emigration getrieben wurde, und der «doch auch in der Ferne nichts von seinem Witz und seiner moralischen Feinfühligkeit verlor». Für literarisch besonders Interessierte und für jeden Freund hochstehender Kurzprosa unbedingt ein Favorit für das Buchgeschenk unterm Weihnachtsbaum! ■
Mit dem vierten Sahl-Band «Der Mann, der sich selbst besuchte» schließt der Luchterhand-Verlag seine sehr verdienstvolle Werkausgabe Hans Sahls ab. Das Buch, basierend auf dem bereits vor 25 Jahren in deutscher Sprache publizierten Band «Umsteigen nach Babylon», enthält sämtliche Erzählungen des Autors, darunter auch eine Reihe von bislang unveröffentlichten Texten aus dem Nachlass, sowie seine bereits zu Sahls Lebzeiten bekanntgewordenen Glossen. Diese oft an entlegenen Stellen veröffentlichten Miniaturen in dieser Ausgabe wieder verfügbar zu machen ist ein besonderes Verdienst dieser jüngsten und letzten Sahl-Anthologie. Zurecht ist der Verlag stolz darauf, mit dieser Edition das erzählerische Werk Sahls in seiner Gesamtheit neu erschlossen zu haben – und damit das Werk «eines großen Autors», der in die Emigration getrieben wurde, und der «doch auch in der Ferne nichts von seinem Witz und seiner moralischen Feinfühligkeit verlor». Für literarisch besonders Interessierte und für jeden Freund hochstehender Kurzprosa unbedingt ein Favorit für das Buchgeschenk unterm Weihnachtsbaum! ■
Hans Sahl: Der Mann, der sich selbst besuchte, Erzählungen und Glossen, 416 Seiten, Luchterhand Verlag, ISBN 978-3-630-87293-3
.
.
Sarah Lark: «Die Insel der roten Mangroven» – Roman
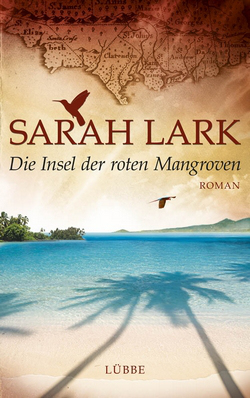 Auf Jamaika schreibt man das Jahr 1753: Deirdre, die Tochter der Engländerin Nora Fortnam und des Sklaven Akwasi lebt behütet auf einer Plantage. Bis sie den jungen Arzt Victor Dufresne kennenlernt und heiratet. Gmeinsam schifft man sich ein nach Saint-Domingue auf der Insel Hispaniola – um sich dort plötzlich dramatischen Verwicklungen ausgesetzt zu sehen.
Auf Jamaika schreibt man das Jahr 1753: Deirdre, die Tochter der Engländerin Nora Fortnam und des Sklaven Akwasi lebt behütet auf einer Plantage. Bis sie den jungen Arzt Victor Dufresne kennenlernt und heiratet. Gmeinsam schifft man sich ein nach Saint-Domingue auf der Insel Hispaniola – um sich dort plötzlich dramatischen Verwicklungen ausgesetzt zu sehen.
Sarah Lark – Pseudonym einer deutschen Bestseller-Autorin – legt hier den zweiten Band ihrer erfolgreichen Karibik-Saga vor – und bedient sich bei fast allen publikumswirksamen Ingredienzien des Genres: Historisch bewegter Hintergrund, exotischer Schauplatz, grandiose Heldenhaftigkeit, und selbstverständlich ein sattes Maß an Herz-Schmerz. Für Kenner und Geniesser des sog. Historischen Romanes sind die «Mangroven» kein Muss, doch für Lark-Fans sicher ein neuer Höhepunkt des Lesespaßes. ■
Sarah Lark: Die Insel der roten Mangroven, Roman, 668 Seiten, Lübbe Verlag, ISBN 978-3-7857-2460-6
.
.
.
Weitere Rezensionen im Glarean Magazin
.
.
.
.
.
.
.
Peter O. Chotjewitz: «Tief ausatmen» (Lyrik)
.
Über das tiefe Ausatmen von Gedanken
Dr. Karin Afshar
.
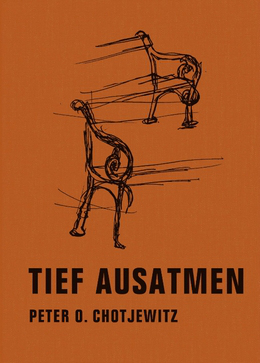 Peter O. Chotjewitz kenne ich nicht. Ich habe mir das Buch ausgesucht, weil mich der Titel angesprochen hat. Tief Ausatmen. Der Einband fühlt sich rauh an, es ist ein ganz einfach gestalteter dunkelorangeroter Leineneinband und im Innern finden sich gelbliche Werkdruck-Seiten, auf ein paar Seiten Illustrationen, Skizzen von Fritz Panzer, die Gedichte – dreizeilig alle, zuzüglich Überschriften. Das Buch ist frisch aus der Druckerei. Sein Geruch ist mir sympathisch.
Peter O. Chotjewitz kenne ich nicht. Ich habe mir das Buch ausgesucht, weil mich der Titel angesprochen hat. Tief Ausatmen. Der Einband fühlt sich rauh an, es ist ein ganz einfach gestalteter dunkelorangeroter Leineneinband und im Innern finden sich gelbliche Werkdruck-Seiten, auf ein paar Seiten Illustrationen, Skizzen von Fritz Panzer, die Gedichte – dreizeilig alle, zuzüglich Überschriften. Das Buch ist frisch aus der Druckerei. Sein Geruch ist mir sympathisch.
Ein erster Hinweis aufs Ausatmen dies:
Ich ging
Nach langer schwerer
geduldig ertragener
Überflüssigkeit
Das mit der Überflüssigkeit macht ihn mir sympathisch. Das ist wohl so, wenn man älter wird, und vieles gesagt ist – man das Leben und die von ihm gebotenenen Dinge eingeatmet hat, um gegen Ende festzustellen, dass die eigene Person doch eigentlich ziemlich unbedeutend ist.
Lesen macht einsam
Mit den Jahren kam
Bücher bis zur Haustür
die Eigentorheit
Wieder hat er mich! Das Wortspiel mit der Torheit, die zum Eigentor wird, und dass man sich bei allem Lesen und Wissen am Ende von den anderen entfernt. Ich unterbreche meine Lektüre und will jetzt wissen, wer der Mann ist, und ob ich ihn richtig verstehe. Also lese ich über Chotjewitz nach, auch um die Ankündigung seines Verlages (er sei «eigensinnig, tiefsinnig, hintersinnig») verstehen, zumindest aber verorten zu können.
Chotjewitz ist 1934 geboren. Seinen ersten Werdegang möge man selbst nachlesen, auch die Geschichte über die Freundschaft mit dem «Oberterroristen» Andreas Baader, dessen Wahlverteidiger er war. Seit Mitte der 1960er Jahre schrieb Chotjewitz realistische Erzählungen und Romane, die er bei Verlagen wie Rowohlt oder Kiepenheuer & Witsch publizieren konnte. Er trat der Gruppe 47 bei, distanzierte sich aber später von deren Monopolstellung: sie hätten den Literaturbetrieb «vergiftet». Chotjewitz – einen ersten Lyrikband hatte er 1965 mit «Ulmer Brettspiele» veröffentlicht, danach keinen mehr – hatte sich als Schriftsteller etabliert, wurde jedoch immer mehr zum Außenseiter: die «neue Innerlichkeit» löste eine Polit-Literatur wie er sie schrieb ab, und der Linksradikalismus der 70er Jahre ging in der Friedensbewegung und den Grünen auf. Chotjewitz zog sich zurück und übersetzte fortan u.a. den Literaturnobelpreisträger Dario Fo aus dem Italienischen ins Deutsche, und gab gelegentlich ein neues Buch heraus, so z.B. den historischen Roman «Macchiavellis letzter Brief». «Fast schien es, als verschwände hier ein Veteran der Linken stellvertretend für seine ganze Generation in der kulturellen und politischen Bedeutungslosigkeit.»
Chotjewitz tauchte wieder auf, nämlich beim Verbrecher Verlag. «Tief Ausatmen» ist posthum in diesem Oktober erschienen. Seine Frau Cordula Güdemann und der Verleger Jörg Sundermaier haben das Material zusammengestellt.
Soweit die Hintergründe, lassen wir jetzt wieder Texte sprechen. Fünf wähle ich noch aus, nicht ganz so willkürlich wie – so schreibt es der Herausgeber – Zeichnungen und Texte im Büchlein miteinander verknüpft sind.
Die Texte muss man sich vorlesen, mehrmals – zeilenübergreifend ergeben sie Sätze, Sinnzusammenhänge. Sie setzen einiges an Vor-, Welt- und auch Geschichtswissen voraus, denn sonst entgehen einem die offenen und versteckten Verweise!
Damals im kalten Krieg
Sehnsucht heißt das alte
Lied der Taiga das schon
meine Mutter sang.
Es ist nicht damit getan, dass man die Zeilen wiedererkennt – man muss sie weiterdenken. Und im Weiterdenken erst erfüllen sie ihren Anstoß.
Bulletin 9/2010
Herr der Sommer war
sehr groß alles voll Knollen
Hals Lunge Leber
Die Gedichte sind Skizzen, die umreißen, ein Tiefergehen erlauben, es aber nicht plakativ einfordern. Sie sind Gedanken im Vorbeigehen, eine Form andeutend. (Die Zeichnungen von Fritz Panzer könnten nicht passender sein.) An anderer Stelle sind sie unstet, kaum zu fassen. Sie wollen nicht festgehalten werden; alles Festhalten scheint dem Schreibenden Zwang.
Die Themen? Vielfältig, aber nicht geordnet. Die Sprache? Es blitzen hin und wieder Bukowskieske Vibes in den Zeilen auf. Manches verstehe ich nicht, weil mir der Kontext fehlt – ich bin eben Chotjewitz-Anfängerin.
Alles spüren
Kühl die schlaflose
Nacht am besten nichts kein Bär
kein Schweif nur liegen
Stilles Feuer
Dich trifft ein Blitz aus
dem Sehschlitz unterm Tschador
wird wild gejodelt

Eigensinnig schreibt Chotjewitz unbedingt, die Vorgabe keiner Formvorgabe ist die Freiheit, die er sich erlaubt. Hintersinnig und tiefsinnig – auch das. Die Verse sind inspirierend in ihrer Kürze, lassen viel Raum. Ein Könner eben.
Es findet sich Selbstironie und Selbstbeobachtung, Spott über andere und Kommentare zu Vergangenem. Eigensinnig schreibt Chotjewitz unbedingt – Elfchen haben wir hier nicht gerade vorliegen, die Vorgabe keiner Formvorgabe ist die Freiheit, die er sich erlaubt. Hintersinnig und tiefsinnig – auch das. Die Verse sind inspirierend in ihrer Kürze, lassen viel Raum. Ein Könner eben. Man kann sich jeden Tag einen Dreizeiler herausgreifen und an ihm eine Weile herumdenken. Und wem etwas einfällt, der möge dies beherzigen:
In der Straßenbahn
Was dir so einfällt
Junge schreib’s auf es könnte
ein Gedanke sein
■
Peter O. Chotjewitz: Tief Ausatmen, Lyrik, Zeichnungen von Fritz Panzer, Herausgeber: C. Güdemann & J. Sundermeier, 140 Seiten, Verbrecher Verlag, ISBN 978-3943167023
.
.
.
.
.
.
.
Interessante Buch- und CD-Neuheiten – kurz vorgestellt
.
Cotton Reloaded: «Der Beginn» – E-Book-Roman
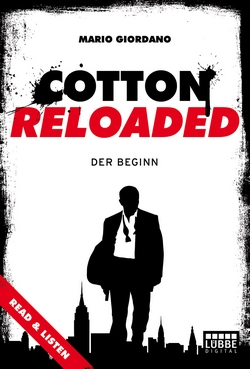 Mitte der 1950-er Jahre begann mit dem ersten Jerry-Cotton-Heft im Bastei-Verlag eine der kommerziell erfolgreichsten Krimi-Serien, deren weltweit verbreiteter Hype unter Mitwirkung von weit über 100 Autoren bis heute andauert. Nun legt der Lübbe-Verlag nach und transferiert den smarten amerikanischen FBI-Agenten mit einer Reloaded-Reihe ins moderne Zeitalter des digitalen E-Book-Lesens. Die erste Story des «neuen» Cotton titelt «Der Beginn» und startet im New York des Jahres 2012, wo der modernisierte G-Team-Mann mitsamt seinen Nebenfiguren Phil Decker, Zeerookah, Mr. High u.a. einen Serienkiller jagt – in einer Welt des Terrorismus’, des Cybercrime, der Drogen- und der Bankenkriminalität.
Mitte der 1950-er Jahre begann mit dem ersten Jerry-Cotton-Heft im Bastei-Verlag eine der kommerziell erfolgreichsten Krimi-Serien, deren weltweit verbreiteter Hype unter Mitwirkung von weit über 100 Autoren bis heute andauert. Nun legt der Lübbe-Verlag nach und transferiert den smarten amerikanischen FBI-Agenten mit einer Reloaded-Reihe ins moderne Zeitalter des digitalen E-Book-Lesens. Die erste Story des «neuen» Cotton titelt «Der Beginn» und startet im New York des Jahres 2012, wo der modernisierte G-Team-Mann mitsamt seinen Nebenfiguren Phil Decker, Zeerookah, Mr. High u.a. einen Serienkiller jagt – in einer Welt des Terrorismus’, des Cybercrime, der Drogen- und der Bankenkriminalität.
Der Verlag will Cotton monatlich «reloaden», und jeder Band erscheint ausschließlich als E-Book und als Hörbuch (in den Formaten ePub bzw. MP3), wobei die einzelnen Folgen in sich abgeschlossen sind. Den Start-Band «Der Beginn» hat Bestseller- und «Tatort»-Autor Mario Giordano («Apocalypsis») geschrieben, Verfasser der zweiten Folge «Countdown» (geplant für Mitte November 2012) wird Peter Mennigen sein. ■
Mario Giordano: Cotton Reloaded – Der Beginn, Kriminal-Roman, E-Book, Lübbe Verlag
.
.
Buch- und CD-Dokumentation: «Jazz unter Ulbricht und Honecker»
 Der 1954 im sächsischen Zwickau geborene Jazz-Posaunist, Arrangeur, Komponist, Big-Band-Dirigent und Autor Frieder W. Bergner hat als Musiker und Kulturschaffender jahrzehntelang unterm DDR-Regime gelebt und gearbeitet. In seiner jüngsten, belletristisch-erzählerisch konzipierten Publikation «Jazz unter Ulbricht und Honecker» berichtet er autobiographisch über sein «musikalisches Leben in der DDR» und streift dabei mit grosser Detailfülle und sehr persönlich-authentischem Schreibstil die wichtigsten Stationen und Personen seiner Karriere. Der Band berichtet davon, «wie aus einem schüchternen, kleinen Jungen ein Mann wurde, der sich vor hundert Menschen auf eine Bühne stellt, um mit Musik und mit Worten seine Geschichten zu erzählen. Und davon, wie er sich über Jahrzehnte seines Lebens nicht von dieser Beschäftigung abbringen ließ. Nicht von den Eltern, nicht von den Obrigkeiten in Schule und Staat…» ■
Der 1954 im sächsischen Zwickau geborene Jazz-Posaunist, Arrangeur, Komponist, Big-Band-Dirigent und Autor Frieder W. Bergner hat als Musiker und Kulturschaffender jahrzehntelang unterm DDR-Regime gelebt und gearbeitet. In seiner jüngsten, belletristisch-erzählerisch konzipierten Publikation «Jazz unter Ulbricht und Honecker» berichtet er autobiographisch über sein «musikalisches Leben in der DDR» und streift dabei mit grosser Detailfülle und sehr persönlich-authentischem Schreibstil die wichtigsten Stationen und Personen seiner Karriere. Der Band berichtet davon, «wie aus einem schüchternen, kleinen Jungen ein Mann wurde, der sich vor hundert Menschen auf eine Bühne stellt, um mit Musik und mit Worten seine Geschichten zu erzählen. Und davon, wie er sich über Jahrzehnte seines Lebens nicht von dieser Beschäftigung abbringen ließ. Nicht von den Eltern, nicht von den Obrigkeiten in Schule und Staat…» ■
Frieder W. Bergner: Jazz unter Ulbricht und Honecker – Mein musikalisches Leben in der DDR, Prosa-Band & Audio-CD, 212 Seiten, Selbstverlag 2012
.
.
Ueli Schenker: «Jagdgründe» – Gedichte
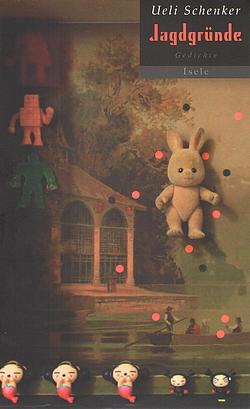 Seit langem gehört der im Luzernischen Meggen lebende Schriftsteller Ueli Schenker zu den profiliertesten Poeten der Innerschweizer Literaturszene. Einst auch als Theater-Autor aktiv, verlegt sich der promovierte Anglistiker und Germanist Schenker nunmehr seit über 20 Jahren fast ausschließlich auf die Lyrik. Sein jüngster Band «Jagdgründe» muss unbedingt zum Besten seines bisherigen Schaffens gezählt werden. Unterteilt in fünf Kapitel, sind über 90 Gedichte versammelt, denen eine thematisch enorme Vielfalt, metaphorische Dichte und auch große stilitische Varianz eignet. Schenker ist außerdem ein Meister des Bilderkontrasts und des Zusammendenkens heterogener Sinnkreise:
Seit langem gehört der im Luzernischen Meggen lebende Schriftsteller Ueli Schenker zu den profiliertesten Poeten der Innerschweizer Literaturszene. Einst auch als Theater-Autor aktiv, verlegt sich der promovierte Anglistiker und Germanist Schenker nunmehr seit über 20 Jahren fast ausschließlich auf die Lyrik. Sein jüngster Band «Jagdgründe» muss unbedingt zum Besten seines bisherigen Schaffens gezählt werden. Unterteilt in fünf Kapitel, sind über 90 Gedichte versammelt, denen eine thematisch enorme Vielfalt, metaphorische Dichte und auch große stilitische Varianz eignet. Schenker ist außerdem ein Meister des Bilderkontrasts und des Zusammendenkens heterogener Sinnkreise:
Im Freien
Schnorchelsommer Herbst
Laubhaufenkrieg Advent ver-
passte Schneeballschlachten
über den Heckenspass ver-
rauscht ein Schwanenpaar
Gedichte zum laut Vorlesen und still Nachdenken – empfehlenswert! ■
Ueli Schenker, Jagdgründe, Gedichte, Isele Verlag, 108 Seiten, ISBN 978-3-86142-559-5
.
.
.
.
.
Weitere Rezensionen im Glarean Magazin
.
.
.
.
.
.
.
Interessante Buch- und DVD-Neuheiten – kurz vorgestellt
.
Therese Bichsel: «Grossfürstin Anna» – Roman
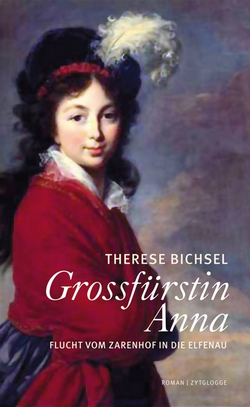 Die Emmentaler Schriftstellerin und Journalistin Therese Bichsel (*1956) ist seit 1997 v.a. als gut recherchierende und literarisch gewandte Porträtistin historischer Frauengestalten im Bewusstsein der literarischen Öffentlichkeit. Nun legt sie – wiederum im Zytglogge Verlag – die Roman-Biographie der Prinzessin Juliane von Sachsen-Coburg vor – jener Anna Feodorowna (1781-1860), die später als russische Grossfürstin an die Seite eines Enkels von Katharina der Grossen verheiratet wird, dann aber aus St. Petersburg flieht und in der Schweiz heimliche Geliebte und Mutter zweier Kinder wird. Bichsel rollt das Schicksal der 14-Jährigen Prinzessin Juliane einfühlsam und historisch informativ auf bis hin zu den wenigen glücklichen Tagen der schließlich geschiedenen russischen Fürstin Anna auf ihrem prächtigen Gut «Elfenau» nahe der Berner Aare. Die Autorin selber zur Entstehungsgeschichte ihres Buches: «Vor einiger Zeit stiess ich auf Anna Feodorowna und war bald fasziniert von dieser Frau, ihren schwierigen Männerbeziehungen und ihrem Kampf um die unehelichen Kinder in einer Zeit des Umbruchs.» – Eine willkommene Bereicherung des an Interessantem momentan nicht so reichen Genres «Historischer Roman». ■
Die Emmentaler Schriftstellerin und Journalistin Therese Bichsel (*1956) ist seit 1997 v.a. als gut recherchierende und literarisch gewandte Porträtistin historischer Frauengestalten im Bewusstsein der literarischen Öffentlichkeit. Nun legt sie – wiederum im Zytglogge Verlag – die Roman-Biographie der Prinzessin Juliane von Sachsen-Coburg vor – jener Anna Feodorowna (1781-1860), die später als russische Grossfürstin an die Seite eines Enkels von Katharina der Grossen verheiratet wird, dann aber aus St. Petersburg flieht und in der Schweiz heimliche Geliebte und Mutter zweier Kinder wird. Bichsel rollt das Schicksal der 14-Jährigen Prinzessin Juliane einfühlsam und historisch informativ auf bis hin zu den wenigen glücklichen Tagen der schließlich geschiedenen russischen Fürstin Anna auf ihrem prächtigen Gut «Elfenau» nahe der Berner Aare. Die Autorin selber zur Entstehungsgeschichte ihres Buches: «Vor einiger Zeit stiess ich auf Anna Feodorowna und war bald fasziniert von dieser Frau, ihren schwierigen Männerbeziehungen und ihrem Kampf um die unehelichen Kinder in einer Zeit des Umbruchs.» – Eine willkommene Bereicherung des an Interessantem momentan nicht so reichen Genres «Historischer Roman». ■
Therese Bichsel: Grossfürstin Anna – Flucht vom Zarenhof in die Elfenau, Roman, 304 Seiten, Zytglogge Verlag, ISBN 978-3-7296-0851-1
.
.
DVD-Dokumentation: «Glenn Gould – Genie und Leidenschaft»
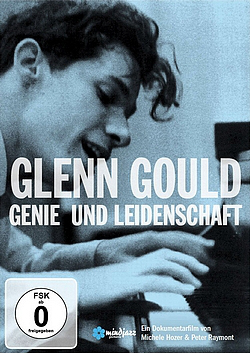 Das kanadische Musik-Phänomen Glenn Gould steht im Mittelpunkt des Dokumentarfilms «Genie und Leidenschaft», unlängst in einer Doppel-DVD (inkl. eines «internationalen Director’s Cut») bei «Mindjazz Pictures» erschienen. Das Video präsentiert vielschichtig und über weite Strecken eindringlich präsentiert das Leben und Werk einer der faszinierendsten Persönlichkeiten der jüngeren Musikgeschichte. Pianist Gould – «Der Mann mit dem Mantel und dem Stuhl» – ist bis heute Gegenstand sowohl internationaler Verehrung als auch unablässiger klavierinterpretatorischer Forschung, und auch 30 Jahre nach seinem Tode scheint die Faszination für diesen Ausnahmekünstler noch nicht nachgelassen zu haben. Der Film beinhaltet unveröffentlichtes Archivmaterial, Interviews mit Gould-Freunden sowie Ausschnitte aus bisher noch nicht publizierten privaten Bild- und Tonaufnahmen. – Die beiden DVDs bringen die (so facettenreiche wie zerrissene) Pianisten-Ausnahmerscheinung Glenn Gould mit all ihrer Widersprüchlichkeit und musikalischen Obsession, aber auch mit ihrer intellektuellen Vielschichtigkeit und interpretatorischen Tiefe nahe. Empfehlenswert. ■
Das kanadische Musik-Phänomen Glenn Gould steht im Mittelpunkt des Dokumentarfilms «Genie und Leidenschaft», unlängst in einer Doppel-DVD (inkl. eines «internationalen Director’s Cut») bei «Mindjazz Pictures» erschienen. Das Video präsentiert vielschichtig und über weite Strecken eindringlich präsentiert das Leben und Werk einer der faszinierendsten Persönlichkeiten der jüngeren Musikgeschichte. Pianist Gould – «Der Mann mit dem Mantel und dem Stuhl» – ist bis heute Gegenstand sowohl internationaler Verehrung als auch unablässiger klavierinterpretatorischer Forschung, und auch 30 Jahre nach seinem Tode scheint die Faszination für diesen Ausnahmekünstler noch nicht nachgelassen zu haben. Der Film beinhaltet unveröffentlichtes Archivmaterial, Interviews mit Gould-Freunden sowie Ausschnitte aus bisher noch nicht publizierten privaten Bild- und Tonaufnahmen. – Die beiden DVDs bringen die (so facettenreiche wie zerrissene) Pianisten-Ausnahmerscheinung Glenn Gould mit all ihrer Widersprüchlichkeit und musikalischen Obsession, aber auch mit ihrer intellektuellen Vielschichtigkeit und interpretatorischen Tiefe nahe. Empfehlenswert. ■
Glenn Gould – Genie und Leidenschaft, Dokumentarfilm von Michele Hozer und Peter Raymont, Mindjazz Pictures, Doppel-DVD, 84 Min. & Bonusmaterial 106 Min.
.
.
Ken Follett: «Winter der Welt» – Roman
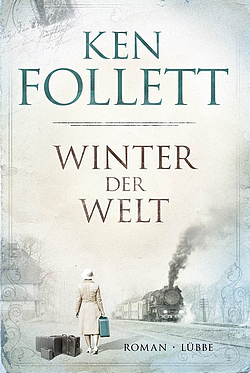 Die Irrungen und Wirrungen des Zweiten Weltkrieges, seine globalen wie einzelmenschlichen Schicksale nimmt Englands wohl berühmtester Bestseller-Autor Ken Follett («Die Nadel») diesmal als historisches Panorama her für seinen jüngsten Wälzer «Winter der Welt». Der über 1000-seitige Roman – Übersetzung: Dietmar Schmidt und Rainer Schumacher – ist als der zweite Teil einer «Jahrhundert-Saga» gedacht – nach «Sturz der Titanen» – und breitet episch vor zeitgeschichtlich dramatischem Hintergrund mannigfaltige Handlungsstränge mit zahllosen fiktiven wie realen historischen Persönlichkeiten aus. Für manche Leserschichten aspruchsvollerer Belletristik mag Ken Follett (*1949) teils etwas geschwätzig, teils etwas rührselig daherschreiben. Für die in die Millionen gehende Fan-Gemeinschaft des produktiven – und übrigens auch sozial sehr engagierten -, dabei äußerst detailreichen Schriftstellers ist selbstverständlich «Winter der Welt» das literarische Muss dieses Herbstes. ■
Die Irrungen und Wirrungen des Zweiten Weltkrieges, seine globalen wie einzelmenschlichen Schicksale nimmt Englands wohl berühmtester Bestseller-Autor Ken Follett («Die Nadel») diesmal als historisches Panorama her für seinen jüngsten Wälzer «Winter der Welt». Der über 1000-seitige Roman – Übersetzung: Dietmar Schmidt und Rainer Schumacher – ist als der zweite Teil einer «Jahrhundert-Saga» gedacht – nach «Sturz der Titanen» – und breitet episch vor zeitgeschichtlich dramatischem Hintergrund mannigfaltige Handlungsstränge mit zahllosen fiktiven wie realen historischen Persönlichkeiten aus. Für manche Leserschichten aspruchsvollerer Belletristik mag Ken Follett (*1949) teils etwas geschwätzig, teils etwas rührselig daherschreiben. Für die in die Millionen gehende Fan-Gemeinschaft des produktiven – und übrigens auch sozial sehr engagierten -, dabei äußerst detailreichen Schriftstellers ist selbstverständlich «Winter der Welt» das literarische Muss dieses Herbstes. ■
Ken Follett, Winter der Welt, Roman, Lübbe Verlag, 1020 Seiten, ISBN 978-3-7857-2465-1
.
.
.
.
Weitere Rezensionen im Glarean Magazin
.
.
.
Hydra (Hg): «Dieses Buch macht dich fertig»
.
Buch macht Wut – Von einem, der auszog, das Wüten zu erlernen
Christian Busch
.
 So manch einer sucht in den sommerlichen Hitzeperioden – oder auch trüben Regentagen – nach Erbauung in satirischen Magazinen oder in den Rubriken der täglich von Neuem gegen das Einheitsgrau des Sommerlochs ankämpfenden Journale. In bewährter Manier halten hier die üblichen Verdächtigen den Kopf als Zielscheibe für des Volkes Zorn hin.
So manch einer sucht in den sommerlichen Hitzeperioden – oder auch trüben Regentagen – nach Erbauung in satirischen Magazinen oder in den Rubriken der täglich von Neuem gegen das Einheitsgrau des Sommerlochs ankämpfenden Journale. In bewährter Manier halten hier die üblichen Verdächtigen den Kopf als Zielscheibe für des Volkes Zorn hin.
Im Holzbaum-Verlag Wien ist jetzt unter dem Titel «Dieses Buch macht dich fertig» eine ganze Sammlung erschienen, die sich als «Tatenbuch für angehende Wutbürgerinnen von Hydra» vorstellt, einem politisch unabhängigen Kulturverein, dessen Mitglieder ehrenamtlich arbeiten und sich der ‘Förderung von Humor, Ironie und Satire’ verschrieben haben. So weit, so gut. Doch kann diese Form der Satire ein ganzes Buch von 168 Seiten füllen?
Das 1. Kapitel widmet sich den Ungerechtigkeiten dieser Welt, die sich – die alte Leier – als konstruierte Objekte menschlichen Neids entpuppen: der Chef und die Großverdiener in Wirtschaft und Politik als Absahner und Sündenböcke auf der Spitze der Karriere- oder besser gesagt: Klischee-Leiter. Wenn man das auf einer Rubrikseite einer einschlägigen Tageszeitung liest, mag man sich kurz freuen. Doch als abendfüllendes Programm, das u.a. dazu auffordert, eine leere Seite anzuschreien, nervt das eher. Genau so gut könnte man zur Kompensierung eine große Schüssel Schlagsahne essen, denkt man.
Auch das 2. Kapitel sucht – mit deutlich erweitertem Spektrum – nach Gründen, sich zu ärgern. Jetzt trifft es unter den bösen Geistern des Alltags auch mal die Handwerker oder die Penis-Liebhaberinnen. So wird man aufgefordert, die 20 (!) Personen aufzuschreiben, an die man beim Sex mit dem Partner gedacht hat, seinen Facebook-Beliebtheit-Koeffizierten zu errechnen und sich aus einem ganzen Cocktail von Ausreden zu bedienen, bis die Autoren im 3. Kapitel – mal mehr, mal weniger einfallsreich – Vorschläge unterbreiten, wie man – Sigmund Freud lässt grüßen – seine Wut los werden kann. So kann man – wer das Buch käuflich erworben hat – Beweisfotos von Kratzern, die man an «sündteuren Autos» hinterlassen hat, einkleben.

Auch wenn einzelne Seiten durchaus Unterhaltungswert besitzen, dürfte die leider viel Banales enthaltende Sammlung «Dieses Buch macht dich fertig» aus dem Holzbaum Verlag den meisten Konsumenten höchstens ein müdes Lächeln abringen.
Auch wenn einzelne Seiten durchaus Unterhaltungswert besitzen, dürfte die leider viel Banales enthaltende Sammlung den meisten Konsumenten höchstens ein müdes Lächeln abringen. Stattdessen wird man sich fragen, ob die Hydra nur eine Schwester der Hybris ist. Wut jedenfalls könnte allenfalls der entwickeln, der für die knapp zehn Euro etwas Originelles, Geistreiches oder Witziges erwartet hat. Denn wenn man auf der letzten Seite aufgefordert wird, eine Bank anzuzünden, zucken die Finger mit Blick auf das Buch schon verdächtig. Hoher Brennwert? Zu gefährlich, deshalb lieber ein Verriss. ■
Hydra (Hg): «Dieses Buch macht dich fertig», Holzbaum Verlag, 168 Seiten, ISBN 978-3-9503097-5-1
.
.
.
.
.
Ulrich Kittstein (Hg.): «An Aphrodite» – Gedichte von Frauen
.
Weibliche Lyrik von der Antike bis ins 20. Jahrhundert
Sigrid Grün
.
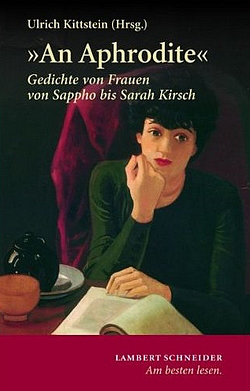 1960 erschien im Verlag Lambert Schneider die Anthologie «Irdene Schale – Frauenlyrik seit der Antike», die damals von Mechthild Barthel-Kranzbühler herausgegeben wurde. «An Aphrodite» ist nun die Nachfolge-Anthologie. Die Auswahl der Gedichte wurde stark überarbeitet. Einerseits musste das Textkorpus reduziert werden, andererseits kamen Gedichte aus dem 20. Jahrhundert hinzu. Gegenwartslyrik wurde allerdings ausgespart, da hier noch kein abwägender Blick aus der Distanz möglich ist. Die nicaraguanische Erzählerin und Lyrikerin Gioconda Belli (* 1948) setzt mit ihren Gedichten also den Schlusspunkt.
1960 erschien im Verlag Lambert Schneider die Anthologie «Irdene Schale – Frauenlyrik seit der Antike», die damals von Mechthild Barthel-Kranzbühler herausgegeben wurde. «An Aphrodite» ist nun die Nachfolge-Anthologie. Die Auswahl der Gedichte wurde stark überarbeitet. Einerseits musste das Textkorpus reduziert werden, andererseits kamen Gedichte aus dem 20. Jahrhundert hinzu. Gegenwartslyrik wurde allerdings ausgespart, da hier noch kein abwägender Blick aus der Distanz möglich ist. Die nicaraguanische Erzählerin und Lyrikerin Gioconda Belli (* 1948) setzt mit ihren Gedichten also den Schlusspunkt.
Den Schwerpunkt bildet weibliche Lyrik aus dem europäischen und amerikanischen Kulturraum. Aber auch Gedichte von türkischen und arabischen Autorinnen finden sich in der facettenreichen Auswahl, die einen Bogen von der Antike bis ins 20. Jahrhundert schlägt. Dabei lässt sich auch sehr gut der Wandel der weiblichen Lebenswelt nachvollziehen. Hier ist eine erhebliche Ausweitung des Aktionsradius’ festzustellen: Etwa von der ausschließlich innerlichen Lyrik des Mittelalters hin zur oft auch stark politisch motivierten Dichtung im 20. Jahrhundert.
Den Auftakt macht die griechische Dichterin Sappho, die als erste bekannte Lyrikerin Europas gilt. In ihren Texten findet man häufig Anrufungen von weiblichen Vorgängerinnen oder Vorbildern, etwa der Göttin Aphrodite: «Auf buntem Thron, Unsterbliche, Aphrodite,/ Zeus’ Tochter, Listenspinnerin, ich flehe zu dir:/ Lähm’ mir mit Trübsinn nicht und Überdrüssen,/ Herrin den Mut».
In der Anrufung war es auch Frauen möglich, sich in eine (weibliche) Traditionslinie zu stellen und ihr Schreiben zu rechtfertigen. Bis ins 20. Jahrhundert setzt sich der Topos fort: Ingeborg Bachmann widmet ihr Gedicht «Wahrlich» zum Beispiel der russischen Dichterin Anna Achmatova. Hier wird ein intertextueller Bezug über eine Sprach- und Kulturgrenze hinweg geschaffen.
Jede Lyrikerin ist mit einer Handvoll Gedichten vertreten. Man findet zum Beispiel Texte von Sappho (um 600 v. Chr.), Sulpicia (um Christi Geburt), Al-Chansa (7. Jh.), Hildegard von Bingen (1098-1179), Theresia von Avila (1515 – 1582), Gaspara Stampa (1523 – 1554), Karoline von Günderode (1780 – 1806), Marianne Willemer (1784 – 1860), Marceline Desbordes-Valmore (1786 – 1859), Annette von Droste-Hülshoff (1797 – 1848), Emily Bronte (1818 – 1848), Emily Dickinson (1830 – 1886), Ricarda Huch (1864 – 1947), Else Lasker-Schüler (1869 – 1945), Anna Andrejewna Achmatowa (1889 – 1966), Gabriela Mistral (1889 – 1957), Nelly Sachs (1891 – 1970), Marina Zwetajewa (1892 – 1941), Maria Pawlikowska-Jasnorzewska (1894 – 1945), Marie Luise Kaschnitz (1901 – 1974), Hilde Domin (1909 – 2006), Margherita Guidacci (1921 – 1992), Blaga Dimitrowa (1922 – 2003), Nazik al-Mala’ika (1923 – 2007), Ingeborg Bachmann (1926 – 1973), Sylvia Plath (1932 – 1963), Gülten Akin (*1933), Sarah Kirsch (*1935), Gioconda Belli (*1948) u.v.m.
Die Gedichte sind mal poetisch und innerlich, mal gesellschaftskritisch und oft verzweifelt. Zu manchen Texten findet man nur schwer einen Zugang. Die Gründe dafür sind vielfältig und können beispielsweise durch die zeitliche Distanz bedingt sein, die zwischen der Entstehung der Texte und der Gegenwart liegt. Die neueren Gedichte, die der hermetischen Lyrik zuzuordnen sind, entziehen sich dem unmittelbaren Verständnis, weil Autorinnen wie etwa Ingeborg Bachmann versuchten ein neues Sprachverständnis zu entwickeln. Die Bilder sind auf der semantischen Ebene zunächst schwer greifbar, nach dem erfolgreichen Prozess der Dechiffrierung aber dafür sehr eingängig.

«An Aphrodite» ist eine umfangreiche und vielseitige Lyrik-Anthologie, die literarisch eindrucksvoll vor Augen führt, wie viel sich in puncto «Befreiung der Frau» im Laufe des vergangenen Jahrhunderts getan hat.
Besonders reizvoll an diesem Band ist die Möglichkeit, als Leser die Variationen der Rolle der Frau innerhalb der patriarchalischen Gesellschaft sehr gut nachzuvollziehen. Die Auswahl ist also als ausgesprochen gelungen zu betrachten, spiegelt sie doch sehr gut wider, wie die weibliche Lebenswelt und ihr Wandel in den verschiedenen Epochen und Kulturräumen erlebt wurde. Natürlich mag man anführen, dass wichtige Autorinnen wie etwa Rose Ausländer fehlen – aber eine vollständige Zusammenfassung weiblichen Schreibens ist nicht einmal für den deutschen Sprachraum wirklich zu bewältigen.
Sehr gelungen ist auch die Einführung durch den Herausgeber Ulrich Kittstein. Auf wenigen Seiten werden hier die Besonderheiten des weiblichen Schreibens und seine Entwicklung zusammengefasst. Eine umfangreiche und vielseitige Anthologie also, die eindrucksvoll vor Augen führt, wie viel sich in puncto «Befreiung der Frau» im Laufe des vergangenen Jahrhunderts getan hat. Es ist faszinierend, diesem Weg auf einer literarischen Spur zu folgen. ■
Ulrich Kittstein (Hg.): An Aphrodite – Gedichte von Frauen von Sappho bis Sarah Kirsch, 231 Seiten, Verlag Lambert Schneider, ISBN 978-3650250742
.
.
.
.
Jaume Cabré: «Das Schweigen des Sammlers» (Roman)
.
Von Dämonen besessen
Günter Nawe
.
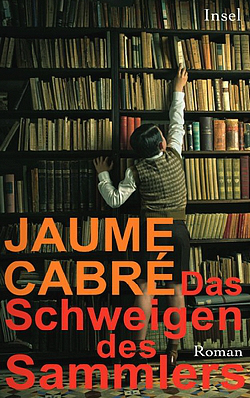 Die Vial, eine wertvolle Geige aus der Werkstatt des Cremoneser Geigenbauers Storioni aus dem 18. Jahrhundert, übt eine seltsame Faszination auf den jungen Adrià Ardèvol aus. Dieser polyglotte, außerordentlich begabte Sohn eines Antiquitätenhändlers aus Barcelona und diese Geige mit ihrem bezaubernden Klang, an der allerdings Blut klebt, stehen im Mittelpunkt des neuen Romans des katalanischen Autors Jaume Cabré.
Die Vial, eine wertvolle Geige aus der Werkstatt des Cremoneser Geigenbauers Storioni aus dem 18. Jahrhundert, übt eine seltsame Faszination auf den jungen Adrià Ardèvol aus. Dieser polyglotte, außerordentlich begabte Sohn eines Antiquitätenhändlers aus Barcelona und diese Geige mit ihrem bezaubernden Klang, an der allerdings Blut klebt, stehen im Mittelpunkt des neuen Romans des katalanischen Autors Jaume Cabré.
Die Geige, die Adrià bald perfekt zu spielen versteht, ist auch der Grund für ein Tötungsdelikt, für einen geheimnisvollen Mord, dem Adriàs Vater Felix Ardèvol i Bosch zum Opfer fällt. Für dieses Verbrechen macht sich der Junge selbst verantwortlich. Hat er doch die wertvolle Stoirioni, die sein Vater einem Interessenten zeigen will, gegen seine eigene und weniger wertvolle Geige ausgetauscht. Diese «Schuld», die er später auf andere Weise – die Geige gehörte eigentlich einem jüdischen Besitzer – abtragen will, muss Adrià leben.
Das ist die Konstellation, aus der heraus der Autor seinen Roman konstruiert. Dabei entwickelt er Handlungsstränge, die sich ständig überschneiden oder parallel zueinander verlaufen. Das vielstimmige Personal dieses umfangreichen Buches, die Schauplätze, ein schier unübersehbare Fülle von Ereignissen in Vergangenheit und Gegenwart – das alles ist auf höchst kunstvolle Weise mit- und ineinander verschränkt, so dass eine Nacherzählung fast unmöglich wird.
Dennoch: Gelehrter soll nach Vaters Willen Adrià werden, nach Mutters Willen Geigenvirtuose. Die Konflikte, die sich daraus für den Jungen ergeben, sind evident – und machen die psychische Situation aus, in der der sensible Adrià, eine höchst eindrucksvolle Figur, sich befindet. Adrià – wie schon sein Vater – ist nicht nur von der Musik besessen, sondern auch von dessen Sammelleidenschaft erfasst. Er verstand, «…dass ich von dem gleichen Dämon besessen war wie mein Vater. Das Kribbeln im Bauch, das Jucken in den Fingern, der trockene Mund…». Adrià versucht, sich in diesem Zwiespalt von Gefühlen und Ambitionen, was einem Fluch gleichkommt, zwischen musikalischem Virtuosentum und Gelehrsamkeit einzurichten.
Aus den Recherchen Adriàs über den Mord an seinem Vater und auf der Suche nach dem Täter erschließt sich die Familiengeschichte und die Geschichte der Geige und ihrer Entstehung in Cremona im 17./18. Jahrhundert. Eine dunkle Vergangenheit tut sich auf. Sie ist verbunden mit der Inquisition im 14. und 15. Jahrhundert, in der der Großinquisitor und sein Sekretär, ein Meuchelmörder, ein Mönch und ein jüdischer Arzt entscheidende Rollen spielen; Paris wird zum Schauplatz und 1914 bis 1918 auch Rom. Eine Geschichte, die Jaume Cabré in Auschwitz–Birkenau 1944 enden lassen wird, mit den schrecklichen Verbrechen von Sturmbannführern und KZ-Ärzten an jüdischen Häftlingen. Cabré schlägt damit einen historischen Bogen vom Mittelalter bis in die Neuzeit – und stellt oft erschreckende Übereinstimmungen, vor allem in ihren negativen Erscheinungsformen, fest.
Es ist eine Geschichte, es sind viele Geschichten in einer von Gier und Macht und Neid, von dunklen Mordfällen und finsteren Intrigen, vom Bösen schlechthin – aber auch über die Liebe. Eine Liebe, die Adrià und Sara erleben und erleiden. Der Roman ist eine Art Metapher über den Missbrauch von Macht und über die Macht der Kunst. Damit ist dieser wunderbare Roman auch ein Buch über die conditio humana, melancholisch dargestellt und sehr tragisch, der sich Adrià ausgesetzt sieht. Rettung erwächst ihm jedoch aus der Liebe und aus der Liebe zur Gelehrsamkeit und zur Musik.
Jaume Cabré wechselt oft unerwartet die Zeitebenen. Erzählzeit und erzählte Zeit gehen plötzlich ineinander über. Es ist ein faszinierendes Tableau der Gleichzeitigkeit von aktuellem Geschehen, von Erinnerung und historischen Fakten, das dieser geniale Autor geschaffen hat. Mitten im Satz wird aus dem Ich-Erzähler ein auktorialer Erzähler; ergibt sich eine Art «Wechselgesang» zwischen der ersten und dritten Person. Wir haben es mit einer sehr kühnen, jedoch sehr gelungene Romankonstruktion zu tun, die vom Leser ein hohes Maß an Aufmerksamkeit erfordert; ihn dafür aber auch wunderbar belohnt. Die kongeniale Übersetzung durch Kirsten Brandt und Petra Zickmann trägt dazu in hohem Maße bei.

Jaume Cabrés Roman “Das Schweigen des Sammlers” ist eine Studie von einzigartigem, ja weltliterarischem Rang über die Macht und deren Missbrauch – und über die Macht der Kunst.
Jaume Cabré ist ein äußerst kluger, ein souveräner Autor. Das hat er bereits in seinen früheren Büchern («Die Stimmen des Flusses», «Senyoria») bewiesen. Mit diesem Roman toppt er jedoch seine bisher erschienenen Romane. Das hat nicht nur etwas mit dem Plot, den vielen Plots, sehr ambitioniert und virtuos miteinander verknüpft, zu tun, sondern auch mit der Musikalität der Sprache des katalanischen Autors. Jaume Cabré hat einmal darüber gesagt: «…denn mehr noch als Schriftsteller bin ich Musiker, jedenfalls, was die Leidenschaft angeht… Es gibt eine syntaktische Kadenz, an der ich dauernd arbeite…». Genau so auch liest sich der Roman, hoch musikalisch, von großer sprachlicher Dichte, artistisch, ohne artifiziell zu sein.
Es sicher nicht zu weit ausgeholt, diesem großartigen Roman weltliterarischen Rang zuzusprechen. ■
Jaume Cabré: Das Schweigen des Sammlers, 839 Seiten, Insel-Suhrkamp Verlag, ISBN 978-3-458-17522-3
.
.
.
.
.
.
Interessante Buch- und CD-Neuheiten – kurz vorgestellt
.
Ulrich Suter: «Literarische Innerschweiz»
 In jahrelanger, akribischer Recherche hat der Schongauer Kulturschaffende Ulrich Suter eine lexikalische Bestandesaufnahme der gesamten Innerschweizer Literatur-Szene erstellt. Der von der Luzerner Albert-Koechlin-Stiftung herausgegebene Band besticht durch eine großartige biographische Materialfülle, durch qualitative Sorgfalt der Auswahl, durch genaue und lückenlose Bestandesaufnahme, und durch ein sowohl ästhetisches wie praktikables Layout. Enthalten sind über 1’200 innerschweizerische Literaturschaffende aus allen 18 Regionen; auf 520 Seiten wird dabei eine Fülle an Stichworten, Porträts, Leseproben und Infos ausgebreitet. Ein 82-minütiger Dokumentarfilm der Filmemacherin Claudia Schmid über die spektakuläre Landschaft der gesamten Vierwaldstättersee-Region und deren Verankerung im Schaffen auch weltliterarisch bedeutsamer Dichter runden den sehr instruktiven Band ab.
In jahrelanger, akribischer Recherche hat der Schongauer Kulturschaffende Ulrich Suter eine lexikalische Bestandesaufnahme der gesamten Innerschweizer Literatur-Szene erstellt. Der von der Luzerner Albert-Koechlin-Stiftung herausgegebene Band besticht durch eine großartige biographische Materialfülle, durch qualitative Sorgfalt der Auswahl, durch genaue und lückenlose Bestandesaufnahme, und durch ein sowohl ästhetisches wie praktikables Layout. Enthalten sind über 1’200 innerschweizerische Literaturschaffende aus allen 18 Regionen; auf 520 Seiten wird dabei eine Fülle an Stichworten, Porträts, Leseproben und Infos ausgebreitet. Ein 82-minütiger Dokumentarfilm der Filmemacherin Claudia Schmid über die spektakuläre Landschaft der gesamten Vierwaldstättersee-Region und deren Verankerung im Schaffen auch weltliterarisch bedeutsamer Dichter runden den sehr instruktiven Band ab.
Unser Fazit: Unverzichtbar für jegliche ernsthafte Beschäftigung mit einem ganz speziellen, überraschend originellen und thematisch reichhaltigen Segment der Schweizer Literatur. ■
Ulrich Suter: Literarische Innerschweiz – Regionen, Porträts, Leseproben, Literaturverzeichnis; Albert Koechlin Stiftung, 520 Seiten, mit gleichnamiger DVD-Beilage zum Buch, ISBN 3-905446-13-8
.
.
.
Beat Portmann: «Alles still»
 Inhalt des Kriminalromans: «Eine junge Frau aus einem alten Luzerner Patriziergeschlecht möchte herausfinden, wer ihr Vater ist, nachdem ihre Mutter das Geheimnis mit ins Grab genommen hat. Gemeinsam mit einem vermeintlichen Privatdetektiv macht sie sich auf die Suche nach den Spuren, die das Liebespaar in den frühen Siebzigerjahren hinterlassen hat. Dabei dringen sie immer tiefer in die Psyche einer Stadt vor, die mit dem Namen der Patrizierin eng verbunden und bis heute über ihren Bedeutungsverlust nicht hinweggekommen ist. In wechselnden Begegnungen mit frommen Kindermädchen, wortkargen Marktfrauen und mysteriösen, kettenrauchenden Jesuiten kommen sie einem Verbrechen auf die Spur und schliesslich einer Liebesgeschichte, die sie auf verhängnisvolle Weise in ihren Bann zieht.» (Verlagsinfo) ■
Inhalt des Kriminalromans: «Eine junge Frau aus einem alten Luzerner Patriziergeschlecht möchte herausfinden, wer ihr Vater ist, nachdem ihre Mutter das Geheimnis mit ins Grab genommen hat. Gemeinsam mit einem vermeintlichen Privatdetektiv macht sie sich auf die Suche nach den Spuren, die das Liebespaar in den frühen Siebzigerjahren hinterlassen hat. Dabei dringen sie immer tiefer in die Psyche einer Stadt vor, die mit dem Namen der Patrizierin eng verbunden und bis heute über ihren Bedeutungsverlust nicht hinweggekommen ist. In wechselnden Begegnungen mit frommen Kindermädchen, wortkargen Marktfrauen und mysteriösen, kettenrauchenden Jesuiten kommen sie einem Verbrechen auf die Spur und schliesslich einer Liebesgeschichte, die sie auf verhängnisvolle Weise in ihren Bann zieht.» (Verlagsinfo) ■
Beat Portmann: Alles still, Kriminalroman (Reihe Tatortschweiz), 240 Seiten, Limmat Verlag, ISBN ISBN 978-3-85791-642-7
.
.
.
Schachklassiker: «Meilensteine der Schachliteratur»
 Anfangs 2009 startete der Hamburger Kleinverleger Jens-Erik Rudolph ein ehrgeiziges Unternehmen: Erklärtes Ziel des rührigen Verlagschefs ist nämlich, der (deutschsprachigen) Schachwelt sämtliche «Klassiker» des Königlichen Spiels in zeitgemäßem Layout und fehlerlektoriert zur Verfügung zu stellen – von Aljechin bis Reti, von Steinitz bis Tarrasch, von Morphy bis Lasker, von Pillsbury bis Nimzowitsch.
Anfangs 2009 startete der Hamburger Kleinverleger Jens-Erik Rudolph ein ehrgeiziges Unternehmen: Erklärtes Ziel des rührigen Verlagschefs ist nämlich, der (deutschsprachigen) Schachwelt sämtliche «Klassiker» des Königlichen Spiels in zeitgemäßem Layout und fehlerlektoriert zur Verfügung zu stellen – von Aljechin bis Reti, von Steinitz bis Tarrasch, von Morphy bis Lasker, von Pillsbury bis Nimzowitsch.
Vor ziemlich genau drei Jahren erschien denn mit Siegbert Tarraschs legendärem Lehrbuch «Das Schachspiel» der Start-Band – und vor kurzem ist mit Ludwig Bachmanns «Schachmeister Pillsbury» bereits das erste Dutzend vollbracht worden. Rudolphs schön aufgemachte, bei BoD herausgebrachte Schach-Klassiker-Reihe dürfte sich schon jetzt bei so manchem Sammler zu einem besonderen Schmuckstück im privaten Schach-Regal gemausert haben, denn seine Nachdrucke überzeugen mit einheitlichem Outfit, mit typographischer Sorgfalt, und nicht zuletzt mit Bereinigungen längst bekannter Fehler der Originalausgaben sowie mit einer Fülle zusätzlicher Diagramm-Drucke. Eine beachtenswerte und verdienstvolle Initiative, die nicht nur dem historisch Interessierten. sondern jedem Schachfreund die ganz Großen der Chess History näher bringt. ■
Jens-Erik Rudolph (Hg): Schachklassiker – Meilensteine der Schachliteratur, BoD, bisher 12 Bände
.
.
.
Rainer Wedler: «Seegang»
 In seiner Novelle «Seegang» kehrt der mehrfach ausgezeichnete Ketscher Essayist, Lyriker und Roman-Autor Rainer Wedler quasi zu seiner einstigen Liebe zurück: der Seefahrt – war doch der 1942 in Karlsruhe geborene Schriftsteller jahrelang Schiffsjunge bei der Handelsmarine, bevor er in Heidelberg studierte und 1969 über Burley promovierte. In Wedlers «Seegang» – thematisch effektvoll unterstützt durch eingestreute Grafiken/Zeichnungen – unternimmt ein älterer Mann alleine eine Schiffsreise und trifft unversehens in seiner Kabine auf eine blinde Passagierin, eine junge Frau, gar ein Mädchen noch, sie könnte seine Tochter sein oder eine junge Geliebte… ■
In seiner Novelle «Seegang» kehrt der mehrfach ausgezeichnete Ketscher Essayist, Lyriker und Roman-Autor Rainer Wedler quasi zu seiner einstigen Liebe zurück: der Seefahrt – war doch der 1942 in Karlsruhe geborene Schriftsteller jahrelang Schiffsjunge bei der Handelsmarine, bevor er in Heidelberg studierte und 1969 über Burley promovierte. In Wedlers «Seegang» – thematisch effektvoll unterstützt durch eingestreute Grafiken/Zeichnungen – unternimmt ein älterer Mann alleine eine Schiffsreise und trifft unversehens in seiner Kabine auf eine blinde Passagierin, eine junge Frau, gar ein Mädchen noch, sie könnte seine Tochter sein oder eine junge Geliebte… ■
Rainer Wedler: Seegang, Novelle, 116 Seiten, Pop Verlag, ISBN 978-3863560300
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Silvia Stolzenburg: «Die Heilerin des Sultans»
.
Ein praller Historienschmöker
Marita Robker-Rahe
.
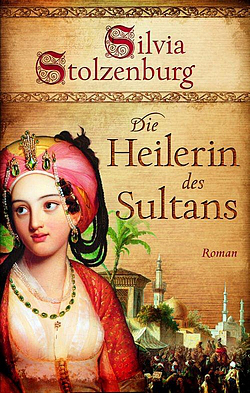 Silvia Stolzenburg studierte Germanistik und Anglistik, um 2006 über zeitgenössische Bestseller zu promovieren. Diese Voraussetzungen merkt man ihren Büchern an, die immer wieder eine akribische Recherche zeigen. Sie vermischt diese mit fiktiven Handlungen und merkt auch an, dass dabei die historischen Ereignisse manchmal zu Gunsten der Handlung verschoben wurden.
Silvia Stolzenburg studierte Germanistik und Anglistik, um 2006 über zeitgenössische Bestseller zu promovieren. Diese Voraussetzungen merkt man ihren Büchern an, die immer wieder eine akribische Recherche zeigen. Sie vermischt diese mit fiktiven Handlungen und merkt auch an, dass dabei die historischen Ereignisse manchmal zu Gunsten der Handlung verschoben wurden.
«Die Heilerin des Sultans» ist das dritte Buch einer Trilogie über die wegen ihres Münsters weltbekannte Stadt Ulm und die – fiktiven – Geschichten der dort lebenden Menschen. Ob sich dieses Buch an seinen Vorgängern messen kann, kann ich nicht beurteilen, da ich die Vorgängerbände «Die Launen des Teufels» und «Das Erbe der Gräfin» (noch) nicht kenne.
«Die Heilerin des Sultans» hat aber alle Qualitäten eines gut lesbaren Historienschmökers. Abenteuer, gut recherchierte historische Hintergründe, ein Hauch von Exotik und eine schöne Liebesgeschichte sind in eine temporeiche und spannende Handlung eingebaut. Jeder Band ist eine in sich abgeschlossene Geschichte, womit man auch keine Schwierigkeiten hat, in die einzelnen Storys einzusteigen. Für mich ist es nach dem Lesen dieses Buches allerdings ein Muss geworden, die Vorgängerbände zu lesen, da ich von der Autorin und ihrem spannenden und flüssigen Schreibstil begeistert bin.
Die Geschichte beginnt im Jahr 1400. Der fünfzehnjährige Falk von Katzenstein hat seine Eltern bei einem Brand verloren und die väterliche Pferdezucht übernommen. Sein Verwalter Lutz ist ihm zum väterlichen Freund geworden, dessen Meinung ihm sehr wichtig ist.
Als eines Tages ein Onkel von Lutz, Otto von Katzenstein auftaucht, hört Falk allerdings nicht auf seinen väterlichen Freund, der spürt, dass Otto nichts Gutes im Schilde führt, sondern Falk bricht mit seinem Onkel zu einer Handelsreise in den Orient auf, um Araberpferde für seine Zucht zu kaufen.
Die Reise endet für Falk damit, dass er von Piraten gefangen genommen wird und nach Bursa in den Palast des Sultans Bayezid I., einem der grausamsten Herrscher des Orients, verkauft wird. Dort soll er zum Soldaten ausgebildet werden, um dem Sultan zu dienen, der sein Reich zu allen Seiten vergrößern will und sogar den Kampf mit dem Nachfolger Dschingis Khans, Timur Lenk, aufnimmt. Im Palast lernt er Sapphira, die Heilerin des Sultans, kennen und lieben. Doch ihre Liebe darf nicht bekannt werden, denn darauf steht der Tod. Sapphira und Falk schmieden einen gefährlichen Plan…

Silvia Stolzenburgs «Die Heilerin des Sultans» garantiert ein pralles und spannendes Lesevergnügen, das Zeit und Lokalkolorit fantastisch einfängt!
Wie schon eingangs erwähnt, ist diese Geschichte ein pralles und spannendes Lesevergnügen, das Zeit und Lokalkolorit fantastisch einfängt. Sowohl die Beschreibung der Reise, als auch die Schilderungen des Haremlebens werden interessant, abenteuerlich und flüssig erzählt, so dass man das Gefühl hat mitten im Geschehen zu sein. Das uns ungewohnte Leben im Orient fasziniert und schreckt gleichzeitig ab, da man viel über die Macht des Sultans, seine Kämpfe und die Intrigen innerhalb des Harems erfährt, die durch die detailgetreuen Schilderungen der Autorin an Leben gewinnen. Ist man erst in die Geschichte eingetaucht, blättern sich die Seiten wie von selbst um, und man fiebert mit den Protagonisten mit. Fantastisch geschrieben! ■
Silvia Stolzenburg: Die Heilerin des Sultans, Historischer Roman, Bookspot Verlag, 528 Seiten, ISBN 978-3937357478
.
.
.
.
.
.
Andreas Maier: «Das Haus» (Roman)
.
«Ich im Haus und alle anderen draußen»
Günter Nawe
.
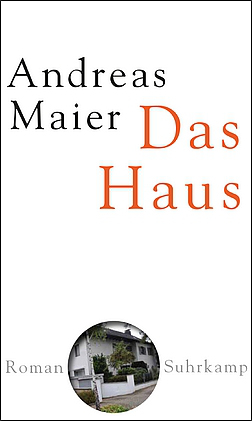 Es ist nicht das erste Mal, dass Andreas Maier literarisch im besten Sinne auffällig wird. Bereits mit «Wäldchestag» hat er auf sich aufmerksam gemacht. Und mit «Das Zimmer» (2010) den großartigen Beginn eines auf elf Bände angelegten Romanzyklus’ vorgelegt: eine Familiensaga, ein großangelegter Heimatroman. Und das ist in diesem Falle kein negativ besetzter Begriff, sondern für Andreas Maier schon fast ein Markenzeichen. Jetzt liegt der zweite Band – betitelt «Das Haus» – vor. Und wieder kann man nur staunen, mit welcher Sensibilität, mit wieviel Empfinden sich der Autor in die Welt eines Kindes hinein versetzen kann. Eines Kindes zudem, das soziophob, das beinahe autistisch ist. Dieses kinndliche Ich – und vielleicht liegt da der Grund – hat in dieser autobiografisch eingefärbten Geschichte zweifellos Bezüge zum Autor Andreas Maier selbst.
Es ist nicht das erste Mal, dass Andreas Maier literarisch im besten Sinne auffällig wird. Bereits mit «Wäldchestag» hat er auf sich aufmerksam gemacht. Und mit «Das Zimmer» (2010) den großartigen Beginn eines auf elf Bände angelegten Romanzyklus’ vorgelegt: eine Familiensaga, ein großangelegter Heimatroman. Und das ist in diesem Falle kein negativ besetzter Begriff, sondern für Andreas Maier schon fast ein Markenzeichen. Jetzt liegt der zweite Band – betitelt «Das Haus» – vor. Und wieder kann man nur staunen, mit welcher Sensibilität, mit wieviel Empfinden sich der Autor in die Welt eines Kindes hinein versetzen kann. Eines Kindes zudem, das soziophob, das beinahe autistisch ist. Dieses kinndliche Ich – und vielleicht liegt da der Grund – hat in dieser autobiografisch eingefärbten Geschichte zweifellos Bezüge zum Autor Andreas Maier selbst.
Und so erzählt er, besser: lässt er Andreas erzählen von den Jahren früher Kindheit wie von einem verlorenen Paradies. «Drinnen» ist das erste von zwei Kapiteln überschrieben. Fremd ist Andreas in einer Welt, der er sich zudem durch eine Art Sprachlosigkeit verweigert. Es gab in diesem Leben noch keine Zwänge, einzig die Urgroßmutter ist so etwas wie eine Bezugsperson. Alles spielt sich im Innern des Kindes ab, ist eine Form der Erinnerungsarbeit. Mit drei Jahren beginnt er sich zu erinnern. «Bis heute kommt es mir vor, als habe damals mein Kopf begonnen, eine Geschichte zu erzählen, die Geschichte meiner Welt oder der Welt schlechthin.» Oder: «Vielleicht war es einfach die Welt, die mir die Welt erzählte.» Und: «… so rekontruiere ich bis heute eigentlich auch immer wieder zwanghaft die Jahre, an die ich mich nicht erinnern kann…». Das also ist die Geschichte, die Andreas Maier erzählt.
«Nach der Verweigerung des Kindergartens hatte ich noch drei Jahre im wiedergefundenen Paradies gelebt.» Doch dann wird diese Welt sehr real. Mit dem Einzug in ein neues Haus beginnt für Andrreas auch das Leben, von dem im Kapitel «Draußen» erzählt wird. Maier porträtiert ein Kind, das sich bewusst als Außenseiter gibt, für den das neue Haus, das er allerdings nun immer wieder verlassen muss, zum Rückzugsraum wird aus der Welt draußen. Erstaunlich ist, dass es von der Außenwelt keine Repressionen ob dieser Verweigerungshaltung gibt. Eher erfährt das Kind Verständnis. «Faul ist er nicht, dumm auch nicht, aber er zieht sich immer so zurück», so die Eltern.
Er konnte sich den Gesetzen der Schule einfach nicht unterordnen. Freunde hatte er nicht, mitmachen wollte er nicht. Er war allein und wollte allein sein. Bei sich war er nur dann. Dieses Leben, diese Welt aber hat auch etwas Bedrohliches, generiert Angst. Sie liegt «…wie ein Gemälde von Breughel…vor mir». Aufregend aber war das «andere» Leben, das Leben im Haus jedoch nicht.besonders. Für das Kind galt es nur zu beobachten: die Eltern, die Geschwister, das Leben draußen – aus sicherer Entfernung.

Roman einer Kindheit, Familiensaga und Heimatroman – Andreas Maier ist mit «Das Haus» ein außergewöhnliches Buch gelungen, das durch die psychologische Tiefe, durch eine fast klinische Nüchternheit und seine lakonische Diktion überzeugt.
So unterscheidet sich dieser Roman von Andreas Maier, wunderbar lakonisch und schon fast schlicht erzählt, grundlegend von anderen Büchern dieser Art, seien sie Kindheitserinnerungen, Entwicklungsromane und ähnliches. Er hat eine ganz eigenen und unverwechselbare Handschrift. Und wenn Maier auch nicht das Kind ist: das Kind ist doch ein Stück weit der brillante und außergewöhnliche Autor Andreas Maier. Das Leben draußen also: Das ist für das Kind und für Andreas Maier die Straße, in der das Haus steht, die Stadt Bad Nauheim, die Wetterau. So wird dieser Roman zu einer Art Heimatroman. Hier ist der Autor Andreas Maier zu Hause – und von hier und darüber erzählt er. «Und die Musik vermischte sich mit meinem Zustand und dem Haus und allen Räumen und der Wetterau vor den Fenstern. Mit den Bäumen, mit der Usa, dem Himmel, und der Ferne, auch mit Herrn Rubin, der lautlos da draußen vor sich hinarbeitet», heißt es am Ende des Romans – dieser Familiensaga, auf deren Fortsetzung wir gespannt sein dürfen. ●
Andreas Maier: Das Haus, Roman, 164 Seiten, Suhrkamp Verlag, ISBN 978-3-518-42266-3
.
.
.
.
.
Thomas Knubben: «Hölderlin – Eine Winterreise»
.
Hinüberzugehen und wiederzukehren
Christian Busch
.
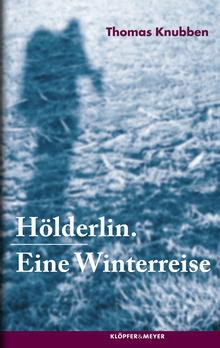 Ende 1827 kündigt Franz Schubert seinen Freunden seine neuesten Kompositionen an, einen «Zyklus schauerlicher Lieder». Dass die unter dem Titel «Winterreise» berühmt gewordenen 24 Vertonungen der Gedichte von Wilhelm Müller in dessen Todesjahr nicht nur ihn selbst sehr «angegriffen» haben, sondern auch der Nachwelt «noch gefallen» sollten», hatte Schubert schon geahnt. So ist das lyrische Ich, der einsame, ziellose Wanderer zwischen den Welten längst zum Inbegriff des romantischen Individuums geworden, das von Liebesschmerz und Weltenflucht getrieben, seiner Sehnsucht beharrlich in die Unendlichkeit folgt. Der Leiermann, den er am Ende trifft, ist Weggeselle, Doppelgänger und Totengräber in einem.
Ende 1827 kündigt Franz Schubert seinen Freunden seine neuesten Kompositionen an, einen «Zyklus schauerlicher Lieder». Dass die unter dem Titel «Winterreise» berühmt gewordenen 24 Vertonungen der Gedichte von Wilhelm Müller in dessen Todesjahr nicht nur ihn selbst sehr «angegriffen» haben, sondern auch der Nachwelt «noch gefallen» sollten», hatte Schubert schon geahnt. So ist das lyrische Ich, der einsame, ziellose Wanderer zwischen den Welten längst zum Inbegriff des romantischen Individuums geworden, das von Liebesschmerz und Weltenflucht getrieben, seiner Sehnsucht beharrlich in die Unendlichkeit folgt. Der Leiermann, den er am Ende trifft, ist Weggeselle, Doppelgänger und Totengräber in einem.
Wer war dieser Wanderer? Hat es ihn gegeben? So könnte man fragen.
Am 22. Juni 1802 war Susette Gontard, Hölderlins seelenverwandte Freundin, Geliebte und Muse, in Frankfurt im Alter von 33 Jahren gestorben. Als Diotima und Priesterin der Hohen Liebe war sie in seinem Roman «Hyperion» bereits unsterblich geworden. Nur wenige Tage später kehrt der Dichter nach 17-monatigem Aufenthalt aus Bordeaux zu Fuß zurück. Sein Zustand ist katastrophal und lässt das Schlimmste befürchten («Und er lässt es gehen, alles wie es will, / Dreht und seine Leier bleibt ihm nimmer still»). Seine Reise per pedes nach Bordeaux im Winter 1801/1802 markiert einen fatalen Wendepunkt in seinem Leben.
Gründe genug für den Ludwigsburger Kulturwissenschaftler Thomas Knubben, sich runde 200 Jahre später – als quasi posthumer Begleiter auf dem Klavier – Hölderlins Spuren folgend auf den Weg von dessen Geburtsstadt Nürtingen in die französische Metropole zu machen: «Und verstehe die Freiheit / Aufzubrechen, wohin er will» (Hölderlin, Lebenslauf). Herausgekommen ist dabei nun ein Wanderer-Reise-Buch, das seine eigenen Reise-Impressionen ebenso wie die von Hölderlin in 24 (!) Kapiteln dokumentiert, Hölderlins Dichtung und Wesen Schritt für Schritt zugänglich macht und erhellt – seine Winterreise.
Natürlich steht zu Beginn eine Reflexion auf das Wandern, für Hölderlin ein Akt der Befreiung und Offenbarung («Komm! Ins Offene, Freund!»). So manches Mal wird Knubben auf seiner Wanderung über die Schwäbische Alb, den Schwarzwald, Straßburg, Lyon und die Auvergne bis zur «schönen Garonne» in Bordeaux irrtümlich als Jakobspilger gesehen. Bis zur Pointe de Grave, dem äußersten Punkt von Hölderlins exzentrischer Bahn, stößt er dabei vor, «dem Endpunkt der von ihm erlebten Welt. Finis terrae» – Hölderlin am Meer.
Hat Hölderlin hier – so kann Knubben jetzt fragen – im gleichmäßigen Kommen und Gehen der Wellen einen Moment der Erfüllung gefunden? Jenen, in dem «Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eins werden, Mensch und Natur ineinander übergehen, die eigene Liebe und die Liebe der anderen sich ununterscheidbar durchdringen»? («Es nehmet aber / Und gibt Gedächtnis die See, / Und die Lieb auch heftet fleißig die Augen, / Was bleibet aber, stiften die Dichter» – Andenken)

Der deutsche Kulturwissenschafter Thomas Knubben bleibt in seinem Lesebuch «Hölderlin – Eine Winterreise» dem genialen «Hyperion»-Dichter buchstäblich auf den F(V)ersen, schreibend und wandernd sein Dichten und Reisen nacherlebend. Ein schönes Buch, und jenseits aller «Jakobspilgerei».
Auf solche Höhen steigt Knubbens Wanderung, ohne Hölderlins Zeit als Hauslehrer in der Bourgeoisie von Bordeaux, seine tragische Beziehung zu Susette Gontard oder seine Rückkehr zu vernachlässigen. Respekt gebührt dem Autor dabei nicht nur für seine sichtlich beschwerliche 53-tägige Reise, sondern auch für seine stets beharrlich-respektvolle Spurensuche in verstaubten Archiven einer verschneiten Gegend mit mehr als einer unwirtlichen Herberge. Weiß sein treuer Wanderstab so manche interessante Anekdote zu berichten, bleibt er seinem Dichter und dessen auch heute noch kaum fassbarem Schicksal treu auf den Versen und kommt ihm dabei wohl näher als jede Habilitationsschrift. Dafür und für dieses gründliche, kenntnisreiche und äußerst verdienstvolle Hölderlin-Lesebuch gebührt ihm großer Dank. ■
Thomas Knubben, Hölderlin – Eine Winterreise, Klöpfer&Meyer-Verlag, ISBN 978-3-86351-012-1
.
.
.
Tomas Espedal: «Gehen – oder die Kunst, ein wildes und poetisches Leben zu führen»
.
«Warum nicht mit der Straße beginnen»
Günter Nawe
.
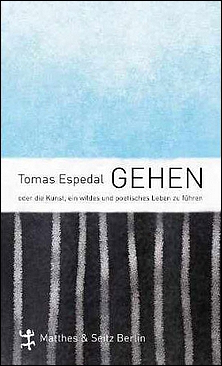 Während Thomas Bernhard in seiner Erzählung «Gehen» Denken und Gehen in einem schier unmöglichen Zusammenhang sieht, findet Karl Krolow in seiner Erzählung «Im Gehen»: «Späth wollte einiges im Gehen loswerden. Er wollte das, was anhänglich war, vergessen.» Beide Titel – und einige mehr – fallen dem Leser (vielleicht) ein bei der Lektüre des wunderbaren Buches des Norwegers Tomas Espedal: «Gehen – oder die Kunst, ein wildes und poetisches Leben zu führen».
Während Thomas Bernhard in seiner Erzählung «Gehen» Denken und Gehen in einem schier unmöglichen Zusammenhang sieht, findet Karl Krolow in seiner Erzählung «Im Gehen»: «Späth wollte einiges im Gehen loswerden. Er wollte das, was anhänglich war, vergessen.» Beide Titel – und einige mehr – fallen dem Leser (vielleicht) ein bei der Lektüre des wunderbaren Buches des Norwegers Tomas Espedal: «Gehen – oder die Kunst, ein wildes und poetisches Leben zu führen».
Doch wie anders ist dieses Buch dieses Autors. Espedal sieht sehr wohl einen Zusammenhang zwischen Gehen und Denken, einen sehr fruchtbaren gar. Auch geht es ihm nicht darum, etwas loszuwerden, zu vergessen, sondern etwas zu gewinnen. Und dies geschieht durch waches Beobachten, durch ein Den-Dingen-«nachdenken», durch Reflexion – auf dem Weg zu sich selbst.
Dieser Tomas Espedal (geb. 1961), ein in Norwegen sehr geschätzter Autor, ist leider im deutschen Sprachraum bisher völlig unbekannt. «Gehen» ist das erste seiner Werke, das in deutscher Übersetzung (Paul Berf) vorliegt.
«Wir denken weniger, wenn wir weit gehen, wir gleiten in den Rhythmus des Gehens, und die Gedanken enden, werden zu einer konzentrierten Aufmerksamkeit, die darauf gerichtet ist, was wir sehen und hören, was wir riechen; diese Blume, der Wind, die Bäume, als würden die Gedanken umgeformt und zu einem Teil dessen werden, was ihnen begegnet; ein Fluss, ein Berg, ein Weg.» So formuliert Espedal seine «Kunst, ein wildes und poetisches Leben zu führen» – und damit fast eine kleine Philosophie des Gehens.
«Warum nicht mit einer Straße beginnen» – mit diesem Satz beginnt dieses wunderbare Buch. «Hatte ich mir nicht schon seit langem gewünscht, mich auf den Weg zu machen, ohne Kurs und Ziel, und nur zu gehen, in eine einzige, beliebige Richtung… Der Philosoph ging täglich. Das schärfe sein Denken.» So gerüstet verlässt ein Mann Frau, Kind und Haus, um das Leben eines Landstreichers zu führen. Er macht sich auf den schon erwähnten Weg zu sich selbst. Es ist ein abenteuerlicher Weg – zum Beispiel durch sein Heimatland Norwegen. Und schnell stellt er fest: «Du bist glücklich, weil du gehst.» Dies Gehen ist aber nicht nur Glück. Es ist auch ein Scheitern, es ist Trinken, ist Not, ist manchmal ein hohes Maß an Verzweiflung. Sein «Gehen» durch Norwegen, später Frankreich und Deutschland, ist eine existenzielle Erfahrung. Im Gepäck hat Espedal, der Schriftsteller, eine Reihe von Kollegen. Vor allem sind es Jean-Jacques Rousseau und Arthur Rimbaud, die ihn «begleiten». Später wird er auf Alberto Giacometti treffen, einen Dialog mit Eric Satie führen, in Deutschland dann, in Todtnauberg, auf Martin Heidegger («Der Feldweg») stoßen. So ist diese Reise auch und vor allem – neben den körperlichen Anforderungen – ein Abenteuer des Denkens.
An einer Stelle zitiert Espedal Walt Whitman, auch er Tramp und Wandersmann:
«Zu Fuß und leichten Herzens schlag ich die offene Straße ein,
Gesund, frei, vor mir die Welt
…
Hinfort frage ich nicht nach Glück, ich bin das Glück
…
Stark und zufrieden zieh ich den offenen Weg.»

Tomas Espedal erzählt vom Abenteuer des Gehens und des Denkens in Reflexionen, Geschichten und wunderbaren Beschreibungen. Illustre Gefährten aus Literatur und Philosophie begleiten den «Landstreicher» auf seinen Wegen durch Norwegen, Frankreich, Deutschland, Griechenland und die Türkei – und die Landschaften des Denkens.
«Stark und zufrieden» zieht Espedal seinen Weg und lernt die Kunst zu reisen! Viele haben sich schon an ihr – teilweise sehr erfolgreich – versucht. W. G. Sebald fällt uns ein und Gottfried Seume. Und all die Flaneure und Spaziergänger der Literaturgeschichte. Tomas Espedal reiht sich mit seinen poetischen Texten ein. Und nimmt uns mit in ein «wildes» Leben, das im zweiten Teil des Buches nach Griechenland, über den Peloponnes und in die Türkei führt. Mit dem Autorenfreund Narve Skaar ist er unterwegs. Sie «gehen, um zu gehen, um zu sehen». Und sehen und erleben sehr viel. Daraus ergeben sich sehr schöne, kleine Erzählungen. Über Istanbul und Merih Günay, der an «Fernando Pessoa erinnert». Oder über den Oberst und seine Familie, denen sie, Espedal und Skaar, auf dem Wege nach Olympos begegnen.
Es ist das Abenteuerliche, das an diesem Buch fasziniert. Es sind aber auch auch die «Gespräche», die der Wanderer führt, die Reflexionen, die sich daraus ergeben. Der Leser «geht» gern mit, lässt sich führen und verführen.
Tomas Espedal, Gehen – oder die Kunst, ein wildes und poetisches Leben zu führen, 235 Seiten, Matthes & Seitz Berlin, ISBN 978-3-88221-551-9
.
.
.
.
Rebecca Gablé: «Der dunkle Thron»
.
Geschichte in Geschichten
Günter Nawe
.
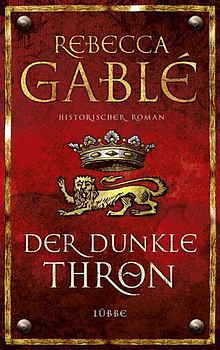 Es waren in jeder Hinsicht aufregende Zeiten, die England zwischen 1529 und 1553 erlebte. Heinrich VIII. wird sich von der katholischen Kirche lossagen, eine Frau nach der anderen heiraten. Einige, wie Anne Boleyn, landen auf dem Schafott. Auf dem Schafott landet auch der papsttreue Thomas Beckett. Wie überhaupt Anhänger der katholischen Kirche vor Verfolgung nicht sicher sind. Andererseits gibt es reformatorische Tendenzen, die von Deutschland aus auf die Insel kommen.
Es waren in jeder Hinsicht aufregende Zeiten, die England zwischen 1529 und 1553 erlebte. Heinrich VIII. wird sich von der katholischen Kirche lossagen, eine Frau nach der anderen heiraten. Einige, wie Anne Boleyn, landen auf dem Schafott. Auf dem Schafott landet auch der papsttreue Thomas Beckett. Wie überhaupt Anhänger der katholischen Kirche vor Verfolgung nicht sicher sind. Andererseits gibt es reformatorische Tendenzen, die von Deutschland aus auf die Insel kommen.
Eine kritische Gemengelage also, die nicht nur die Gesellschaft in Unruhe versetzt, sondern auch die Monarchie. Während sich Heinrich VIII. bemüht, einen Thronfolger in die Welt zu setzen, gibt es immer noch Mary, seine Tochter und damit die legitime Thronfolgerin – und Papistin. Auf sie setzen die Engländer ihre Hoffnungen. Als spätere Königin wurde sie als «Bloody Mary» bekannt. Sie ist «die historische Hauptfigur» im neuen Roman von Rebecca Gablé. Aus ihrer Perspektive erzählt die Autorin – und gibt ihr so die Gelegenheit, etwas an ihrem Bild in der Geschichtsschreibung zu korrigieren. Um sie und die Kontrahenten herum hat Rebecca Gablé das gesamte historische Personal der Zeit hervorragend in Szene gesetzt.
Mary steht als fiktive Hauptfigur Nicholas of Waringham gegenüber. Und damit sind wir «im Roman». «Der dunkle Thron» ist der nun vierte Band der mittlerweile berühmten Waringham-Saga, mit der die Autorin nicht nur alle Bestsellerlisten erklommen, sondern auch eine millionenfache Fangemeinde gefunden hat. Das hat wiederum etwas mit der sehr gelungene Mischung aus Fakten und Fiktion, die diese schon fast beispielhaften und literarisch anspruchsvollen historischen Romane der Gablé auszeichnet.
Mary und Nick: Sie kennen sich von Kindheit an. Sie sind befreundet und irgendwie liebt er sie auch ein wenig. Auf jeden Fall ist er immer an ihrer Seite, wenn es gilt, sie von ihrem größten Feind, ihrem Vater, zu beschützen. Denn Mary ist nicht nur ein Stachel im Fleische Henry VIII., sie steht seiner Heiratspolitik ebenso entgegen wie seinen kirchenpolitischen Plänen. Und Nick? Als Erbe einer heruntergekommenen Baronie hat er nicht nur wirtschaftliche Probleme zu bewältigen. Als Earl steht er auch mitten im politischen Geschehen seiner Zeit. Auf einer Seite ist er dem König den Vasalleneid schuldig, auf der anderen Seite steht eben Mary. Eine Position, die zu Verwicklungen führt, Gefahren für Leib und Leben birgt. Gefährliche Abenteuer sind für ihn zu bestehen, politische Händel auszufechten, Familienprobleme zu lösen. Er kämpft, stürzt, steht wieder auf. Er liebt und leidet, zeigt Mut und Schwäche, glaubt und zweifelt.
Nicholas of Waringham ist eine starke Figur. Und bewährt sich glänzend. «Vielleicht sind Männer wie ich so überholt und überflüssig geworden wie alte Schlachtrösser, die meine Vorfahren einst gezüchtet haben. Aber kein Waringham hat sich je einem Tyrannen unterworfen. Und ich schwöre bei Gott, ich werde nicht der erste sein». Es gibt zwar kein historisches Vorbild für ihn, so Rebecca Gablé in einem Interview mit dem Glarean Magazin, aber «es hätte Nicholas of Waringham… geben können».

Mit dem vierten Roman der Waringham-Saga legt Rebecca Gablé, die «Königin des historischen Romans», wieder einem spannenden und sehr unterhaltenden Roman vor. Mit profundem Wissen ausgestattet zeichnet sie sprachmächtig und fantasiereich ein farbenfreudiges Bild Englands an der Nahtstelle von Mittelalter und Renaissance.
Wie in allen ihren Romanen versteht es die Autorin auch in «Der dunkle Thron» hervorragend, Geschichte in Geschichten zu erzählen – kenntnisreich, farbenprächtig und sprachmächtig. Ihr «Herz gehöre dem englischen Mittelalter», hat Rebecca Gablé einmal gesagt. Mehr noch: Ausgestattet mit einem profunden Wissen um die Zeit verdienen die Romane der studierten Mediävistin und Germanistin im wahrsten Sinne des Wortes das Prädikat «historisch».Mit «Der dunkle Thron» hat Rebecca Gablé das Mittelalter verlassen und ist in der Renaissance angekommen. Aber es sind ja immer die Zusammenhänge und Übergänge, die Epochen der Geschichte so spannend machen. Ein Spannung, die auch durch die gesamte abenteuerliche Geschichte von Nicholas of Waringham hindurch zu spüren ist. Aber nicht nur daran ist es Rebecca Gablé gelegen. Sie möchte ihre Leser unterhalten. Und das ist ihr – wie schon mit den früheren Waringham-Romanen – hervorragend gelungen.
Rebecca Gablé, Der dunkle Thron, Historischer Roman, 956 Seiten, Lübbe-Ehrenwirth Verlag, ISBN 978-3-431-03840-8
.
.
.
.
.
.
Wells Tower: «Alles zerstört, alles verbrannt»
.
Wie schrecklich Liebe sein kann
Günter Nawe
.
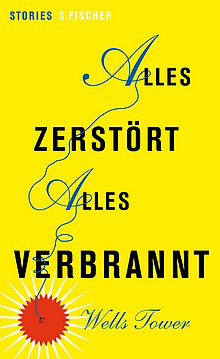 Es ist schön, dass es immer wieder Bücher gibt, die sich auf die eine oder andere Weise aus der Flut von Neuerscheinungen herausheben, neugierig machen – und auch glücklich, weil sie dem Leser das Gefühl vermitteln, etwas Wunderbares entdeckt zu haben. Ein solches Buch ist «Alles zerstört, alles verbrannt», ein schmaler Band mit Stories des jungen Kanadiers Wells Tower, 1973 in Vancouver geboren. Ein erstaunliches Debüt.
Es ist schön, dass es immer wieder Bücher gibt, die sich auf die eine oder andere Weise aus der Flut von Neuerscheinungen herausheben, neugierig machen – und auch glücklich, weil sie dem Leser das Gefühl vermitteln, etwas Wunderbares entdeckt zu haben. Ein solches Buch ist «Alles zerstört, alles verbrannt», ein schmaler Band mit Stories des jungen Kanadiers Wells Tower, 1973 in Vancouver geboren. Ein erstaunliches Debüt.
Was eine gute Short Story zu sein hat – Ernest Hemingway und Raymond Carver haben es gezeigt. Sie zeichnet sich durch eine bestimmte Art von Minimalismus und einen lakonischen Stil aus. Sie berichtet in der Regel von einfachen Menschen, von Alltäglichem und oft Nebensächlichem – und wird dadurch zu etwas beispielhaft Besonderem.
Von dieser Art sind auch die Geschichten, die Wells Tower erzählt. So von dem Mann, der von seiner Frau rausgeworfen wird, nachdem sie an der Windschutzscheibe seine Wagens einen Fußabdruck entdeckt, der mit ihrem eigene nicht übereinstimmt. «Vicky erblickte über dem Handschuhfach den schemenhaften Fußabdruck einer Frau an der Windschutzscheibe. Sie zog ihre Schuhe aus, sah, dass der Abdruck nicht mit ihrem übereinstimmte, und sagte Bob, er sei in ihrem Haus nicht mehr willkommen.»
Von einem unglücklichen Vater ist die Rede und seinem missratenen Sohn. Und von einer Insel, in der titelgebenden Erzählung «Alles zerstört, alles verbrannt», auf der die Menschen versuchen, sich durch Brandschatzen und Blutvergießen aus ihrer Hoffnungslosigkeit und von ihren Depressionen zu befreien. Das betrifft auch die persönlichen Beziehungen. «Pia fehlte mir schon jetzt… Zu böse und zu traurig war sie nicht aufgestanden, um von mir Abschied zu nehmen.» Am Ende stellt der Ich-Erzähler fest, «wie schrecklich die Liebe sein kann».
Es sind fast durchweg verkrachte Existenzen in einem «Wild America» – so der Titel einer der Geschichten. Wie Derrick und Claire, die sich permanent mit billigem Fusel besaufen. Zerstörung allenthalben und Selbstzerstörung. «Feindschaft» herrscht auch zwischen den beiden Mädchen Jacey und Maya. Zwischenmenschliche Beziehungen werden jeweils auf den Prüfstand gestellt – mit allen negativen Ergebnissen. Und Illusionen zerschellen an den Klippen des Lebens.

Mit «Alles zerstört, alles verbrannt» haben wir ein erstaunliches literarisches Debüt vor uns. Diese Stories des Kanadiers Wells Tower stehen in der Tradition der klassischen amerikanischen Kurzgeschichte, und doch hat der junge Autor seinen eigenen Stil, einen unverwechselbaren Ton. Seine Geschichten von verkrachten Existenzen und an den an den Klippen des Lebens zerschellten Illusionen gehören zum Besten, was das Genre «Kurzgeschichte» zurzeit zu bieten hat.
In Amerika gilt Wells Tower als hervorragender und vor allem als einer der besten Nachwuchsautoren der amerikanischen Literatur. Die Erstveröffentlichung seiner «Stories», die jetzt auch hier in der hervorragenden Übersetzung von Malte Krutzsch und Britta Waldhof zu lesen sind, erfolgte in «The New Yorker» und in «The Paris Review» – und wurden bereits mehrfach ausgezeichnet.
Tower ist allerdings kein Epigone von Hemingway oder Carver. Er hat schon seinen eigenen Stil, einen sehr eigenen Ton. Seine Geschichten sind von einer großartigen Eindringlichkeit. Atmosphärisch dicht, schnörkellos in der Diktion, kraftvoll und unsentimental und gerade deshalb von großer Tiefe. Meisterhaft.
Wells Tower ist ein großartiger Autor, von dem wir sicher noch viel erwarten dürfen. Deshalb dürfen wir auf das nächste Buch von ihm – er schreibt an einem Roman – sicher gespannt sein. ■
Wells Tower, Alles zerstört, alles verbrannt – Stories, 270 Seiten, S. Fischer Verlag, ISBN 978-3-10-080031-2
.
.
.
.
.
Martin Walker: «Schwarze Diamanten»
.
Spannend und unterhaltsam, doch thematisch zu viel des Guten
Isabelle Klein
.
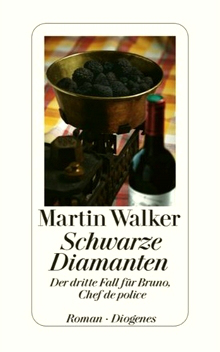 Im beschaulichen Saint Denis ist im Dezember jede Menge zu tun für Bruno, den Chef de police: Das lokale Sägewerk schließt, Menschen verlieren ihre Jobs, nicht zuletzt wegen des Sohnes des Besitzers Guillaume Pons, der sich an die Spitze der Écolos gestellt hat. Vater und Sohn sind zutiefst verfeindet. Guillaume ist kürzlich, nach vielen Jahren Auslandsaufenthalt in Asien, wo er scheinbar äußerst erfolgreich war, in seine Heimat zurückgekehrt. Er eröffnet die Auberge des Verts und will Bürgermeister werden – sehr zum Verdruss Brunos…
Im beschaulichen Saint Denis ist im Dezember jede Menge zu tun für Bruno, den Chef de police: Das lokale Sägewerk schließt, Menschen verlieren ihre Jobs, nicht zuletzt wegen des Sohnes des Besitzers Guillaume Pons, der sich an die Spitze der Écolos gestellt hat. Vater und Sohn sind zutiefst verfeindet. Guillaume ist kürzlich, nach vielen Jahren Auslandsaufenthalt in Asien, wo er scheinbar äußerst erfolgreich war, in seine Heimat zurückgekehrt. Er eröffnet die Auberge des Verts und will Bürgermeister werden – sehr zum Verdruss Brunos…
Doch nicht genug: Bruno, geschäftstüchtiger Trüffelzüchter, verkauft zu Saisonbeginn die «schwarzen Diamanten» auf dem Markt in Sainte Alvère, als ihn sein Freund Hercule auf Ungereimtheiten hinweist: die teuren Trüffeln wurden anscheinend mit minderwertigen Chinatrüffeln gestreckt und überteuert an Pariser Hotels verkauft. Bruno nimmt sich der Sache an…
Schließlich kommt es auf dem örtlichen Weihnachtsmarkt, den der Chef de police in seiner Funktion als Weihnachtsmann beehrt, auch noch zu einem Überfall auf den allseits geschätzten vietnamesischen Restaurant- und Weihnachtsmarktstand-Besitzer Nimh. Bruno ermittelt und sticht in ein Wespennest aus Intrigen. Und als Bruno und der Baron sich auf die Schnepfenjagd begeben, finden sie Hercule brutal ermordet…
Martin Walker nimmt sich in diesem seinem dritten «Bruno»-Fall einiges vor: Bandenkrieg der Vietnamesen und Chinesen, Organisiertes Verbrechen, verbunden mit dem Kolonialkrieg in Vietnam und dem Algerienkrieg, jede Menge Stoff also – meines Erachtens etwas zu viel, denn durch die Trüffelthematik, gewürzt mit oben genannten Bezügen, ist dieser Krimi thematisch überfrachtet. Dadurch, dass letztlich alle Ereignisse zusammenhängen, wirkt dieser Fall zu konstruiert, es geht zulasten der Stringenz und der Spannung: Der Mord an Hercule geschieht «so nebenbei» und geht angesichts aller anderen «Probleme» unter, wird am Ende auch mit wagen Vermutungen abgespeist.
Statt den Fall glaubhaft und durchdacht in den Mittelpunkt zu stellen, wird zu sehr auf anders abgezielt: auf das «Multitalent», den «Allrounder» Bruno. Alle seine unzähligen Vorzüge zu nennen ist unmöglich: Bruno ist nicht nur Polizist, Koch, Selbstversorger, Tennis- und Rugbylehrer, sondern auch ambitionierter Trüffelzüchter, Jäger, Kinderretter, Feuerwehr- und Weihnachtsmann. Und er ist immer und überall zur Stelle: Er besorgt Jobs, rettet mal so nebenbei ein Kind aus der Jauchegrube, wird mal schnell zum Feuerwehrmann, rettet dabei weitere Kinder. Bruno ist zum Gutmenschen hochstilisiert, ist positiv völlig überzeichnet, wirkt dadurch unglaubhaft. Überhaupt ist mir die Schwarz-Weiß-Malerei, die der Autor hier betreibt, zu flach: Böse sind nur böse und Gute nur gut. Wo bleiben Einblicke in das Seelenleben und die Entwicklung/Hintergründe/Motive, die die Bösen so böse werden lassen? Den Charakteren fehlt es insgesamt an Tiefe – sie bleiben alle sehr oberflächlich beschrieben. Dafür erhalten wir jede Menge Einblick in Brunos Seelen- bzw Liebesleben: Isabelle, Pamela, eine alleinerziehende Mutter…

Bei aller Kritik an Martin Walkers neuem Krimi «Schwarze Diamanten» mit seiner thematischen Überfrachtung und seiner psychologischen Schwarz-Weiss-Malerei: Das Buch unterhält durchaus bestens, ist prima geeignet beispielsweise als Strandlektüre - ein echter Wohlfühlkrimi!
Bei aller Kritik ist aber doch zu sagen: das Buch unterhält durchaus bestens, ist prima geeignet beispielsweise als Strandlektüre – ein echter Wohlfühlkrimi. Er enthält viel stimmige Darstellung der Atmosphäre mittels dichtem Beschreibungsstil; man bekommt regelrecht Lust, dem Departement Dordogne, dem Périgord einen Besuch abzustatten, dabei gut zu essen – natürlich mit Trüffeln und Wein… Und wenn der Folgeband die angesprochenen Fehler vermeidet: Konstruiert-gesuchte Handlung, überfrachtete Themata, Oberflächliche Figuren-Entwicklungen, teils psychologische Unglaubwürdigkeit, dann darf man sicher erwartungsvoll dem vierten «Fall» des Walkerschen Polizeichefs Bruno entgegensehen. Ich jedenfalls werde ihn bestimmt lesen. ■
Martin Walker, Schwarze Diamanten (Black Diamond), Kriminalroman, 348 Seiten, Diogenes Verlag, ISBN 978-3257067828
.
.
.
.
.
.
.
Guy Wagner: «Die Heimkehr» (Gustav Mahler)
.
Das Künstlerleben als Schlüssel zum Verständnis des Werkes
Christian Busch
.
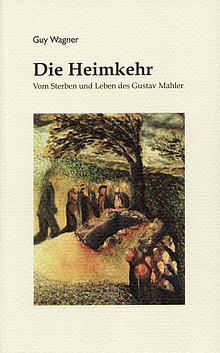 Über dem Saal liegt eine atemlose Spannung. In die Stille hinein lauschen Menschen den verklingenden Streichertönen, hie und da schluchzen die Celli, seufzt ein Fagott, die Stille durchbrechend. Erschütterung macht sich breit. In düstersten Klangfarben voll Trauer und Resignation vollzieht sich im letzten Aufbäumen der schmerzvolle Todeskampf bis zum unausweichlichen Ende, der Auflösung im Adagissimo und Pianissimo. Wehmütiger Abschied von der Erde, der geliebten Natur. Am Schluss steigt Gnade auf: eine Vision himmlischen Lebens, der Blick ins Jenseits, die Erlösung? Das Ende von Gustav Mahlers Neunter, der letzten vollendeten Symphonie, erst nach seinem Tod 1912 von Bruno Walter («…der Schluss gleicht dem Verfließen der Wolke in das Blau des Himmelsraumes») uraufgeführt, lässt die Zuhörerschaft in höchster Betroffenheit zurück: ein magischer Moment der Wahrhaftigkeit und Entrückung. Das muss man erlebt haben.
Über dem Saal liegt eine atemlose Spannung. In die Stille hinein lauschen Menschen den verklingenden Streichertönen, hie und da schluchzen die Celli, seufzt ein Fagott, die Stille durchbrechend. Erschütterung macht sich breit. In düstersten Klangfarben voll Trauer und Resignation vollzieht sich im letzten Aufbäumen der schmerzvolle Todeskampf bis zum unausweichlichen Ende, der Auflösung im Adagissimo und Pianissimo. Wehmütiger Abschied von der Erde, der geliebten Natur. Am Schluss steigt Gnade auf: eine Vision himmlischen Lebens, der Blick ins Jenseits, die Erlösung? Das Ende von Gustav Mahlers Neunter, der letzten vollendeten Symphonie, erst nach seinem Tod 1912 von Bruno Walter («…der Schluss gleicht dem Verfließen der Wolke in das Blau des Himmelsraumes») uraufgeführt, lässt die Zuhörerschaft in höchster Betroffenheit zurück: ein magischer Moment der Wahrhaftigkeit und Entrückung. Das muss man erlebt haben.
100 Jahre nach seinem Tod haben die Werke von Gustav Mahler nichts von ihrer Aktualität und Wirkung auf den modernen Menschen eingebüßt, scheinen mehr als zuvor unsere innersten Ängste und Sehnsüchte zu berühren. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Warum ist das Leben so leidvoll? Wie schwer ist meine Krankheit? Wofür lebe ich? Wie gehe ich mit meiner Angst vor dem Tod um? Wo finde ich Trost, Gnade oder gar Erlösung? Gründe genug, den tönenden Kosmos des letzten großen Symphonikers in Worte zu fassen und sich mit seinem Leben und Werk auseinander zu setzen, wie dies Guy Wagner in seinem Roman «Die Heimkehr» getan hat.
Am 8. April 1911 bricht der schwerkranke Gustav Mahler zu seiner letzten großen Reise von New York über Paris/Neuilly nach Wien auf. Die – tagebuchartig protokollierten – letzten 40 Tage schildern (immer wieder unterbrochen durch Rückblenden, Briefe, Aussagen von Zeitzeugen und Verweise auf sein Werk) seine Heimkehr nach Wien, wo der Todkranke seine letzte Zufluchtstätte sucht. «Da ziehen die blassen Gestalten meines Lebens wie der Schatten längst vergangenen Glücks an mir vorüber, und in meinen Ohren erklingt das Lied der Sehnsucht wieder.» Wie ein Film zieht sein Leben noch einmal in seinen Höhen und Tiefen an ihm vorüber, bis er am 18. Mai im Alter von 50 Jahren an einer unheilbaren bakteriellen Herzerkrankung in Wien stirbt, Endstation eines von vielen Zweifeln, Anfeindungen, Schicksalsschlägen und einigen wenigen Triumphen und Stunden des Glücks geprägten Lebens.
Nicht erst die tiefenpsychologische Analyse von Siegmund Freud hatte die Frage aufgeworfen: War die problematische Verbindung mit Alma («Ach Almschili!») richtig? Jene fast 20 Jahre jüngere, höchst attraktive Tochter eines Wiener Malers, deren Lebensfreude ihn, den Hofoperndirektor auf dem Gipfel seiner Karriere, beseelte und der er mit dem Adagietto aus der Fünften eine Liebeserklärung machte; die er sich – in seiner körperlichen Defizienz und im Hinblick auf seine Kunst und Aufgaben – zu bändigen gezwungen sah. Sogar das Komponieren verbot er ihr. Darf es ihn da wundern und schmerzen, wenn sie sich – und nicht zum ersten Mal – zu einem jüngeren (Walter Gropius) hingezogen fühlt?
Erinnerungen werden wach an die Uraufführungen seiner Werke, in denen Mahler gelebt hat wie kein zweiter («Erfahrenes und Erlittenes… Wahrheit und Dichtung in Tönen»), besonders an die triumphale Aufführung der Achten Symphonie in München (1’000 Mitwirkende), wo er vor illustrem und zahlreichem Publikum einen strahlenden Erfolg erlebt – warum gab es von diesem Momenten so wenige? Was bleibt von der Liebe zur Erde und den Menschen in all diesen Machtkämpfen, politischen Intrigen und antisemitischen Hetzkampagnen – vor allem in der feinen Wiener Hofgesellschaft – übrig?
Was bedeuten die Hammerschläge in seiner Sechsten Symphonie, die Schicksalsschläge, die ihn ereilen? Seine Herzschwäche, das Fremdgehen von Alma, der grausame Tod seines Kindes Putzi (Kindertotenlieder), «warum?».
In Guy Wagners konsequent Krankheits- und Lebensgeschichte symmetrisch kontrastierender Darstellung gelingt weit mehr als nur ein biographischer Roman: eine sorgfältiger Spiegel der Jahrhundertwende. Der Stand der Medizin, Dualismus, Jugendstil, Neoromantik, Expressionismus, Psychoanalyse, absolute Musik und Antisemitismus finden ihren Niederschlag in der Sprache der zu Wort kommenden Personen, nicht zuletzt der Sprache der häufig zitierten Werke Mahlers. Parallel dazu werden die Frauenbeziehungen, die Stationen seiner Karriere bis zu den Wurzeln seiner familiären Herkunft (die leidende Mutter, der brutale Vater, die sterbenden Geschwister) sichtbar.

Mahlers Leben als Schlüssel zum Verständnis seines umfangreichen Oeuvres in seinen wesentlichen Etappen und Stationen, Erfolgen und Tragödien zum Leben zu erwecken, dies hat Guy Wagner in seinem jüngst erschienenen, 350 Seiten umfassenden Roman «Die Heimkehr» mit Dokumenten-Collage auf originelle, sehr dichte und umfassende Weise geschafft.
Mahlers Leben als Schlüssel zum Verständnis seines umfangreichen Oeuvres in seinen wesentlichen Etappen und Stationen, Erfolgen und Tragödien zum Leben zu erwecken, dies hat Guy Wagner in seinem jüngst erschienenen, 350 Seiten umfassenden Roman mit Dokumenten-Collage auf originelle, sehr dichte und umfassende Weise geschafft. Wagner zeichnet Mahler dabei nicht als den Prototyp einer dekadenten Künstlerexistenz, wie sie durch Thomas Manns berühmte Novelle «Der Tod in Venedig» (1911) und auch später durch Luchino Viscontis kongeniale Verfilmung derselben – untermalt durch Mahlers Dritte und Fünfte – genährt wurde, sondern als den eigenständigen, sich radikal zu seiner Individualität bekennenden Künstler. Es bleibt mehr als eine Ahnung von dem, «in welche Hände die geniale Veranlagung eines jungen Menschen gelegt war, und was im Laufe dieses Lebens das Genie noch werde erleiden müssen.» (Nathalie Bauer-Lechner) ■
Guy Wagner, Die Heimkehr – Vom Sterben und Leben des Gustav Mahler, Rombach Verlag, 350 Seiten, ISBN 978-3-7930-9665-8
.
.
.
Regine U. Schricker: «Ohnmachtsrausch und Liebeswahn»
.
Von der weiblichen Lust am Leiden in der Liebe
Sigrid Grün
.
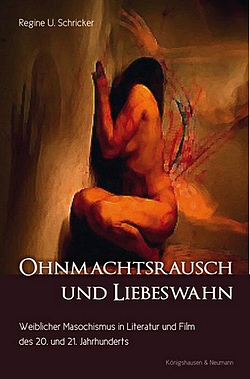 Schon bevor der deutsche Psychiater und Rechtsmediziner Richard von Krafft-Ebing den Begriff des Masochismus, der sich auf den österreichischen Schriftsteller Leopold von Sacher-Masoch bezieht, in den wissenschaftlichen Diskurs einführte, beschrieben zahlreiche Autoren Frauen, die eine gewisse Lust an der Unterwerfung und am Leiden in der Liebe empfanden. Sowohl Goethe, als auch die Geschwister Bronte oder Nathaniel Hawthorne beschrieben solche Figuren. Besonders populär wurde die Darstellung der in Leid umgeschlagenen Leidenschaft im 20. und 21. Jahrhundert. Dies hat nicht zuletzt mit der «pornographication of the mainstream» zu tun, die Brian McNair und Susan Sontag Mitte der 1990er Jahre postulierten. In einer Zeit, in der Sexualität nicht «glücklich, sondern allenfalls süchtig» macht (Georg Seeßlen) und die mediale Darstellung nackter Körper nicht mehr ungewöhnlich, sondern ganz alltäglich ist, erscheint der Sadomasochismus als interessantes «Lusterlebnis».
Schon bevor der deutsche Psychiater und Rechtsmediziner Richard von Krafft-Ebing den Begriff des Masochismus, der sich auf den österreichischen Schriftsteller Leopold von Sacher-Masoch bezieht, in den wissenschaftlichen Diskurs einführte, beschrieben zahlreiche Autoren Frauen, die eine gewisse Lust an der Unterwerfung und am Leiden in der Liebe empfanden. Sowohl Goethe, als auch die Geschwister Bronte oder Nathaniel Hawthorne beschrieben solche Figuren. Besonders populär wurde die Darstellung der in Leid umgeschlagenen Leidenschaft im 20. und 21. Jahrhundert. Dies hat nicht zuletzt mit der «pornographication of the mainstream» zu tun, die Brian McNair und Susan Sontag Mitte der 1990er Jahre postulierten. In einer Zeit, in der Sexualität nicht «glücklich, sondern allenfalls süchtig» macht (Georg Seeßlen) und die mediale Darstellung nackter Körper nicht mehr ungewöhnlich, sondern ganz alltäglich ist, erscheint der Sadomasochismus als interessantes «Lusterlebnis».
Die Autorin Regine U. Schricker nähert sich in ihrer Dissertation «Ohnmachtsrausch und Liebeswahn» dem Thema «Weiblichkeit und Masochismus» an, wobei sie der Frage nachspürt, wie «weibliche Unterwerfung kulturell besetzt ist», und wie die mediale Inszenierung vonstatten geht. Dabei analysiert sie fiktionale literarische und filmische Texte des 20. und 21. Jahrhunderts (aus den Jahren 1954-2004). Vor allem nordamerikanische, französische und deutschsprachige Texte werden herangezogen. Den Textanalysen stellt die Autorin einen einleitenden Teil voran, in dem sie zunächst ein Theoriegebäude entwirft, in dem psychoanalytische, literarische, feministische und rezeptionstheoretisch ausgerichtete Diskurse berücksichtigt werden. Ausgehend von Ricahrd von Krafft-Ebings, Sigmund Freuds und Theodor Reiks psychonalytischen Arbeiten zeigt die Autorin auf, wie Masochismus und Weiblichkeit in Relation zueinander gestellt werden können.
Sehr interessant ist auch die Analyse von «Venus im Pelz», Leopold von Sacher-Masochs Novelle, in der ein männlicher Masochist im Zentrum der Darstellung steht. Schließlich geht Regine Schricker der Frage nach, ob der Masochismus eine spezifisch weibliche Angelegenheit sei, wie es etwa die Konzepte der Psychoanalytikerinnen Helene Deutsch, Marie Bonaparte und Jeanne Lampl-de Groot nahe legen. Welche Positionen sind im feministischen Diskurs vorherrschend? Und welche Rolle spielt der weibliche Masochismus in der feministischen Film- und Literaturtheorie?
Im Hauptteil der Arbeit widmet sich die Autorin dann ausführlich elf literarischen und filmischen Texten, die sie nach unterschiedlichen Kriterien zusammenfasst. Luis Bunuels Film «Belle de jour» aus dem Jahre 1967 und Rainer Werner Fassbinders Fernsehfilm «Martha» aus dem Jahr 1974 etwa setzen sich intensiv mit dem Bürgertum und seinen Abgründen auseinander. Der voyeuristische weibliche Blick wird anhand von David Lynchs Film «Blue Velvet» (1986) und Elfriede Jelineks Roman «Die Klavierspielerin» (1983) thematisiert. In den Analysen von Elizabeth McNeills Erzählung «Nine and a Half Weeks» von 1978 (später sehr erfolgreich von Adrian Lynes mit Kim Basinger in der Hauptrolle verfilmt) und von Ingeborg Bachmanns 1971 erschienenem Roman «Malina» wird schließlich der Zusammenhang von Sprachlosigkeit und Begehren in den Mittelpunkt gestellt. Wie weibliche (zerstörte) Körper inszeniert werden, kann man gut anhand von Pauline Reages Roman «Geschichte der O» (1954) und Marina de Vans Film «In My Skin» (2002) nachvollziehen. Religiöse Opfer stehen in Lars von Triers «Breaking the Waves» (1996) und in M. Night Shyamalans «The Village» (2004) im Mittelpunkt. Zuletzt geht es um den Coming-out-Film einer Masochistin, Steven Shainbergs «Secretary» von 2002.

Die neue Studie «Ohnmachtsrausch und Liebenswahn» von Regine Schricker bietet fundierte Analysen zahlreicher literarischer und filmischer Texte, die man nach der Lektüre dieses Buches neu lesen kann. Mit ihrer Arbeit sensibilisiert sie für ein Thema, das in den Medien eine immer wichtigere Rolle spielt. Sprachlich klar und inhaltlich gehaltvoll bietet die Autorin dem Leser eine sehr gute Möglichkeit, sich ausführlich mit einem spannenden Thema auseinander zu setzen.
Regine U. Schricker geht dem Phänomen des weiblichen Masochismus in der Literatur und im Film sehr eingehend nach und zeigt fundiert die verschiedenen Ansätze auf, die hinter der Deutung des Zusammenhanges von Weiblichkeit und Masochismus stecken. Welche Rolle spielt eine labile Persönlichkeitsstruktur? Was bedeutet die Darstellung des weiblichen Masochismus für die weibliche Identität? Regine Schrickers Buch ist sehr gut gegliedert, und ihren wissenschaftlichen Ausführungen lässt sich hervorragend folgen. ■
Regine U. Schricker, Ohnmachtsrausch und Liebeswahn – Weiblicher Masochismus in Literatur und Film des 20. und 21. Jahrhunderts, 236 Seiten, Königshausen&Neumann Verlag, ISBN 9783826045165
.
.
.
.
.
.
.
.
Helena Marten: «Die Kaffeemeisterin»
.
Eine unmögliche Liebe
Isabelle Klein
.
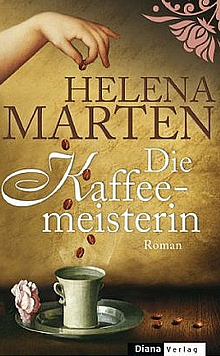 Ein ansprechend gestaltetes Cover und der verheißungsvolle Titel «Die Kaffeemeisterin» ließen mich beim Stöbern in der Buchhandlung aufmerksam werden. – Frankfurt 1732: Nach dem Tod ihres Mannes hat es die junge Johanna Berger nicht leicht das Kaffehaus «Coffeemühle» erfolgreich weiterzuführen, machen ihr doch allerlei Intrigen und Misstrauen gegenüber dem «teuflischen Getränk» Kaffee, das «süchtig macht», das Leben schwer. Doch die gewitzte Johanna lässt sich nicht unterkriegen, hat sie es doch Adam auf dem Totenbett versprochen. So mausert sie sich zu einer fähigen Geschäftsfrau, die Frankfurts ersten Damensalon aufmacht. Denn: warum soll der verführerische Genuss Frauen verwehrt bleiben?! Doch am Tag der Eröffnung schlägt Intimfeind Hoffmann erneut zu, es kommt zum Eklat. Die «Bergerin» steht unvermittelt vor dem Nichts. Es beginnt eine abenteuerliche Reise, die sie über Venedig schließlich bis ins exotische Istanbul, in den Harem des Sultans führt. Zurück lässt Johanna allerding ihre zwei Stiefkinder und auch ihre knospende Bekanntschaft mit dem jüdischen Musiker Gabriel Stern, der ihre große, aber unerfüllbare Liebe zu werden scheint …
Ein ansprechend gestaltetes Cover und der verheißungsvolle Titel «Die Kaffeemeisterin» ließen mich beim Stöbern in der Buchhandlung aufmerksam werden. – Frankfurt 1732: Nach dem Tod ihres Mannes hat es die junge Johanna Berger nicht leicht das Kaffehaus «Coffeemühle» erfolgreich weiterzuführen, machen ihr doch allerlei Intrigen und Misstrauen gegenüber dem «teuflischen Getränk» Kaffee, das «süchtig macht», das Leben schwer. Doch die gewitzte Johanna lässt sich nicht unterkriegen, hat sie es doch Adam auf dem Totenbett versprochen. So mausert sie sich zu einer fähigen Geschäftsfrau, die Frankfurts ersten Damensalon aufmacht. Denn: warum soll der verführerische Genuss Frauen verwehrt bleiben?! Doch am Tag der Eröffnung schlägt Intimfeind Hoffmann erneut zu, es kommt zum Eklat. Die «Bergerin» steht unvermittelt vor dem Nichts. Es beginnt eine abenteuerliche Reise, die sie über Venedig schließlich bis ins exotische Istanbul, in den Harem des Sultans führt. Zurück lässt Johanna allerding ihre zwei Stiefkinder und auch ihre knospende Bekanntschaft mit dem jüdischen Musiker Gabriel Stern, der ihre große, aber unerfüllbare Liebe zu werden scheint …
Bei dem vorliegenden Buch handelt es sich, nach der «Porzellanmalerin», um das zweite Werk des Autorenduos Helena Marten. Gemäß Verlagsangaben besteht dies aus Autorinnen, die beide in der Verlagsbranche arbeiten. Eines ist dieser Roman sicherlich: eine unterhaltsame Lektüre, gepaart mit einer problematischen Liebesgeschichte, vor historischer Kulisse mit exotischen Schauplätzen. Er liest sich leicht, die Sprache ist sehr eingängig und einfach, bildhaft, teils auch banal (mit sehr vielen Ausrufesätzen). Da wird beispielsweise geplumpst, geschmissen oder losgelegt. Oder schon mal der Schwester des Sultans das Wort «Hallo» in den Mund gelegt. Wer drückte sich zur damaligen Zeit wohl so aus?! Von vgaloppierenden Hunden» ganz zu schweigen…
Sollte ein historischer Roman nicht mehr aufweisen?! Nämlich einen gewissen «Mehrwert» – ich möchte Neues erfahren. Doch außer rudimentären Kenntnissen über die Kaffeezubereitung wird hier nichts geboten. Zudem möchte ich in die Geschichte hineingezogen, an Schauplätze versetzt werden, die dicht beschrieben sind. Stattdessen ist Lokalkolorit Mangelware: Johannas Venedig wird zwar bildhaft beschrieben, doch nicht atmosphärisch ausgearbeitet. Auch Istanbul bleibt bloßer Handlungshintergrund für einen kurzen Ausflug in den Harem. Diesbezüglich hat das Autorenduo jede Menge Potenzial verschenkt: Johanna hastet innerhalb nicht einmal eines Jahres (und 100 Seiten) von Frankfurt über Venedig nach Istanbul und via Neapel wieder zurück. Wie glaubhaft ist es solches anno 1733? Eine anstrengende Reise innerhalb dieser Zeitspanne zu bewältigen, nebenbei noch zur Kaffeemeisterin des Sultans aufzusteigen und zwei neue Sprachen zu erlernen?

Schlecht ist Helena Martens neuer Roman «Die Kaffeemeisterin» keineswegs. Nur leider historisch sehr schwammig bis fragwürdig. Ein Historischer Roman sollte vor allem authentisch und korrekt sein. Ich bevorzuge pralle «Sittengemälde» a la Rebecca Gable, wo sich überzeugende und fein gezeichnete Gestalten glaubhaft verhalten und entsprechend handeln. Und wo ich quasi nebenbei jede Menge Neues aus alter Zeit erfahre. Dies alles fehlt bei Helena Marten – schade.
Dieser historische Roman ist also vor allem eines: Anachronistisch mit seiner Hauptfigur Johanna, die über Giovanna zu Yuhanissa mutiert. Sie wird als «stark und faszinierend» beschrieben, ist aber erstaunlich naiv. Sie reist alleine nach Venedig – wie das bitte zu einer Zeit, in welcher Frauen alleine nicht mal das Haus verließen?! Oder: Sie besucht einen jüdischen Musiker zu Hause und gibt zur Begrüßung die Hand.
Die Protagonistin, eigentlich eine sympathische Figur, ist leider schablonenhaft ausgearbeitet. Sie meistert jede Situation, aber überzeugt weder als historische Gestalt noch als Mensch wirklich, sie bleibt vorhersehbar und seltsam blutleer, außerdem naiv in ihren Gedankengängen wie in ihren Verhaltensweisen. Die Beziehung zu dem «faszinierenden, großäugigen und sensiblen» Musiker Gabriel bleibt weitestgehend «auf der Strecke». Dennoch erkennen beide vom ersten Augenblick an die gegenseitige Anziehung und können einander nicht vergessen…
Aber bei aller Kritik: Schlecht ist dieser Roman keineswegs. Nur leider historisch sehr schwammig bis fragwürdig. Zudem fehlt im dritten Teil, als Johanna wieder in Frankfurt/Main ankommt, der rote Faden; Hier reihen sich mehr oder weniger Ereignisse, und alles endet recht vorhersehbar.
Ein historischer Roman sollte vor allem authentisch und historisch korrekt sein. Ich bevorzuge pralle «Sittengemälde» a la Rebecca Gable, wo sich überzeugende und fein gezeichnete Gestalten glaubhaft verhalten und entsprechend handeln. Und wo ich außerdem, quasi nebenbei, jede Menge Neues aus alter Zeit erfahre. ■
Helena Marten, Die Kaffeemeisterin, 512 Seiten, Diana Verlag, ISBN 3453290607
.
.
.
Brigitte Fuchs: «salto wortale»
.
NIELÄUFTEINWURMSTURM
Günter Nawe
.
.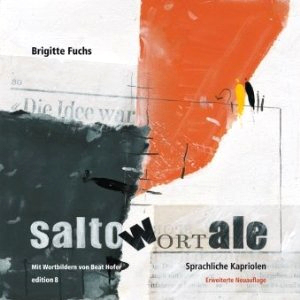 «Als sich das ROTWEINROT und das
«Als sich das ROTWEINROT und das
WEISSWEINWEISS näher kamen,
sah die Welt plötzlich ganz rosé aus»
Von dieser und anderer, fantastisch vielfältiger Art sind die Sprachspiele der Brigitte Fuchs. Und so liegt – um es vorwegzunehmen – ein höchst amüsantes, ein sehr intelligentes und sehr schönes Buch vor mir, das jede Empfehlung wert ist. Was die Lyrikerin Brigitte Fuchs hier bietet, ist sprachliche Equilibristik der besonderen Art. Sie spielt mit den Wörtern, schüttelt sie sich zu recht, findet poetische Wortbilder, schlägt gewagte Salti und Kapriolen. Sie schreibt Sinn und vermeintlich Unsinn – doch lasse man sich nicht täuschen. Alles, was wir in diesem Buch sehen und lesen, ist begründet in der Lust an der Sprache und hat einen höchst poetischen Wert.
Ihre Lyrik ist – so hat Brigitte Fuchs es einmal selbst formuliert – «Arbeit an der Aussage, am Klang, am Rhythmus, an der Form». Ein hoher Anspruch, dem die Schweizer Lyrikerin in jeder Zeile, in jedem Bild gerecht wird. Für die Sprachartistin gehören «Genauigkeit des Denkens und das genaue Hinsehen wesentlich zum Handwerk des Schreibens». Und so ist das, was hier so leichtfüßig herkommt, harte Arbeit und pefektes Handwerk.
Geboren in Widnau im St. Galler Rheintal lebt die Lyrikerin heute im Kanton Aargau. Die gelernte Lehrerin ist nicht nur nur als Dichterin, sondern auch gestalterisch tätig. Ihren Arbeiten merkt man dies an. Dafür hat sie bereits zahlreiche Literaturpreise erhalten. Die Bücher der Brigitte Fuchs – zum Beispiel: «Herzschlagzeilen», «Das Blaue vom Himmel oder ich leben jetzt» und «Solange ihr Knie wippt» – sind längst über den Status eines Geheimtipps hinaus. Und das sollte auch für den Band «salto wortale» gelten.
Die Sprachkünstlerin Brigitte Fuchs konfrontiert den Leser mit oft sehr ungewohnten visuellen und verbalen Überraschungen. Seien es Wortcollagen, Sprachbilder, Gedichte oder Schüttelreime.
Da gibt es das Sprachbild «KONKRET», das mit der Zeile NIELÄUFTEINWURMSTURM endet.
Da sagt
«…der Seiltänzer zu seiner Frau: >Du müsstest wissen, dass für mich ein Seitensprung nicht in Frage kommt!<
Oder man lese das «Sonett» – wenn man so will: ein wunderbares Liebesgedicht, in dem der Liebste aufgefordert wird, ein Sonett zu schreiben. Worauf er dichtet:
«…Sonette sind was Bittersüsses, Feines, / für Mädchen, die längst Frauen sind, mein Kind! / Sonette sind die Länge deines Beines – / denkst du denn, dass ich dafür Worte find?»
Manchmal «jandelt» es richtig schön. So, wenn Brigitte Fuchs ihrem großen Kollegen Ernst Jandl folgendes Gedicht widmet:
Oh Schandl
Was für ein Wandl
seit Ernst Jandl
verschwandl
… .
kein Wortspielhandl
alles verläuft im Sandl
oh Schandl

In ihrem Lyrik-Band «salto wortale» versteht es Brigitte Fuchs souverän, auf der gesamten Klaviatur der Sprache zu spielen. Ihr Buch ist amüsant, hintergründig und vordersinnig, intelligent und wunderbar – voller Lust an der Sprache und von hohem poetischen Wert. Durch die kongenialen Wortbilder von Beat Hofer bekommt dieser Lyrikband zudem ein unverwechselbares Aussehen.
Nein, nichts verläuft in diesem herrlichen Buch, in diesen «vergnüglichen, anregenden und bekömmlichen Blätterbuch für Sprachfans» «im Sandl». Auch nicht die wunderbaren Farbbild-Seiten des Grafikers Beat Hofer. Er spielt ebenfalls gekonnt mit Bild und Wort und Farbe und hat so dem Lyrikband sein unverwechselbares Aussehen gegeben.
Übrigens: Müsste man der POESIE nicht endlich das DU anbieten? Brigitte Fuchs steht längst mit der Poesie auf Du und Du. Im «Vor- und Nachwort» schreibt sie: «Wir verlangen ja nicht viel vom Wort: Das und kein anderes soll es sein, anfänglich, wahr, gut, groß, geflügelt. Es soll uns auf die Sprünge helfen, wir wollen es ergreifen, halten, führen, erteilen, entziehen. Eines gibt das andere, wir werden jedes unterschreiben und das letzte, noch ehe es gesagt ist, behalten». Dem ist nichts hinzuzufügen. ▀
Brigitte Fuchs, salto wortale – Sprachliche Kapriolen (Zweite/erweiterte Auflage), mit Wortbildern von Beat Hofer, 192 Seiten, edition 8, ISBN 978-3-85990-110-0
.
.
.
.
Inge Grolle: «Die jüdische Kauffrau Glikl» (Biographie)
.
«Aus vielen Sorgen und Nöten und Herzeleid»
Günter Nawe
.
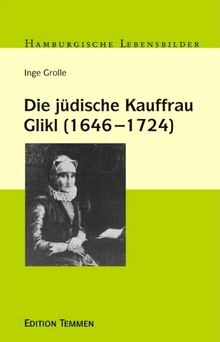 Sie war eine deutsch-jüdische Kauffrau, eine erfolgreiche Unternehmerin und Perlenhändlerin. Sie lebte von 1646 bis 1724, geboren in Hamburg und gestorben in Metz. Sie hieß eigentlich korrekt «Glikl bas Judah Leib» (Tochter des Judah Leib), wurde aber eher bekannt als «Glückl von Hameln», benannt nach dem Herkunftsort ihres Mannes Chajim: Hameln.
Sie war eine deutsch-jüdische Kauffrau, eine erfolgreiche Unternehmerin und Perlenhändlerin. Sie lebte von 1646 bis 1724, geboren in Hamburg und gestorben in Metz. Sie hieß eigentlich korrekt «Glikl bas Judah Leib» (Tochter des Judah Leib), wurde aber eher bekannt als «Glückl von Hameln», benannt nach dem Herkunftsort ihres Mannes Chajim: Hameln.
Glikl führte ein außergewöhnliches und exemplarisches Leben, über das sie in erster Linie ihren Kindern berichtete – und durch einen Glücksfall auch der Nachwelt. So liegen sowohl der Urtext ihrer Erinnerungen in westjiddischer Sprache (und hebräischen Schriftzeichen) – in «Weiberdeutsch», wie es etwas despektierlich hieß – vor als auch mehrere Übertragungen. Zuletzt kam dieses Verdienst 1913 Alfred Feilchenfeld zu. Eine Neuausgabe erfolgte 1994, der Fassung von Bertha Pappenheim, eine Nachfahrin der «unbekannten Jüdin» Glikl, durch Viola Roggenkamp.
Dieser außergewöhnlichen Frau hat jetzt Inge Grolle ein «Lebensbild» gewidmet. Die Autorin, sie studierte Geschichte, Germanistik und Romanistik, hat sich durch zahlreiche wissenschaftliche Publikationen einen Namen gemacht. Ihr besonderes Interesse gilt der hamburgischen Sozial- und Frauengeschichte. Ihre Arbeit über die Kauffrau Glikl hat sie entlang der bekannten biografischen Fakten gerschrieben, immer aber in den Konzext von Zeit und Zeitumständen gestellt.

Bertha Pappenheim im Kostüm der Glikl. Pappenheim, eine entfernte Verwandte Glikls, übersetzte und veröffentlichte 1910 deren Memoiren. (Nach einem Gemälde von L. Pilichowski)
So ist Grolles Buch für den Leser ein faszinierendes Porträt der Glikl von Hameln und gleichzeitig ein spannendes Zeitpanorama. Wie lebte Glikl von Hameln, und wie lebten Juden Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts in Deutschland? In den Erinnerungen der Glikl können wir es nachlesen. Sie hatten geschäftlichen Erfolg, genossen zum Beispiel als «Hofjuden» Anerkennung. Sie waren insgesamt und als Familie im Besonderen gefährdet als Juden und Kaufleute. Es gab Krankheiten wie die Pest. Und es gab religiöse Umbrüche und Irritationen (zum Beispiel das Auftreten dess Sabbatai Zwi), die sich auf das religiöse Leben der Juden auswirkten. Es gab staatliche Restriktionen und persönliche Verfolgungen.
Das alles hat Glikl nicht nur miterlebt, sondern auch aufgeschrieben. Sie, Mutter von 12 Kindern, dreißig Jahre mit Chajim verheiratet, später als selbständige Geschäftsfrau mit internationalen Verbindungen tätig, schildert sehr ausführlich die äußeren Umstände ihres Lebens. Sie gibt aber auch einen Blick in ihre Seelenlage – «Aus vielen Sorgen und Nöten und Herzeleid». Sie, die aufopferungsvolle Frau und Mutter, findet ihren Halt im Glauben an einen Gott, der sie hält, obwohl «sündig», und dem sie sich in jeder Siuation ihres Lebens anvertraut. Dass sie, nach einer zweiten und nicht sehr glücklichen Ehe, verarmt starb, macht ihre persönliche Tragik aus.

nge Grolle erinnert uns mit ihrem Lebensbild der Kauffrau Glikl von Hameln nicht nur an eine faszinierende Frau, sondern gibt auch ein sehr differenziertes Zeitbild. Die Lebenswelt der Glikl war geprägt von Zeitgeist und Zeitumständen und kann so als exemplarisch gelten. Inge Grolles sehr empfehlenswerte Arbeit ist es auch.
Dies alles ist bei Inge Grolle zu lesen. Und mehr. Die jüdischen Sitten und Gebräuche werden uns ebenso nahegebracht wie das Rollenverständnis von Mann und Frau in der jüdischen Lebenswelt – vor allem aber das Selbstverständnis einer jüdischen Frau in der damaligen Zeit.
So erzählt Inge Grolle von der Geschichte und den Geschichten.der Glikl, die uns mit ihren Aufzeichnungen auch ein höchst wichtiges literarisches Zeugnis hinterlassen hat. Und es ist sehr schön, dass die Autorin einige dieser von Glikl erzählten Geschichten an das Ende ihres Buches gestellt hat. Von einer «märchenhaften Atmosphäre altjiddischer Erzählkunst» ist die Rede (I.G.). Und weiter: «Inmitten von Glikls biografischem Bericht ist die sprachliche Suggestion der Geschichten manchmal so stark, dass die dramatischen Ereignisse ihres eigene Lebens fast selbst den Charakter eines alten Exempels annehmen.» Dem ist von Seiten des Lesers nichts hinzuzufügen. ▀
Inge Grolle: Die jüdische Kauffrau Glikl (1646-1724), 194 Seiten, Edition Temmen Hamburg, ISBN 978-3-8378-2017-1
.
.
.
.
H.Sarkowicz & A.Mentzer: «Schriftsteller im Nationalsozialismus»
.
Kompakte und präzise Darstellung eines heiklen Themas
Jan Neidhardt
.
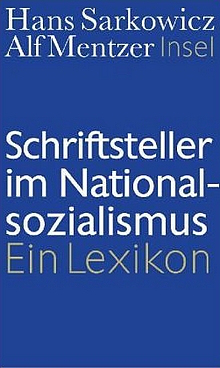 Wer sich mit der deutschen Literatur zur Zeit des Nationalsozialismus beschäftigt, wird wahrscheinlich zunächst an die Schriftsteller denken, die als Emigranten Deutschland verlassen haben – meist gezwungenermaßen, wie Bertolt Brecht oder die Mann-Brüder, um nur zwei bekannte Namen zu nennen. Andererseits gab es auch noch eine Menge Schriftsteller, die nicht unbedingt mit dem Naziregime konform gingen, trotzdem in Deutschland blieben und teilweise auch weiter veröffentlichten – Stichwort «Innere Emigration», landläufig zum Beispiel verbunden mit Namen wie Erich Kästner oder Ricarda Huch.
Wer sich mit der deutschen Literatur zur Zeit des Nationalsozialismus beschäftigt, wird wahrscheinlich zunächst an die Schriftsteller denken, die als Emigranten Deutschland verlassen haben – meist gezwungenermaßen, wie Bertolt Brecht oder die Mann-Brüder, um nur zwei bekannte Namen zu nennen. Andererseits gab es auch noch eine Menge Schriftsteller, die nicht unbedingt mit dem Naziregime konform gingen, trotzdem in Deutschland blieben und teilweise auch weiter veröffentlichten – Stichwort «Innere Emigration», landläufig zum Beispiel verbunden mit Namen wie Erich Kästner oder Ricarda Huch.
Um den weiten Bogen zum umschreiben, den das neue Lexikon «Schriftsteller im Nationalsozialismus» der beiden Autoren Hans Sarkowicz und Alf Metzner spannt, muss man zur Literatur jener Zeit die damals mengenmäßig weit überwiegenden systemkonformen Literaten mit hinzuzählen. Ein Bereich, dem sich die Literaturwissenschaft v.a. auch im populären Bereich eher ungern widmet. Schriftsteller wie Hans Grimm, Will Vesper oder Heinrich Anacker stehen in der Schmuddelecke jener Blut-und-Boden-Literatur, die heutzutage höchstens noch zeitgeschichtlich von Interesse sein kann.
Das Lexikon widmet sich in einer Gesamtschau einer Übersicht zu vielen der Autoren, die in Deutschland zur Zeit des Nationalsozialismus erscheinen durften. Literaturgeschichtlich ist die Zeit sehr spannend und erstaunlich vielschichtig, das wird bei der Lektüre des Lexikons schnell klar. Es sei noch einmal betont: Nicht alles, was zwischen 1933 und 45 in Deutschland in Druck ging, war Nazi-Literatur. Teilweise durften selbst jüdische Autoren bis 1938 (natürlich unter erheblichen Schwierigkeiten) weiterhin veröffentlichen. Autoren der Nachkriegszeit haben damals ihre ersten Schreibversuche gemacht, zum Beispiel Marie Luise Kaschnitz, Wolfgang Koeppen, Max Frisch.
Sarkowcz und Mentzer, die sich in ihrem Band mit einem sehr breiten Spektrum an Literatur beschäftigen, fällen keine Pauschalurteile, sondern stellen in alphabetischer Reihenfolge Gegner des NS-Regimes und berüchtigte Nazi-Literaten nebeneinander. Über diese Art der Zusammenstellung von 155 so unterschiedlichen Biographien lässt sich sicher streiten. Aber ich finde die Idee gelungen, wenn man etwas über die Lebensumstände jener Zeit nicht nur unter schriftstellerischen Gesichtspunkten erfahren möchte.
Nebeneinandergestellt ohne Wertung zeigen sich oft Parallelen in den Entwicklungen, die geschichtlich bestimmt sind. Die Erfahrung des Ersten Weltkriegs und die darauf folgende Phase der Weimarer Republik spielen fast immer eine Rolle, andererseits die persönlich Suche nach einer Sinngebung, die sich im künstlerisch-literarischen Schaffen niederschlägt. Spannend ist es, anhand dieses Buches besonders die gefeierten Nazidichter einmal näher unter die Lupe zu nehmen. Viele von ihnen, so zeigt sich, waren Konjunkturritter, die literarisch sonst kaum eine Chance gehabt hätten, größere Aufmerksamkeit zu erzielen. An ihrem Beispiel wird aber auch das Kompetenzgerangel im kulturellen Sektor des sog. Dritten Reiches deutlich, ebenso die Tatsache, das ein gefeierter Schriftsteller schnell unter die Räder kommen konnte, wenn er es sich mit einer der verschiedenen Schaltstellen der Macht verscherzt hatte.

«Schriftsteller im Nationalsozialismus» von Sarkowicz & Mentzer ist ein interessantes Projekt, indem es die Schriftsteller aus der Zeit des Nationalsozialismus in einem biographisch orientierten Lexikon verzeichnet. Gut geeignet für alle, die sich eine Übersicht verschaffen möchten, und für alle, die auch nach weiterführenden Informationen zu bestimmten Personen suchen.
Einen weiteren Punkt zeigt das Lexikon sehr gut auf, nämlich dass die Wirkung der Literatur jener Zeit nicht Punkt 1945 schlagartig aufhörte, sondern dass die Denkweise, die hier angestoßen wurde, weiter wirkte. Mehr noch, nicht nur die vermittelten Denkweisen wirkten weiter, auch Schriftsteller dieser Zeit waren «danach» weiter im Geschäft, wie zum Beispiel Hans Baumann, der Erfinder des berüchtigten Liedes «Es klappern die morschen Knochen», der nach dem Krieg als «Geläuterter» zahlreiche (und teils bis heute beliebte) Kinderbücher schrieb. Und schließlich blieben auch viele Bücher, die in jener Zeit verfasst wurden, auch besonders die vermeintlich unpolitischen, weiterhin erfolgreich, wurden teils in entschärften Versionen noch Jahre lang neu aufgelegt. Ein Thema also, dem man sich in seiner Komplexität sehr lange widmen kann.
Den Autoren ist hier ein wirkliches Kunststück gelungen: die Literatur von 1933 bis 1945 kompakt und präzise darzustellen. Der lexikalische Hauptteil enthält 155 Biographien, durchaus auch erzählerisch ausgestaltet und nicht bloße Aneinanderreihung von Eckdaten. Es gibt ein Werkverzeichnis (meist in Auswahl) und Hinweise zur Sekundärliteratur. Das Lexikon ist natürlich als Nachschlagewerk gedacht und auch geeignet, andererseits passt es auch hervorragend zum Querlesen und Schmökern. Viele Namen mit unglaublich spannendem und dabei zeittypischem Lebenslauf sagen uns heute nichts mehr, sind aber wichtig für das literarische Gesamtbild jener Zeit. Gewiss, bei 155 Autoren bleibt letztlich die Auswahl eine subjektive, das stellen Sarkowicz und Metzner auch gar nicht in Abrede. – Herausgekommen ist ein Buch, das man sicher schon als Standardwerk bezeichnen kann, das sich aber auch für jeden Literatur- und zeitgeschichtlich Interessierten abseits des wissenschaftlichen Kontextes eignet. ▀
Hans Sarkowicz, Alf Metzner: Schriftsteller im Nationalsozialismus – Ein Lexikon, Erweiterte Neuauflage, Insel Verlag, 676 Seiten, ISBN 978-3-458-17504-9
.
.
Andrea Wölk: «Infinitas – Krieger des Glaubens»
.
Neue Vampir-Reihe im Oldigor Verlag
Sarah Fuhrmeister
.
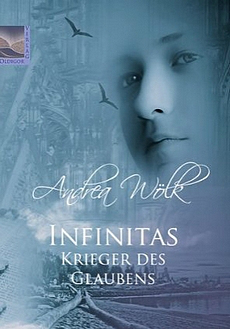 Channing McArthur tauscht seine Pariser Wohnung für zwei Monate mit der jungen Sara aus den USA – ein Tausch mit fatalen Folgen. Denn bei seiner Ankunft wird er in einen tödlichen Autounfall verwickelt. Tage später erwacht er aus dem Koma und muss zu seiner Verwunderung feststellen, dass er kein richtiger Mensch mehr ist. Sara, ihre Freunde, ihre Familie: allesamt sind sie Vampire, und um sein Leben zu retten, wurde auch Channing verwandelt. Binnen weniger Tage ist er vom absoluten Langweiler zum Anführer einer ganzen Kriegerschaft guter Vampire, die ihren bösartigen Artgenossen den Kampf angesagt haben.
Channing McArthur tauscht seine Pariser Wohnung für zwei Monate mit der jungen Sara aus den USA – ein Tausch mit fatalen Folgen. Denn bei seiner Ankunft wird er in einen tödlichen Autounfall verwickelt. Tage später erwacht er aus dem Koma und muss zu seiner Verwunderung feststellen, dass er kein richtiger Mensch mehr ist. Sara, ihre Freunde, ihre Familie: allesamt sind sie Vampire, und um sein Leben zu retten, wurde auch Channing verwandelt. Binnen weniger Tage ist er vom absoluten Langweiler zum Anführer einer ganzen Kriegerschaft guter Vampire, die ihren bösartigen Artgenossen den Kampf angesagt haben.
So beginnt das erste Abenteuer einer neuen Vampir-Reihe aus der Feder der Autorin Andrea Wölk: «Infinitas – Krieger des Glaubens», erschienen im Oldigor-Verlag, dem Selbstverlag der Autorin. Damit widmet A. Wölk ihr neuestes buch einer zur Zeit sehr angesagten Thematik, nämlich dem Vampirismus, der seit dem Erscheinen von «Bis(s)» gerade auch in Deutschland seine Kreise zieht. In einem lockeren Schreibstil versucht sie dabei junge Erwachsene in ihren Bann zu ziehen, und mit einfachen, kurzen Sätzen, gepaart mit «moderner» Wortwahl passt sich die Autorin diesem Literatur-Trend der Zeit an.
Leider ist ein angenehmer, flüssiger Stil für den Erfolg eines Fantasy-Romans noch längst keine Garantie: Spannung und/oder Humor, einprägsame Protagonisten, fantastische Wesen sollten in einer Geschichte schon vereint werden. Und genau dort sitzt das größte Problem von Andrea Wölk: Sie erschafft Protagonisten, deren emotionale Lage an vielen Stellen nicht nachvollziehbar bzw. realistisch erscheint.

Ein gelungener Vampir-Roman sollte den Leser entweder durch seine humorvollen Ansätze oder dann durch mitreißende Action-Szenen überzeugen; diesbezüglich hebt sich «Infinitas – Krieger des Glaubens» von Andrea Wölk leider durch nichts von der breiten Masse positiv ab.
Trotzdem erweckt sie ihre Figuren oft auf durchaus angenehme Art und Weise zum Leben. Dieses ist aber auch das Einzige, das hier inhaltlich ins Gewicht fällt. Denn Action und Kämpfe, die in der Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse vorkommen, werden in «Krieger des Glaubens» eher flach und unspektakulär beschrieben; Spannung kommt nur an der Oberfläche vor. Eine tiefergehende und anhaltende Spannung, die den Leser in ihren Bann zieht, ihn dem Ende entgegen fiebern lässt, fehlt gänzlich. Stattdessen widmet Andrea Wölk ihre Aufmerksamkeit vor allem dem ausschweifenden Sex-Leben ihrer Hauptfiguren; In fast jedem Kapitel kommt mindestens ein «Quickie» vor, wobei in teils eher vulgären Worten der Akt angedeutet wird – womit das Buch nicht zuletzt die Jugendlichen vergrault, die sich für diese Reihe interessieren könnten. Erotik gehört zwar in viele Romane, sollte aber in einem guten Verhältnis eingebunden werden.
Kenner der berühmten Vampir-Storys – beispielsweise «Bis(s) der Tod euch scheidet» von M. J. Davidson oder «Bis(s) zum Abendrot» von S. Meyer – werden den ersten Teil lesen und kaum Freude daran finden: ein gelungener Vampir-Roman sollte den Leser entweder durch seine humorvollen Ansätze oder dann durch mitreißende Action-Szenen überzeugen; diesbezüglich hebt sich «Infinitas – Krieger des Glaubens» durch nichts von der breiten Masse positiv ab. Ob sich also die neue Vampir-Reihe im Oldigor Verlag, dem Selbstverlag der Autorin, wirklich durchzusetzen vermag, ist sehr zu bezweifeln… ▀
Andrea Wölk, Infinitas – Krieger des Glaubens, Roman, 300 Seiten, Oldigor Verlag, ISBN 978-3981426700
.
______________________________
Geb. 1973 in Neumünster, literarisch vielseitig interessiert, berufliche Tätigkeit in der Gastronomie, Homepage
.
.
.
.
.
.
.






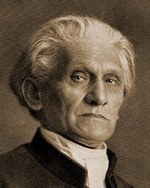
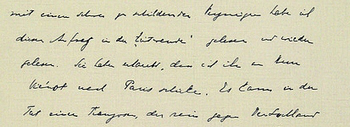
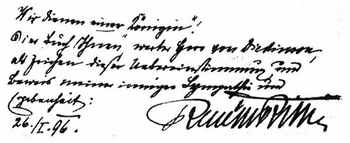




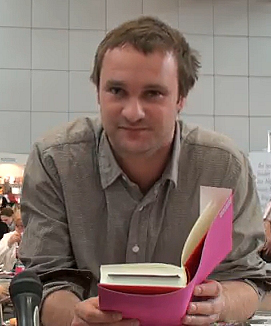

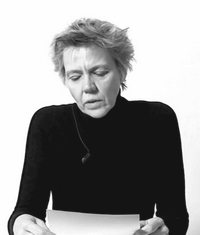









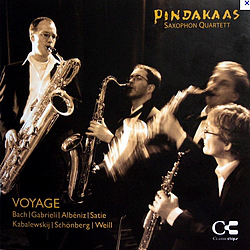
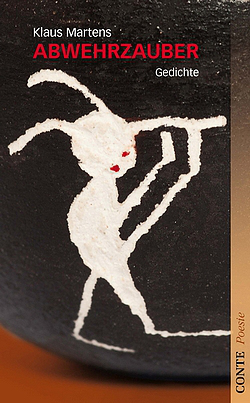
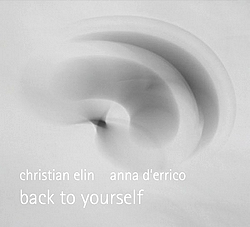
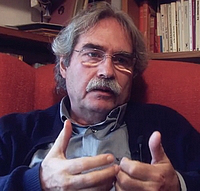
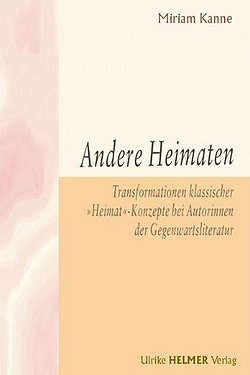














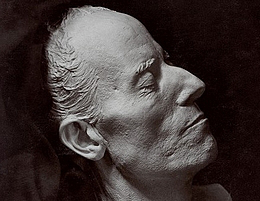

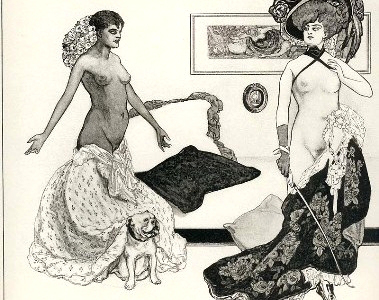









leave a comment