Arthur van de Oudeweetering: «Mustererkennung im Mittelspiel» (Schach)
.
Hervorragende Verdeutlichung
strategischer Zusammenhänge
Thomas Binder
.
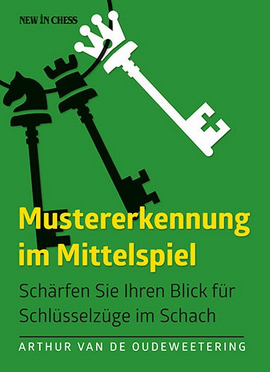 Mit «Mustererkennung im Mittelspiel» liegt nunmehr die deutsche Übersetzung von «Improve your chess pattern recognition» von Arthur van de Oudeweetering vor. Der knapp 50jährige Holländer dürfte als Schachspieler nur Insidern ein Begriff sein. Die FIDE führt ihn zurzeit als Internationalen Meister mit einer Elo-Zahl knapp unter 2300. Sein schachlicher Schwerpunkt liegt indes in der Arbeit als Trainer und Kolumnist. Von beiden Präferenzen können wir als Leser seines aktuellen Werkes profitieren!
Mit «Mustererkennung im Mittelspiel» liegt nunmehr die deutsche Übersetzung von «Improve your chess pattern recognition» von Arthur van de Oudeweetering vor. Der knapp 50jährige Holländer dürfte als Schachspieler nur Insidern ein Begriff sein. Die FIDE führt ihn zurzeit als Internationalen Meister mit einer Elo-Zahl knapp unter 2300. Sein schachlicher Schwerpunkt liegt indes in der Arbeit als Trainer und Kolumnist. Von beiden Präferenzen können wir als Leser seines aktuellen Werkes profitieren!
Erfahrene Trainer werden die These bestätigen, dass Erfolg im Schachspiel zu einem großen Teil an das Erkennen typischer Stellungsmuster und das Umsetzen der passenden Manöver gebunden ist. Sind diese Aspekte bei rein taktischen Stellungen sowie im Endspiel seit langem gut erforscht und auch trainingsmethodisch aufgearbeitet, halten komplexe Stellungen mit vorwiegend strategischem Gehalt noch viel Arbeit bereit. In letzter Zeit sind hierzu einige wichtige Bücher erschienen, so Bronzniks «Techniken des Positionsspiels im Schach» und Nunns «Das Verständnis des Mittelspiels im Schach». Einen etwas anderen Zugang – über die Bauernstrukturen – wählt Flores Rios in «Chess Structures». Das vorliegende Buch ergänzt und bereichert diese Palette wesentlich.
Oudeweetering hat sein Buch in 4 größere Abschnitte mit insgesamt 40 Kapiteln gegliedert. Jedes einzelne bespricht eine typische Stellungskonstellation ausführlich in allen Aspekten.
Im 1. Teil geht es um «Figuren auf typischen Posten». Da kommen alte Bekannte vor, wie Springer auf f5 oder d6 (im Buch «Der Riesenkrake» genannt), Läufer auf langen Diagonalen oder eingesperrt auf h2, wie seinerzeit bei Spasski gegen Fischer.
Der 2. Teil widmet sich «kontraintuitiven Zügen». Dabei erliegt der Autor nicht der Versuchung, spektakuläre Wendungen vorzuführen, sondern bleibt auch hier seriös – fast wissenschaftlich. So lernen wir, unter welchen Umständen z.B. überraschende Rückzüge, Doppelbauern oder Bauernschläge «zum Rand» ihre Stärke ausspielen können.
Teil 3 ist typischen Opferwendungen gewidmet – aber eben nicht jenen, die man aus Taktikbüchern kennt und an deren Ende ein Matt oder Materialgewinn stehen. Hier geht es um positionelle Opfer mit Langfristwirkung. Aus dieser Materie die Gesetzmäßigkeiten heraus zu arbeiten und verständlich zu analysieren, ist für ihren Rezensenten die größte Stärke des ganzen Buches gewesen. Als Beispiel sei der Bauern-Vorstoß e5-e6 genannt. Mit dem Bauernopfer und dem verbleibenden Doppelbauern teilt Weiß die gegnerischen Kräfte in zwei Hälften, zwischen denen zumindest kurzfristig keine Koordination besteht.
Der 4. Teil schließlich betrachtet kurzzügige Manöver mit strategischem Gehalt, die zum Teil so konzentriert auch noch nicht vorgestellt wurden, etwa die Turmverdoppelung auf dem Umweg über die 2. Reihe.

Der internationale Meister und Schach-Autor Arthur van de Oudeweetering (*1966)
Jedes einzelne Kapitel beginnt mit einem ganz kurzen Einführungstext und endet mit einer ebenso knappen Zusammenfassung. In diesem Rahmen folgen dann pro Kapitel 6 bis 7 sorgfältig ausgewählte Partien. Der niederländische IM konzentriert sich dezidiert auf das jeweils besprochene Thema. Die Eröffnung wird entweder ganz ausgelassen oder unkommentiert wiedergegeben – was auf das gleiche hinausläuft, denn ein Diagramm ermöglicht in jedem Fall den Einstieg an der passenden Stelle. So konsequent ist der Autor auch am anderen Ende der Partie: Mündet das betreffende Motiv nicht direkt in den Partieschluss, wird der weitere Verlauf nur noch in Worten angedeutet.
Der relevante Ausschnitt hingegen wird in kurzen, gut gefassten Anmerkungen treffend erläutert. Abweichende Varianten sind auf das unbedingt erforderliche Maß beschränkt. Die Kommentare fokussieren sehr gut auf das konkret besprochene Thema. Sie sind zudem angenehm lesbar – vermutlich gleichermaßen das Verdienst des Autors und des Übersetzers Harald Keilhack.
Schachliche Schwächen sind aus Sicht des Rezensenten nicht auszumachen. Die inhaltliche und didaktische Aufbereitung setzen Maßstäbe. Ich sehe nur wenige Verbesserungsansätze: Die Kapitelüberschriften könnten manchmal etwas weniger blumig formuliert sein. Sie machen zwar neugierig, helfen aber nicht bei der Orientierung. Außerdem wäre ein zusätzlicher Mehrwert zu erreichen, wenn man die schon im Titel angesprochenen Muster auch optisch auf den Diagrammen hervorhebt. Dieses Element – heute in der computergestützten Schachpräsentation eine Selbstverständlichkeit – ist in der gedruckten Schachliteratur noch nicht so recht angekommen. Generell kämpft ja gerade bei solch komplexen Themen das Schachbuch einen scheinbar aussichtslosen Kampf gegen moderne Trainingsmittel und interaktive Medien. Bücher wie dieses zeigen, wie schade es wäre, wenn dieser Kampf auf Dauer verloren ginge.

Arthur van de Oudeweetering legt mit «Mustererkennung im Mittelspiel» ein vorzügliches Buch zu einem komplizierten Thema vor. Es gelingt ihm, dem Leser das Erkennen und Bewerten typischer Mittelspielstellungen nahe zu bringen. Neben fortgeschrittenen Schachspielern dürften vor allem Schachtrainer sehr von dieser Arbeit profitieren.
Fragen wir uns schließlich nach der Zielgruppe, die van de Oudeweetering mit seinem Buch erreicht. Mir fallen zuerst Schachtrainer ein. Sie finden hervorragende Ideen zur Verdeutlichung strategischer Zusammenhänge und zum Schulen des Blickes für typische Stellungsmuster – und das mit überlegt zusammengestellten Beispielpartien.
Wer als Spieler von diesem Werk profitieren möchte, wird sich auf eine anstrengende Arbeit einlassen müssen. Es geht eben nicht ohne konzentriertes Durcharbeiten der einzelnen Beispiele. Immerhin erleichtert die Aufteilung in übersichtliche Kapitel auch dieses Unterfangen. Freilich setzt das selbständige Arbeiten mit dem Buch ein schachliches Grundniveau voraus, das ich nicht unter einer Elo-Spielstärke von 1800 ansetzen würde – aufstrebende Jugendspieler einmal ausgenommen, denen «Mustererkennung im Mittelspiel» hiermit ausdrücklich empfohlen sei. ■
Arthur van de Oudeweetering: Mustererkennung im Mittelspiel – Schärfen Sie Ihren Blick für Schlüsselzüge im Schach, 300 Seiten, New in Chess, ISBN 978-90-5691-615-2
.
.
Weitere Schach-Rezensionen im Glarean Magazin
.
.
.
Interview mit dem Schach-Autor J. Carlstedt («Die kleine Schachschule»)
.
Jonathan Carlstedt: «Die kleine Schachschule»
Thomas Binder
.
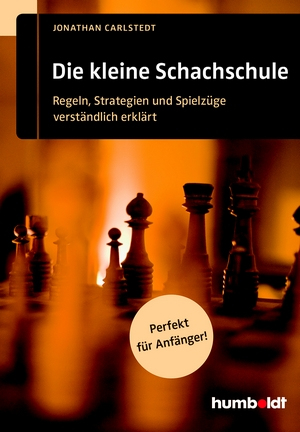 Der junge Hamburger Bundesliga-Spieler Jonathan Carlstedt gehört seit kurzer Zeit zu den Exponenten der Deutschen Schachszene. Neben dem eigenen Spiel arbeitet er als Geschäftsführer der Schachschule Hamburg, schreibt als Journalist und Online-Autor für verschiedene Medien und hat seit 2010 bereits mehrere Bücher vorgelegt. Dabei wendet er sich an die ganze Breite des Schachpublikums. Sind die Eröffnungsbücher sicher dem Experten vorbehalten, galten die beiden Werke unter dem Obertitel «Die große Schachschule» dem engagierten Turnier- und Vereinsspieler. Mit der «Kleinen Schachschule» wird das Spektrum der Zielgruppen nun gewissermaßen «nach unten» abgerundet, verkündet doch schon die Titelseite «Perfekt für Anfänger!»
Der junge Hamburger Bundesliga-Spieler Jonathan Carlstedt gehört seit kurzer Zeit zu den Exponenten der Deutschen Schachszene. Neben dem eigenen Spiel arbeitet er als Geschäftsführer der Schachschule Hamburg, schreibt als Journalist und Online-Autor für verschiedene Medien und hat seit 2010 bereits mehrere Bücher vorgelegt. Dabei wendet er sich an die ganze Breite des Schachpublikums. Sind die Eröffnungsbücher sicher dem Experten vorbehalten, galten die beiden Werke unter dem Obertitel «Die große Schachschule» dem engagierten Turnier- und Vereinsspieler. Mit der «Kleinen Schachschule» wird das Spektrum der Zielgruppen nun gewissermaßen «nach unten» abgerundet, verkündet doch schon die Titelseite «Perfekt für Anfänger!»
Carlstedts Werk reiht sich in die Tradition klassischer Schach-Lehrbücher für «Jedermann», wie sie seit mehr als 100 Jahren einen Urtyp der Schachliteratur darstellen. Kann man dieses Genre noch mit neuen Ideen bereichern?
Blicken wir zunächst auf die grobe Gliederung des Werkes: Wir haben vier wesentliche Abschnitte vor uns:
– Die Grundbegriffe und Regeln des Schachspiels werden auf ca. 40 Seiten erklärt
– Es folgen knapp 70 Seiten über Eröffnungen
– Das Mittelspiel wird auf ca. 60 Seiten abgehandelt
– Mit gut 40 Seiten ist das Endspielkapitel eher knapp bemessen
– Den Abschluss des Buches bildet ein kurzer Essay «Die Welt der Schachszene», (dem der Rezensent gerne etwas mehr Umfang und Tiefgang gewünscht hätte).
Das einführende Kapitel vermittelt das regeltechnische Rüstzeug jeder Schachpartie, leider noch nicht auf dem Stand der 2014 geänderten FIDE-Regeln (bei Stellungswiederholung und 50-Züge-Regel).
In den folgenden Hauptkapiteln hat es sich Carlstedt zur Aufgabe gemacht, dem «Anfänger» deutlich mehr zu vermitteln, als es vergleichbare Bücher tun. Exemplarisch dafür ist das Eröffnungskapitel. Nach Vermittlung der Grundstrategien (Figurenentwicklung, Königssicherheit) führt der Autor den Leser in einige wichtige Eröffnungssysteme ein. Dabei findet Jonathan Carlstedt das für einen Spieler auf Anfänger-Niveau passende Maß zum Verständnis der vorgestellten Eröffnungen. Bei jedem Zug wird dargestellt, inwiefern er seinen Beitrag zu den Grundzielen des Eröffnungsspiels leistet. Streiten könnte man allenfalls über das Mengenverhältnis (acht Seiten Königsgambit vs. fünf Seiten Sizilianisch) und über die Auswahl der Systeme. So fehlen etwa mit der Pirc-Verteidigung oder Russisch auch Eröffnungen, die einem Anfänger sehr wahrscheinlich recht bald begegnen werden.
Als ein Juwel unter vielen möchte ich hervorheben, wie der Autor die «fried liver attack» des Zweispringerspiels (freilich ohne sie beim Namen zu nennen) behandelt. Ich selbst habe schon viele Schach-Eleven ob der doppelten Bedrohung des Punktes f7 regelrecht verzweifeln sehen. Schade nur, dass in diesem Buch der betreffende Text im Abschnitt «Italienische Partie» versteckt ist.
Unter dem Oberbegriff «Mittelspiel» führt Carlstedt in die wichtigsten taktischen Manöver und strategischen Motive ein. Der Leser lernt Fesselungen, Gabeln, Spieße, Abzüge ebenso kennen wie grundlegendes Wissen über Bauernstrukturen und -schwächen. Auch die Eigenheiten der einzelnen Figuren und die Konsequenzen für ihren optimalen Einsatz werden besprochen. Ein (zu) kurzer Abschnitt über den Königsangriff beschließt das Mittelspiel-Kapitel.
Bei den Endspielen widmet Carlstedt den verschiedenen Aspekten der Bauernumwandlung (Opposition, Randbauer, Quadratregel) breiten Raum. Es folgen einige wichtige Stellungen zum Endspiel «Turm&Bauer gegen Turm». Das ist sicher eines der anspruchsvollsten Kapitel des Buches, und Jonathan Carlstedt präsentiert es so gekonnt, dass auch der «Anfänger» jederzeit folgen kann. Überraschend: Erst danach geht er auf die elementaren Matts mit den Schwerfiguren ein. Insgesamt hätte man dem Endspiel-Kapitel sogar etwas mehr Umfang gewünscht. Da bleiben einige Themen offen, die man auch der Zielgruppe dieses Buches zumuten kann. Andererseits wäre selbst ein Anfänger-Lehrbuch der Schach-Endspiele gut und gerne so stark wie die ganze vorliegende «Kleine Schachlehre» – so bietet sich das vielleicht für ein Nachfolgeprojekt an.
Das Buch im handlichen Taschenbuchformat ist auf hochwertigem Papier produziert und sorgfältig redigiert. Der Sprachstil des jungen Autors macht Freude, seine bereits enorme Erfahrung als Trainer ist auf jeder Seite zu verspüren.
Circa 200 Stellungsbilder unterstützen in perfekter Weise das Verständnis. Diese Diagramme wurden offenbar mit Chessbase-Software erstellt. Dabei nutzt Carlstedt die Möglichkeit der Verdeutlichung von Ideen und Plänen mit farbigen Pfeilen und Feldmarkierungen. Allerdings geht die visuelle Aussagekraft dieses Gestaltungsmittels beim Schwarz-Weiß-Druck fast völlig verloren und in einigen Fällen ist die Erkennbarkeit gerade dadurch sogar eingeschränkt.

Jonathan Carlstedt legt ein modernes «Anfänger-Lehrbuch» vor. Ansprechende Gestaltung und frischer Schreibstil tragen zum Erfolg des Werkes bei.
Bleibt die Frage, an welche Zielgruppe sich das Buch richtet. Carlstedt ist insofern konsequent, dass er keine spezielle Zielgruppe anspricht. Insbesondere fehlen jegliche spielerischen Elemente, wie man sie aus Kinder-Schach-Lehrbüchern kennt. Die Ansprache des Lesers orientiert sich am erwachsenen, allenfalls jugendlichen Schachschüler. So ist die Zielgruppe wohl nicht an Altersgruppen festzumachen, sondern am Einsteiger, der sich auf das anstrengende aber wunderbare Abenteuer einlassen will, das Schachspiel «von der Pike auf» zu erlernen. Wer das vorliegende Buch konzentriert durcharbeitet und das Gelernte umsetzt, wird schon nach wenigen eigenen Partien die ersten Früchte der Arbeit ernten.
Carlstedt schreibt im Vorwort: «Bücher schreiben macht Spaß». Wenn der Leser diesen Spaß des Autors nachempfindet, ist das Werk gelungen. Ich habe ihn nachempfunden! ■
Jonathan Carlstedt: Die kleine Schachschule – Regeln, Strategien und Spielzüge verständlich erklärt, Humboldt Verlag, 224 Seiten, ISBN 978-3-86910-209-2
.
.
.
.
Interview mit dem Schach-Autor Jonathan Carlstedt
«Der Schach-Sport ist – richtig verpackt – sehr kommunikativ»
.
Glarean Magazin: Herr Carlstedt, stellen Sie sich zunächst unserer Leserschaft kurz vor?
Jonathan Carlstedt: Ich bin 24 Jahre alt. Nachdem ich 2010 mein Abitur in Hamburg gemacht habe, begann ich selbstständig als Schachspieler/-Trainer/-Autor/-Journalist zu arbeiten. Inzwischen bin ich Internationaler Meister, trainiere ca. 25 Schüler, schreibe für den Deutschen Schachbund, bin Geschäftsführer des Hamburger Schachklubs und der Schachschule Hamburg, Organisator des VMCG-Schachfestivals und selber als Spieler auf diversen Turnieren und in der ersten Bundesliga aktiv. Außerdem verfasse ich regelmäßig Schachbücher und -Artikel.
GM: Was läuft in Deutschland bei der öffentlichen Darstellung des Schachs als Wettkampfsport falsch? Was kann/muss man besser machen um das Image des Schachsports aufzupolieren?
JC: Vermutlich muss man hier differenzieren. Wir haben zum einen die externen Umstände, bis zu einem gewissen Punkt passt Schach nicht in unsere Zeit. Schach ist ein stiller Sport, in dem nicht derjenige recht hat, der am lautesten schreit, sondern derjenige, der die besten schachlichen Argumente hat. Meine sehr und ganz persönliche Meinung ist, dass dieser Ansatz in unser Gesellschaft, die Kraft des Arguments über der Kraft der Lautstärke, immer weniger eine Rolle spielt und Schach als dessen Vertreter geringere Chancen als andere Sportarten hat, akzeptiert zu werden.
Gerade bin ich in Dresden, hier spielen 10 der stärksten Frauen des Landes ein Turnier mit einem Preisfond von 10’000 Euro in äußerst professioneller Atmosphäre. Nun ist die Frage: Wie können wir das Interesse der Medien und damit der Öffentlichkeit gewinnen. Anscheinend ist es möglich, das für einen Schach-WM-Kampf zu schaffen. «SPIEGEL Online» und «Zeit online» berichten ausführlich mit großartiger Berichterstattung. Um eine regelmäßige Darstellung wie andere «Mainstream»-Sportarten zu erreichen, müssen wir in gemeinsamer und vor allem koordinierter (etwas was gelegentlich fehlt) Anstrengung versuchen, ein Grundverständnis für unser Spiel bei der breiten Masse zu erzeugen. Dann haben wir die Chance, auch in der öffentlichen Wahrnehmung häufiger eine Rolle zu spielen.
Aber was ist das Image des Schachsport? Freaks ohne Anschluss? Sportart für Super-Intelligente? Schul-AG für Außenseiter? Wenn dem so ist, dann müssen wir etwas tun! Das geht nicht von heute auf morgen, denn die Diskussion wurde in der Schachszene bisher nicht geführt, ob wir nicht gut daran tun, eine Randsportart zu sein. Meine Meinung dazu ist klar: Unser Sport ist interessant, richtig verpackt sehr kommunikativ, und wenn Sie sich heute die Topspieler anschauen, haben wir intelligente, durchtrainierte Leistungssportler, die sich verkaufen können. Mit hochwertiger und beständiger Öffentlichkeitsarbeit können wir ins Bewusstsein der Bevölkerung treten. Konkret und kurzfristig müssen wir freundlicher zu Einsteigern werden, denn in den Vereinen ist das Bild in der Tat teilweise schmuddelig. Auch wenn ich vermutlich einige böse Mails bekommen werde, müssen frische Klamotten, Deo, gepflegtes Auftreten und Genuss von Alkohol nur zur späten Stunde ungeschriebenes Gesetz im Verein werden.
Zusammenfassend also: Wir sind unseres Glückes Schmied, konstante Öffentlichkeitsarbeit, die bereits geleistet wird, zusammen mit einem gemeinsamen Bewusstsein für deren Wichtigkeit sind die beiden Eckpfeiler uns in der breiten Öffentlichkeit zu etablieren.
GM: Sie sind Geschäftsführer der Schachschule Hamburg. Sie haben jetzt Gelegenheit ein wenig Werbung für dieses Projekt zu machen :-)
JC: Die Schachschule Hamburg bietet Schachinteressierten jeden Alters und jeder Spielstärke vom Anfänger bis zum Bundesligaspieler «offline»-Trainingsmöglichkeiten (wie man das glaube ich neudeutsch nennt) an. Dabei versuchen wir uns nach den Bedürfnissen und Wünschen der jeweiligen Interessenten zu richten und haben unser Trainingsangebot entsprechend breit aufgestellt. Jeder der also irgendwie an Schach interessiert ist, ist bei uns genau richtig! :-)
GM: Professionelle Schachschulen mit kommerzieller Ausrichtung scheinen sich in Deutschland wachsender Beliebtheit zu erfreuen. Wie schätzen Sie auf lange Sicht den Markt für solche Projekte ein? Wie sehen Sie diese Schulen im Spannungsfeld der «klassischen» Ausbildungswege junger Schachspieler wie Schulschach-AGs, Schachvereine und ggf. das Training der Verbandskader und schließlich den vielen neuen Spiel- und Trainingsansätzen im Internet?
JC: Die Schachschule Hamburg ist aus dem Hamburger Schachklub, dem größten Schachverein Deutschlands, entstanden und ein Teil dieses Schachklubs. Zwar verstehen wir uns als Unternehmen, müssen und wollen aber auch den Ideen eines gemeinnützigen Vereins wie dem Hamburger Schachklub genügen.
Der Markt für Schachschulen ist aus meiner Sicht sehr groß. Wir haben in Deutschland 90’000 eingetragene Schachspieler, davon alleine können Schachschulen nicht leben. Die Zahl derjenigen, die im Kindesalter oder wann auch immer die Grundregeln kennengelernt haben und grundsätzlich Interesse am Schachspiel bzw. -sport haben, ist ungleich größer. Wenn sich die «Schachszene» weiterhin diesen Umstand bewusst macht, ist der Markt noch lange nicht gesättigt. Übrigens eine Tendenz, die ich aus meiner selbstständigen Arbeit als Trainer untermauern kann. Allein in den vergangenen zwei Monaten musste ich sieben Anfragen von Schülern ablehnen, da ich keine Zeitkapazitäten mehr habe.
Für uns ist Schachschule und Schulschach kein Spannungsfeld, sondern die Grundlage für unsere Existenz. Unheimlich viele engagierte Trainer leisten an Schulen ehrenamtliche Arbeit, die die Basis dafür ist, dass Menschen wie ich und Institutionen wie die Schachschule wirtschaftlich arbeiten können. Ohne den Unterbau der dort geschaffen wird, kann es weiter in der Spitze bzw. für die Spitze keine Zukunft geben.
Auch das Internet ist, denke ich, förderlich für den Schachsport. Auf jeden Fall müssen wir uns nicht davor fürchten. Jene die ohnehin lieber in ihren eigen vier Wänden bleiben, haben das auch schon vor dem Aufkommen des Internets getan. Der Vorteil des Internets, aus Schachspieler-Sicht, ist, dass man schneller und unkomplizierter mit dem Schachsport in Berührung kommt. Unsere Aufgabe ist es, all jenen, die über das Internet zum Schachsport gekommen sind, Angebote zu unterbreiten, in den Verein zu kommen. Denn seien wir ehrlich: Bei einem Bierchen oder für Kinder und Jugendliche einer Cola in der realen Welt eine Partie Schach zu spielen, entspricht deutlich eher den menschlichen Bedürfnissen, als im eigenen Kämmerlein gegen anonyme Gegner zu spielen. Und auch wenn es einige nicht glauben, die meisten Schachspieler sind sogar extrem in Ordnung.
GM: Sie bieten auch Anfänger-Kurse für Erwachsene und Kurse für Senioren an. Wie werden diese Angebote angenommen?
JC: Im Grundsatz sind wir mit dem Zuwachs an Interessenten zufrieden. Trotzdem muss man einen Unterschied machen zwischen Erwachsenen, die im Berufsleben stehen und Senioren. So laufen die Seniorenkurse, die wir wöchentlich beispielsweise von 10 bis 12 Uhr anbieten, hervorragend. Berufstätige nach der Arbeit noch von 19 bis 21 Uhr für ein Schachtraining zu begeistern ist, wenn auch nicht unmöglich, doch schwierig. Deshalb gehen wir hier einen zweiten Weg: Wir bieten sogenannte Kompaktkurse an, Kurse also, die an einem Samstag gehalten werden und weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Kurse sehr gut geeignet sind, damit man seinen Partner mitnimmt, um anschließend gut gerüstet zu sein bei einem abendlichen Glas Rotwein auf dem Balkon eine Partie Schach zu spielen. Es ist nicht unser Ziel, jeden zu einem Großmeister zu machen.
Dieses Angebot wollen wir ausbauen, mit Eltern/Kind-Kursen und Trainings, die nicht bei uns, sondern in den Schulen vor Ort stattfinden. Wir haben hier noch einen weiten Weg zu gehen, sind aber überzeugt, dass dies der Richtige ist.
GM: Zu Ihrem neuesten Buch, der «Kleinen Schachschule». Zunächst war ich etwas verwirrt, nach zwei Büchern unter dem Label «Große Schachschule» jetzt auf die «Kleine Schachschule» zu treffen. Können Sie uns Ihre bisherigen Buchprojekte vorstellen und einen Blick auf die nächsten Pläne werfen?
JC: Da muss ich etwas weiter ausholen, aber da ich bisher schon ellenlang geantwortet habe, mögen mir die Leser das verzeihen :-)
Mein erstes Buch schrieb ich im zarten Alter von 19 Jahren, zeitgleich zur Lernphase meines Abiturs. «Die Englische Eröffnung» war der Titel und behandelt eine Schacheröffnung, die ich seit ich denken kann, spiele. Im Anschluss folgte «Die große Schachschule» Damals hatte ich eine Schachschule in Lüneburg und ich habe große Teile des Lehrplans meiner Schachschule in dieses Buch integriert, es folgte ein weiteres Eröffnungsbuch «Die Tarrasch-Verteidigung», ein Buch das aus meiner Sicht für die «Eingeweihten» eine Menge interessante neue Ideen beinhaltet. Anschließend schrieb ich «Die große Schachschule: Aus den Fehlern der Großmeister lernen». Hier habe ich 25 Partien analysiert, an vielen war ich selber beteiligt, wo eine Seite, vertreten durch einen Profispieler, einen schweren Fehler begeht. Mein Versuch war es, und ich hoffe er ist mir gelungen, diesen Fehlern auf den Grund zu gehen und «en passant» weniger erfahrenen Schachfreunden einen Einblick in die Schachszene zu geben.
Zu guter Letzt also «Die kleine Schachschule», auf die ich ebenfalls sehr stolz bin. Einerseits ist sie inhaltlich aus meiner Sicht gut geworden, außerdem hat mal wieder der Verlag hervorragende Arbeit geleistet, was Layout etc. angeht.
Zukünftige Projekte… Mein Plan war eigentlich weniger zu arbeiten :-) Derzeit gibt es einige Angebote Bücher zu schreiben. Meine Idee ist allerdings, einfach eins zu schreiben, ohne dass jemand davon weiß und es dann einem Verlag anzudrehen. Ich habe immer noch die sehr romantische Vorstellung mich einmal in ein Haus auf einer fernen Insel einzuschließen, dort zwei Monate an einem Buch zu schreiben, ohne von außen gestört zu werden. Vielleicht kennen Sie ja einen Verlag mit einem Haus auf einer karibischen Insel? ;-)
GM: Die «Kleine Schachschule» ist vom Typ her sicher mit klassischen Schachlehrbüchern zu vergleichen. Schach-Einführungen für Anfänger gibt es seit mehr als 100 Jahren. Sie erklären elementar die Regeln und geben kurze Abrisse zu Taktik-Motiven, strategischen Prinzipien, zur Eröffnungstheorie und Endspiellehre. Welche neuen Ideen haben Sie für diesen Lehrbuch-Typ eingebracht?
JC: In der «Kleinen Schachschule» geht es darum, kurz und bündig Interessenten am Schach unser Spiel näher zu bringen und ohne großes Hin und Her die Grundlagen zu bieten, um einfach mal eine Partie Schach zu spielen.
Meine neue Idee in dem Buch ist, früher auf grundlegende Strategien in den 3 Phasen Eröffnung Mittelspiel, Endspiel einzugehen. Meine Erfahrung aus den vielen Trainings und Lehrgängen mit Anfängern ist, dass man die Leute durchaus fordern kann und das Interesse am Schach auch und vor allem in den Strategien begründet ist. ■
.
.
.
.
Gerhard Josten: «Auf der Seidenstraße zur Quelle des Schachs»
.
Bereicherung des Diskurses über den Schach-Ursprung
Thomas Binder
.
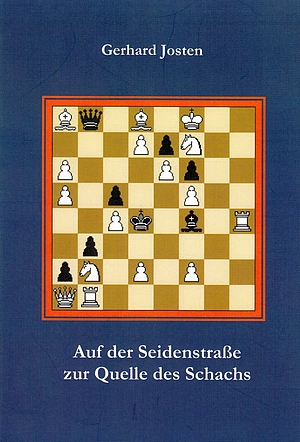 Die Frage nach dem Ursprung des königlichen Spiels gehört zu den ungelösten Problemen der Kulturgeschichte. Als sicher kann gelten, dass das Schachspiel aus südöstlicher Richtung zu uns gelangt ist. Alle weiteren Details bleiben bisher – und werden es möglicherweise immer bleiben – im Reiche der Mythen verborgen.
Die Frage nach dem Ursprung des königlichen Spiels gehört zu den ungelösten Problemen der Kulturgeschichte. Als sicher kann gelten, dass das Schachspiel aus südöstlicher Richtung zu uns gelangt ist. Alle weiteren Details bleiben bisher – und werden es möglicherweise immer bleiben – im Reiche der Mythen verborgen.
Gemeinhin wird der Ursprungsort in einem riesigen Gebiet vermutet, das mit «China, Indien oder Persien» zu umschreiben wäre. Oft wird sogar versucht, einen einzelnen Schöpfer des Spiels zu benennen. Selbst die berühmte Weizenkornlegende reiht sich in diese Überlegungen ein, ist doch die von Feld zu Feld verdoppelte Füllung des Schachbretts mit Weizenkörnern der Lohn für den «Erfinder des Schachspiels».
Zu den Forschern, die sich in jüngerer Zeit auf die Suche nach den Quellen des Schachs gemacht haben, zählt die Initiativgruppe Königstein. Von 1991 bis 2005 trafen sich namhafte internationale Schachhistoriker zu acht Konferenzen. Letztlich konnten auch sie keine schlüssige Antwort auf die eingangs gestellte Frage finden. Auf der Homepage http://www.schachquellen.de ist ihr Vermächtnis dokumentiert.
Eines der Mitglieder dieser Gruppe ist auch der deutsche Schachhistoriker, -komponist und -schriftsteller Gerhard Josten. Er legt nunmehr in Buchform seine Erkenntnisse und Schlussfolgerungen zum Thema vor.
In den Mittelpunkt der Überlegungen stellt er dabei die Seidenstraße – einen Oberbegriff für die Handelsrouten entlang derer schon um die Zeitenwende der Kontakt zwischen Europa und (Ost-)Asien seinen Anfang nahm. Dabei wurden nicht nur Handelsgüter ausgetauscht, sondern auch Wissen, Ideen, Techniken – sicher aber auch Geschichten, Kunst, Überzeugungen – und ganz gewiss auch Spiele und Spielideen.
In einem seiner einführenden Kapitel führt uns Josten in jene Zeit und räumt mit manchen falschen Vorstellungen über die Seidenstraße auf. So musste man keinesfalls den ganzen Weg vom Mittelmeer nach China auf sich nehmen, um von den Segnungen dieser Route zu profitieren. Vielmehr wurden Güter und Ideen über viele Zwischenstationen unter den Völkern weitergereicht, dabei immer wieder verändert und bereichert.
Den letztgenannten Prozess beschreibt Gerhard Josten nun für das Schachspiel, indem er verschiedene (Brett-)spiele ins Feld führt, die in den Ländern entlang der Seidenstraße und in deren weiterem Einflussgebiet verbreitet waren. Er wägt ab, welche Elemente dabei jeweils in das Schachspiel eingeflossen sind, wie sie sich zu einem Spiel vereinigten und ergänzten, das letztlich als Urform des Schachs angesehen werden kann. Hierfür verwendet er an zentraler Stelle und durchaus schlüssig den aus der Philosophie und Religionswissenschaft bekannten Begriff des Synkretismus.
Den Ort, an dem das Schachspiel entstanden sein könnte, bestimmt Josten im Kushanreich, welches innerhalb der Seidenstraße eine solch zentrale Position einnimmt, dass es sich als Schmelztiegel der Kulturen und ihrer Spiele offenbar anbietet.
Hat der Autor damit die Frage nach dem Ursprung des Schachs gelöst? Sicher nicht! Er bereichert aber den Diskurs um eine interessante Hypothese, die über den genannten Entstehungsort hinaus verschiedene neue Ideen einbringt. Ob sie dem Anspruch strenger Wissenschaft standhält, mag Ihr Rezensent nicht beurteilen. Das ist aber auch sekundär, solange keine eindeutig schlüssigeren Erklärungsansätze bekannt sind.
Die von Josten vorgelegte Arbeit ist eine in sich geschlossene Theorie – nicht besser und nicht schlechter als andere. Das Verdienst des Autors besteht darin, seine Ideen in eine auch dem Laien zugängliche Form gebracht und unsere Sinne für das nach wie vor ungelöste Problem geschärft zu haben.
Ob man seinen Gedankengängen in jedem Falle folgen möchte, bleibt dem Leser überlassen. An manchen Stellen konnte ich dies jedenfalls nicht bis ins letzte Detail tun – so als er zu einem unvollständig(!) gefundenen Satz von mehr als 4’000 Jahre alten Spielsteinen eine mögliche Anordnung auf einem 8×8-Brett ableitet, die natürlich der des heutigen Schachs sehr ähnlich ist.

Gerhard Josten bereichert mit seiner neuen Monographie die Forschung zum Ursprung des Schachs um eine interessante Hypothese. Seine Ideen werden schlüssig und gut lesbar vorgetragen, dabei passend illustriert. Die Kaufempfehlung für einschlägig interessierte Leser wird (trotz des recht hohen Preises) gerne ausgesprochen.
Jostens Buch ist angenehm lesbar geschrieben. Hier kommt ihm sein für einen Sachbuchautor überdurchschnittliches Schreibtalent zu Gute, welches ja schon in Romanen erprobt ist. Die Darstellung ist reich und zweckmäßig illustriert, überwiegend mit archäologischen Funden von Spielsteinen und –brettern sowie kartographischen Skizzen. Dabei gelingt Gerhard Josten auch der Spagat zwischen erfrischender Lesbarkeit und wissenschaftlicher Korrektheit im Umgang mit Quellen und Zitaten. Erstere stammen oft aus dem Internet. Der Autor hat, obwohl schon im achten Lebensjahrzehnt stehend, dieses Medium aktiv in seine Forschungsarbeit einbezogen. Zu den Zitaten ist anzumerken, dass englischsprachige in der Regel ohne Übersetzung stehen gelassen wurden.
Als Klammer des Buches dient der sogenannte Babson-Task – eine Aufgabe, die für Schachkomponisten lange Zeit ebenso unlösbar schien, wie für die Historiker die Frage nach den Quellen des Schachs. Auf dem Titelbild prangt (vielleicht nicht ganz zum Thema passend) die bisher beste Darstellung hierzu in einer Aufgabe des Russen Leonid Jarosch. Gegen Ende des Buches kommt Josten darauf zurück. Man mag den Zusammenhang zur Grundthematik etwas bemüht finden, als eine weitere Anregung zum Weiterforschen (z.B. im Internet) nimmt der Rezensent diesen Exkurs gerne auf.
Der Preis des Buches von knapp 30 Euro erscheint mir allerdings etwas zu hoch und wird ihm möglicherweise die verdiente Verbreitung unter Schachspielern, die gern etwas über den Brettrand hinausschauen, erschweren. ■
Gerhard Josten: Auf der Seidenstraße zur Quelle des Schachs, Diplomica Verlag Hamburg, 139 Seiten, ISBN 978-3842892194
.
Weitere Schach-Rezensionen im Glarean Magazin
.
.
.
Martin Breutigam: «Himmlische Züge»
.
Jüngste Schach-Historie abwechslungsreich beleuchtet
Thomas Binder
.
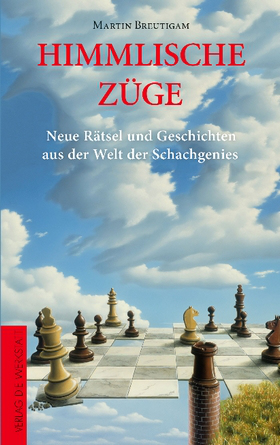 Gut drei Jahre nach dem Band «Todesküsse am Brett» legt der Göttinger Verlag «Die Werkstatt» eine zweite Sammlung der Kolumnen Martin Breutigams vor.
Gut drei Jahre nach dem Band «Todesküsse am Brett» legt der Göttinger Verlag «Die Werkstatt» eine zweite Sammlung der Kolumnen Martin Breutigams vor.
Den Rezensenten beeindruckt dabei zuallererst, dass ein nicht auf Schach spezialisierter Verlag das wirtschaftliche Risiko einzugehen bereit ist, sich auf diesem Markt zu platzieren. Ja – das Schachbuch lebt und ist von den modernen Medien mit ihren ureigensten Vorteilen nicht unterzukriegen.
Wir hatten das Vorgängerwerk vor drei Jahren an dieser Stelle rezensiert und könnten heute vieles aus jener Besprechung wiederholen. Erneut handelt es sich um die unveränderte Zusammenstellung von Breutigams Kolumnen in deutschen Tageszeitungen wie dem «Tagesspiegel» und der «Süddeutschen». Diesmal stammen die 140 Beiträge aus dem Zeitraum 2010 bis 2013, schließen also unmittelbar an das Vorgängerwerk an: «Todesküsse am Brett»
Der beleuchtete Zeitraum war schachhistorisch sehr ereignisreich. Zwei Weltmeisterschaften mit Vishy Anand als Hauptperson bilden die Klammer: Das Buch beginnt mit der 4. WM-Partie gegen Topalow in Sofia und endet mit dem spektakulären Finale der vorletzten Partie gegen Carlsen in Chennai. Parallel dazu können wir den Aufstieg des jungen Norwegers verfolgen, der zwar schon 2010 die Nummer 1 der Welt war, jedoch noch nicht mit der jetzigen Dominanz. So berichtet Breutigam etwa Anfang 2011, dass Carlsen gerade innerhalb von vier Monaten acht Partien verloren hatte – bei seiner heutigen Form kaum vorstellbar und längst vergessen.
Neben Carlsens Aufstieg verfolgt die Chronologie übrigens das Vorankommen der deutschen «Schachprinzen» um Rasmus Svane und Matthias Blübaum. Interessante Parallelen, aber gewiss auch Unterschiede werden deutlich.
Höhen und Tiefen bescherten die letzten drei Jahre auch dem deutschen Schach. Da steht der Gewinn der Europameisterschaft 2011 neben dem peinlichen Auftritt einer zweitklassigen Auswahl bei der Schacholympiade ein Jahr zuvor. Weitere Wettkampf-Highlights aufzuzählen, hieße einfach die Schachereignisse dieser Jahre zu wiederholen.
Die große Stärke von Breutigams Buch liegt im Abwechslungsreichtum der Kolumnen. Da stehen Kombinationen aus aktuellen Turnieren neben Porträts einzelner Spieler. Es gibt mehr oder weniger philosophische Betrachtungen und Blicke in die Vergangenheit – letztere allerdings meist mit einem aktuellen Anlass verknüpft. Eine gerade in ihrer Subjektivität starke Auswahl von Spielerporträts komplettiert den Reigen.
Die großen und kleinen Streitfragen der Schachpolitik bleiben nicht ausgespart. An das Konfliktpotential der deutschen Olympiamannschaft 2010 habe ich schon erinnert. Auch die Kandidatur der Herren Karpow und Weizsäcker für Führungspositionen in FIDE und ECU wird besprochen, ebenso wie das Finanzgebaren der türkischen Föderation und die Probleme etablierter Turnierveranstalter (am Beispiel der Chess Classics).
Die aktuellen Diskussionen der Schach-Community (Betrugs- und Verdachts-Fälle, das missratene Steinbrück-Buchcover, diverse Sportgerichts-Urteile und vieles mehr) werden nicht ausgespart.
Obwohl Martin Breutigam auf vordergründig wertende Kommentare weitgehend verzichtet, ist meist klar zu erkennen, wie er Position bezieht.

Schon das sensationelle Preis-Leistungs-Verhältnis macht dieses Kaleidoskop der letzten drei Schachjahre zu einer sicheren Kaufempfehlung. Martin Breutigam ist als unterhaltsamer Autor und kundiger Experte über jeden Zweifel erhaben. Gewisse Abstriche sind allenfalls dem Konzept geschuldet, Zeitungskolumnen unkommentiert und unredigiert zu übernehmen.
Doch im Blickpunkt steht auf jeder Seite eine tolle Schachkombination, bei der man alle Streitpotentiale und Skandälchen vergessen möchte! Gestaltung und Gliederung sind von «Todesküsse am Brett» unverändert übernommen. Jede Kombination wird auf einer Textseite präsentiert, die zu etwa einem Drittel vom Stellungsdiagramm eingenommen wird. Der Text leitet dann zur Aufgabenstellung über, mit der der Leser aufgefordert wird, den Geistesblitz des jeweiligen Schachmeisters aufzuspüren. Die Lösungen mit Angabe der Hauptvariante und der wichtigsten Abweichungen sowie sehr knappen Erläuterungen sind jeweils kopfstehend am unteren Rand der Seite angeführt. Dem kundigen Schachfreund genügt das allemal, dem interessierten Laien wird hingegen einiges zum Verständnis fehlen.
Etwa ein Dutzend ganzseitige Fotos lockern den Text auf, darunter einige selten gesehene Aufnahmen. Mein Favorit ist Aronjan, der einem Bildhauer Modell sitzt.
Die wortgetreue Übernahme der Zeitungs-Kolumnen hat natürlich ihre Grenzen. Das Buch wendet sich ausdrücklich auch an absolute Schach-Laien (wozu sonst die Erläuterungen zur Schach-Notation im Anhang?) – und diese werden sich mit manchem der knappen Texte doch etwas allein gelassen fühlen. Ergänzungen aus der zeitlichen Distanz hätten zumindest bei einigen Themen gut getan. Leider fehlen neben Hintergrundinformationen auch Datumsangaben zur jeweils originalen Veröffentlichung, es ist jeweils nur die Jahreszahl angegeben. ■
Martin Breutigam: Himmlische Züge – Neue Rätsel und Geschichten aus der Welt der Schachgenies, Verlag Die Werkstatt, 160 Seiten, 978-3730300877
.
Weitere Schach-Rezensionen im Glarean Magazin
.
.
.
Peter Mitschitczek: «Fang den König!» (Schach für Kinder)
.
Neue Ideen in der Vermittlung des Kinder-Schachs
Thomas Binder
.
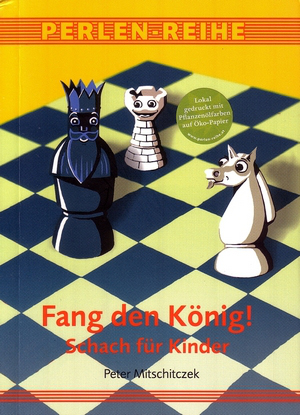 Als langjähriger Schach-Nachwuchstrainer war der Rezensent gespannt, mit Peter Mitschitczeks «Fang den König» ein neues Kinderschach-Lehrbuch in der Hand zu halten. Die Neugier stieg, weil sich der Autor nicht als Schachmeister vorstellt, sondern als Opernsänger. Zwischen diesen beiden Bereichen – seinem Beruf und seinem Hobby – sieht er vielfältige Parallelen, wovon er den Kindern in einem der einführenden Kapitel auch erzählt. Schon dort spürt man, worin Mitschitczeks großes Potential liegen kann: Er spricht die Kids unterhaltsam und erzählerisch an. Man spürt in jedem Satz, dass der Autor Spaß gehabt hat am Formulieren und am spielerischen Entwickeln seiner Ideen.
Als langjähriger Schach-Nachwuchstrainer war der Rezensent gespannt, mit Peter Mitschitczeks «Fang den König» ein neues Kinderschach-Lehrbuch in der Hand zu halten. Die Neugier stieg, weil sich der Autor nicht als Schachmeister vorstellt, sondern als Opernsänger. Zwischen diesen beiden Bereichen – seinem Beruf und seinem Hobby – sieht er vielfältige Parallelen, wovon er den Kindern in einem der einführenden Kapitel auch erzählt. Schon dort spürt man, worin Mitschitczeks großes Potential liegen kann: Er spricht die Kids unterhaltsam und erzählerisch an. Man spürt in jedem Satz, dass der Autor Spaß gehabt hat am Formulieren und am spielerischen Entwickeln seiner Ideen.
Auf 136 kleinformatigen Seiten und von Jürgen Schremser sehr hübsch illustriert will das Buch den Kindern die Grundregeln des Schachspiels nahe bringen. Das Ziel ist auf dem Rücktitel formuliert: «So bist du bestens gerüstet für die erste Schachpartie mit deinen Freunden, Eltern oder Geschwistern!» Damit steckt das Werk wohl einen Anspruchsrahmen ab, der weit unter den möglichen Konkurrenzprodukten liegt. Würde man nämlich «Fang den König!» an der Serie «Fritz & Fertig» des Marktführers messen, so hätte Mitschitczek schon vor dem ersten Zug keine Chance. Jene Produktreihe mit DVDs, Büchern, Rätselblöcken usw. setzt im Angebot für Kinder im Grundschulalter eine ganz andere Marktmacht und Autoren-Kompetenz ein, als es ein Einzelkämpfer leisten kann.
Was lernen wir also auf den 136 Seiten aus der Perlen-Reihe? Es sind wirklich nur die Grundregeln des Schachspiels. Nach 36 Seiten sind wir immerhin so weit gekommen, dass wir das leere Schachbrett richtig vor uns hinlegen und die Figuren in Grundstellung bringen können. Dann folgt die Erklärung der Spielregeln, beginnend mit der Gangart der Figuren. Rochade und en-passant-Schlag sowie die grundlegenden Remis-Regeln bilden schon den krönenden Abschluss. Das Material wird sehr unterhaltsam präsentiert, immer wieder unterbrochen von netten kleinen Abschweifungen. Auch die unvermeidlichen Geschichten der Schach-Folklore wie die Weizenkornlegende und Kempelens Automat dürfen nicht fehlen.
Sehr gut gefällt mir, dass Mitschitczek schon in die frühen Abschnitte immer wieder kleine Aufgaben und Spielideen einbaut – selbst in einem Moment, wo das Kind noch gar keine vollständige Schachpartie spielen kann. Genannt seien etwa die Aufgabe, mit dem Springer von einer Ecke zur anderen zu gelangen oder ein Duell zwischen acht Bauern auf jeder Seite. Besonders gefallen hat mir das Spielchen mit zwei Türmen gegen acht Bauern. Als «running gag» ziehen sich Übungen durch das Buch, bei denen der junge Schachspieler Gummi-Bärchen als Belohnung verdienen kann.
Soweit zu den Stärken des vorliegenden Buches. Etwas schwieriger wird für mich die Bewertung, wenn es um den schachlichen Gehalt geht. Da habe ich nämlich so meine Zweifel, ob der oben formulierte Anspruch «…gerüstet für die erste Schachpartie…» gehalten werden kann. Das schachliche Niveau bleibt doch auf sehr bescheidenem Level stehen. Als höchste Schule bekommen wir das «Schäfermatt» präsentiert, sowie das Treppenmatt mit zwei Türmen.
Und damit sind wir beim eigentlichen Problem: Wo liegt die Zielgruppe für dieses Buch? Der Klappentext bemisst sie mit «… ab 8 Jahren», bei einem großen Online-Händler habe ich «8 – 10 Jahre» gefunden. Das alles ist wohl dem Gedanken geschuldet, dass die Kinder natürlich des Lesens und des selbständigen «Arbeitens» mit dem Buch mächtig sein müssen. Aber – selbst als Schachanfänger dürften Kids in diesem Alter mehr erwarten als ihnen »Fang den König!» bieten kann.
Zumindest teilweise scheint mir das Herangehen des Autors eigentlich auf eine noch jüngere Zielgruppe zu fokussieren, was dann aber am Selbst-Lesen scheitert. Es gibt heute für Kinder dieses Alters (und jüngere!) ein reichhaltiges Schachangebot: AGs in Grundschulen und Kindergärten, spezialisierte Schachschulen für die Jüngsten und spezielles Trainingsmaterial in Hülle und Fülle. Ja, selbst die Turnierlandschaft der Altersklassen U8 und U6 (ja, wirklich) ist heute schon unüberschaubar, ganz zu schweigen von der U10. Schließlich machen Kinder in diesem Alter heute ihre ersten Erfahrungen mit dem Computer und finden auch dabei altersgerechte Einstiege in das königliche Spiel.
Um die Kids wirklich für eine erste Schachpartie zu rüsten, hätte Mitschitczek deutlich weiter ausholen sollen. Bei den elementaren Mattführungen wäre das Matt mit einer Schwerfigur (Dame oder Turm) unerlässlicher Lernstoff. Aus der Endspielwelt wäre sicher noch Elementares über Bauernumwandlungen (Opposition, Quadratregel) denkbar. Mehr Raum als nur eine einfache Aufzählung hätten zudem die grundlegenden Eröffnungsprinzipien (Entwicklung, Rochade, Zentrum) verdient. Stattdessen wird das Schäfermatt präsentiert, was die üblichen Lernziele im Anfängertraining geradezu unterläuft.

Der Autor bringt auf erfrischende und kindgerechte Weise, mit lockerem Sprachstil und guter Bebilderung, neue Ideen in die Vermittlung der Grundregeln des Schachspiels ein. Die Zielgruppe der 8-10-jährigen hätte allerdings deutlich mehr schachliche Substanz vertragen.
Besonders attraktiv für die angesprochene Zielgruppe wären einfache taktische Motive (Springergabel, Fesselung, Abzug, Patt-Tricks, Mattbilder…) gewesen. Gerade solche «action»-lastigen Elemente können die betreffende Altersgruppe für das Schachspiel enorm begeistern. Hier hätte Mitschitczeks Buch seine Stärken in der kindgerechten Erzählweise und der lebendigen Illustration besonders gut ausspielen können. Ich wäre sehr gespannt, wie der Autor diese Themen vermitteln würde.
Aus eigener Erfahrung weiß der Rezensent, dass Kinder der angesprochenen Altersklasse schon sehr bald nach dem Erlernen der Grundregeln weit mehr und Anspruchsvolleres an schachlichem Know-How wollen, brauchen und auch verstehen, eben um wirklich für die erste Schachpartie oder gar das erste Kinderschach-Turnier gerüstet zu sein. ■
Peter Mitschitczek: Fang den König! – Schach für Kinder, Verlag Perlen-Reihe, 136 Seiten, ISBN 978-3990060261
.
Weitere Schach-Rezensionen im Glarean Magazin
.
.
.
Mario Ziegler: «Das Schachturnier London 1851»
.
Qualitätsvolle Monographie zu einem schachhistorischen Meilenstein
Thomas Binder
.
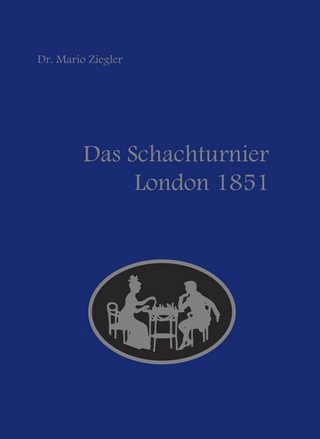 Das Jahr 1851 markiert einen Meilenstein in der Geschichte des Schachs als Wettkampfsport. Zum ersten Mal trafen einige der anerkannten Meister in einem Turnier aufeinander. Bis dahin hatten sich die Besten der Besten nur in Match-Zweikämpfen gegenüber gestanden. In London nun maßen sich 16 Spieler, darunter gut zur Hälfte Akteure, die man nach heutigem Verständnis etwa zu den Top-20 der Super-Großmeister zählen würde.
Das Jahr 1851 markiert einen Meilenstein in der Geschichte des Schachs als Wettkampfsport. Zum ersten Mal trafen einige der anerkannten Meister in einem Turnier aufeinander. Bis dahin hatten sich die Besten der Besten nur in Match-Zweikämpfen gegenüber gestanden. In London nun maßen sich 16 Spieler, darunter gut zur Hälfte Akteure, die man nach heutigem Verständnis etwa zu den Top-20 der Super-Großmeister zählen würde.
Den Übergangscharakter der Veranstaltung verdeutlichen auch die Regularien. So war «London 1851» mitnichten ein Turnier, wie wir es heute kennen, sondern eine Folge von KO-Matches, die in einem Finale kulminierte. Eine Begrenzung der Bedenkzeit war nicht vorgesehen, nach 8 Stunden wurde die Partie vertagt. Interessant auch, dass zwar das Anzugsrecht ausgelost wurde, nicht aber die Farbverteilung. So konnte unter Umständen auch Schwarz die Partie eröffnen. Die damit nötige Übersetzung der Partien in die heute übliche Notation mag in einigen Fällen die Quelle von Unklarheiten gewesen sein.
Über das Turnier von London gibt (gab es bisher) zwei Standardwerke: 1852 veröffentlichte der Engländer Howard Staunton das authentische Turnierbuch. Staunton war die zentrale Figur des Londoner Turniers. Er wirkte maßgeblich in Vorbereitung und Durchführung des Turniers mit und nahm zudem als Spieler teil. Sportlich erlebte er allerdings mit Platz 4 eine Enttäuschung. Stauntons verdienstvolles Turnierbuch wurde 2010 von Jens-Erik Rudolph in einer deutschen Ausgabe neu herausgebracht. Den deutschen Klassiker lieferte bereits 1852 der Berliner Verlag Veit & Company. Eine namentliche Nennung des Autors hierzu gibt es bisher nicht. Mario Ziegler – um nun endlich zum hier rezensierten Buch zu kommen – nennt einige Argumente für die Autorenschaft Alexanders von Oppen, des Herausgebers der «Schachzeitung».
Mit dem letzten Satz wurde bereits angedeutet, dass der Historiker Dr. Mario Ziegler in der Tat neue Forschungsergebnisse vorlegen kann. Er arbeitete beide Turnierbücher sowie darüber hinaus zahlreiche Schachzeitungen und –kolumnen (buchstäblich aus «aller Welt») auf. Ein breites Feld für geschichtliche Forschungen lässt das Londoner Turnier allemal. So gibt es bis heute keinen genauen Terminplan des wohl knapp 2 Monate dauernden Wettstreits. Ziegler hat hier Pionierarbeit geleistet, indem er für viele Partien das Datum auf engere Zeiträume eingrenzen konnte. Zu der kontrovers diskutierten Abmachung zwischen dem späteren Turniersieger Adolf Anderssen und seinem Viertelfinalgegner Jozsef Szen über eine Teilung des Preisgeldes, das einer der beiden erringen würde, entwickelt Ziegler in ausführlicher und gut fundierter Argumentation einen eigenen Standpunkt. So ergreift er auch an vielen anderen Stellen sehr wohl Partei für den einen oder anderen Spieler, für den einen oder anderen Kommentator, analysiert und moderiert die einschlägige Fachdiskussion.
Den Hauptteil des Buches bilden die ausführlich kommentierten Partien. Auf ca. 370 Seiten werden die 85 gespielten Schachpartien vorgestellt. Knapp 100 Seiten nehmen die Porträts der 16 Teilnehmer ein – naturgemäß in sehr unterschiedlicher Gewichtung, sind doch über die weniger bekannten Teilnehmer kaum biographische Details verfügbar. Gehen einige der Porträts an die 10 Seiten heran, oder bei Staunton weit darüber hinaus, so ist es bei E.S. Kennedy – nicht einmal die Vornamen sind bekannt – nur eine halbe Seite. Selbst über Anderssens Finalgegner, den Engländer Wyvill kommt kaum mehr als eine Seite zusammen. Das zeigt einmal mehr, auf welch schwieriges Forscherterrain sich Mario Ziegler begeben hat. Komplettiert wird sein Werk durch eine Reihe kürzerer Artikel zur Vorgeschichte und Nachwirkung des Turniers.
Zu den großen Stärken des vorliegenden Buches muss Zieglers Sprachstil gezählt werden. Es ist ein Vergnügen, seine Zeilen zu lesen. Ihm gelingt eine sachliche Darstellung, die ohne emotionale Aufwallungen auskommt und dennoch spannend und lebendig zu lesen ist. Dabei stört es nicht, dass der Historiker nun mal nicht aus dem Korsett einer wissenschaftlich fundierten Arbeit entfliehen kann. Fast jede Seite ist mit umfangreichen Fußnoten gespickt. Neben akribischen Quellenangaben beherbergen sie jeweils den Text der fremdsprachigen Originale. Davon Gewinn zu haben, setzt zwar die sichere Beherrschung der zitierten Sprachen – zudem in zeitgenössischer Ausprägung – voraus, mit diesem Hintergrund kann man aber noch manche Nuancen entdecken, die bei der Übersetzung verloren gegangen sind.
Im Mittelpunkt des Interesses stehen natürlich die Partieanalysen. Hier leistet der Autor eine solide Arbeit. Jede einzelne Partie wird sehr ausführlich vorgestellt, in angemessener Weise mit Diagrammen illustriert. In der Eröffnungsphase verweist Mario Ziegler an vielen Stellen auf den damaligen Stand der theoretischen Diskussion und auf Vorgängerpartien. Ein Verweis auf heutiges Theoriewissen findet hingegen seltener statt. Der Partieverlauf wird anschaulich geschildert, insbesondere die Wendepunkte werden pointiert herausgestellt. Die analysierten Alternativen und Varianten untermauern die Argumentation. Natürlich stützt sich Mario Ziegler dabei auf Computerhilfe. Er benennt im Quellenverzeichnis selbst die eingesetzten Programmversionen und die benutzte Hardware. In den Kommentaren wird für mich freilich nicht immer erkennbar, wo Ziegler eigene Entdeckungen (bzw. die seines Computers) präsentiert und wo er auf bereits früher veröffentlichte Analysen zurückgreift.
Dem heutigen Leser mag es befremdlich vorkommen, dass damals selbst in einem Elite-Turnier grobe Fehler an der Tagesordnung waren. Auch die geringe Remisquote (nur 7 von 85 Partien) spricht für ein ganz anderes Spielniveau. So gesehen könnte man das vorliegende Werk vielleicht noch um eine globalere Analyse zur Entwicklung der Spielstärke und der Leistungsdifferenzierung in jener Epoche ergänzen.
Neben der schachlich soliden Arbeit überzeugen die Partiebesprechungen durch ihren flüssigen Schreibstil und die nie verloren gehende Einbindung in den Gesamtzusammenhang des Turniers. Etwas unglücklich erscheint allenfalls, dass ab dem Halbfinale auch die Matches der unterlegenen Spieler ohne klare Abgrenzung vorgestellt werden. So steht das große Final-Match zwischen Anderssen und Wyvill nicht am Ende des Buches, sondern wird noch von den Spielen um die Plätze 3 bis 7 gefolgt. Hier könnte ich mir bei einer Überarbeitung eine klarere Teilung in das eigentliche KO-Turnier und die Trostrunde vorstellen.

Nach mehr als 150 Jahren wird von Dr. Mario Ziegler ein neues Standardwerk über das erste große Schachturnier vorgelegt. Im Mittelpunkt stehen Porträts der 16 Turnierteilnehmer und die ausführliche Besprechung aller 85 Partien. Zieglers Monographie überzeugt gleichermaßen durch fundierte historische Recherche wie flüssig geschriebene Texte.
Das vorliegende Buch macht einen hochwertigen Eindruck. Typographisch gibt es nichts auszusetzen, auch der Umgang mit den zahlreichen Fußnoten ist gelungen. Bedenkt man die enorme Forschungsarbeit, die in diesem Werk steckt, ist der stolze Preis gewiss mehr als gerechtfertigt. Freilich muss offen bleiben, ob es in der Schachszene genügend Interessenten gibt, die es ermöglichen, dass man solche Projekte wirtschaftlich sinnvoll durchhalten kann.
Gerade auch unter diesem Aspekt möchte ich Mario Ziegler viel Erfolg und Beharrlichkeit in seiner Arbeit wünschen. Aus seiner Feder stammen übrigens zwei mindestens genauso reizvolle schachhistorische Projekte: «Die große Schachparade» (an den historischen Epochen orientiert) und «Säulen des Schachs» (Vorstellung wichtiger Orte der Schachgeschichte). Zu beiden Serien ist bislang ein Band erschienen, und man darf erwartungsfroh auf Fortsetzung hoffen. ■
Mario Ziegler: Das Schachturnier London 1851, Verlag ChessCoach, 555 Seiten, ISBN 978-3944158006
.
Weitere Schach-Rezensionen im Glarean Magazin
.
.
.
John Nunn: «Das Verständnis des Mittelspiels im Schach»
.
Das Schach-Mittelspiel in 100 Lehr-Motiven
Thomas Binder
.
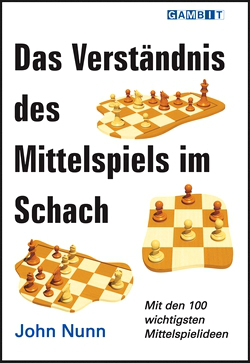 Man muss den englischen Großmeister John Nunn hier gewiss nicht vorstellen, gehört er doch seit Jahren zu den produktivsten und zu Recht beliebtesten Autoren der Schachszene. Sein neuestes Werk «Das Verständnis des Mittelspiels im Schach» will laut Untertitel die «100 wichtigsten Mittelspielideen» präsentieren. Bevor wir uns der Frage zuwenden, wie dies gelungen ist, machen wir uns mit dem Aufbau des Buches vertraut.
Man muss den englischen Großmeister John Nunn hier gewiss nicht vorstellen, gehört er doch seit Jahren zu den produktivsten und zu Recht beliebtesten Autoren der Schachszene. Sein neuestes Werk «Das Verständnis des Mittelspiels im Schach» will laut Untertitel die «100 wichtigsten Mittelspielideen» präsentieren. Bevor wir uns der Frage zuwenden, wie dies gelungen ist, machen wir uns mit dem Aufbau des Buches vertraut.
Nach zwei vielversprechenden Einführungsbeiträgen («Mythen des Mittelspiels» und «Die Verbundenheit aller Dinge») folgen acht etwa gleichwertige Kapitel zu den wichtigsten Themen des Mittelspiels. Die Titel dieser Abschnitte sprechen für sich: Materielle Ungleichgewichte; Strategie; Aktivität; Angriffsspiel; Verteidigungsspiel; Bauernstruktur; Typische Zentrumsformationen; Typische Fehler.
Dabei fällt eigentlich nur das Kapitel «Angriffsspiel» etwas aus dem Rahmen. Es widmet sich vorwiegend taktischen Ideen (z.B. klassischen Opfermotiven). In den übrigen Abschnitten dominiert strategische Überlegung – und damit erfüllt sich auch die Erwartungshaltung, die zumindest der Schreibende an ein Mittelspielbuch knüpft. Eine Ausnahmestellung nimmt allenfalls noch das Schlusskapitel ein, in dem es weniger um konkrete Motive auf dem Schachbrett geht, als um das Denken des Schachspielers. So wird hier z.B. davor gewarnt, den Besitz des Läuferpaars bereits als gewinnbringenden Vorteil zu überschätzen, oder ein dargebotenes Opfer ohne Prüfung von Alternativen automatisch anzunehmen.
Besonderen Gewinn habe ich aus den Kapiteln über «materielle Ungleichgewichte» (z.B. Stellungen mit Mehr-Qualität oder den unterschiedlichen Kompensationen für eine Dame) und über Zentrums-Formationen gezogen. In letztgenanntem geht es um Zentrums-Strukturen, die sich typischerweise aus ganz bestimmten Eröffnungen ergeben. Das sind Themen, die in der einschlägigen Literatur unterrepräsentiert sind, und deren Vermittlung wohl auch einen solch profilierten Autor wie John Nunn braucht. Hier kommen sie in einer Form herüber, die auch dem Spieler mit Elo-Niveau unterhalb der magischen 2000 verständlich wird.
Jedes der oben erwähnten Kapitel beginnt auf zwei dicht bedruckten Seiten ohne jeden Partiebezug mit einer theoretischen Einführung. Ehrlich gesagt, sind diese Texte für den Leser ziemlich anstrengend. Da man sie aber für das Verständnis der folgenden Seiten unbedingt lesen sollte, müsste hier nach einer etwas attraktiveren Gestaltung gesucht werden.
Dann folgt jeweils die Vorstellung der zugehörigen «Mittelspiel-Ideen». Diese summieren sich über die acht Komplexe dann auf jene versprochenen 100 Motive. Jedes einzelne wird mit passenden Partien illustriert, die mustergültig kommentiert sind. Zwei Diagramme zu jeder Partie (bzw. jedem Partie-Fragment) geben Gelegenheit, dem Text auch ohne Schachbrett zu folgen. Die eingestreuten Varianten halten sich in Umfang und Tiefgründigkeit genau an das notwendige Maß. Hier schreibt ein Autor für seine Leser, der genau weiß, was sie von ihm erwarten.
Leider hat sich John Nunn – in meinen Augen unnötig – etwas enge Ketten angelegt, die den Gesamteindruck ein wenig trüben. Es beginnt mit der strengen Systematisierung, bei der nun mal genau 100 Motive heraus kommen sollten. War das Nunns Idee oder hat hier der Verlag einen gut gemeinten Rat gegeben? So stehen Themen gleichberechtigt nebeneinander, die gewiss eine – auch im Umfang – unterschiedliche Präsentation verdient hätten.
Geht dieses Muster z.B. bei taktischen Motiven (Idee 43: «Das Springeropfer auf d5 im Sizilianer») gut auf, so stößt es bei strategischen (Idee 21: «Der Minoritätsangriff») oder gar psychologischen (Idee 97: «Mangelnde Wachsamkeit») an seine Grenzen. Ja, das (selbst?) angelegte Korsett wird noch enger: Jede «Idee» wird auf genau 2 Seiten vorgestellt, mit je 2 Partien (je genau eine pro Seite), jede Partie mit genau 2 Diagrammen illustriert, in jeder Druckspalte genau ein Diagramm. Schade – da werden Reserven verschenkt, die eine differenziertere Darstellung der Themen möglich gemacht hätten.

John Nunns «Das Verständnis des Mittelspiels im Schach» spricht mit 100 Motiven wichtige strategische, taktische und psychologische Aspekte an. Auch wenn buchformale Restriktionen vorhanden sind: Das neueste Werk des berühmten Schachautors stellt eine wertvolle Lektüre für Spieler ab mittlerem Vereinsspielerniveau dar. Empfehlenswert!
Ein großes Lob hingegen ist der Partieauswahl zu zollen. Die Beispiele stammen überwiegend aus der aktuellen Turnierszene des 21. Jahrhunderts. Selbst zu bereits bekannten und in der Literatur oft behandelten Motiven finden sich also neue Gedanken.
Das Buch kann jedem Spieler ab mittlerem Vereinsspielerniveau (was ich mal mit ELO ab 1800 ansetzen würde) empfohlen werden, der sich im schwierigen Feld der Planfindung und Stellungsbewertung in komplexen Mittelspielstellungen verbessern möchte. Er wird vom Autor anspruchsvoll gefordert, aber immer didaktisch geführt und nicht im Variantengestrüpp alleingelassen. Empfehlenswert! ■
John Nunn: Das Verständnis des Mittelspiels im Schach, Gambit Publications, 240 Seiten, ISBN 978-1906454388
.
Weitere Schach-Rezensionen im Glarean Magazin
.
.
.
Ripperger / Wietek / Ziegler: «Die Säulen des Schachs – Paris»
.
Interessanter Exkurs in die Schach-Kulturgeschichte
Thomas Binder
.
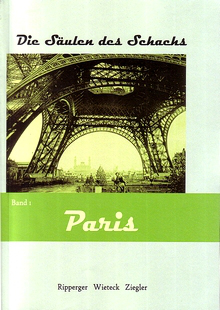 Der saarländische Verlag ChessCoach überrascht die Schachwelt mit einem weiteren ambitionierten Projekt zur Schachgeschichte. Neben ihre Reihe «Die große Schachparade» stellen die gleichen Autoren nun mit «Die Säulen des Schachs» eine Serie mit substantiell anderem Ansatz: Konzentriert sich die Schachparade auf das Turnierschach und seine Meister, wird bei den «Säulen des Schachs» der gesamte historische und kulturelle Kontext in den Vordergrund geholt. Es ist also dem Verlag das Durchhaltevermögen zu wünschen, beide Projekte komplettieren zu können.
Der saarländische Verlag ChessCoach überrascht die Schachwelt mit einem weiteren ambitionierten Projekt zur Schachgeschichte. Neben ihre Reihe «Die große Schachparade» stellen die gleichen Autoren nun mit «Die Säulen des Schachs» eine Serie mit substantiell anderem Ansatz: Konzentriert sich die Schachparade auf das Turnierschach und seine Meister, wird bei den «Säulen des Schachs» der gesamte historische und kulturelle Kontext in den Vordergrund geholt. Es ist also dem Verlag das Durchhaltevermögen zu wünschen, beide Projekte komplettieren zu können.
Im 19. Jahrhundert fand das Königliche Spiel seinen Weg vom Zeitvertreib der höfischen Gesellschaft in die Kreise des gebildeten Bürgertums. Zugleich entwickelte es sich zu jenem Gesamtbild aus Kunst, Wissenschaft und Sport, als das wir es noch heute wahrnehmen. Die Autoren haben den interessanten Ansatz gewählt, diese Entwicklung am Beispiel von fünf europäischen Metropolen nachzuzeichnen. Dem Eröffnungsband über Paris sollen noch London, St. Petersburg, Wien und Berlin folgen.
Im Buch stehen die schachlichen und die gesamt-geschichtlichen Beiträge etwas nebeneinander. Man hat den Eindruck, dass die Autoren – darunter der dem interessierten Publikum gut bekannte (Schach)-Historiker Helmut Wieteck – doch ein wenig aneinander vorbei gearbeitet haben. Die Verschränkung der beiden Ebenen gelingt nur stellenweise. Da das Buch allerdings in ca. 40 kurze Kapitel gegliedert und im übrigen sehr reichhaltig bebildert ist, kann man sich gut orientieren und Schwerpunkte setzen.
In den geschichtslastigen Abschnitten sind historische Ereignisse sachlich dargestellt, etwa die Französische Revolution oder der Deutsch-Französische Krieg. Umfangreiche Porträts stellen uns eine überraschend große Zahl historischer Personen vor: Schriftsteller, Naturwissenschaftler, Politiker, Adlige, Philosophen, Komponisten… Nicht in jedem Fall wird der Bezug zum Gesamtthema deutlich.
Wer sich jedoch darauf einlässt, wird viel Wissenswertes erfahren, auch wenn seine Erwartungen an das Buch vielleicht andere waren. Insgesamt nehmen diese Themen gut die Hälfte des Raumes ein und sind mir damit ein wenig überrepräsentiert.
Beim flüchtigen Vergleich wird offenbar, dass heutzutage die universelle Wissensquelle «Wikipedia» auch für die Autoren einen unverzichtbaren Faktenfundus bildete. Einzelne Formulierungen stimmen auffällig überein, die Grenze zum Plagiat wird freilich nie auch nur andeutungsweise sichtbar.
Blicken wir auf den schachlichen Anteil des Buches, so beginnt die Reise im berühmten Pariser Café de la Régence, also bei Kaffeehaus-Schach im besten Sinne. Morphy tritt auf und die berühmte Partie des Meisters Legall (heute als Seekadettenmatt bekannt) wird besprochen. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist Paris in der Tat der schachliche «Nabel der Welt». Mit Namen wie Philidor, Deschapelles, de la Bourdonnais und Saint Amant sowie ihren jeweiligen Gegnern kann man nicht nur Pariser sondern europäische Schachgeschichte schreiben. Natürlich fehlt auch die Fernpartie gegen London nicht, mit welcher die Pariser Spieler die «Französische Verteidigung» begründeten.
Wenig später prägten Immigranten das Schachleben der französischen Metropole. Namen wie Kieseritzky und Bernstein sind uns heute vielleicht gerade noch geläufig. Im vorliegenden Buch sehen wir nicht nur ihre Partien, sondern erfahren Wissenswertes über die spielenden Personen. Die Autoren lassen sie mit ihren Stärken und Schwächen, mit ihrem persönlichen Schicksal lebendig werden.
Die Wende zum 20. Jahrhundert und seinen Formen des Wettkampfschachs symbolisieren in Paris die Weltausstellungen der Jahre 1867, 1878, 1889 und 1900. Mit einer Ausnahme wurden sie von hochkarätigen Schachturnieren flankiert. Eingebettet in gelungene Artikel zum zeithistorischen Umfeld der Ausstellungen – hier gelingt das oben angemahnte Zusammenspiel sehr gut – werden die Turniere durch vollständige Kreuztabellen und einige Partiebeispiele präsentiert. Mit Meistern wie Steinitz, Winawer, Zuckertort, Blackburne, Anderssen, Lasker, Pillsbury, Marshall, Tschigorin und vielen anderen traf sich die Weltelite an der Seine.
Die beiden letzten Textseiten sind – nach meinem Geschmack etwas unmotiviert – dem französischen Maler Marcel Duchamp gewidmet. Seine schachliche Bedeutung – er spielte u.a. bei fünf Olympiaden – ist unbestritten. Jedoch fällt seine Karriere zeitlich aus dem thematischen Rahmen des Buches.

Die Autoren stellen das Schachspiel in den Zusammenhang der historischen Ereignisse und kulturellen Entwicklungen in der französischen Hauptstadt. Die Gewichtung mag dem Leser etwas zu sehr auf den nicht-schachlichen Themen liegen. Seine wahre Stärke offenbart das Buch aber bei den Porträts heute fast vergessener Meister. Die Serie mit vier weiteren geplanten Bänden über europäische Schach-Metropolen darf mit Spannung erwartet werden.
Insgesamt werden uns 34 Partien der Protagonisten vorgeführt und von Reinhold Ripperger knapp kommentiert. Hier hätte man sich etwas mehr schachliche Analyse gewünscht, zumal wenn man weiß, dass Ripperger als erfahrener Trainer hier seine große Stärke hat. Auch dabei wäre der historische Kontext von Interesse. Wenn es z.B. zu einer Partie von 1843 lapidar heißt: «Wir befinden uns hier in der Tarrasch-Variante des Damen-Gambits.», so drängt sich die Frage auf, welche Rolle diese Variante damals – ein halbes Jahrhundert vor Tarrasch – spielte.
Wenn es also an diesem Buch den einen oder anderen Kritikpunkt gibt, so hat das vor allem mit der Erwartungshaltung des Rezensenten zu tun. Der Spagat, Schach im Rahmen der gesellschaftlichen Entwicklung einer Epoche zu präsentieren, ist noch nicht oft versucht worden. Nur selten ist er besser gelungen, als es Ripperger, Ziegler und Wieteck tun. Wünschen wir dem Buch einen Leserkreis, der das Bildungsinteresse mitbringt, diese Idee zu tragen. Das Projekt sollte unbedingt gelingen – der Gesamtwert erschließt sich gewiss erst aus dem Blick auf alle fünf vorgesehenen Ausgaben. ■
Reinhold Ripperger / Helmut Wieteck / Mario Ziegler: Die Säulen des Schachs – Paris, ChessCoach Verlag, 212 Seiten, ISBN 978-3981190571
.
Weitere Schach-Rezensionen im Glarean Magazin
.
.
.
Interview mit dem Schach-Autor R. Ripperger («Gegenspiel»)
.
Reinhold Ripperger: «Gegenspiel»
Thomas Binder
.
 Repertoirebücher nehmen im Spektrum der Eröffnungsliteratur einen breiter werdenden Raum ein. Sie haben den unbestreitbaren Vorteil einer hohen Praxistauglichkeit. Autor und Leser können sich auf die für sie wirklich relevanten Systeme beschränken und in diese vertiefen. Während bei den reinen Eröffnungs-Nachschlagewerken inzwischen wohl elektronische Medien und Datenbanken konkurrenzlos sind, ist hier dem gedruckten Buch ein Platz weiterhin sicher. Der saarländische Schachtrainer Reinhold Ripperger hat nach «Anzugsvorteil» – einem Weißrepertoire für den e4-Spieler – nun mit «Gegenspiel» das Pendant für den Nachziehenden vorgelegt. Ein Repertoire für Weißspieler, die den Damenbauern bevorzugen, ist in Vorbereitung.
Repertoirebücher nehmen im Spektrum der Eröffnungsliteratur einen breiter werdenden Raum ein. Sie haben den unbestreitbaren Vorteil einer hohen Praxistauglichkeit. Autor und Leser können sich auf die für sie wirklich relevanten Systeme beschränken und in diese vertiefen. Während bei den reinen Eröffnungs-Nachschlagewerken inzwischen wohl elektronische Medien und Datenbanken konkurrenzlos sind, ist hier dem gedruckten Buch ein Platz weiterhin sicher. Der saarländische Schachtrainer Reinhold Ripperger hat nach «Anzugsvorteil» – einem Weißrepertoire für den e4-Spieler – nun mit «Gegenspiel» das Pendant für den Nachziehenden vorgelegt. Ein Repertoire für Weißspieler, die den Damenbauern bevorzugen, ist in Vorbereitung.

Reinhold Ripperger (Dipl. Sozialarbeiter) wurde 1954 in St. Ingbert/D geboren, wo er auch heute noch mit Ehefrau und Tochter lebt. Seit seinem 18. Lebensjahr ist er aktiver Schachspieler. Er durchlief die Ausbildung des Deutschen Schachbundes und erhielt 1985 die Trainerlizenz.
Rippergers Schwarz-Vorschlag klingt auf den ersten Blick banal und schmalspurig: «Ziehen Sie 1… e6, egal was der Gegner eröffnet haben mag.» Dieses Vorgehen (wahlweise auch mit c6, d6, g6 oder anderen Zügen zelebriert) ist so selten gar nicht anzutreffen. Aber nicht immer ist es von Verständnis für die entstehenden Stellungen getragen. Man muss also bei der Repertoireplanung einen Schritt weiter gehen – und das tut Reinhold Ripperger.
Gegen 1. e4 landet man im Franzosen, wobei Ripperger auch in der Folge eine sinnvolle Auswahl anbietet – immer dort, wo Schwarz Gelegenheit hat, das Spiel zu bestimmen. Gegen 1. d4 fokussiert er sich streng auf den modernen Stonewall, bei dem Schwarz seine weiteren Bauern auf c6, d5 und f5 platziert, den Königsläufer aber im Gegensatz zum klassischen Stonewall auf d6. Die somit abgegrenzte Eröffnungswahl ist nicht nur von Ripperger selbst, sondern von mehreren namhaften Großmeistern erprobt und hat sich bewährt. Insbesondere verweist der Autor darauf, dass sich in beiden Eröffnungen ähnliche Motive ergeben und dem Spieler die Orientierung erleichtern. Bei der weiteren Variantenauswahl entscheidet sich Ripperger immer für offensive Abspiele, verspricht seinem Leser ein «Spiel auf Gewinn». Mit Schwarz wird also nicht ängstlich geklammert, sondern getreu dem Titel des Buches aktives Gegenspiel gesucht.
Angenehm fällt dabei auf, dass der Leser nicht mit ellenlangen und vielfach untergliederten Zugfolgen allein gelassen wird. In angemessenem Umfang werden der Sinn der einzelnen Züge und der dahinter stehende strategische Plan erläutert. Zwei bis drei Diagramme pro Seite lockern den Text auf und lassen es zu, die Ausführungen auch «vom Blatt» zu verfolgen. Nun hatte der Rezensent natürlich weder das Wissen noch die Zeit, jede einzelne Variante auf ihren schachlichen Gehalt zu prüfen. Stichproben haben aber das Vertrauen in Rippergers fundierte Analysen gestärkt. Dabei ist der Autor ein unabhängiger Geist, der vor der Autorität von Großmeistergenerationen und rechenstarken Computern nicht erschrickt, wenn es eigene Ideen zu vertreten gilt. Mit Blick auf das eigene Repertoire habe ich exemplarisch eine Variante geprüft: Nach 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Lb4 verfügt Weiß über die interessante Gambitfortsetzung 4. Ld2. Sie hat einen gewissen schachhistorischen Wert, stand u.a. 1950 im Kandidatenwettkampf zwischen Bronstein und Boleslawski auf der Tagesordnung. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass man damit selbst gestandene Französisch-Spieler aus dem Gleis ihrer Vorlieben werfen kann. Ripperger nun lässt seine Leser nicht im Regen stehen: Er empfiehlt sehr deutlich die Antwort 4… Sc6! Der Blick auf die Schach-Software «Fritz» bzw. in die «Mega Database» enthüllt dies als einen echten Geheimtipp: Die Datenbankstatistik zeigt, dass er gerade mal mit einer Häufigkeit von 4% in dieser Stellung gespielt wird und auch nach längerer Rechenzeit, weist «Fritz 13» den Zug erst als Nr. 4 oder 5 seiner Kandidatenzüge aus. Mit solchen Empfehlungen kann Reinhold Ripperger also auch dem gestandenen Spieler noch viele neue Ideen vermitteln.

Schach-Autor und -Trainer Reinhold Ripperger legt mit «Gegenspiel» ein praxistaugliches Schwarz-Repertoire mit Schwerpunkt «Französisch» vor. Die Stärke des Buches liegt in der Eigenständigkeit seiner Analysen und den angemessenen Erläuterungen zum strategischen Gehalt der empfohlenen Züge.
Gelungene Gestaltung und Typographie sorgen dafür, dass man das Buch jederzeit gern zur Hand nimmt. Der auf den ersten Blick vielleicht etwas hohe Preis ist durch den enormen Arbeits- und Analyseaufwand gerechtfertigt. Hier wird eine eigene Leistung des Autors verkauft, der wohl zu jeder Aussage des Buches stehen kann – keine schnell dahin geschriebene Computeranalyse. Einziger Kritikpunkt: ca. 35 Seiten mit insgesamt 100 Testaufgaben einschließlich Lösungen und Punktbewertung scheinen mir in einem Repertoirebuch entbehrlich. Abgefragt wird hier nicht schachliches Können, sondern «nur» das Erinnern der vorgestellten Varianten.
Alles in allem: Basierend auf der Empfehlung «Spiele immer 1… e6» legt Reinhold Ripperger ein praxistaugliches Schwarz-Repertoire vor. Neben einer gezielten Auswahl von Französisch-Varianten konzentriert er sich auf den Modernen Stonewall. Die Stärke des Buches liegt in der Eigenständigkeit seiner Analysen und den angemessenen Erläuterungen zum strategischen Gehalt der empfohlenen Züge. ■
Reinhold Ripperger: Gegenspiel – Ein dynamisches Repertoire für den Schwarzspieler, ChessCoach-Verlag, 272 Seiten, ISBN 3-981190-57-0
.
Leseproben
.
.
.
Interview mit dem Schach-Autor Reinhold Ripperger
«Eröffnungstheorie ist ein lebendiger Prozess»
.
Glarean Magazin: Herr Ripperger, in den letzten 2-3 Jahren steht Ihr Name immer wieder für interessante Neuveröffentlichungen auf dem Schachbuch-Markt. Den Menschen dahinter kennen sicher nur wenige. Möchten Sie sich bitte kurz den Glarean-Lesern vorstellen?
Reinhold Ripperger: Ich bin 57 Jahre alt, verheiratet, habe eine erwachsene Tochter, bin von Beruf Sozialarbeiter und lebe im Saarland.
GM: Als sehr aktiven Turnierspieler weist Sie schon die DWZ-Datenbank des deutschen Schachverbandes aus. Ihre Bücher lassen vermuten, dass Sie auch als Trainer Erfahrungen gesammelt haben?
RR: Ich bin seit über 30 Jahren Trainer und im Besitz der B-Lizenz. Als Spieler des SC Anderssen St. Ingbert und des SC Caissa Schwarzenbach habe ich in der Oberliga Südwest und in der 2. Bundesliga gespielt.
GM: Der Blick auf Ihre Homepage offenbart, dass es neben dem Schachspieler Ripperger noch einen auf ganz andere Art interessanten Menschen gibt – den Liedermacher. Erzählen Sie doch bitte ein wenig über diese Seite.
RR: Ich liebe gute Musik und bin ein glühender Fan von Reinhard Mey. Ich schreibe selbst hin und wieder ein Lied und veranstalte Liederabende, bei denen ich Keyboard spiele und neben eigenen Liedern auch Stücke von Hannes Wader, Reinhard Mey oder den Wise Guys singe. Im übrigen bin ich der Ansicht, dass Schach und Musik eng miteinander verwandt sind.
GM: Zurück zum Schachautor: Wenn ich nichts übersehen habe, liegen aus Ihrer Feder – zum Teil mit Co-Autoren – knapp 10 Bücher vor. Das Spektrum ist breit, der Schwerpunkt liegt aber bisher im Eröffnungsbereich. Wie schreibt man eigentlich heute in der Zeit der Datenbanken ein Eröffnungsbuch, das sich vom Durchschnitt abhebt? Wie ist das Verhältnis von eigener Erfahrung zur Vorgefassten Meinung anderer Autoren bzw. der Einschätzung der Computerprogramme?
RR: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich versuche in meinen Büchern, wie auch im Training, die Denkweise meiner Leser zu verändern. Ich lege großen Wert auf die Stellungsbeurteilung und das Schmieden eines sinnvollen Planes. Ich gehe auf die Feinheiten der Position ein und will so die strategischen und taktischen Fertigkeiten meiner Leser ausbilden. Die Computerprogramme sind wahnsinnig stark geworden, können aber einem Spieler keinen Plan erklären. Oft „sehen“ sie auch selbst keinen Plan. Selbstverständlich greife ich bei der Analyse einer Variante manchmal auch die Idee eines anderen Autors auf und versuche diese in meine Überlegungen einzubeziehen.
GM: Was muss heute ein gutes Eröffnungsbuch bieten, um einen Mehrwert gegenüber computergestützten Medien zu erreichen?
RR: Ich versuche dem Lernenden zu vermitteln, wie er sich ein vernünftiges Eröffnungsrepertoire zusammenstellt, seine ihm zur Verfügung stehende Zeit optimal nutzt. Ich versuche ihm wertvolle Ratschläge zu geben, welche psychologischen Einflüsse in einer Schachpartie zum Tragen kommen. Ein Fehler auf dem Brett entspringt einem Defizit im schachlichen Denken. Das versuche ich meinen Schülern klar zu machen.
GM: Einige Ihrer Bücher, darunter das aktuelle «Gegenspiel» verstehen sich als Repertoire-Empfehlung. Der Markt scheint gerade in diesem Bereich zu boomen. Ist das ein Trend «weg vom allgemeinen Eröffnungslexikon» hin zum «individuellen Rundum-Sorglos-Paket»?
RR: Wie ich schon sagte, kann ein Computer kein Eröffnungsrepertoire zusammenstellen. Außerdem ist die Eröffnungstheorie im modernen Schach ein lebendiger Prozess, der ständig im Fluss ist und von ehrgeizigen Spielern stetig beobachtet und weiterentwickelt wird.
GM: Leben Sie eigentlich das Konzept «… im ersten Zug immer e7-e6» auch selbst vor und wenn ja, mit welchen Erfahrungen?
RR: Ja, oft spiele ich selbst so. Das hat mir zum Beispiel in der Französischen Verteidigung eine Menge Erfahrung eingebracht. Natürlich muss ich hin und wieder von diesem meinen Gegnern bekannten Repertoire abweichen, um Vorbereitungen aus dem Weg zu gehen und mit der einen oder anderen Überraschung aufzuwarten.
GM: An «Gegenspiel» gefällt mir besonders, dass Sie den Leser nicht mit langen Varianten allein lassen, sondern die Idee einzelner Züge in kurzen und verständlichen Erklärungen erläutern.
RR: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich selbst sehr ungern endlos lange Varianten mit eingeschobenen Untervarianten nachspiele. Dann ist es doch selbstverständlich, dass ich das meinen Lesern ersparen möchte. Das soll aber nicht heißen, dass ich in meinen Büchern den Königsweg gefunden habe. Es gibt andere Konzepte, die bei anderen Schachspielern auf große Zustimmung stoßen und das ist auch in Ordnung.
GM: In den Katalogen finde ich ein Buch, das – nicht nur in Ihrem bisherigen Schaffen – aus dem Rahmen fällt. «Die große Schachparade 1», angekündigt als Streifzug durch die Turnierwelt vor 100 und mehr Jahren. Die Ziffer «1» weckt in mir die Erwartung, dass wir es hier mit einem auf Fortsetzung angelegten Projekt zu tun haben. Erzählen Sie uns bitte, worauf wir uns hier freuen dürfen.
RR: Die Schachparade ist kein klassisches Lehrbuch sondern mehr ein Lesebuch zum Thema Schach in unterschiedlichen Epochen und Ländern. Wir wollen den Lesern die Menschen hinter den Schachspielern näher bringen und interessante Details über Zeitgeist, politische und gesellschaftliche Hintergründe vermitteln. Das Buch ist sehr aufwendig gestaltet mit vielen Fotos und in Hardcover produziert ein echter Hingucker. Es werden nach und nach weitere Bände folgen.
GM: Sie veröffentlichen im Eigenverlag „ChessCoach“. Was hat Sie und Ihren Partner bewogen, einen eigenen Verlag aufzubauen?
RR: Ein eigener Verlag hat natürlich den Vorteil, dass man seine Vorstellungen eins zu eins umsetzen kann. Natürlich bringt es deutlich mehr Arbeit mit sich, das Buch nicht nur zu konzipieren, sondern auch am Markt zu platzieren, ein Vertriebsnetz aufzubauen und mit dem Buchhandel Geschäftsbeziehungen zu pflegen. Dennoch stellt es auch eine interessante Erfahrung dar, auf diesem Sektor tätig zu sein. Der Verlag ChessCoach ist ständig auf der Suche nach neuen Autoren und interessanten Konzepten. Da ich auf Grund meiner Schwerbehinderung nicht mehr im Berufsleben stehe, kann ich für den Verlag mehr Zeit aufwenden und habe gleichzeitig eine interessante und sinnvolle Beschäftigung. Dennoch muss man es als Liebhaberei ansehen, da angesichts der geringen Auflage eines Schachbuchs die Kosten-Nutzen-Rechnung in den Hintergrund tritt und kaufmännischen Anforderungen nicht genügt.
GM: Welche aktuellen Projekte hat der ChessCoach-Verlag denn in der Pipeline?
RR: Im Verlag ChessCoach wird in Kürze das Buch «Anzugsvorteil II» erscheinen, ein Weißrepertoire für d4-Spieler. Außerdem stehen die Arbeiten an zwei schachhistorischen Werken kurz vor dem Abschluss: «Die Säulen des Schachs» sowie «London 1851». Zudem wird es ein Lehr- und Arbeitsbuch geben, «Die goldenen Regeln des Schachspiels». Besonders innovativ ist ein Projekt zum Thema Entscheidungen am Schachbrett. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Unterschied zwischen Fernschach und Nahschach. Hierzu konnten wir zwei international renommierte Großmeister gewinnen. ■
.
Weitere Schach-Rezensionen im Glarean Magazin
.
.
.
E. Neiman & Y.Afek: «Invisible Chess Moves»
.
Von der Unsichtbarkeit gewisser Schachmanöver
Thomas Binder
.
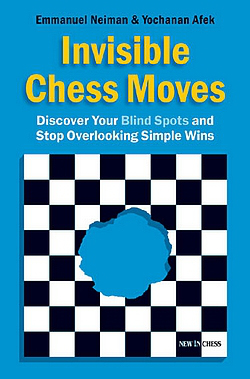 Bislang sind Emmanuel Neiman (FIDE-Meister aus Frankreich) und Yochanan Afek (Internationaler Meister aus Israel, lebt und arbeitet in den Niederlanden) vor allem als Trainer und Autoren hervorgetreten. Afek ist darüber hinaus als namhafter Studienkomponist bekannt. Ihr erstes Gemeinschaftswerk erschien 2009 in Frankreich und liegt nun in einer erweiterten Übersetzung auf dem englischsprachigen Schachbuchmarkt vor.
Bislang sind Emmanuel Neiman (FIDE-Meister aus Frankreich) und Yochanan Afek (Internationaler Meister aus Israel, lebt und arbeitet in den Niederlanden) vor allem als Trainer und Autoren hervorgetreten. Afek ist darüber hinaus als namhafter Studienkomponist bekannt. Ihr erstes Gemeinschaftswerk erschien 2009 in Frankreich und liegt nun in einer erweiterten Übersetzung auf dem englischsprachigen Schachbuchmarkt vor.
Der Ansatz des Buches ist originell und erfrischend. Die Autoren gehen der Frage nach, warum bestimmte Züge, bestimmte Manöver für Schachspieler aller Leistungsklassen – die Partiebeispiele gehen bis hin zu WM-Kämpfen – sehr schwer erkennbar sind. An der Komplexität der zu berechnenden Varianten kann es nicht liegen. In aller Regel muss man nur wenige Züge voraus denken. Die Kombinationen lassen sich problemlos beim Lesen «vom Blatt» verstehen. Es muss also andere Gründe geben – und es gibt sie. Neiman und Afek haben bestimmte wiederkehrende Merkmale erkannt, die einen Zug quasi «unsichtbar» machen. Einerseits sind es geometrische Motive, andererseits psychologische Hemmnisse, die uns abhalten einen bestimmten Zug auch nur zu erwägen.
Das Werk gliedert sich demgemäß in zwei Hauptteile: «Objektive» und «Subjektive» Unsichtbarkeit. Dies und die weitere Untergliederung zeigen, dass die Autoren durchaus mit Ernsthaftigkeit und Akribie gearbeitet haben, nicht in Richtung «Sensationskabinett» abdriften. Natürlich kann man über die Einteilung streiten – bleibt die Unsichtbarkeit doch auf unser menschliches Auge beschränkt. Computer haben auch mit «objektiv unsichtbaren» Zügen keine Mühe und «subjektive Unsichtbarkeit» ist eben doch abhängig vom Leistungsstand und Erfahrungsschatz des Spielers. Dieser Unterschied spiegelt sich übrigens sehr schön in den Partiekommentaren wider. Im ersten Teil werden überwiegend Beispiele von beiden Spielern übersehener Motive vorgestellt, tritt die tatsächliche Partiefolge als Anmerkung in den Hintergrund. Im zweiten Teil sehen wir meist sehr schwierige, aber tatsächlich gespielte Züge. Hier war die Unsichtbarkeit also auf einen der beiden Spieler beschränkt.
Das erste Kapitel ist weiter unterteilt in «hard-to-see moves» (mir fällt keine griffige Übersetzung ein) und in eine Sammlung geometrischer Motive. In die erste Gruppe fallen u.a. ruhige Züge, Desperado-Manöver oder kollineare Züge. Zur zweiten Kategorie gehören rückwärts gerichtete und horizontale Züge (der Begriff «horizontal effect» sollte vielleicht ersetzt werden, hat er doch im Computerschach eine ganz andere Bedeutung), Figuren-Rundläufe oder Selbstfesselungen.
Im zweiten großen Abschnitt geht es um «positionelle» und «psychologische» Unsichtbarkeit. Hier wird offensichtlich, dass doch eine gewisse Korrelation von schachlicher Sehschärfe und Spielstärke besteht. Da ähnelt das Buch schon eher gewöhnlichen Taktik-Lehrbüchern, bewahrt aber seinen eigenen Blick auf die tieferen Ursachen der Fehler.
Zu den Kriterien positioneller Unsichtbarkeit gehören Züge, die die eigene Bauernstruktur schwächen, scheinbar stellungswidriger Abtausch oder ungewöhnliche Figurenpostierung (z.B. der berühmt-berüchtigte Springer am Rand). Zu den psychologischen Faktoren wird schließlich das Umdenken zwischen Angriff und Verteidigung gerechnet – ergänzt wieder um geometrische Gedanken wie «vorwärts gerichtete Verteidigungszüge» und «rückwärts gerichtete Angriffszüge».
Nach jedem Unterkapitel und am Ende des Buches folgen Übungsaufgaben. Die Lösungen sind oft noch mit der reizvollen Zusatzfrage «Warum war dieser Zug unsichtbar?» garniert. Die jeweilige Antwort darauf gehört für mich zu den schönsten Aha-Erlebnissen im Buch.
Das Ganze wird locker und ansprechend präsentiert, man kann den Autoren mühelos folgen. Tiefe und Breite der Variantenbesprechung ist angemessen. Ein paar Anekdoten lockern den Text auf. Die sehr zahlreichen Partiebeispiele (ergänzt um ganz wenige Studien) decken einen Zeitraum vom 19. Jahrhundert bis in die jüngste Vergangenheit ab. Auch die aktuelle Meistergeneration (Anand, Topalow, Kramnik u.a.) ist vor der Tücke unsichtbarer Züge also nicht gefeit.

Neiman und Afek gelingt in ihrem «Invisible Chess Moves» ein erfrischend neuer Blick auf die Ursachen schachlicher Fehler und verpasster Chancen. Sie entdecken eine Reihe positioneller und geometrischer Motive, die einen Zug «objektiv unsichtbar» machen, und schärfen so des Lesers «Gefühl» für ungewöhnliche Lösungen von Stellungsproblemen.
Ob Neiman und Afek den im Untertitel angedeuteten Anspruch erfüllen können, sei dahingestellt. Sicher hat man nach der Lektüre seinen Blick für ungewöhnliche Lösungen eines Stellungsproblems geschärft. Dies in praktischen Spielerfolg umzusetzen, bleibt jedem Spieler auch jetzt noch selbst überlassen.
Manchmal würde man sich etwas mehr erläuternden Hintergrundtext wünschen. Aus ihrem Erfahrungsschatz als Trainer könnten die Autoren gewiss manch weitere Details beisteuern. Zuallererst wünscht sich Ihr Rezensent – in seiner Eigenschaft als Schachlehrer – aber eine deutsche Übersetzung, die er dann auch seinen Schülern dringend empfehlen würde. ■
Emmanuel Neiman / Yochanan Afek, Invisible Chess Moves, New in Chess, 240 Seiten, ISBN 978-90-5691-368-7
.
.
.
.
Weitere Schach-Rezensionen im Glarean Magazin
.
.
.
.
.
.
Die Schachzeitschrift KARL feiert ihr 10-jähriges Bestehen
.
Vom Vereinsblatt zum internationalen Schachfeuilleton
Interview mit dem KARL-Herausgeber Harry Schaack
Thomas Binder
.
Mit KARL feiert heuer eines der profiliertesten Schach-Printmedien sein zehnjähriges Jubiläum. Ursprünglich nur für den lokalen Bereich konzipiert, mauserte sich dieses «Kulturelle Schachmagazin» während des vergangenen Dezenniums unter der Ägide seines Gründers, Herausgebers und Chefredakteurs Harry Schaack zu einer qualitätsvollen und vielbeachteten Schachzeitschrift weit über die BRD-Grenzen hinaus. KARL will nach eigenem Bekunden «in Berichten, Analysen, Essays und Porträts einen Blick werfen auf die kulturellen, historischen und gesellschaftlichen Aspekte des Schachs». Weniger die modernsten Eröffnungsvarianten als vielmehr die unübersehbar vielfältigen «außerschachlichen» Aspekte des Königlichen Spiels stehen also im Fokus der vierteljährlich erscheinenden Zeitschrift. «Glarean»-Mitarbeiter Thomas Binder hat dem KARL-Herausgeber einige Fragen zur Vergangenheit und Zukunft seines interessanten Magazins gestellt.
 Glarean Magazin: Glückwunsch Ihnen und dem KARL-Team zum zehnjährigen Jubiläum, Herr Schaack! Wie kam es seinerzeit zur Gründung einer Schachzeitung mit einem solch klaren Profil auf «Schach und Kultur»?
Glarean Magazin: Glückwunsch Ihnen und dem KARL-Team zum zehnjährigen Jubiläum, Herr Schaack! Wie kam es seinerzeit zur Gründung einer Schachzeitung mit einem solch klaren Profil auf «Schach und Kultur»?
Harry Schaack: KARL war ursprünglich die Vereinszeitung meines Klubs «Schachfreunde Schöneck», die ich seit den späten Neunzigern verantwortlich betreute. 2001 entschloss ich mich zusammen mit Johannes Fischer und Stefan Löffler die Zeitschrift unter gleichem Namen mit völlig neuem Konzept bundesweit zu vertreiben, die ersten Jahre noch mit einem Vereinsteil für Mitglieder. Nun erschien KARL in hoher Qualität mit Schwerpunkt-Konzept. Gründe für die Ausrichtung unseres Heftes waren zum einen natürlich unser generelles Interesse an Kultur, zum anderen war uns schon damals klar, dass im Zeitalter des Internets ein Printprodukt, das vorrangig über Turniere berichtet, stets der Aktualität hinterher hechelt.
Die erste Ausgabe «Tempo» erschien im Sommer 2001. Nach drei Heften schied Stefan Löffler aus, Johannes Fischer ist dagegen bis heute eng mit KARL verbunden und betreut mehrere Rubriken. Zunächst gab es einige Skepsis, ob das Schwerpunkt-Konzept dauerhaft tragen würde. Doch wir hatten schon zu Beginn eine lange Liste möglicher Themen erstellt, die nach nunmehr 41 Ausgaben noch nicht ausgereizt ist. Daher sehen wir optimistisch in die Zukunft.
GM: Können Sie sich – als der «Macher» des KARL – unseren Lesern kurz vorstellen? Sie haben ja im Schach sicher auch außerhalb der KARL-Redaktion Ihre Spuren hinterlassen?
HS: Ich habe Germanistik, Philosophie und Kunstgeschichte studiert. Nach meinem Abschluss arbeitete ich einige Zeit als Grafiker in einer Werbeagentur, was mir aber offen gestanden nicht sehr zusagte. Ich suchte eher eine Tätigkeit im kulturellen Bereich. Dann ergab sich dank einer Anstoßfinanzierung die Chance, KARL zu machen. Heute bin ich selbstständig und – neben der KARL-Herausgabe – als Grafiker und Journalist tätig. Zudem war ich für die Chess Classics drei Jahre lang als Pressesprecher tätig.
Schach spiele ich seit über 20 Jahren bei den bereits erwähnten «Schachfreunden Schöneck» in der Nähe von Frankfurt, wo ich lange Zeit in der 2. Bundesliga gespielt habe. Ich bin FIDE-Meister, spiele aber in den letzten Jahren aus Zeitmangel nur noch selten (was ich bedaure).
GM: Und der Name KARL?
HS: Bundesweit gibt es unser Heft seit 2001, doch eigentlich gibt es KARL – wie bereits erwähnt – schon viel länger. Die Geburtsstunde geht auf das Jahr 1984 zurück, als mein Schach-Klub seine Mitglieder aufforderte, einen Namen für die neu gegründete Vereinszeitung zu finden. Die dritte Ausgabe trug dann den bis heute erhaltenen Namen – übrigens lange vor «Fritz». «Karl» verwies auf ein «typisches» Vereinsmitglied, wollte den «Brigittes» und «Emmas» ein männliches Pendant an die Seite stellen und ist auch als Akronym zu verstehen, abgeleitet aus Begriffen, mit denen sich der progressive Verein identifizierte. So war anfangs noch auf dem Cover zu lesen: «Zeitschrift für Kommunikation, Ansichten/Amazonen, Realitäten und Lorbeerkränze». Der Name ohne direkten Schachbezug sollte ein Hinweis darauf sein, dass die Redaktion kein «Durchschnittsblättchen» machen wollte und «durchaus auch für Nichtschachspieler» interessant sein sollte. Ein Credo, das bis heute Gültigkeit hat.
GM: Wir haben in den letzten Jahren manche Schachzeitungen kommen, aber auch gehen sehen. Vor allem jene, die sich auf die aktuelle Berichterstattung konzentrieren, konnten im Wettstreit mit den vielfältigen und tagesaktuellen Quellen im Internet nicht mithalten. Wie sehen Sie allgemein den Markt für Schachzeitungen, und wo positioniert sich Ihr Magazin?
HS: Das Internet ist der natürliche Feind aller Zeitschriften, die sich auf Aktualität konzentrieren. Wenn man eine Nachricht einen Monat später bringt als irgendeine Website, muss man dem Leser Zusatzleistungen bieten, Hintergrundinfos, Vorortberichte, aber das ist nicht immer einfach. In Deutschland gab es bis vor kurzem fast zehn regelmäßig erscheinende Zeitschriften. Dass nicht alle überleben würden, ist nicht verwunderlich, weil der Markt übersättigt war.
Der Trend geht – auch wenn mir das nicht gefällt – immer mehr in Richtung digitaler Zeitung. Das hat natürlich einige Vorteile für die User. Über ein IPad (oder ein ähnliches Gerät) kann man von überall auf der Welt bequem auf sein Archiv zugreifen, ohne kiloweise Papier mitzuschleppen. Jüngere Generationen sind mit diesen neuen Medien aufgewachsen, und das physische Buch wird unweigerlich immer mehr an Boden verlieren. In diesen neuen Medien liegen große Chancen, und in diesem Bereich wird sich auch KARL in Zukunft positionieren müssen.
GM: Wie entwickelt sich die Auflage der Zeitschrift? Sind Sie optimistisch, die «kritische Masse» für einen wirtschaftlich vertretbaren Betrieb des KARL halten zu können?
HS: Unsere Auflage ist seit einiger Zeit recht konstant. Die Abonnentenzahl steigt stetig leicht an, aber nicht mehr signifikant. Wirtschaftlich wichtig ist für uns der Verkauf älterer Hefte. Von Beginn an war dies ein Teil unseres Konzeptes. Da die Beiträge zu Schwerpunkten nicht der Aktualität geschuldet sind, sind sie auch noch Jahre später lesbar. Sie sind in dieser Hinsicht eher mit Fachbüchern als mit Zeitschriften vergleichbar.
Ich denke, dass unsere kulturelle Fokussierung ein Publikum anspricht, das sich dem Buch bzw. dem Papier verpflichtet fühlt. Deshalb habe ich im Moment keine Sorge und bin zuversichtlich, dass sich das Heft weiterhin «trägt». Zum anderen stand für mich nie der finanzielle Aspekt im Vordergrund. Es ist eher meine Leidenschaft, die das Heft stützt. Denn eigentlich ist mein Honorar angesichts des betriebenen Aufwandes nicht adäquat.
GM: KARL hat zu allen Themen immer außerordentlich kompetente Autoren aufzubieten. Sicher ist das mittlerweile ein Selbstläufer, weil man sich geehrt fühlt, für den KARL schreiben zu dürfen, oder?
HS: Das ist nicht ganz richtig. In Deutschland haben wir vielleicht einen ganz guten Ruf und können auf einen Autorenpool zurückgreifen. Doch wir arbeiten auch mit vielen nichtdeutschen Autoren zusammen. KARL erscheint in Deutsch und ist deshalb im Ausland vor allem durch meine Präsenz bekannt. Kontakte entstehen nicht selten durch meine zahlreichen Turnierbesuche im Ausland. Zudem weiß man oft nicht, wie zuverlässig ein Autor ist, wenn man das erste Mal mit ihm arbeitet. Ein Wagnis, das uns z.B. bei unserem Fischer-Heft sehr in Verlegenheit gebracht hat. Ein deutscher Autor, dessen Namen ich nicht nennen möchte, sagte uns kurz vor Redaktionsschluss einen zentralen Beitrag ab. Aber aus diesem Desaster haben wir gelernt.
GM: Auf Ihrer Homepage listen Sie ca. 160 «Mitarbeiter» auf (darunter auch einige leider bereits verstorbene). Wie ist diese Liste zu verstehen?
HS: Die Liste ist eine Gesamtdarstellung all unserer Mitarbeiter seit unserer ersten bundesweiten Ausgabe. Die große Menge ist auch ein Spiegelbild unseres Heft-Konzeptes, das immer wieder nach neuen Experten verlangt.
GM: Möchten Sie einige Autoren hervorheben, mit denen Sie besonders intensiv und produktiv zusammenarbeiten?
HS: Seit 2004 arbeite ich im schachhistorischen Bereich sehr intensiv mit Dr. Michael Negele zusammen, der mich auch in dankenswerter Weise immer wieder mit seiner Sammlung unterstützt. Er ist vermutlich unser fleißigster Autor. Eng arbeite ich auch mit Prof. Dr. Ernst Strouhal und Michael Ehn zusammen, die neben ihrer KARL-Kolumne zahlreiche weitere Artikel beigesteuert haben. In letzter Zeit ist Großmeister Mihail Marin öfter mit längeren schachspezifischen Beiträgen vertreten. Johannes Fischer ist freilich als Mann der ersten Stunde von Beginn an im Boot. Er betreut u.a. unsere Reihe «Porträts» und hat das Bild der Zeitschrift über die Jahre erheblich mitgeprägt. Schließlich sind natürlich unsere langjährigen Kolumnisten Prof. Dr. Christian Hesse und Wolfram Runkel zu nennen.
GM: Wie lange arbeiten Sie an einer KARL-Nummer von der Themenidee bis zu dem Tag, da es bei mir im Briefkasten liegt? Wer außer den Autoren ist daran noch beteiligt?
HS: Das ist schwer zu sagen, weil dies stark themenabhängig ist. Die Idee entsteht meist schon viele Monate vorher. Dann frage ich frühzeitig Autoren und Interviewpartner an, doch nicht alle können oder wollen tatsächlich einen Artikel schreiben, d.h. ich muss das Themenkonzept peu à peu anpassen. Mein eigener Aufwand richtet sich danach, wie viele Artikel ich selbst schreibe, und wie viele Reisen ich dafür unternehmen muss. Bei einem Schwerpunkt wie der WM in Bonn 2008 war ich z.B. der einzige Journalist, der die gesamte Spielzeit vor Ort war. Insofern kostet teilweise alleine die Recherche enorm viel Zeit.
Die heiße Schlussphase bis zur Fertigstellung eines Heftes beträgt etwa drei bis vier Wochen. Für die graphische Umsetzung des Heftes und die Auswahl der Beiträge bin ich alleine verantwortlich, wenngleich ich mich z.B. mit Johannes Fischer oft bespreche und auch seine Ideen einfließen. Außerdem gibt es noch zwei, drei Korrekturleser.
GM: Ich habe immer diejenigen Ausgaben als besonders interessant empfunden, in denen Sie ein Thema umfassend und aus sehr verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Stellvertretend seien Ausgaben wie «Schach und Politik», «Rivalen», «Zufall», «Schach und Musik» oder «Schönheit» genannt. In letzter Zeit verschiebt sich Ihr Schwerpunkt etwas zu Heften über eine einzelne Region oder ein Traditionsturnier. Zufall oder bewusste Themenverschiebung?
HS: Eine Themenverschiebung kann ich nicht erkennen. Die beiden Hefte, die sich mit einer Region beschäftigten, lagen nur dadurch direkt hintereinander, weil der Schachbund NRW sein Jubiläum feierte, das Heft 4/2010 über die Niederlande aber schon über ein Jahr im Voraus geplant war. Auch in der Vergangenheit gehörten Hefte über Regionen, Städte und Turniere zu unserer Themenpalette. Wenn wir die Möglichkeit haben, uns an aktuelle Ereignisse wie Jubiläen oder Ausstellungen anzuhängen, machen wir das. So ist unser letztes Heft über die Chess Classic deshalb entstanden, weil dieses nicht nur für Deutschland wichtige Traditionsturnier plötzlich zu Ende ging und ich als ehemaliger Pressesprecher mit dem Event verbunden war. Und da muss man schon einmal kurzfristige Themenänderungen vornehmen.
GM: Wie weit in die Zukunft reicht denn Ihr aktueller Themenkatalog? Können Sie uns mit ein paar Stichworten neugierig machen?
HS: Wir planen meist vier Hefte im Voraus. Für das Heft 1/2012 habe ich z.B. bereits einiges in die Wege geleitet und auch schon Interviews geführt. Bis zum Heft 2/2012 gibt es bereits konkrete Absprachen. Titel möchte ich nicht nennen, denn es wäre ungünstig, wenn andere Zeitschriften die gleichen Themen aufgreifen würden. So war ursprünglich für das Heft 3/2011 ein Kortschnoi-Schwerpunkt vorgesehen. Doch weil ihm auch die Zeitschrift SCHACH fast ein ganzes Heft gewidmet hat, haben wir davon abgesehen und uns stattdessen für seinen Antipoden Karpow entschieden, der ebenfalls einen runden Geburtstag hat.
GM: Unter den aktuell in der Schachszene diskutierten Problemen stehen (leider) die Betrugsmöglichkeiten mit elektronischen Hilfsmitteln im Blickpunkt. Aus meiner Sicht wäre dies ein ideales Feld für KARL, das Thema mit allen Aspekten (geschichtlich, technisch, rechtlich, Folgen und Lösungsansätze usw.) auszuleuchten. Sind Sie in der Spur?
HS: Sie haben vollkommen recht, Betrug ist ein reizvolles Thema und im Moment auch leider ein aktuelles Problem. Ich hatte Gelegenheit, mich in Bonn bei der Deutschen Meisterschaft als Augenzeuge direkt vor Ort über den «Fall Natsidis» zu informieren und mit Teilnehmern darüber zu sprechen. Der technische Fortschritt hat Möglichkeiten geschaffen, die Manipulation immer leichter machen. Gelingt es in Zukunft nicht, dies zu unterbinden, wird das Schach stark leiden.
«Betrug» war eines der Themen, die wir zu Beginn auf unserer Ideenliste für KARL-Schwerpunkte notiert hatten – das war 2001. Natürlich habe ich in Anbetracht der aktuellen Ereignisse über dieses Thema nachgedacht. Da wir aber einige Hefte im Voraus planen, müssen sich die Leser noch ein wenig gedulden. Doch ich bin sicher, dass uns das Thema noch eine ganze Weile begleiten wird.
GM: Im Vergleich zum hochwertigen Anspruch Ihrer Zeitschrift fällt das begleitende Internet-Angebot eher nüchtern und spartanisch aus. Damit sind Sie in der Schachzeitungs-Branche allerdings keineswegs allein. Reicht die Kraft nicht für eine umfassende Online-Präsenz oder spielt da auch die Angst mit, sich quasi eine Konkurrenz im eigenen Haus zu schaffen?
HS: Unsere Internet-Seite bedarf dringend einer Überarbeitung, das ist richtig. Dieses Problem haben wir leider allzu lange hinausgeschoben. Im Moment sind wir dabei, die Seite komplett neu zu gestalten. Dies dauert allerdings noch einige Zeit, weil mittlerweile doch schon ein enormer «Content» vorhanden ist. Wir bieten auf unserer Homepage zu jedem unserer Hefte gleich mehrere Leseproben. Mittlerweile sind in unserer «Kolumne», wo verschiedene Autoren aktuelle Publikationen rezensieren, über hundert Beiträge zu finden.
Wir hoffen, in naher Zukunft eine ansprechende Website präsentieren zu können. Angst vor Konkurrenz im eigenen Haus haben wir dagegen nicht. Unsere dort veröffentlichten Beiträge dienen unserer Eigenwerbung. Eine tägliche Berichterstattung über aktuelle Ereignisse streben wir dagegen nicht an.
GM: Was sind aus Ihrer Sicht die Highlights von zehn Jahren KARL-Geschichte? Denken Sie an ein besonders gelungenes Heft, einen sehr interessanten – vielleicht auch kontroversen – Artikel?

KARL-Macher H. Schaack (Hintergrund) in erlauchtem Kreise anlässlich des Keres-Festes 2006 in Tallin/Estland
HS: Ein ganz besonderes Highlight ist zweifellos bis heute das Keres-Heft (KARL 2/2004). Dabei wurden wir – Johannes Fischer und ich – vom Estnischen Fremdenverkehrsamt unglaublich unterstützt. Die besorgten uns nicht nur den Flug, sondern auch eine mehrtägige Estland-Rundreise in Begleitung. Wir hatten dadurch Kontakt zu allen wichtigen Gesprächspartnern, u.a. auch mit der Familie von Keres. Das war wundervoll und ist auch dem Engagement von Johannes Fischer zu verdanken, der im Vorfeld zahlreiche Institutionen anfragte. Zudem haben alle von uns angestrebten Artikel und Interviews geklappt, darunter die mit Spasski und Smyslow.
Aufgrund dieses Heftes lud man mich 2006 anlässlich des 90. Geburtstages des estnischen Nationalhelden zur großen Keres-Feier nach Tallinn ein. Ein unvergessliches Erlebnis, denn alle großen Spieler der Ära Keres waren versammelt: Karpow, Kortschnoi, Spasski, Awerbach, Taimanow, Gligoric, Unzicker, Schmid, Olafsson, u.v.m. Die Einladung enthielt auch Empfänge beim Präsidenten und ein Mittagessen mit dem Premierminister. Das war großartig. Ein anderes schönes Erlebnis war die Zusammenarbeit mit der Familie Unzicker für KARL 2/2007. Mit seiner Frau und den beiden Söhnen traf ich mich mehrfach in München zu mehrstündigen Interviews, die letztlich zu einer sehr persönlichen Biographie führten.
Auch zahlreiche Atelierbesuche bei diversen Künstlern, die sich mit Schach beschäftigten, sind mir in guter Erinnerung geblieben. Unter den vielen Ausgaben sind mir schachhistorisch vor allem die Lasker- und Nimzowitsch-Ausgaben (KARL 1/2008 + 4/2006) sowie die Hefte über den DSB und über Wien (1/2002 + 2/2009) in Erinnerung geblieben. Aber ich mag auch das Musik-Heft (KARL 4/2007), wo ich u.a. mit Portisch sprechen konnte, der in seiner Karriere nur ganz selten Interviews gegeben hat. Gleich zwei kuriose Artikel gibt es im Zufalls-Heft (KARL 2/2006): Einen von Strouhal über «Schach&Religion» und einen von Donninger über «Zufall&Computer». Das originellste Titelbild ist vermutlich jenes des Taktik-Heftes – ein Kugelfisch, den ich einer Anregung meiner Lebensgefährtin verdanke. Schließlich haben wir im aktuellen Heft (KARL 2/2011) mit unserem Preisrätsel, dass es meines Wissens so im Schachbereich noch nie gab, einen großen Erfolg gelandet, denn die Rückmeldung unserer Leser ist so groß wie nie.
GM: Herr Schaack, besten Dank für Ihre Ausführungen und weiterhin viel Erfolg mit KARL! ■
.
Leseprobe 1 (pdf) (Chrilly Donninger: Computerschach)
Leseprobe 2 (pdf) (Feuilleton: Café de la Régence)
Leseprobe 3 (pdf) (Wandler zwischen den Welten: Wolfgang Unzicker)
.
.
.
.
.
.
Gerhard Josten: «Aljechins Gambit»
.
Exquisiter Roman um ein unsterbliches Schach-Genie
Thomas Binder
.
 Wenn es mir gelingt, einen Roman an einem Tage komplett durchzulesen, ist damit eigentlich schon genug des Lobes gesagt: Gerhard Josten hat es geschafft, mich mit «Aljechins Gambit» für ein paar Stunden an den Balkonstuhl zu fesseln und alles ringsherum vergessen zu lassen. Ich wollte eintauchen in die Mysterien um den vierten Weltmeister der Schachgeschichte Alexander Aljechin – und seinen bis heute nicht völlig geklärten plötzlichen Tod in einem portugiesischen Hotel.
Wenn es mir gelingt, einen Roman an einem Tage komplett durchzulesen, ist damit eigentlich schon genug des Lobes gesagt: Gerhard Josten hat es geschafft, mich mit «Aljechins Gambit» für ein paar Stunden an den Balkonstuhl zu fesseln und alles ringsherum vergessen zu lassen. Ich wollte eintauchen in die Mysterien um den vierten Weltmeister der Schachgeschichte Alexander Aljechin – und seinen bis heute nicht völlig geklärten plötzlichen Tod in einem portugiesischen Hotel.
Der Kölner Gerhard Josten (geb. 1938) ist als profunder Schachhistoriker sowie als Autor von Schachproblemen bekannt und geschätzt. Zu beiden Bereichen legte er bereits mehrere Sachbücher vor. Nach «Ein bisschen unsterblich wie Schach» (Roman, 2005) wagt er nun erneut den Spagat zur Belletristik mit schachlichem Hintergrund. Da die Schachwelt auf diesem Gebiet nicht eben mit viel Literatur verwöhnt ist, nehmen wir solche Angebote gerne wahr und freuen uns – zumal wenn sie so gut gelungen sind wie in diesem Fall.
Der Rezensent ging nicht ganz ohne Vorwissen an die Lektüre, hatte sich vor allem bei Edward Winter und in der bei Schachthemen gewöhnlich recht zuverlässigen deutschsprachigen Wikipedia kundig gemacht. Es blieben mehr Fragen als Antworten – und das Erstaunen darüber, dass eine scheinbar so gut bekannte Persönlichkeit nach nicht einmal einem Jahrhundert so viele biographische Unklarheiten offen lässt. So weiß Wikipedia nur von drei Ehefrauen, während das englische Pendant und auch Gerhard Josten deren vier benennen. Auch Aljechins Verstrickung in die politischen Wirren der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist rätselhaft und faszinierend zugleich: 1919 von den Bolschewiki zum Tode verurteilt, möglicherweise von Trotzki persönlich gerettet und danach sogar noch als Jurist in Moskau tätig… Später heiratet er eine Schweizer Sozialdemokratin und eine russische Generalswitwe, um gegen Ende seines Lebens sogar in den Verdacht der Nazi-Kollaboration zu geraten.

Legendäres Bild eines legendären Todes einer Legende: Der tote Aljechin (angeblich erstickt in einem Lissaboner Hotel an einem Stück Fleisch - März 1946)
Um dieses Lebensende ranken sich nun zahlreiche Spekulationen, die auch den Ausgangspunkt der Handlung in Jostens neuestem Buch bilden. Bekannt ist, dass Alexander Aljechin am 24. März 1946 mit nur 53 Jahren unerwartet in einem Hotel des portugiesischen Seebades Estoril bei Lissabon verstarb. Das Foto des tot in einem Sessel zusammengesunkenen Weltmeisters gehört zum Kanon der Schachgeschichte.
Die offizielle Erklärung spricht davon, er sei beim Essen an einem Stück Fleisch erstickt. Ausgerechnet das weit verbreitete Foto nährt die Zweifel an dieser Version: Das vor ihm platzierte Essgeschirr ist leer und sauber. Der Leichnam lässt keine Zeichen eines Todeskampfes erkennen und trägt zudem einen dicken Wintermantel. Da ist es naheliegend, andere Todesursachen anzunehmen – zumal sich mit etwas Phantasie auf allen Seiten des schachlichen wie weltpolitischen Spektrums Ansatzpunkte für Verschwörungstheorien finden lassen, ganz abgesehen von einer möglichen Depression angesichts der eigenen wirtschaftlichen Lage und des absehbaren Endes der Herrschaft als Schachweltmeister. Zu den Protagonisten der Mord-Thesen gehört der kanadische Großmeister Kevin Spraggett, der sich intensiv mit der Angelegenheit beschäftigte.
Unser Buch kommt in den ersten acht Kapiteln als eine klassische Kriminalerzählung daher. Es begegnen uns u.a. ein ehrgeiziger Kriminalkommissar, den der Fall weit mehr interessiert als dienstlich nötig, sein etwas begriffsstutziger Mitarbeiter, ein undurchsichtiger Hotelportier und eine attraktive Inspektorin in der Lissaboner Polizeizentrale. Wenn Ihnen das alles irgendwie bekannt vorkommt, lesen Sie vermutlich nicht ihren ersten Kriminalroman und erkennen, dass wir es hier eben mit einfachem aber gut gemachtem Krimi-Schriftsteller-Handwerk zu tun haben. Das Ganze ist flüssig zu lesen und lässt niemals Langeweile aufkommen. Der Autor verzichtet darauf, komplizierte Seitenstränge in die Handlung einzuflechten, arbeitet sozusagen «geradeaus» die Geschichte ab. Ist das vielleicht ein «schachliches» Denkmuster? Sei´s drum – der an Schach(geschichte) interessierte Leser kommt auf jeden Fall auf seine Kosten und wird das Buch nicht aus der Hand legen, solange er auf eine Lösung des Aljechin-Mysteriums hofft.

Gerhard Josten nimmt den bis heute ungeklärten Tod des vierten Schachweltmeisters Alexander Aljechin als Ausgangspunkt für einen klassischen Krimi. Kein S(ch)achbuch also, sondern ein höchst spannender Roman, der geeignet ist, die Schachspieler für eines der geheimnisvollsten Themata der Schachgeschichte zu interessieren.
Diese präsentiert Josten dann in den beiden letzten Abschnitten. Hier soll natürlich nicht verraten werden, wie die Geschichte ausgeht. Nur so viel: Der Autor und seine handelnden Personen gehören offenbar zu den Zweiflern an der offiziellen Todesursache. Letztlich schlägt sich Josten aber nicht auf die Seite einer der etablierten Theorien, sondern präsentiert eine eigene Lösung, bei der ein letztes Mal Aljechins Genialität auch außerhalb des Schachbretts aufzublitzen scheint. Der Titel des Buches «Aljechins Gambit» erhält plötzlich eine ganz unerwartete Bedeutung.
Jostens «Lösung» ist sicher kein ernsthafter Beitrag zur Diskussion um Aljechins frühen Tod und dessen ungeklärte Umstände. Sie erscheint dem Rezensenten nicht plausibler als andere Theorien, aber sie ist und bleibt eine erfrischende literarische Aufarbeitung des Themas und lenkt vielleicht das Interesse einer größeren Leserschaft auf das schachhistorische Mysterium und die in vieler Hinsicht faszinierende Persönlichkeit des vierten Schach-Weltmeisters. ■
Gerhard Josten, Aljechins Gambit – Roman, Verlag Helmut Ladwig, 150 Seiten, ISBN 9783941210349
.
.
.
.
.
Viktor Kortschnoi: «Meine besten Kämpfe» (Jubiläumsausgabe)
.
Zum 80. Geburtstag eines charismatischen Schachspielers
Thomas Binder
.
 Man kann diese Rezension nicht ohne ein paar würdigende Worte zu Viktor Kortschnoi beginnen, der in diesen Tagen seinen 80. Geburtstag feiert. Mehr als ein halbes Jahrhundert hat der charismatische Meister die Schachwelt geprägt.
Man kann diese Rezension nicht ohne ein paar würdigende Worte zu Viktor Kortschnoi beginnen, der in diesen Tagen seinen 80. Geburtstag feiert. Mehr als ein halbes Jahrhundert hat der charismatische Meister die Schachwelt geprägt.
Schon 1956 Großmeister geworden – damals gab es weltweit gerade 50 Titelträger –, gehörte er mehr als 30 Jahre lang zur absoluten Weltspitze. Viermal gewann er die Meisterschaft der Sowjetunion; sechsmal siegte der Jubilar mit der Nationalmannschaft bei der Schach-Olympiade; ab den 1970er-Jahren nahm Viktor Kortschnoi mehrmals Anlauf auf die Weltmeisterschaft, 1978 und 1981 unterlag er erst im WM-Kampf gegen seinen ewigen Rivalen Anatoli Karpow. Auch das Duell der beiden 1974 war praktisch schon ein WM-Kampf, der Sieger würde Weltmeister werden, da Bobby Fischers Rückzug vom Turnierschach absehbar war. Noch 1983 drang Kortschnoi in das Kandidaten-Halbfinale vor, wo er Kasparow unterlag – eine neue Schachgeneration hatte das Zepter übernommen.
Ist seine Bedeutung für das Weltschach kaum hoch genug einzuschätzen, so scheint dem Rezensenten die politische Bedeutung seiner Kämpfe am Schachbrett und außerhalb des Turniersaals noch wichtiger. Die Umstände der WM-Kämpfe sind in vielen Büchern geschildert worden, zuletzt in «Der KGB setzt matt», wozu Kortschnoi selbst ein aufschlussreiches Nachwort verfasste.
Kortschnois Emigration aus der Sowjetunion machte die Repressalien offenbar, unter denen unangepasste Persönlichkeiten wie er in der Diktatur zu leiden hatten.
Für Insider stehen in diesem Zusammenhang viele Namen im Raum: Sosonko, Gulko, Lein, Spasski… Für die Schach-Öffentlichkeit ist die «lebende Legende» Viktor Kortschnoi eine Gallionsfigur für menschliche Stärke und Charakterfestigkeit.
Viktor Kortschnoi hat sich seine geistige Frische und enorme Spielstärke bis ins hohe Alter bewahrt. 2006 wurde er Senioren-Weltmeister, und sitzt bis zum heutigen Tage regelmäßig in den höchsten Ligen am Brett. Was er für das Schach in seiner Wahlheimat Schweiz getan und bewirkt hat, kann man wohl von «außen» nur schwer ermessen.
In der dortigen Nationalliga ereignete sich auch jene amüsante Geschichte, als er seinem Gegner mit den Worten «Ich bin Schachgroßmeister» (Video auf Youtube) die Aufgabe nahelegte. Jedem anderen Spieler hätte man dies als Unsportlichkeit vorgehalten. Einer Persönlichkeit vom Range Kortschnois wird es als nette Anekdote toleriert – auch ein Zeichen von Hochachtung der gesamten Schachwelt vor dem Achtzigährigen.
Wie würdigt man Kortschnoi zu diesem Jubiläum? Der Verlag «Edition Olms» hat sich für eine Neuauflage der Partiensammlung «Meine besten Kämpfe» entschieden. Gut zehn Jahre nach der Erstausgabe wurden die beiden Bände zu einem Gesamtwerk von 430 Seiten vereint. Diesem Ursprung ist übrigens die merkwürdige Aufteilung in «Partien mit Weiß» und «Partien mit Schwarz» geschuldet. Innerhalb der beiden Teile sind die je 55 Partien chronologisch sortiert. Das Cover verspricht eine «aktualisierte und erweiterte Jubiläumsausgabe». Die Erweiterung beschränkt sich allerdings auf zehn Partien und endet auch bereits 2003, nicht wirklich eine Aktualisierung also.
So werden uns nun 110 Partien präsentiert – ein kleiner Ausschnitt aus den fast 5’000 Kortschnoi-Partien in der marktbeherrschenden Datenbank, mit denen er laut «Wikipedia» den Rekord der meisten dokumentierten Schachpartien hält. Immerhin zwei Partien des Buches hat der Rezensent nicht in jener Datenbank gefunden: die Weißpartien von 1953 gegen Suetin und von 1955 gegen Tschechower.
Alle Partien sind vom Meister selbst kommentiert. Oft stellt er einige Bemerkungen zum Anlass des Spiels und Gedanken zum jeweiligen Gegner voran. Auch in den Kommentaren lässt er uns an seinem Denken Anteil nehmen, reflektiert seine Überlegungen und Berechnungen. Die rein schachlichen Kommentare konzentrieren sich auf das Wesentliche. Dort, wo Kortschnoi ausführlicher wird, hat er uns Wichtiges zu sagen, ergibt sich auch ein Lerneffekt, obwohl wir ja gewiss kein Lehrbuch vor uns haben. Der Leser wird ge- aber nicht überfordert. Angegebene Varianten haben immer das richtige Maß. Man spürt – bzw. erklärt es Kortschnoi an einer Stelle selbst –, dass die Varianten mit Computerhilfe geprüft sind. Dennoch kommt nie der Eindruck auf, der Autor habe sich vom Schachprogramm treiben lassen. Er setzt es souverän als Kontrollinstanz ein – nicht mehr und nicht weniger. Schmunzeln muss der Leser freilich über die Bemerkung zu einer Alternativ-Variante: «Mit einer solchen Stellung müsste man Deep Blue füttern, damit uns die Maschine sagt, wer besser steht.» – Selbstironie eines Genies und zugleich ein Zeitdokument; heute würde uns der Laptop die ersehnte Antwort geben.

Anlässlich des 80. Geburtstag von Viktor Kortschnoi legt die «Edition Olms» zu einem günstigen Preis eine Sammlung von 110 Gewinnpartien des Jubilars vor. Kortschnois Kommentare sind auch im Abstand von Jahrzehnten noch lesenswert und lehrreich. Text und Varianten finden genau das richtige Maß zum Verständnis der 110 Meisterwerke.
Das Buch ist – wie immer bei Olms – typographisch angenehm gelungen. Übersichtliches Schriftbild und sinnvoll eingesetzte Diagramme machen es sehr gut lesbar. Das Geleitwort von Kortschnois Freund und Weggefährten Gennadi Sosonko gehört zu den weiteren Stärken des Buches.
«Wie würdigt man Kortschnoi zu diesem Jubiläum?» hatte ich weiter oben gefragt. Die Herausgabe seiner Partiensammlung war gewiss eine gute Idee – genau genommen wohl die zweitbeste… Noch besser wäre seiner charismatischen Persönlichkeit eine (erweiterte) Neuauflage der Autobiographie «Mein Leben für das Schach» gerecht geworden. Aber das ist eben der Wunsch des Rezensenten. Vielleicht kann man ihn ja schon mal für Viktors nächsten runden Geburtstag notieren… ■
Viktor Kortschnoi, Meine besten Kämpfe, Edition Olms Zürich, 430 Seiten, ISBN 978-3283010188
.
.
.
.
.
Thematisch verwandte Links
Chess-international – Tipps-und-Tricks-mit-Ebooks – SCV.Schulschach-Bayern
DerWesten – Ich bin Schach-Grossmeister
.
.
Interview mit dem (Schach-)Schriftsteller Martin Weteschnik
.
«Systematisch lernen und regelmäßig üben!»
Thomas Binder
.
Vor zwei Wochen stellten wir hier den neuen Taktik-Band des Frankfurter Schach-Autoren Martin Weteschnik vor. Mit seinem «Schachtaktik–Jahrbuch 2011» setzt der FIDE-Meister eine Reihe erfolgreicher Schach-Publikationen aus seiner Feder fort. Nun denkt aber der bekannte Taktik-Theoretiker an die Beendigung seiner schachlichen Publikationsarbeit, um sich stattdessen «mit voller Kraft» aufs Romane-Schreiben konzentrieren zu können. «Glarean»-Mitarbeiter Thomas Binder stellte dem rührigen Schach-Pädagogen und Roman-Autoren einige Fragen zu seiner zurückliegenden Karriere und zu seinen Zukunftsvorstellungen.
Glarean Magazin: Als Turnierspieler ist es inzwischen recht ruhig um Sie geworden, dafür widmen Sie sich je länger desto mehr dem belletristischen Schreiben. Was waren denn so die wichtigsten Lebensstationen Ihrer (Schach-)Karriere?
Martin Weteschnik: Ich bin 1958 in Frankfurt am Main geboren und dort aufgewachsen. Nach dem Abitur begann ich Germanistik zu studieren und wollte Schriftsteller werden. Das Schreiben, so meinte ich damals, sei der einfachere Part, das «Worüber» weitaus schwieriger. Tatsächlich hatte ich bis dahin nicht eben viel erlebt, was einem künftigen Schriftsteller nicht gerade zu einem sensationell anspruchsvollen Blickfeld verhilft. Folglich sollte und wollte ich erst einmal die Welt kennenlernen! In Japan blieb ich etwas länger. Das Land und seine Kultur haben mich tatsächlich bis heute geprägt. Seither bemühe ich mich um eine Synthese zwischen östlichem und westlichem Denken.
In Amerika schließlich, wo ich fast fünf Jahre in San Francisco wohnte (eine verdammt schöne Stadt!), begann ich mich – nunmehr Mitte zwanzig – mit einem äußerst faszinierenden Spiel zu beschäftigen: mit Schach. Mehr als zwei Jahre verbrachte ich in Ungarn und lernte bei einem Profitrainer. Später unterrichtete ich selbst und schrieb mein erstes Schachbuch. Das «Lehrbuch der Schachtaktik» wurde mittlerweile in mehrere Sprachen übersetzt und erschien zudem bei ChessBase auf CD und DVD. Am erfolgreichsten ist es auf dem englischsprachigen Markt und gilt mittlerweile als Standardwerk im Bereich Taktik. Auf diese Weise gelangte ich also wieder zum Schreiben…
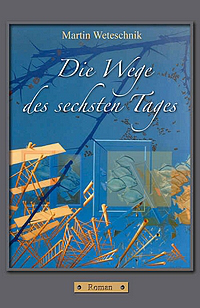
Weteschnik-Roman: «Einen Verlag zu finden ist ungleich schwieriger, als ein gutes Buch zu schreiben.»
Mit etwa 25 Jahren erlernte ich das Schachspiel in San Francisco im sogenannten Mechanics’ Institute. Nach einem Jahr schlug ich meinen ersten IM und den einen oder anderen ELO-Träger (damals ab 2200). Die Leute befragten mich anschließend, weshalb ich über die ersten Züge einer Hauptvariante eine Stunde lang nachgedacht hätte (ich kannte noch keine Eröffnungstheorie), oder warum ich den gleichen Fehler beginge wie Anderssen in einer seiner Matchpartien gegen Morphy. Oh natürlich! – Ich spielte also schon damals wie Anderssen… (leider hat es, wenn überhaupt, nur bezüglich der Fehler zu Anderssens Niveau gereicht).
Nach etwas über einem Jahr wurde mir praktisches Schach langweilig. Tatsache! Die anderen schienen immer nur dasselbe zu spielen, so jedenfalls kam es mir vor (mit dieser Vermutung hatte ich auch nicht ganz unrecht, zumindest was das blinde Nachspielen von Eröffnungstheorie anbelangt) – und selbst fiel mir auch nichts Weltbewegendes ein.
GM: Wie wurde denn aus dem «gelangweilten» Schach-Adepten ein FIDE-Meister?
MW: Aus irgendeinem Grund empfahl mir jemand, Capablancas Partien nachzuspielen (für manche nicht gerade der aufregendste Spielstil). Vielleicht lag es ja an Capablancas Bestreben, alle Figuren harmonisch einzusetzen und zusammenspielen zu lassen, jedenfalls half Capablancas Schachstil mir zu verstehen, wie Einfachheit und konsequentes Verfolgen einer Idee bei gleichzeitigem Bemühen um Harmonie (alle Kräfte wirken irgendwann zusammen) folgerichtig zu einem neuen und einzigartigen Ergebnis führen. So ein «magischer» Moment entsteht im Strategischen ähnlich wie Steinitz es einst bei der Taktik postulierte: dass Kombinationen keine Geniestreiche aus heiterem Himmel sondern das Ergebnis konkreter Positionen sind. Nun, das klingt ziemlich theoretisch. Mag mir im Schach das höhere Handwerkszeug – und möglicherweise auch die nötige Gedächtnisleistung – gefehlt haben, so behaupte ich aus meinen Erfahrungen heraus dennoch, dass selbst große Kreativität für jeden erfahrbar ist. Möglicherweise verdanke ich dem «Langeweiler» Capa den Zugang zu meinem Einfallsreichtum. Auch in anderen Bereichen (zum Beispiel beim Schreiben) werden mir die Ideen wohl nicht mehr ausgehen.
GM: Und wie ging’s dann in Europa weiter, in den angestammten Schachgefilden sozusagen?
MW: Meine «Schachkarriere» ist schnell erzählt. Aus Amerika kehrte ich nach Europa zurück, um dort Schach besser lernen und spielen zu können. Es blieb zumeist beim Lernen. Zwei Jahre trainierte ich mit Tibor Karolyi (dessen Schüler Peter Leko seinerzeit der jüngste Großmeister wurde). Fast ohne Vorkenntnisse war ich mit dem 70’000 Züge umfassenden, auswendig zu lernenden Eröffnungsrepertoire zumeist überfordert. Als «alter Mann» in der Dreißigern lernt sich eben nicht mehr so leicht, was heutzutage bereits Elfjährige mit ELO 2500 (allerdings auch erst nach Jahren intensivsten Trainings) beherrschen… Mir fehlten die praktischen Erfahrungen, um den gigantischen Stoff mit etwas Konkretem verknüpfen und ihn so im Gedächtnis speichern zu können.
Meist spielte ich damals geschlossene (IM-)Turniere. In meinem zu der Zeit einzig gespielten Open in Deutschland (Bad Vilbel 1995; verflucht aber auch, was könnte ich mir heute alles leisten, wenn es damals ausgewertet worden wäre…) erreichte ich den zweiten Platz. Später nahm ich an ein paar GM-Turnieren teil, und auf meinem «schachlichen» Höhepunkt (und letztem Turnier in Ungarn) fehlte mir nominell nur ein Titelträger, um die erste IM-Norm zu erspielen.
Ich muss dennoch zugeben, dass ich nie ein guter praktischer Spieler war. Viele recht peinliche Performances wären mir erspart geblieben, hätte ich aus gesundheitlichen o.ä. Gründen rechtzeitig aufgehört. Aber wir alle wissen ja: Der rechte Zeitpunkt, sich von jenen Dingen zu trennen, an denen wir hängen, ist nicht immer leicht abzupassen. Mein Freund und Trainer Tibor Karolyi sagte einmal zu mir, er kenne keinen (und er kennt eine Menge Leute), der das Schachspiel so sehr liebe wie ich. Sei’s drum, heute kann ich mir nichts Gewinnbringenderes, systematisch Erlernbareres und Tiefgreifenderes vorstellen als Tai Chi (Meditation in Bewegung), das ich wenig, dafür aber tagtäglich praktiziere. Schach war leider irgendwann nicht mehr mein Weg.
GM: Ihre Bücher haben nach meinem Eindruck einen großen Praxisbezug. Da liegt die Vermutung nahe, dass Sie auch als Trainer aktiv waren bzw. sind?
MW: Ja, ich habe Schach unterrichtet, Vorträge gehalten und auch einen Verein betreut. Allen Amateuren (und da meine ich durchaus Spieler bis 2400 ELO) kann ich empfehlen, wenigstens ein Mal in ihrem Schachleben mit einem gutem Trainer oder einem Profi zu trainieren (möglichst nicht in einer größeren Gruppe!). Durchschnittlich werden Spieler (bis etwa 1900) meiner Erfahrung nach innerhalb eines Jahres um 200 Ratingpunkte zulegen. Spieler (etwa wie die «ewigen FMs») werden möglicherweise feststellen, dass sie zu einseitig spielen. Gute Spieler lernen vielleicht weniger an technischen Dingen dazu, doch werden sie davon profitieren, dass ihnen ein erfahrener Trainer eine andere Perspektive aufzeigt. Natürlich nicht immer, aber immer öfters: Ich habe Leute mit einer Spielstärke von 2200 erlebt, die nach nur ein paar grundlegenden Stunden mit einem guten Trainer Titelträger einfach übers Brett schoben (push him over the board, meint Tibor Karolyi treffend, wenn er von der Waffe des Raumvorteils spricht).
Auch wenn meine schriftstellerische Arbeit das Trainieren anderer heute nicht mehr zulässt, möchte ich an dieser Stelle einen Tipp loswerden (auch wenn er allzu einfach klingen mag): Systematisch lernen und regelmäßig üben!
GM: Wie würden Sie die Zielgruppe Ihrer Schachbücher beschreiben?
MW: Das sind Spieler mit einer DWZ von 1200 – 2000.
GM: Wie findet man eigentlich bei der heutigen Fülle von Turnierpartien die «Rosinen im Kuchen», also die wirklich sehenswerten Kombinationen?
MW: Auf diese «Rosinen» im Kuchen wird man natürlich auch durch Quellen wie Internet und Zeitschriften aufmerksam. Man soll das Rad nicht immer neu erfinden; Eine brillante Kombination wird nicht schlechter, nur weil sie irgendwo mehrfach erscheint. Und ein Copyright gibt es weder auf das Finden noch (leider) auf das Kreieren von Taktik. Grundsätzlich bemühe ich mich natürlich, durch Eigenarbeit Neuem auf die Spur zu kommen. Dabei macht es die Fülle an Material eher einfacher, interessante Kombinationen aufzuspüren. In der Tat sollte man die guten Kombinationen bei den besseren Spielern suchen. Andererseits erstaunt es immer wieder, wie taktisch beschlagen auch schwächere Spieler sind. Das mag daran liegen, dass den meisten Turnierspielern im Amateurbereich viele Ideen bereits bekannt sind. Wenn einer die taktischen Motive kennt und ihren Aufbau versteht, kann jeder auch mal ganz große Taktik spielen… Also auf geht’s!
GM: Sind bei Ihren Taktik-Publikationen nachträglich viele interessante Partien «durch den Rost gefallen», weil sie sich bei nachträglicher Analyse als unkorrekt erwiesen?
MW: Natürlich lässt jeder ein Analyseprogramm im Hintergrund laufen. Unfehlbar ist keiner von uns. Man sollte sich dennoch auch auf sein Gefühl verlassen. Meist werden Kombinationen eher verworfen, weil mehrere Lösungswege dem Leser das Üben erschweren.
GM: Ich habe gelesen, dass Sie sich aus dem Schachbuchgeschäft zurückziehen wollen. Es wird also keine weiteren «Schachtaktik-Jahrbücher» mehr geben?
MW: Vermutlich. Ich könnte mir aber vorstellen, dass mein Freund Heinz Brunthaler diese hübsche Reihe auch unter seinem Namen weiterführen kann.
GM: Zu Ihren Roman-Projekten: Auf welches Genre und welche inhaltlichen Schwerpunkte konzentrieren Sie sich dabei?
MW: Gerade habe ich einen Thriller mit historischer Schiene fertiggestellt und mich auf Verlagssuche begeben. Einen Verlag zu finden ist ungleich schwieriger, als ein gutes Buch zu schreiben… Da ich ein möglichst großes Publikum erreichen möchte, stehen Handlung und Spannung im Vordergrund. Allerdings konnte ich es mir nicht verkneifen (neben gründlicher Recherche), das Ganze auch mit etwas Gehalt zu unterlegen… Spannung mit Tiefgang soll auch meine künftigen Werke auszeichnen. Das nächste ist bereits in Planung und wird sich noch deutlicher auf das Thriller-Element konzentrieren. Während der jetzige Roman an den Schauplätzen Dresden, Genf, New Orleans und New York angesiedelt ist, spielt der nächste in Frankfurt, gleichwohl mit ein wenig internationalem Flair garniert. Irgendwann schreibe ich auch wieder ein Sachbuch (Mensch, Wissenschaft, Umwelt – sorry: keins über Schach). Mein unbescheidenes Ziel aber ist es, mit Romanen auch in Englisch verlegt zu werden und eines Tages ein Buch zu schreiben, das nicht nur inhaltlich, sondern zudem stilistisch über gute Unterhaltungsliteratur hinausgeht.
GM: Wird Ihr umfangreiches Wissen aus der Schachszene irgendwie in die Handlung einfließen?
MW: In wie weit das Thema Schach in meinen ersten Roman («Die Wege des sechsten Tages» / 2008) eingeflossen ist, kann man z.B. dem entspr. Medienecho entnehmen. Genauso wenig wie ich allerdings in reinem Lokalkolorit zu versinken gedenke, meide ich einseitig themenbezogenes Schreiben. Für den aktuellen Roman war zunächst kein Schachbezug vorgesehen. Allerdings drohte der historische Plot (des hauptsächlich in der Jetztzeit spielenden Thrillers) plötzlich in Paris zu versanden. In dem Roman geht es nebenbei um das Mausoleum Karl II. Zudem sollte die historische Schiene nach Amerika führen. Der Herzog von Braunschweig, Paris Mitte des 19. Jahrhunderts, Amerika… mmh… da war doch was? Richtig, die legendäre Schachpartie zwischen dem Amerikaner Paul Morphy und eben jenem Herzog (und dem Grafen dʼIsoard). Schach hilf! – Wie fantastisch sich das Ganze letztlich fügt, wird an dieser Stelle natürlich nicht verraten – auch nicht, was meine Recherchen zu dieser Partie und über den Grafen dʼIsoard ergeben haben… ■
.
.
.
.
.
Michael Ehn / Ernst Strouhal: «en passant»
.
Eindrückliche Zeitdokumentation der jüngeren Schachgeschichte
Thomas Binder
.
 Das 20-Jahr-Jubiläum der wöchentlichen Schachkolumne in einer überregionalen Tageszeitung ist heutzutage sicher ein Grund für würdige Feiern. Michael Ehn und Ernst Strouhal (dem regelmäßigen Leser als «ruf & ehn» bekannt) können stolz auf genau diese zwei Jahrzehnte ihrer Arbeit für den Wiener «Standard» zurückblicken. Sie begehen dies mit einer Sammlung ihrer dort erschienenen Beiträge und werden das dabei entstandene Buch «en passant» am 10. Dezember im «project space» der Wiener Kunsthalle bei einer grandiosen Veranstaltung präsentieren.
Das 20-Jahr-Jubiläum der wöchentlichen Schachkolumne in einer überregionalen Tageszeitung ist heutzutage sicher ein Grund für würdige Feiern. Michael Ehn und Ernst Strouhal (dem regelmäßigen Leser als «ruf & ehn» bekannt) können stolz auf genau diese zwei Jahrzehnte ihrer Arbeit für den Wiener «Standard» zurückblicken. Sie begehen dies mit einer Sammlung ihrer dort erschienenen Beiträge und werden das dabei entstandene Buch «en passant» am 10. Dezember im «project space» der Wiener Kunsthalle bei einer grandiosen Veranstaltung präsentieren.
Die beiden Autoren müssen dem Fachpublikum wohl nicht mehr vorgestellt werden. Michael Ehn gehört zu den renommiertesten Schachhistorikern der Gegenwart. Erst kürzlich konnten wir an dieser Stelle sein Buch «Alles über Schach» vorstellen. Ernst Strouhal doziert u.a. an der Universität für angewandte Kunst in der österreichischen Hauptstadt. Seine kulturwissenschaftlichen Studien haben vielfältige Bezüge zum Schachspiel.
Der Versuch, eine Zeitungskolumne in Buchform zu pressen, erscheint gewagt. Ehn und Strouhal haben einen ungewöhnlichen Ansatz gewählt, diese Vielfalt zu bewältigen. Ihrem Buch ist eine DVD beigegeben, die eine unveränderte Wiedergabe aller seit Juni 1990 erschienenen Beiträge – das sind mehr als 1’100 – enthält. Dabei gehen die Autoren betont puristisch vor: Die Artikel der Jahre 1990 bis 2008 werden als Scans im JPG-Format präsentiert, die der Jahre 2009 und 2010 (bis Juni) als PDF-Dokument. So hat man einen Weg gefunden, vergängliches Material aus Tageszeitungen vollständig für die Schachfreunde künftiger Generationen zu erhalten.
Eine rückwirkende Rezension der Kolumnen aus heutiger Sicht verbietet sich von selbst. Um dem Leser einen kleinen Einblick zu gewähren, will ich willkürlich ein paar Monate aus dem riesigen Fundus herausgreifen und die Inhalte ganz kurz vorstellen. Die Auswahl wurde nach dem Zufallsprinzip getroffen, lässt aber den eigentlichen Reiz der Lektüre aufscheinen: Es ist höchst amüsant, frühere Beiträge aus heutiger Sicht noch einmal zu lesen, Parallelen zu ziehen, Wertungen zu hinterfragen.
April 1992: Am 5.4. kommentieren die Autoren die Querelen um die Brettbesetzung der österreichischen Olympiade-Mannschaft und teilen in Richtung Verbandsspitze aus. Aktuelle Parallelen kommen dem Rezensenten nicht ganz zufällig in den Sinn. Am 12.4. wird der Schachöffentlichkeit ein neues Wunderkind vorgestellt: Der 12jährige Peter Leko war damals gerade der jüngste IM der Schachwelt. Leko prophezeite übrigens seinerzeit Anand als künftigen Weltmeister – und sich selbst (für 2002) als dessen Nachfolger. Erwies sich Teil 1 der Vorhersage als Volltreffer, wird am zweiten Teil noch gearbeitet… Eine Woche später würdigen die Autoren Alex Wohl für den Gewinn der australischen Meisterschaft und zum Monatsende geht es in die «exzentrische Welt der Studien». Anlass ist das Erscheinen der Studien-Datenbank des Holländers Harold van der Heijden.
Juli 2002: Das Modewort hieß «Advanced Chess», wobei sich zwei menschliche Spieler mit Computer-Unterstützung duellieren. So berichtet die Kolumne vom 6.7.2002 über ein solches Match zwischen Anand und Kramnik – nicht ahnend, dass beide mehrere Jahre später ohne Rechner um die WM gegeneinander spielen werden. Wie es der Zufall will, wird eine Woche später ein weiterer WM-Kandidat ins Bild gesetzt: Ein Topalow-Porträt ziert den Beitrag über das Dortmunder Kandidatenturnier, am 20.07. werden dann Topalow und Leko als Finalisten von Dortmund präsentiert und zum Ende des Monats steht fest: «Es kann nur einen geben» – Leko ist der Herausforderer für Weltmeister Kramnik.
August 2008: In diesem Monat stehen zunächst drei Beiträge zu Geschichte und Gegenwart des Schachs auf der Karibik-Insel Kuba im Blickpunkt. Am 25. August wird dann mit weit ausholendem Blick auf den Ödipus-Komplex eine aktuelle Turnierpartie zwischen Vater und Sohn Carlsen kommentiert. Ohne «ruf & ehn» wäre sie längst in Vergessenheit geraten. –

Auf Buch und DVD namens «en passant» dokumentieren Ehn und Strouhal die 20-jährige Geschichte ihrer Schachkolumne im Wiener «Standard». Das großformatige Buch bietet als Orientierungshilfe die dazugehörigen Register. Wer sich auf die Arbeit mit den mehr als 1’000 Dateien einlässt, wird mit hochinteressanten Fundstücken zur jüngeren Schachgeschichte und darüber hinaus belohnt.
Die Kolumne wird meist mit einer aktuellen oder thematisch passenden und angemessen kommentierten Meisterpartie beschlossen. Hinzu kommen eine oder mehrere Schachaufgaben, seit Juli 2000 in den drei Kategorien «Ganz leicht», «Ganz schön» und «Ganz schön schwer» – Titel, die den spielerisch souveränen Umgang der Autoren mit dem königlichen Spiel ahnen lassen.
Das großformatige und aufwendig gestaltete Buch könnte man augenzwinkernd als «DVD-Booklet» bezeichnen. Es enthält die unentbehrlichen Orientierungshilfen zur DVD: eine kurze Chronologie der Beiträge; ein alphabetisches Namen- und Sachregister jeweils mit Verweis zum Datum des Beitrages; eine detailliert nach Eröffnungen sortierte Partieübersicht und chronologische Übersicht der Partiefragmente; eine Auswahl von ca. 270 der oben erwähnten Aufgaben mit Lösungen; und als Highlight: 20 Kolumnen als Faksimile-Abdruck.
Uns liegt also ein großartiges Zeitdokument vor, mit dem die verdienstvollen Autoren ihrer Schachspalte ein bleibendes Denkmal gesetzt haben. Wer es in voller Pracht genießen will, muss sich am Rechner durch das Gewirr von weit über 1’000 Dateien kämpfen – eine Geduldsarbeit, die wohl nur Enthusiasten (und Rezensenten) fertig bringen. Vielleicht ist ja dereinst das nächste Jubiläum (das Vierteljahrhundert?) Anlass für eine «echte» Buchausgabe ausgewählter Kolumnen mit rückblickendem Kommentar. Lesespaß und Entdeckerfreude wären garantiert. ■
Michael Ehn / Ernst Strouhal: «en passant», Mit DVD, Springer Verlag Wien / New York, 182 Seiten, ISBN 978-3-7091-0345-6
.
.
Leseprobe (Buch-Scan)
.
.
Michael Ehn / Hugo Kastner: «Alles über Schach»
.
Mythen und Kuriositäten rund ums Königliche Spiel
Thomas Binder
.
 Der Humboldt-Verlag hat sich in letzter Zeit verstärkt des königlichen Spiels angenommen. Mittlerweile ist dort eine kleine Schachbibliothek entstanden, die alle wesentlichen Bereiche von der Eröffnung bis zum Endspiel abdeckt. Nach «Legendäre Schachpartien» liegt nun mit «Alles über Schach – Mythen, Kuriositäten, Superlative» das zweite auf mosaikartige Information ausgerichtete Buch vor. Als Autoren lassen der bekannte Schachhistoriker und -journalist Michael Ehn sowie der Spiele-Experte Hugo Kastner höchste Ansprüche erwarten.
Der Humboldt-Verlag hat sich in letzter Zeit verstärkt des königlichen Spiels angenommen. Mittlerweile ist dort eine kleine Schachbibliothek entstanden, die alle wesentlichen Bereiche von der Eröffnung bis zum Endspiel abdeckt. Nach «Legendäre Schachpartien» liegt nun mit «Alles über Schach – Mythen, Kuriositäten, Superlative» das zweite auf mosaikartige Information ausgerichtete Buch vor. Als Autoren lassen der bekannte Schachhistoriker und -journalist Michael Ehn sowie der Spiele-Experte Hugo Kastner höchste Ansprüche erwarten.
Das Genre, dem sie sich verschrieben haben, ist nicht neu. Zu allen Zeiten wurden Bücher geschrieben, die in unterhaltsamer Weise möglichst vielseitige Fakten aus der Geschichte des Schachspiels sammeln und sie mit besonders spektakulären Zügen würzen. Ein Blick nur in den eigenen Bücherschrank des Rezensenten fördert u.a. Werke von Krabbé («Schach-Besonderheiten»), Damsky («Chess records»), Fox / James («The complete chess addict»), Linder («Faszinierendes Schach») oder die schachhistorischen Werke von Edward Winter zu Tage. Der letzte größere Beitrag auf diesem Gebiet, Christian Hesses «Expeditionen in die Schachwelt», setzte in mancher Hinsicht neue Maßstäbe und wird von Ehn/Kastner in einer Rangliste der wichtigsten Schachbücher zu Recht ganz weit vorn eingeordnet. Die vorgenannten Titel umreißen etwa das Spektrum, das wir auch hier zu erwarten haben, setzen aber Schwerpunkte auf jeweils eigenem Gebiet. So ist Hesse in seinen Analysen deutlich tiefgründiger, Krabbé konzentriert sich auf wenige Einzelthemen, Winter betreibt eigenständige schachhistorische Forschung.
Ehn und Kastner lösen mit Leichtigkeit die Aufgabe, sich in dieser Vielfalt zu behaupten und legen ein Buch vor, das sich – auch bei sehr günstigem Preis-Leistungsverhältnis – als unterhaltsame und lehrreiche Lektüre für jeden Schachfreund empfehlen kann. Seine Stärke ist die Vielfalt der angesprochenen Themenkomplexe bei ansprechender Gestaltung. Naturgemäß findet man vieles wieder, was man aus ähnlichen Sammlungen bereits kennt. Aber selbst der versierte Leser wird neue Fakten, Informationen und vor allem Partien entdecken. Gegenüber anderen Werken dieser Art hebt sich «Alles über Schach» zudem mit einer ansehnlichen Reihe von Fotoseiten ab.
Wo immer es geht, führen die Autoren eine Art Rangliste ein, folgen darin wohl dem Zeitgeist der Fernseh-Ranking-Shows. Mein Geschmack ist diese Pseudo-Objektivität nicht, aber es stört auch nicht wirklich. Vielleicht macht ja ein Internet-Portal daraus sogar eine tragfähige Idee für Abstimmungen nach den «Best-Of»s der Schachgeschichte.
Blicken wir kurz auf den Inhalt – nur so kann man wohl den vielseitigen Charakter des Buches erfassen. Es gliedert sich in sechs große Abschnitte mit jeweils zwei Schlagworten als Titel:
«Geschichte & Mythos» (ca. 65 Seiten): Kurze Abrisse zur Schachgeschichte von der unvermeidlichen Weizenkornlegende über Mittelalter und 20. Jahrhundert bis zum Computer-Zeitalter.
«Meister & Amateur» (ca. 100 Seiten): Es beginnt mit Statistiken und Superlativen, wie man sie in vielen derartigen Büchern findet und Seitenblicken auf schachspielende Politiker, Sportler und Künstler. Dann folgt «endlich» die erste Rangliste: Die 10 wichtigsten Schachspielerinnen der Geschichte. Weitere Listen folgen für die Top-Spieler, die niemals Weltmeister wurden (Philidor vor Morphy und Keres) sowie die Titelträger (Waren wirklich Euwe und Spassky die «schwächsten» Weltmeister?).
«Partie & Turnier» (ca. 60 Seiten): Neben einigen Rekorden und Superlativen der Turniergeschichte und zu Partien (a la «Schnellstes Patt» und «langlebigste Vierfachbauern») stehen nun die Ranglisten ganz im Mittelpunkt. Ehn und Kastner servieren – nach ihrer Einschätzung, aber weitgehend plausibel – die schönsten Einzelzüge aus praktischen Partien: Marshalls «Goldener Zug» landet auf Platz 4, Sie dürfen also gespannt sein, wer sich vor ihm platziert. Es folgen die zehn besten Kurzpartien, wobei mir die Grenze bei maximal 22 Zügen etwas hoch gegriffen erscheint, sowie 2×10 «Partien für die Ewigkeit». In dieser letzten Kategorie helfen sich die Autoren mit dem Kunstgriff einer zeitlichen Zweiteilung. Zunächst werden uns die Klassiker präsentiert, dann die Partien der letzten 60 Jahre. Mit Blick auf das Gesamtwerk hätte ich mir diesen Abschnitt etwas umfangreicher gewünscht.
«Kunst & Literatur» (ca. 55 Seiten): Hier geht es vor allem um Schach in Literatur und Film sowie um Schachhistoriker und -sammler. Neben einigen episodischen Artikeln sind auch hier Ranglisten präsent. Bemerkenswerterweise belegt sowohl bei den Schachbüchern wie bei den Schachfilmen der gleiche Stoff den ersten Platz. Welcher es ist, soll hier nicht verraten werden.
«Problem & Studie» (ca. 90 Seiten): Für meinen Geschmack ist dieser Bereich, der den meisten Lesern weniger vertraut sein wird, etwas überrepräsentiert. Gleich 11 Ranglisten gibt es zu verschiedenen Bereichen des Kunstschachs von Retro- über Märchenschach bis zu Problemen und Studien und ihren jeweiligen Protagonisten. Da verliert man schnell die Übersicht, zumal gerade diese Bereiche oft mehr Erläuterung gebraucht hätten. Eine Lösung von «Dawson’s Weihnachtsbaum» auf wenigen Zeilen dürfte jedenfalls beim Retro-unerfahrenen Leser mehr Fragen als Antworten hinterlassen. Dessen ungeachtet, hält auch dieser Abschnitt eine Reihe netter Entdeckungen bereit, die dem Rezensenten bisher entgangen waren.
«Rösselsprünge & Rochaden» (ca. 50 Seiten): Das letzte Kapitel vereint in kurzen Splittern vielfältige Kuriositäten aus der Geschichte des Schachs. Vergessene Namen und Fakten werden ans Licht gezogen. Vieles davon liest man gern. Wussten Sie zum Beispiel, dass man sich früher bei manchen Turnieren Bedenkzeit regelrecht «einkaufen» konnte oder dass es einen einzigen Schach-Weltmeister gab, zu dessen Hobbies das Kanufahren gehörte? Auf die Nachricht über einen – mir bislang unbekannten – Schachmeister, der nach seinem Tode ausgestopft und zur Schau gestellt wurde, hätte ich hingegen gerne verzichtet. Ganz zum Schluss folgt auch in diesem Kapitel eine Rangliste: Unter «10 Schach-Varianten» führt Fischer-Random vor Tandem- und Räuberschach. Das ist dann eine Spitzengruppe, der auch der praktizierende Jugendtrainer aus eigener Erfahrung zustimmen kann.

Mit «Alles über Schach» komplettiert der Humboldt-Verlag seine Schachreihe mit einem informativen und vielseitigen Lese-Buch. Die Autoren Ehn und Kastner ergänzen das bereits gut versorgte Genre mit einem Werk, das interessante eigene Schwerpunkte setzt.
464 Seiten ungetrübter Lesefreude liegen hinter uns. Einige wenige handwerkliche Fehler sind dem Rezensenten aufgefallen; sie lassen sich bei einer Neuauflage sicher beheben.
So wird dem jungen deutschen Fußballstar Özil, der leidenschaftlich gern Schach spielt, ein falscher Vorname beigegeben.
Beim Kommentar zu Kortschnoi–Karpow (5. WM-Partie 1978) zitiert der Autor zwar widersprüchliche Einschätzungen von Rauser und Tal, verzichtet aber auf die heute mögliche Objektivierung durch Tablebases.
Die schachlichen Analysen sind notwendigerweise durchweg recht kurz. Dennoch sollten oberflächliche Formulierungen (wie «… und matt im nächsten Zug», wenn doch tatsächlich noch verzögernde Verteidigungen möglich sind, die u.U. sogar zu einem anderen Mattbild führen) noch ausgebessert werden.
Schließlich wünscht sich der Rezensent noch ein Namens- bzw. Partieverzeichnis im Anhang und würde dafür auch gerne auf die nach Sternzeichen sortierte Geburtstagsliste verzichten. ■
Michael Ehn/Hugo Kastner: Alles über Schach, Humboldt Verlag Hannover, 464 Seiten, ISBN 978-3-86910-171-2
.
.
.
.
Martin Breutigam: «Todesküsse am Brett»
.
Kurzweilige Geschichten rund um die Schach-Genies
Thomas Binder
.
 Martin Breutigam kann mit Recht als einer der umfassendsten Schachkenner deutscher Sprache gelten. Viele Jahre spielte der Internationale Meister in der Bundesliga; inzwischen wird er vorwiegend als freischaffender Schachjournalist wahrgenommen. Dabei ist es ihm gelungen, die Schachszene in zwei der großen überregionalen Tageszeitungen Deutschlands präsent zu halten: der Süddeutschen Zeitung und dem Berliner Tagesspiegel.
Martin Breutigam kann mit Recht als einer der umfassendsten Schachkenner deutscher Sprache gelten. Viele Jahre spielte der Internationale Meister in der Bundesliga; inzwischen wird er vorwiegend als freischaffender Schachjournalist wahrgenommen. Dabei ist es ihm gelungen, die Schachszene in zwei der großen überregionalen Tageszeitungen Deutschlands präsent zu halten: der Süddeutschen Zeitung und dem Berliner Tagesspiegel.
Seine neueste Veröffentlichung ist eine Sammlung von Nachdrucken seiner Kolumne im Tagesspiegel aus den Jahren 2006 bis 2010: «Todesküsse am Brett – 140 Rätsel und Geschichten der Schachgenies von heute».
Um es vorwegzunehmen: Rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft liegt damit ein nettes kleines Buch vor, mit dem man jedem Schach-Interessierten – unabhängig von Alter oder Spielstärke – eine Freude machen kann. Der günstige Preis – knapp 10 Euro – trägt dazu bei, dass sich die Investition auf jeden Fall lohnt. Dieser Preis begründet sich wohl durch die einfache Gestaltung als Taschenbuch und sicher auch durch die «Zweitverwertung» bereits vorhandenen Materials. Sozusagen «Gebrauchsliteratur» im besten Sinne…
Den Hauptteil des Buches bilden «140 Rätsel und Geschichten der Schachgenies von heute», wie es im Untertitel heißt. Nach Art und Umfang sind sie eine ideale Lektüre zum Schmökern zwischendurch, für eine kurze U-Bahn-Fahrt, für eine Wartezeit oder vor dem Einschlafen. Knapp ein Drittel jeder Seite ist dabei einem optisch angenehm gedruckten großen Stellungsbild vorbehalten. Danach folgen ein kurzer Text über den jeweiligen Protagonisten bzw. den aktuellen Bezug und dann mehr beiläufig die Frage nach der Gewinnfortsetzung, die der genannte Spieler an dieser Stelle aufs Brett gezaubert hat.
Die Auflösung wird kopfstehend und in sehr kleiner Schrift am unteren Ende der Seite präsentiert – ein gelungener Kompromiss, wie ich finde: Man muss nicht weiterblättern, ist aber auch davor geschützt, die Lösung quasi «aus Versehen» wahrzunehmen. Die Antworten beschränken sich auf drei bis vier Zeilen, gehen aber in der Analyse zumindest so weit, dass auch ein Schachfreund auf mittlerem Klubspielerniveau die Zugfolge ohne Brett nachvollziehen und verstehen kann. Einige ganzseitige Porträt-Fotos (u.a. Aronjan, Short, Carlsen, Hou Yifan) runden das Werk ab.

Zocken auf http://www.schach.de nach der Polit-Demo: Putin-Gegner und Ex-Schach-WM Garry Kasparow («Todesküsse» Seite 10)
Die Auswahl der Partien ist – dem Ursprung der Beiträge geschuldet – auf die aktuelle Meistergeneration und die Turniere des letzten Jahrzehnts beschränkt. Auch die in diesem Zeitraum verstorbenen Top-Spieler (stellvertretend seien Fischer und Bronstein genannt) werden gewürdigt.
In einigen Fällen spannt Breutigam den Bogen mit einem Kunstgriff weit auf, z.B. wenn er Akiba Rubinstein vorstellt, um dann mit einer aktuellen Partie fortzusetzen, deren Motiv an dessen berühmte Opferpartie gegen Rotlevi erinnert. Ansonsten dokumentieren die Texte schlaglichtartig die Schachgeschichte seit 2006, freilich ohne ins Detail zu gehen.
Seiner Verantwortung als Journalist wird der Autor darin gerecht, dass er auch kontroverse Themen nicht ausspart, sei es Kasparows politisches Engagement, die Austragung der Frauen-WM 2008 in einem Krisengebiet oder die umstrittene Null-Toleranz-Regel der FIDE. So gewinnt auch der Außenstehende einen Eindruck von jenen Themen, die uns Schachspieler abseits des Brettes beschäftigen, und er wird angeregt, sich darüber näher zu informieren. Mehr kann man im Rahmen dieser Sammlung sicher nicht leisten. Letztlich ist gerade die Vielfalt der angesprochenen Aspekte eine Stärke des Buches.
Bei der Auswahl der Stellungen hat sich Martin Breutigam auf effektvolle Kombinationen konzentriert, die zum sofortigen Partieschluss führten. So ist für Unterhaltungswert und Lerneffekt gleichermaßen gesorgt.
Ob es dabei eines reißerischen Titels wie «Todesküsse am Brett» bedurft hätte, mögen Marketing-Experten bewerten. Den Titel verwendet Breutigam – leicht abgewandelt – für seinen Artikel über Kramniks Niederlage gegen Deep Fritz, als der Weltmeister ein einzügiges Matt zuließ. Ich halte dies für die am meisten überbewertete Episode der jüngeren Schachgeschichte, und leider macht Breutigam hier keine Ausnahme: Ausgerechnet diese Story wird auf mehreren Seiten ausgebreitet.

140 kurze Geschichten umrahmen jeweils eine knackige Kombinations-Pointe aus dem Schaffen der aktuellen Meistergeneration. In einem unschlagbar günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis legt uns Martin Breutigam ein passendes Weihnachtsgeschenk für jeden Schachfreund auf den Gabentisch.
Wenn man das Buch liest – und gerade wenn man sich einzelne Geschichten zur genüsslichen Lektüre herauspickt – muss man immer im Hinterkopf behalten, dass es sich um Zeitungskolumnen handelt, deren Aktualität längst ihr Verfallsdatum überschritten hat. Im Seitenkopf ist jeweils relativ unauffällig die Jahreszahl der Veröffentlichung angegeben. Eine etwas genauere Datierung wäre hilfreich. Formulierungen wie «bei der laufenden WM» oder «am letzten Sonntag» erschließen sich dem Leser so immer erst nach einem kurzen Zweifeln, zumal der Reiz des Taschenbuches auch darin besteht, es nicht chronologisch durchzuarbeiten. Geradezu als Anachronismus wirkt es z.B. wenn Magnus Carlsen für das Erreichen von Platz 31 der Weltrangliste gefeiert wird… Die Texte aus heutiger Sicht nachträglich umzuformulieren oder zu ergänzen, wäre wohl ein schwieriger Spagat gewesen, bei dem die Authentizität auf der Strecke bleiben müsste.
Dieser zeitliche Versatz, an den sich der Leser erst gewöhnen muss, bleibt das einzige Unbehagen bei einer ansonsten absolut kurzweiligen und anregenden Lektüre. ■
Martin Breutigam: Todesküsse am Brett, Verlag Die Werkstatt, 160 Seiten, ISBN 978-3895337437.
.
.
Weitere Leseproben
__________________________________________
.
.
Weitere Schach-Links
Magnus Carlsen for Fashion – Neustart im deutschen Schach – Schach als Therapie gegen Autismus – Schach in der Kaffeepause – Schachboxen – Chaoszone-Schach – DerWesten: Schach-Bundesliga – RP-Online: Schach-Bundesliga – Schachklubs im Osten – Pasch-Net: Schach-Geschenk – Deutscher Schulschach-Kongress – Schachplatz: Schach-Olympiade
Elmar Hennlein: «Die Schach-Weltmeisterschaften der Frauen»
.
Umfassende Chronik des weltmeisterlichen Frauen-Schachs
Thomas Binder
.
 Gleich mehrfach betritt das Buch «Die Schach-Weltmeisterschaften der Frauen» von Elmar Hennlein Neuland. Der Autor hat als Literaturwissenschaftler und Theologe bisher auf anderen Gebieten gearbeitet, verfasst nun aber als passionierter Schachspieler erstmals eine Monographie zu dieser Thematik. Zugleich ist es das erste Schachbuch aus dem Wuppertaler Damen-Verlag. Somit liegt uns nun – und das ist die dritte und bedeutendste Neuerung – erstmals eine auf Vollständigkeit abzielende Darstellung zur Geschichte der Schachweltmeisterschaften der Damen vor.
Gleich mehrfach betritt das Buch «Die Schach-Weltmeisterschaften der Frauen» von Elmar Hennlein Neuland. Der Autor hat als Literaturwissenschaftler und Theologe bisher auf anderen Gebieten gearbeitet, verfasst nun aber als passionierter Schachspieler erstmals eine Monographie zu dieser Thematik. Zugleich ist es das erste Schachbuch aus dem Wuppertaler Damen-Verlag. Somit liegt uns nun – und das ist die dritte und bedeutendste Neuerung – erstmals eine auf Vollständigkeit abzielende Darstellung zur Geschichte der Schachweltmeisterschaften der Damen vor.
Wer selbst im zeitgemäßen Medium Internet den Versuch macht, sich einen umfassenden Überblick über die nur gut 80jährige Geschichte dieser Wettkämpfe zu verschaffen, der kann verstehen, dass Hennlein von langjähriger Recherche spricht. Es ist dem Autor gelungen, die weit verstreuten Informationen zu einer chronologischen Gesamtdarstellung zu vereinen. In gedruckter Form sucht das Buch seinesgleichen und kann sich wohl als Standardwerk zur Thematik etablieren. Der Internet-Nutzer sei ergänzend auf die Webseite von Mark Weeks zur Geschichte der Schach-WM hingewiesen sowie auf die deutschsprachige Wikipedia, wo vor allem Gerhard Hund verdienst- und liebevolle Arbeit geleistet hat.

Die erste Schach-Weltmeisterin Vera Menchik im Simultan-Kampf gegen 20 Spielerinnen und Spieler (London 1931)
Elmar Hennlein widmet sich in einzelnen Kapiteln jeder der bisher 32 Weltmeisterschaften der Damen und den Titelträgerinnen von Vera Menchik bis Alexandra Kostenjuk. Zusätzlich geht er auf das Damenturnier 1897 in London ein, den legitimen Vorgänger der Weltmeisterschaften. Zu jedem Titelkampf bekommen wir die komplette Ergebnisübersicht mit Kreuztabellen oder Partielisten geboten, einschließlich der Kandidaten-Wettkämpfe (ab 1952) und Interzonenturniere (ab 1971). Bei Turnieren im Schweizer System ergänzt der Autor mit einer Kreuztabelle der oberen Turnierhälfte – ein ungewohnter und aufschlussreicher Blick auf den Turnierverlauf.
Zu den herausragenden Spielerinnen gibt es kurze biographische Details, die sich meist aber auf die Lebensdaten und die wichtigsten Turniererfolge beschränken. Etwas umfangreichere Darstellungen finden sich nur über Vera Menchik und ihre zeitweilige Rivalin Sonja Graf. Ist der Eindruck so falsch, dass die Weltmeisterinnen späterer Jahrzehnte – kommen sie aus Russland, Georgien oder China – im Vergleich zu diesen charismatischen Persönlichkeiten irgendwie austauschbar wirken?
Neben den nüchternen Ergebnissen steht jeweils eine knappe Schilderung des Wettkampfverlaufs, die allerdings kaum über das hinaus geht, was man aus den Zahlen ablesen kann. Außerdem werden zu fast jeder WM eine bis zwei entscheidende Partien in Notation und mit Diagramm dargestellt. Die Kommentare innerhalb der Partien sind knapp gehalten, können und wollen eine schachliche Analyse nicht ersetzen. Insgesamt zwölf Spielerinnen werden mit ganzseitigen, sehr gelungenen Porträt-Zeichnungen aus der Feder von Axel Hennlein «ins Bild gesetzt».
Im Anhang finden wir einige Statistiken sowie zusammengefasste biographische Daten zu knapp 100 Spielerinnen. Gewissenhaft sind an allen Stellen die verwendeten Quellen dokumentiert.
Die bisherigen Frauen-Weltmeisterinnen
.
Name Zeitraum Land
Vera Menchik 1927–1944 Tschechoslowakei&GB
keine Weltmeisterin 1944–1950 –
Ljudmila Rudenko 1950–1953 Sowjetunion
Jelisaweta Bykowa 1953–1956 Sowjetunion
Olga Rubzowa 1956–1958 Sowjetunion
Jelisaweta Bykowa 1958–1962 Sowjetunion
Nona Gaprindaschwili 1962–1978 Sowjetunion
Maja Tschiburdanidse 1978–1991 Sowjetunion
Xie Jun 1991–1996 China
Zsuzsa Polgár 1996–1999 Ungarn
Xie Jun 1999–2001 China
Zhu Chen 2001–2004 China
Antoaneta Stefanowa 2004–2006 Bulgarien
Xu Yuhua 2006-2008 China
Alexandra Kostenjuk seit 2008 Russland
.
Wenn man das Buch als Lektüre begreift, wird man irgendwann an einer gewissen Einförmigkeit Anstoß nehmen, die das Thema in der hier gewählten Darstellungsform nun einmal mit sich bringt. Es ist daher nicht als Lesestoff zu verstehen, sondern als Nachschlagewerk – ein Anspruch, den es hervorragend erfüllt.

Der Autor legt ein Standardwerk zu einem bislang vernachlässigten Thema vor. Jede einzelne WM wird sachlich und mit Schwerpunkt auf die sportlichen und biographischen Fakten dargestellt. Wenige Wünsche – insbesondere nach Fotos – bleiben offen. Die hochwertige äußere Gestaltung hebt das Werk vom üblichen Schachbuchmarkt ab, bedingt allerdings auch einen ungünstig hohen Verkaufspreis.
Was bleibt für den Leser an Wünschen? Da ist zunächst der vollständige Verzicht auf Fotos zu bedauern. Für den historisch kurzen Zeitraum müsste sich eigentlich genug Bildmaterial finden lassen. Jedenfalls hätten Fotos die Chance geboten, noch mehr Zeitkolorit zu vermitteln. Gleiches ließe sich vielleicht auch durch verstärkten Einsatz zeitgenössischer Zitate (aus Zeitungen – gern auch im Faksimile) erreichen. Schließlich – und das lässt sich wohl am einfachsten beheben – fehlen in allen Tabellen die Angaben zum Herkunftsland der Spielerinnen.
Das vorliegende Buch hat mit 35 Euro einen stolzen Preis. Mir scheint, dieser ist vor allem der für Schachliteratur ungewöhnlich edlen Ausstattung geschuldet. Das Lektorat hat ganze Arbeit geleistet, der Rezensent keinen einzigen Druckfehler gefunden. Leinen-Einband und sehr hochwertiges Papier ist der geneigte Schachbuch-Leser heute nicht mehr gewohnt… – und er ist wohl leider auch nicht mehr bereit, dafür zu zahlen. Hier könnte der Damen-Verlag möglicherweise am hohen eigenen Anspruch scheitern. Vielleicht kann man das Buch mit einer Auflage in Taschenbuch-Qualität für einen deutlich größeren Leserkreis attraktiv machen; verdient hätte es dies. ■
Elmar Hennlein, Die Schach-Weltmeisterschaften der Frauen, Damen-Verlag Wuppertal, 232 Seiten, ISBN 978-3-942008-00-6
.
Leseproben
.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des «Glarean Magazins»
.
Ständige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des «Glarean Magazins»
.
 Dr. Karin Afshar (Literatur)
Dr. Karin Afshar (Literatur)
Geb. 1958 in der Eifel/D, Studium der Sprachwissenschaft, Finn-Ugristik und Psychologie, Promotion, zahlreiche belletristische und fachwissenschaftliche Publikationen, lebt als Herausgeberin, Lektorin und Publizistin in Frankfurt – – Karin Afshar im Glarean Magazin
.
.
 Thomas Binder (Schach)
Thomas Binder (Schach)
Geb. 1961, Diplom-Ingenieur, aktiver Schach-Spieler und -Trainer, Co-Autor des Wikipedia-Schach-Portals, lebt als EDV-Berater in Berlin – – Thomas Binder im Glarean Magazin
.
.
 Christian Busch (Musik/Literatur)
Christian Busch (Musik/Literatur)
Geb. 1968 in Düsseldorf/D, Studium der Germanistik, Romanistik und Erziehungswissenschaft an der Universität Bonn, jahrelange Musik-Erfahrung in verschiedenen Chören, arbeitete als Lehrer in Frankreich, Südafrika und Deutschland, lebt Düsseldorf – – Christian Busch im Glarean Magazin
.
.
 Bernd Giehl (Literatur)
Bernd Giehl (Literatur)
Geb. 1953 in Marienberg/D, Studium der Theologie in Marburg, zahlreiche schriftstellerische und theologische Publikationen, lebt als evang. Pfarrer in Nauheim – – Bernd Giehl im Glarean Magazin
.
.
.
 Sigrid Grün (Literatur)
Sigrid Grün (Literatur)
Geb. 1980 in Rumänien, Schauspielausbildung in Regensburg, Studium der Deutsche Philologie, Philosophie und Vergleichenden Kulturwissenschaft, derzeit Promovierung, Sachbuch-Autorin und Betreiberin eines oberbayerischen Kulturportals – – Sigrid Grün im Glarean Magazin
.
.
.
 Michael Magercord (Musik/Literatur)
Michael Magercord (Musik/Literatur)
Geb. 1962, früher als Journalist bei der Berliner Tageszeitung taz und als «Stern»-Korrespondent in Peking tätig, verschiedene Buchpublikationen, lebt als Feature-Autor und Reporter des Hörfunks in Prag/Tschechien – – Michael Magercord im Glarean Magazin
.
.
 Günter Nawe (Literatur)
Günter Nawe (Literatur)
Geb. 1940 in Oppeln/D, von 1962 bis zur Pensionierung 2005 Mitarbeiter eines Kölner Zeitungsverlags, danach freischaffend u.a. als Pressesprecher eines großen Kölner Chores und Buchrezensent für Print- & Online-Medien – – Günter Nawe im Glarean Magazin
.
.
 Wolfgang-Armin Rittmeier (Musik)
Wolfgang-Armin Rittmeier (Musik)
Geb. 1974 in Hildesheim/D, Studium der Germanistik und Anglistik, bis 2007 Lehrauftrag an der TU Braunschweig, langjährige Erfahrung als freier Rezensent verschiedener niedersächsischer Tageszeitungen sowie als Solist und Chorist, derzeit Angestellter in der Erwachsenenbildung – – Wolfgang-Armin Rittmeier im Glarean Magazin
.
.
 Dr. Mario Ziegler (Schach)
Dr. Mario Ziegler (Schach)
Geb. 1974 in Neunkirchen/Saarland, Studium der Geschichte und Klassischen Philologie, 2002 Promotion in Alter Geschichte, seither als Wissenschaftlicher Mitarbeiter im universitären Lehrbetrieb tätig. Langjähriger Schachtrainer sowie Autor und Herausgeber verschiedener Bücher zum Thema Schach. Mario Ziegler im Glarean Magazin
.
.
.
Boris Gulko (u.a.): «Der KGB setzt matt»
.
Düsterer Blick hinter die Weltschach-Kulissen
Thomas Binder
.
 Die politischen Einflüsse auf das Weltschach in der Zeit des Kalten Krieges harren noch einer umfassenden Darstellung. Einzelaspekte sind immer wieder aufgegriffen worden, so von Garri Kasparow und Viktor Kortschnoi in autobiographischen Büchern oder in Werken über den WM-Kampf zwischen Spasski und Fischer.
Die politischen Einflüsse auf das Weltschach in der Zeit des Kalten Krieges harren noch einer umfassenden Darstellung. Einzelaspekte sind immer wieder aufgegriffen worden, so von Garri Kasparow und Viktor Kortschnoi in autobiographischen Büchern oder in Werken über den WM-Kampf zwischen Spasski und Fischer.
Die Autoren legen hier ihren Schwerpunkt auf die Manipulationen durch den sowjetischen Geheimdienst KGB. Leider können sie daher – etwa im Gegensatz zur Aufarbeitung der Stasi-Vergangenheit in der DDR – nicht auf Originaldokumente zurückgreifen. Ihre Darstellung muss also zwangsläufig hinter dem Anspruch einer wissenschaftlich dokumentierten Arbeit zurück bleiben.
Das Buch hinterlässt einen zwiespältigen Eindruck. Dies beginnt bereits beim Blick auf die Liste der Autoren. Vier Namen stehen auf dem Einband: Boris Gulko, Viktor Kortschnoi, Wladimir Popow, Juri Felschtinski – und zumindest zwei davon lassen beim interessierten Schach-Enthusiasten Neugier und Vorfreude aufkommen.
Der Beitrag von Viktor Kortschnoi – immerhin eines der wesentlichen Opfer der beschriebenen Manipulationen – beschränkt sich aber leider auf ein mehrseitiges Nachwort ohne neue Erkenntnisse. Den Hauptteil des Buches bestreiten Gulko und das Autorenpaar Popow&Felschtinski mit etwa gleich langen Essays. Den amerikanischen Großmeister, der 1986 aus der Sowjetunion emigrierte, muss man in Schachkreisen wohl nicht vorstellen. Felschtinski ist ein amerikanischer Historiker, der ebenfalls aus der Sowjetunion emigriert war. Sein Forschungsschwerpunkt bleibt das Wirken des sowjetischen und russischen Inlands-Geheimdienstes. Einige Popularität erlangte er vor allem durch seine Zusammenarbeit mit dem 2006 in London unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommenen Ex-KGB-Mitarbeiter Litwinenko. Ex KGB-Oberstleutnant Popow gehörte zu jener Abteilung, die den internationalen Sportverkehr überwachte. Nach seinem Ausscheiden aus dem Geheimdienst emigrierte er nach Kanada.
Gemeinsam ist allen Autoren der Hass auf die kommunistischen Machthaber und deren Geheimdienst. Dass diese Emotion in ihren Ausführungen immer wieder Ausdruck sucht, kommt der objektiven Bewertung des Buches nicht unbedingt entgegen. Gerhard Josten hat es in seiner treffenden Rezension («Rochade Europa 3/2010») psychoanalytisch gedeutet, die Autoren würden nun «ihre Vergangenheit besser bewältigen können, als ohne diesen Rückblick». Ganz so weit möchte ich nicht gehen – aber Hass ist sicher ein schlechter Ratgeber, wenn man den Anspruch hat, ein historisch-politisches Enthüllungsbuch zu schreiben.
Gulkos Beitrag ist im Wesentlichen eine Schilderung der Repressalien, denen er und seine Gattin Anna Achscharumowa (selbst zeitweise eine Anwärterin auf die WM-Krone) ausgesetzt waren. Diese begannen etwa 1976, als sie sich weigerten eine Erklärung der sowjetischen Schach-Elite gegen den «abtrünnigen» Kortschnoi zu unterzeichnen. Zwei Jahre später stellten sie einen Ausreiseantrag, der schließlich 1986 genehmigt wurde.
Stark ist Gulko vor allem in den Passagen, in denen er detailreich von seinem Leben in jenem Jahrzehnt berichtet, sei es vom Hungerstreik, von Protestaktionen zum Interzonenturnier 1982 oder von der Manipulation der Frauen-Meisterschaft, als Anna kurz vor dem Titelgewinn stand.
Als wesentlichen Nutznießer der KGB-Politik macht Gulko den früheren Weltmeister Anatoli Karpow aus. Gewiss hat Karpow in der Sowjetunion weitgehende Privilegien genossen und sich diese auch durch eine gewisse Systemnähe – man kann es auch Opportunismus nennen – bewahrt. Inwieweit Karpow selbst im Hintergrund aktiv geworden ist, kann ich auch nach der Lektüre dieses Buches nicht beurteilen. Leider ist Gulko an vielen Stellen auf Vermutungen und Gerüchte angewiesen. Das macht dann auch Stellen wie die Behauptung, Karpow habe dank seiner KGB-Kontakte noch kürzlich ein Stück Land in Sibirien mit gigantischen Erdgasvorräten erworben und dabei 2 Milliarden Dollar gewonnen, für den unvoreingenommenen Leser schwer nachprüfbar.
So bleibt insgesamt ein unklarer Eindruck, den in Gulkos Bericht freilich die Passagen aus seinem eigenen Erleben mehr als wettmachen.
Noch wesentlich unklarer fällt die Bewertung des zweiten Hauptteiles aus. Der Historiker Felschtinski wird im Autorenporträt für «mehrere Dutzend Bände von historischen Dokumenten» gerühmt. Davon ist hier allerdings nicht viel zu lesen. Dokumente und Belege vermisst man fast völlig. Der Essay ist eine allgemeine Abrechnung mit dem KGB, wobei nahezu im Akkord einzelne Personen auf die Bühne geholt werden, von der sie ebenso schnell wieder verschwinden – ohne dass der Leser sich ein umfassendes Bild machen könnte oder auch nur deren Bezug zur Schachthematik erkennt. Erst gegen Ende gehen Felschtinski und Popow auf einige KGB-Aktionen im Umfeld der WM-Kämpfe Karpows gegen Kortschnoi bzw. Kasparow ein. Dass die sowjetische Führung hier auf Seiten Karpows stand und alles versuchte, ihm den WM-Titel zu sichern, überrascht schon nicht mehr. Dass dies soweit ging, Kortschnoi noch während des WM-Kampfes 1981 in Meran zu ermorden, sollte sich der Wettkampf ungünstig für Karpow entwickeln, ist hoffentlich eine paranoide Übertreibung.
Dem Anspruch einer historisch-dokumentarischen Darstellung kann dieses Buch nicht gerecht werden; darauf werden wir mit Blick auf die russischen Archive wohl noch lange warten müssen. Selbst die zwischen den Hauptautoren offene Frage, ob der KGB bei seiner Einmischung in das Weltschach allein aus eigenem Antrieb oder gemeinsam mit der Parteiführung handelte, muss vorerst offen bleiben.
Im Anhang findet man einen Brief von Popow an Felschtinski, in dem er vor allem auf die nach wie vor reale Bedrohung durch den (jetzt russischen) Geheimdienst eingeht. Die Anmerkung des Herausgebers, ohne diesen Brief hätte es das vorliegende Buch vermutlich nicht gegeben, bleibt ebenso nebulös, wie viele andere Andeutungen auf den 200 Seiten zuvor.
Dem interessierten Schachspieler sei das Buch empfohlen, wenn er sich eine gesunde kritische Distanz zu den notwendigerweise subjektiven Ausführungen der Autoren bewahrt. Die Erinnerungen Gulkos allein verdienen es, für künftige (und nicht nur schachspielende) Generationen bewahrt zu bleiben. ■
B.Gulko/V.Kortschnoi/W.Popow/J.Felschtinski, Der KGB setzt matt – Wie der sowjetische Geheimdienst die Schachwelt manipulierte, Excelsior Verlag Berlin, 216 Seiten, ISBN 978-3-935800-06-8
.
Themenverwandte Links
Spiegel: KGB half Karpow – Samaranch als KGB-Spion? – Oppositionsführer Garri Kasparow (SZ-Interview) – Phänomen Kortschnoj – Wie Bobby Fischer den Kalten Krieg gewann – Chess/Essen (Musical) –
.
Leseproben
.
.
.
Politik und Schach in der Ex-DDR (Interview)
.
«Nur eine Minderheit wusste vom Leistungssportbeschluss»
Interview mit dem DDR-Schach-Historiker Manuel Friedel
Thomas Binder
.
 Ende letzten Jahres publizierte der junge Historiker Manuel Friedel eine Bachelor-Arbeit an der Technischen Universität Chemnitz mit dem Titel «Sport und Politik in der DDR am Beispiel des Schachsports» (das «Glarean Magazin» berichtete darüber). «Die Geschichte des Schachsports in der DDR ist nahezu komplett unerforscht», stellte dabei Friedel in dieser seiner Untersuchung fest, die für wichtige Teilbereiche einige wissenschaftliche Grundsteine für zukünftige Forschungsarbeit legte.
Ende letzten Jahres publizierte der junge Historiker Manuel Friedel eine Bachelor-Arbeit an der Technischen Universität Chemnitz mit dem Titel «Sport und Politik in der DDR am Beispiel des Schachsports» (das «Glarean Magazin» berichtete darüber). «Die Geschichte des Schachsports in der DDR ist nahezu komplett unerforscht», stellte dabei Friedel in dieser seiner Untersuchung fest, die für wichtige Teilbereiche einige wissenschaftliche Grundsteine für zukünftige Forschungsarbeit legte.
Um die Thematik etwas zu vertiefen, hat «Glarean»-Mitarbeiter Thomas Binder dem jungen DDR-Forscher ein paar Fragen zu seinem Buch und dessen Ergebnissen gestellt. –
.
Glarean Magazin: Herr Friedel, welchen Bezug haben Sie persönlich zum Schachspiel?
Manuel Friedel: Ich selbst bin ein Amateurschachspieler mit rund 1800 DWZ und spielte einige Jahre für den ESV Nickelhütte Aue in der Bezirksliga. Seit 2002 spiele ich allerdings nicht mehr im Verein, sondern nur noch gelegentlich einige Internetpartien. Ich verfolge aber nach wie vor gespannt das internationale Schachgeschehen. Ich habe mich auch schon immer für die Geschichte des Schachspiels interessiert.

Grundlagenforschung in Sachen DDR-Schach: Manuel Friedels Bachelor-Arbeit «Sport und Politik in der DDR»
GM: Wie kamen Sie eigentlich auf das Thema Ihrer Bachelor-Arbeit?
MF: Es kamen wohl mehrere Faktoren zusammen. Zum einen interessiere ich mich besonders für die Deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts, worauf ich auch meinen Studienschwerpunkt gelegt habe, und zum anderen interessiert mich, wie ich bereits erwähnt habe, die Geschichte des Schachspiels. Da kam mir irgendwann die Idee, meine Abschlussarbeit zum DDR-Schach zu schreiben.
Bei meinen ersten Recherchen zum DDR-Schach habe ich mit Erstaunen festgestellt, dass es noch kein Buch zu diesem Thema gab. Das sah ich als Herausforderung an, weil ich «Pionierarbeit» leisten musste und mich auf keine Sekundärliteratur stützen konnte. Ich habe dann mit meinen beiden Dozenten, Prof. Kroll und Dr. Thoß gesprochen, ob sie die Arbeit betreuen würden. Sie stimmten beide sofort zu, worüber ich sehr froh war.
Allerdings bereitete mir der Mangel an Quellen einige Bauchschmerzen, weshalb ich zwischendurch überlegte, das Projekt abzubrechen. Aber meine Freunde haben mir immer wieder Mut gemacht, die Arbeit zu Ende zu führen.
GM: War es schwer, für dieses Thema offene Ohren an der Universität zu finden, oder stießen Sie auf Verständnis?
MF: Wie erwähnt willigten beide Dozenten sofort ein. Mir kam auch der Umstand zugute, dass Dr. Thoß sich sehr für die DDR und deren Sportgeschichte der Neuzeit interessiert. Er konnte mir deshalb auch sehr wertvolle Hinweise zu der Arbeit geben.
GM: Welche Quellen konnten Sie erschließen? Manches war ja wohl bisher nicht veröffentlicht?
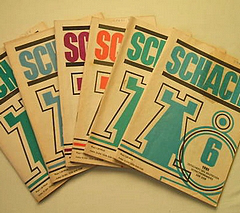
Propaganda-Träger der sozialistischen Schach-Politik: Die ab 1953 einzige in der DDR herausgegebene Schachzeitschrift «Schach»
MF:Ich habe mir einige Akten des Bundesarchives in Berlin-Lichterfelde angesehen. Allerdings konnte ich nicht sonderlich viele neue Erkenntnisse gewinnen. Ich hatte mir von dem Archivbesuch mehr erhofft.
Ich habe mir dazu sämtliche Ausgaben der Zeitschrift «Schach» bis 1990 angesehen und einige Artikel aus dem «Neuen Deutschland» und noch ein paar kurze Artikel aus anderen Zeitschriften. Weiterhin führte ich zwei Zeitzeugen-Interviews mit GM Knaak und GM Uhlmann, die auch sehr hilfreich waren. Im Internet fand ich außerdem zwei Interviews mit Ernst Bönsch und Paul Werner Wagner, die ich ebenfalls mit in die Arbeit einfließen ließ. In einigen Büchern gab es hier und dort einen Absatz zum Schach in der DDR, aber es gab eben noch kein Überblickswerk zum DDR-Schach.
Meine Arbeit war deswegen wie ein Puzzle, weil es galt, viele kleine Bausteine zusammenzusetzen, um einen groben Überblick zu gewinnen.
GM: Sie fanden Kontakt zu wichtigen Zeitzeugen, die Hintergrundinformationen geben konnten ?
MF: Ja, die Interviews mit GM Uhlmann und GM Knaak gaben mir viele Hintergrundinformationen, ebenso die Interviews im Internet mit Paul Werner Wagner und Ernst Bönsch. Allerdings stellte sich schnell heraus und war auch nicht anders zu erwarten, dass diese vier Zeitzeugen einige widersprüchliche Auskünfte gaben; schließlich sind alle vier subjektiv durch ihre persönlichen Erfahrungen geprägt. Wie heißt es so schön: «Der Zeitzeuge ist der Feind des Historikers». Es galt also diese Aussagen zu hinterfragen und zu gewichten. Ähnlich subjektiv gefärbt war natürlich die Autobiografie von Manfred Ewald; Autobiografien neigen immer dazu, dass eigene Handeln im Nachhinein zu rechtfertigen und in ein besseres Licht zu rücken.

Vom Stasi-Häftling zum Präsidenten der Emanuel-Lasker-Gesellschaft: Kulturmanager und DDR-Schach-Zeitzeuge Paul Werner Wagner
GM: Woran liegt es wohl, dass es bislang keine umfassende Darstellung des DDR-Schachs gibt?
MF: Ich habe mich auch gefragt, warum zu diesem interessanten Thema noch keiner etwas geschrieben hat. Eine Antwort auf diese Frage weiß ich leider auch nicht.
GM: Gab es bisher erwähnenswertes Feedback auf Ihre Arbeit von Spielern oder Funktionären aus der Zeit des DDR-Schachs?
MF: Nein, bisher nicht.
GM: Ich wurde in letzter Zeit oft mit dem Gedanken konfrontiert, wonach das Schach in der DDR in hohem Ansehen gestanden haben müsste, weil es in der Sowjetunion hohe Achtung genoß. Haben Sie dieses Vorurteil auch erfahren?
MF: Ja – aber die DDR-Sportsführung hatte kein besonderes Interesse am Schach. Sie verteidigten sich immer wieder mit dem Argument, dass sie das Schachspiel bereits genug fördern würden, und dass nicht noch mehr Geld für diesen Sport – sofern er als Sport gesehen wurde – vorhanden wäre.
Ich habe vor wenigen Tagen (also erst nach dem Erscheinen meines Buches) ein neues Dokument (datiert vom 10.April 1987) aus dem Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde («Finanzielle Handlungsspielräume – Konsequenzen einer Gleichstellung des sogenannten ‘Sport II’ mit den besonders geförderten Sportarten») gefunden, in dem es u.a. heißt:
«Nicht zugestimmt werden kann […] der These, dass bei der Popularisierung des Schachsports durch die Massenmedien unzureichende Beiträge geleistet werden. Wie keine zweite Sportart in der DDR ist das Schach Gegenstand von Beiträgen im ND, in den Organen der Bezirksleitungen der SED, in der ‘Jungen Welt’, im ‘Sportecho’ und anderen Tageszeitungen […] Auch das Fernsehen und der Rundfunk leisten unter Beachtung der Spezifik der Darstellung dieser Sportart eine verantwortungsbewußte Arbeit […] Die DDR ist das Land, in dem die reichhaltigste Schachliteratur in der Welt produziert und der Bevölkerung angeboten wird»…
GM: Zentraler Punkt beim Rückblick auf 40 Jahre Schach in der DDR bleibt der unselige ‘Leistungssportbeschluss‘. Stimmt es eigentlich, dass diesen bisher niemand als Dokument gesehen hat, er nur mündlich vermittelt wurde?
MF: Wie ich leider erst nach Publikation meiner Arbeit herausgefunden habe, kann man den Beschluss, der auf das Jahr 1969 zurückgeht, in einigen Quellenpublikationen mittlerweile ansehen.
GM: Haben Sie bei Ihren Recherchen Anhaltspunkte dafür gefunden, dass es unter den führenden Schachspielern der DDR Versuche des Widerstands gegen diesen Beschluss gegeben hat?
MF: Es gab insgesamt genügend Widerstand gegen diesen Beschluss. Aber in wie weit die DDR-Spitzenspieler Widerstand leisteten oder überhaupt leisten konnten, kann ich (noch) nicht genau sagen. Es gab auf alle Fälle aus dem Ausland genügend Versuche, die DDR in das internationale Schachgeschehen wieder zu integrieren.
GM: Im Rückblick überlagert die «Diskriminierung» der Schachspieler nach 1972 das Bild deutlich. Umgekehrt erscheinen die frühen Jahre als eine Blütezeit des DDR-Schachs auch im Spitzenbereich – mit der Olympiade in Leipzig 1960 als Höhepunkt. Hat also der Leistungssportbeschluss nicht nur die Wettkampfchancen der Spitzenspieler, sondern auch die öffentliche Wahrnehmung völlig verändert?
MF: Nur eine Minderheit wusste von diesem Beschluss; er wurde schließlich nur mündlich verbreitet. GM Knaak sagte mir, dass er immer wieder gefragt wurde, warum denn die DDR nicht an der Olympiade teilnahm. Die Leute dachten, so sagte er mir, dass die DDR zu schlecht sei, um an dieser Olympiade teilzunehmen, obwohl man sich nicht für die Olympiade qualifizieren musste. Die Verwunderung über die Absenz der DDR war also schon da. Die Zeitschrift «Schach» hat versucht, um dieses Problem herumzuschreiben. Man kann also schon sagen, dass das Image des DDR-Schachs unter diesem Beschluss gelitten hat.
GM: Da sich Ihr Buch im Rahmen einer Bachelor-Arbeit in Umfang und Form an einigen Stellen beschränken musste, bleibt die Frage, ob das gesammelte Material vielleicht die Grundlage einer weiterführenden Darstellung sein könnte?
MF: Ich werde dieses Thema auf alle Fälle weiterverfolgen. Gerade was den «Leistunssportbeschluss» angeht, habe ich seit dem Erscheinen des Buches einige neue Erkenntnisse hinzugewonnen, auch wenn einiges noch im Dunkeln liegt und vielleicht auch liegen bleiben wird.
An der einen oder anderen Stelle kann man das Buch mit Sicherheit auch noch vertiefen. Wenn ich genügend neues Quellenmaterial gesammelt und ausgewertet habe, werde ich evtl. eine neue Auflage des Buches anstreben. ■
Weiterführende Links: Politisierung des DDR-Spitzensports
.
.
.
.
Manuel Friedel: Schach und Politik in der DDR
.
Zwischen sportlicher Höchstleistung und staatlicher Ideologie
Thomas Binder
.
 «Die Geschichte des Schachsports in der DDR ist nahezu komplett unerforscht», stellt Manuel Friedel in seiner unlängst erschienenen Untersuchung «Sport und Politik in der DDR am Beispiel des Schachsports» einleitend fest. In seiner Bachelor-Arbeit an der TU Chemnitz hat der junge Historiker – über dessen persönlichen Bezug zum Thema wir leider nichts erfahren – zumindest für einen wichtigen Teilbereich die Grundsteine gelegt.
«Die Geschichte des Schachsports in der DDR ist nahezu komplett unerforscht», stellt Manuel Friedel in seiner unlängst erschienenen Untersuchung «Sport und Politik in der DDR am Beispiel des Schachsports» einleitend fest. In seiner Bachelor-Arbeit an der TU Chemnitz hat der junge Historiker – über dessen persönlichen Bezug zum Thema wir leider nichts erfahren – zumindest für einen wichtigen Teilbereich die Grundsteine gelegt.
Das schmale Buch (der substantielle Inhalt beschränkt sich auf gut 40 Seiten) ist Ergebnis einer umfangreichen Forschungsarbeit. Friedel standen dabei unveröffentlichte Archive sowie die Erinnerungen von Zeitzeugen (darunter Großmeister Wolfgang Uhlmann und Rainer Knaak) zur Verfügung.
Sein Text ist als wissenschaftliche Arbeit gestaltet. Jede Aussage wird akribisch mit Quellen belegt, allein das Literaturverzeichnis füllt 10 Seiten. Der Leser muss sich auf diesen Stil einlassen. Sensationelle Enthüllungsgeschichten oder rührende Einzelschicksale wird er nicht finden.
Dennoch ist das Werk angenehm zu lesen. Dafür sorgt der Autor mit einem flüssigen Schreibstil und einer logischen Gliederung. (Da stört es auch nicht, dass zuweilen die Kapitelnummerierung durcheinander gerät; solche kleinen handwerklichen Fehler sind wohl dem Vertriebsmodell «Print on Demand» geschuldet.)
Friedel beschreibt zunächst die frühen Jahre des DDR-Schachs bis zur Gründung des Deutschen Schachverbandes im Jahre 1958. Hier geht er genauer auf Zwistigkeiten und Verfehlungen unter den Funktionären ein – ein Aspekt, der auch manchem sachkundigen Leser neu sein dürfte. Daraus jedoch eine Geringschätzung des Schachs bis in die letzten Jahre der DDR abzuleiten (Seite 51), erscheint etwas gewagt.
Es folgen Erörterungen zur Rolle des Sports und besonders des Schachs im politischen System der DDR. Die Staatsführung hatte früh erkannt, dass sportliche Erfolge die Anerkennung des jungen Staates fördern können. Der Beitrag der Schachspieler hierzu war in den frühen Jahren gewiss bedeutsam, fanden sie doch als erste Sportorganisation Aufnahme in einem internationalen Fachverband.
Als unumstrittenen Höhepunkt in 40 Jahren DDR-Schach arbeitet der Autor die Schach-Olympiade in Leipzig 1960 heraus. Die folgenden Jahre brachten sportlich die größten Erfolge, worauf das Buch allerdings nur sehr summarisch eingeht.
Der Höhenflug des DDR-Schachs endete nach 1972 mit dem unseligen «Leistungssportbeschluss». Die Aktiven nichtolympischer Sportarten konnten fortan nicht mehr an internationalen Meisterschaften teilnehmen oder ins westliche Ausland reisen. Auch die optimalen Trainingsmöglichkeiten des DDR-Sports (Stichwort «Staatsamateure») blieben ihnen versagt.
Das genaue Zustandekommen dieses Beschlusses kann auch Manuel Friedel nicht erhellen. Andere Quellen sprechen hierzu von einem Beschluss des SED-Politbüros im April 1969. Der Autor berichtet aber in interessanten Details, dass alle Versuche, ihn für das Schach zu umgehen zum Scheitern verurteilt waren. Selbst der ungarische Parteichef Kadar gehörte zu den Fürsprechern der ostdeutschen Schachspieler. Ob man freilich eine von Ernst Bönsch organisierte wissenschaftliche Konferenz als Maßnahme gegen diesen Beschluss deuten kann, sei dahingestellt. Man hätte sich diesbezüglich vom Buchautor ein paar Hinweise darauf gewünscht, wie die DDR-Schachspieler (sowohl im Spitzen- wie im Breitensport) mit den Beschränkungen ihrer Turnierpraxis umgingen.
So bleibt im Dunkel, wie es 1988 zum überraschenden Start einer DDR-Mannschaft bei der Schacholympiade kam. Andere Quellen (Tischbierek) führen es auf eine Erkrankung von DTSB-Chef Manfred Ewald zurück, dem eine persönliche Abneigung gegen das Schach unterstellt wird. Bereits mit Beginn des Jahres 1988 gab es erste Anzeichen für ein Aufweichen des Leistungssportbeschlusses. Hatten erneut die Schachspieler (wie damals bei der Aufnahme in die FIDE) einen Damm gebrochen? Diese Frage bleibt leider unbeantwortet, denn sie wurde durch die geschichtliche Entwicklung ab 1989 obsolet.
Damit endet auch Friedels chronologischer Rückblick. Die Entwicklung des Deutschen Schachverbandes in der Wendezeit (z.B. die Ablösung des Präsidenten Werner Barthel 1990) kommt nicht mehr zur Sprache.
Im letzten größeren Kapitel bespricht der Autor die politisch-ideologische Überfrachtung der Zeitschrift «SCHACH». Seine Analyse ist auch hier korrekt und stichhaltig. Dennoch scheint er das Thema etwas überzubewerten, waren doch politische Ergebenheitserklärungen und ideologische Vereinnahmung typisch für alle Publikationen in der DDR.
In den Grenzen einer Bachelor-Arbeit müssen natürlich manche Wünsche des interessierten Publikums offen bleiben. Die strikte Beschränkung auf das Thema «Sport und Politik» blendet jede Darstellung sportlicher Ergebnisse aus. Auch episodische Schilderungen und Erfahrungsberichte sucht der Leser vergeblich. Die Interviews mit Zeitzeugen werden nur indirekt zitiert und Abbildungen, Tabellen oder Grafiken fehlen fast völlig.
Für die noch zu schreibende Geschichte des DDR-Schachs hat Manuel Friedel aber wesentliche Forschungsergebnisse zusammengetragen. Der Themenkomplex ist dabei so wichtig und inhaltsreich, dass er eine weitere Bearbeitung und repäsentative Darstellung verdient. ■
Manuel Friedel, Sport und Politik in der DDR am Beispiel des Schachsports, BoD Norderstedt, 68 Seiten, ISBN 978-3-8391-1709-5
(Lesen Sie hierzu auch unser Interview mit dem Autor Manuel Friedel)
.
Inhalt
1. Einleitung
2. Der Schachverband der DDR
3. Sport und Politik in der DDR
4. Die Bedeutung des Schachs innerhalb des DDR-Sports
5. Die XIV. Schacholympiade 1960 in Leipzig
6. Der Leistungssportbeschluss von 1972 und seine Auswirkungen auf die Turnierpraxis des DDR-Schach
7. Schachsport und Propaganda in der Fachzeitschrift Schach
8. Schlussbetrachtung
.
Leseproben
.
.
.

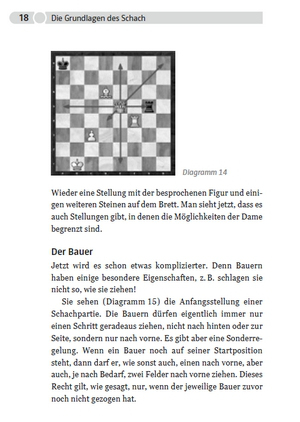


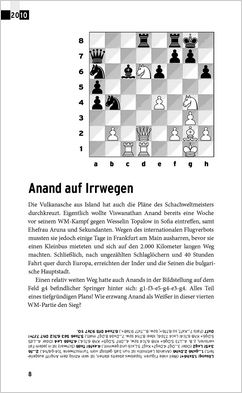



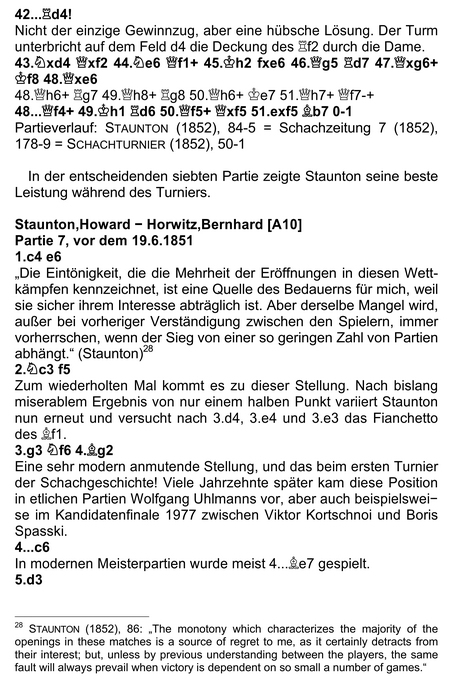



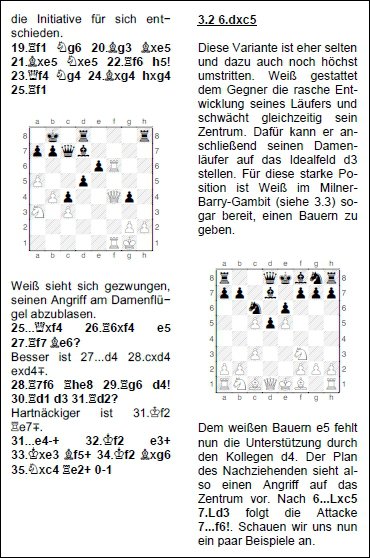
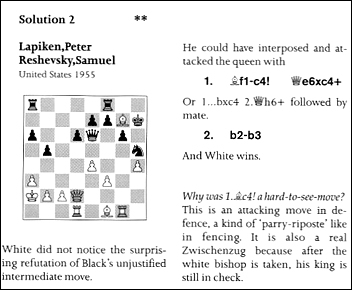
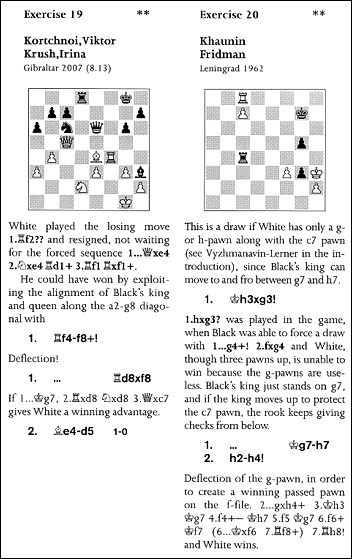









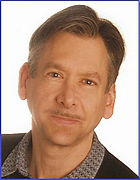

















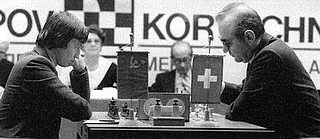





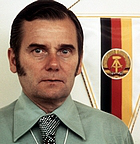








leave a comment