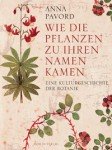oder
Einige Gedanken zum Umgang mit sprachlichen Rassismen
Georg Schober
Unbedacht ausgesprochene Worte können verletzen, und wer sonst als die AdressatInnen derselben wissen, ob und in welchen Maß sie verletzt werden.
Die oftmals bösartigen und rassistischen Postings und LeserInnenbriefe in Zusammenhang mit der „Mohr im Hemd“-Diskussion erlebe ich als zutiefst beschämend und verletzend.
Beim Versuch, die „Diskussion“ von Beginn an in ihren unterschiedlichen Aspekten wahrzunehmen, war ich allerdings erstaunt, wie der „Mohr im Hemd“ auf fm4 und in einer Reihe von Blogbeiträgen, deren AutorInnen sich als AntirassistInnen verstehen, thematisiert wurde.
Im Sinne einer antirassistischen Bewußtseinsbildung scheint es mir nicht zielführend, vorweg apodiktisch festzustellen: „Solche Wörter sind für Schwarze im deutschsprachigen Raum eine der schwersten Beleidigungen …“ und die umgehende Entfernung des Begriffs aus Speisekarten und Sprachgebrauch der ÖsterreicherInnen zu erwarten.
Diese Form der Forderung ist in der Folge auch von vielen Menschen als oberlehrerInnenhaft bis missionarisch empfunden worden. So ist es nicht verwunderlich, daß bisher kaum jemand vom rassistischen und verletzenden Hintergrund des Begriffs „Mohr“ überzeugt werden konnte. Vielmehr wurden eine Menge dem Thema Rassismus gegenüber aufgeschlossene Menschen nicht zuletzt durch die Art und Weise der Argumentationen verärgert oder / und finden die Diskussion einfach nur lächerlich.
Sprache ist etwas Lebendiges und unterliegt einer ständigen Veränderung. Gleichzeitig ist sie auch ein Spiegel der herrschenden Machtverhältnisse. Eine Minderheit kann von der jeweiligen Mehrheit zwar erwarten und verlangen, auf ihre Sichtweise und Erfahrungen einzugehen. Dabei ist es sicher nicht verkehrt, inhaltlich zu argumentieren, ein wenig über Befindlichkeit, Geschichte sowie eventuelle Informationsdefizite der Mehrheitsbevölkerung Bescheid zu wissen und zu versuchen, auch auf diese einzugehen.
War das Unverständnis vieler ÖsterreicherInnen hinsichtlich des Themas „Mohr im Hemd“ wirklich nicht vorhersehbar? Der „Mohr im Hemd“ ist ein Teil der österreichischen kulinarischen Tradition. Für gar nicht so wenige hat er seit ihrer Kindheit etwas Geheimnisvolles, Exotisches und in keiner Weise Abwertendes an sich.
Möglicherweise ist dies bei den meisten ein Grund für ihr Festhaltenwollen am Begriff „Mohr im Hemd“.
Bisher bot die Kampagne um den „Mohr im Hemd“ vor allem rechtspopulistischen Sichtweisen einen „Auftritt“ wie beispielsweise ein Blick in diverse Internetforen zeigt. Mein Eindruck ist: Die Art und Weise, wie die Kampagne geführt wurde, schadet der Antirassimusbewegung mehr als sie ihr nutzt.
Schade, daß die österreichische Antirassismusbewegung zahlenmäßig so schwach in diversen Foren von Tageszeitungen usw. vertreten ist. Es ist fein, sich in der Facebookgruppe „Stop racist Unilever-Campaign in Austria“ gemeinsam mit über 1000 Gleichgesinnten zu wissen. Jene, die es mit Argumenten zu überzeugen gilt, finden sich allerdings an anderen Orten.
Ich bin mir bewußt, daß diese Aufgabe einem Spagat gleicht: einerseits als konsequenter „Anwalt“ aller von Rassismus Betroffenen aufzutreten und andererseits Gesprächsbereitschaft vermeintlich nicht Einsichtigen gegenüber zu signalisieren und so möglichst viele Menschen für gemeinsame positive Ziele zu gewinnen.
Als Beobachter der bisherigen Ereignisse kommt man um die Frage nicht herum, warum sich kaum ein/e Schwarze/r in den bisherigen Prozeß einbringt. Hat das etwas damit zu tun, nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen zu wollen? Oder stehen für die Menschen ganz andere Probleme im Vordergrund? Schade, denn durch die schwache Präsenz der unmittelbar Betroffenen fehlt der Diskussion eines ihrer zentralen Elemente.
Als Schwarze/r lebt es sich in Österreich sicher nicht immer einfach. Umso wichtiger scheint mir beispielsweise, ein realistisches Bild von der Vielfalt Afrikas zu vermitteln. Das impliziert nicht nur das Sichtbarmachen von Stärken und positiven Aspekten, sondern auch die Darstellung von Problemen und Schwächen. Alles andere stärkt letztlich das rechte Lager, dessen offensichtliches „Erfolgs“geheimnis es ja ist, an konkreten gesellschaftlichen Problemen anzuknüpfen und populistische, oftmals menschenverachtende Forderungen bzw. Antworten aus ihnen abzuleiten.
Eine kritische und differenzierte Selbstwahrnehmung und entsprechende Positionierung der Afrika-Community in der Öffentlichkeit wirkt sympathisch und nimmt gleichzeitig jenen gesellschaftlichen Kräften, die für gewöhnlich kein gutes Haar an AfrikanerInnen lassen, zumindest teilweise den Wind aus den rassistischen Segeln.
Andreas Lindinger schreibt in seinem Beitrag „I will mohr“ gestoppt! Ein Pyrrhussieg?: „Dabei weiß ich, dass es auf alle diese Fragen keine eindeutigen Antworten geben wird, sondern dass sie jeder von uns für sich selbst finden muss. Umso wichtiger wäre daher ein breiter, grundsätzlicher Diskurs mit unterschiedlichen Positionen! Danke!“
Dem kann ich mich nur anschließen!
Weitere Blogbeiträge zum Thema „Mohr im Hemd“
Georg Schober: WE WANT MORE! Eine eisige Formulierung heizt die Diskussion um sprachlichen Rassismus an
Andreas Lindinger: Offener Brief betreffend “I will mohr”
Philipp Sonderegger: Wer a Tschusch ist, bestimmen no immer miar!
Gerald Bäck: PC
Gerald Bäck: Wer Rassist ist, bestimmen immer noch wir!
Klaus Werner Lobo: Warum ich Rassist bin
Martin Blumenau: Geschichten aus dem wirklichen Leben
Thomas Knapp: Der Mohr und die linke Sprachverwirrung
Jana Herwig: Warum mir das AIDA-Logo sauer aufstößt, oder: Wider die positivistische Definition der Diskriminierung
Printmedien
Die Presse vom 02.08.2009 : Political Correctness: Was man nicht sagen darf
Kurier vom 29.07.2009: Wenn alte Worte neues Leid bringen