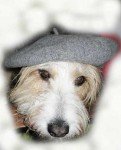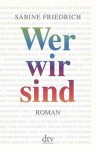Im 19. Teil unseres Literaturquizes wurde nach Oskar Maria Graf gesucht. Im Rahmen dieses literarischen Rätsels finden Sie ausführliche Infos über den Autor.
Die Fragen und Antworten
- Wie heißt der Autor? Oskar Maria Graf
- Wie lautet der Name seiner ersten Frau? Karoline Bretting
- Zu welchem Anlass besuchte der Autor 1934 die UdSSR? 1. Unionskongress der Sowjetschriftsteller
Falls die Informationen, die wir für Sie über Oskar Maria Graf im „Duftenden Doppelpunkt“ zusammengetragen haben, nicht ausreichen, sind Sie eingeladen, in folgenden Sites zu blättern:
Erinnerung: Wenn Sie an die jeweils aktuelle Quizrunde erinnert werden möchten, senden Sie bitte einfach ein leeres Mail mit dem Betreff „Literaturquiz Erinnerung“ an das Literaturblog Duftenden Doppelpunkt.
Alle bisherigen literarischen Rätsel und die das Quiz begleitenden Beiträge können Sie auf der Seite „Literaturquiz zur Bücherverbrennung 1933“ nachlesen.
Das nächste Quiz veröffentlichen wir am Mittwoch, dem 23. Oktober 2013. Zur Beantwortung der Fragen haben Sie bis Dienstag, dem 05. November 2013 um 12:00 Uhr Zeit.
***
Die Preise und ihre GewinnerInnen
Werner Fuld: Das Buch der verbotenen Bücher. Universalgeschichte des Verfolgten und Verfemten von der Antike bis heute aus dem Verlag Galiani geht an Rudolf K.
 „Gibt die Nachwelt jedem verbotenen Buch die ihm gebührende Würde zurück, wie Tacitus angesichts einer Bücherverbrennung vor 2000 Jahren prophezeite? Oder lassen die Flammen gar manche Schrift erst in hellem Licht erstrahlen, die sonst im Dunkeln geblieben wäre? Ovid wurde von Kaiser Augustus im Jahre 13 n. Chr. verbannt, auf dem Vatikanischen Index fanden sich zwar Kant und Gregorovius, nie jedoch Hitler, Lenin oder Marx. Mit ihnen befasst sich Fuld ebenso wie mit erotischer und ketzerischer Literatur, mit den Schwarzen Listen unter den Nazis, in der DDR und natürlich auch in der BRD, wo Texte als ’staatsgefährdende Schriften‘ verboten wurden, die als kommunistisch eingestuft wurden oder Kritik an der Bundesregierung oder den Alliierten übten. Noch heute werden hierzulande im Schnitt jährlich 300 Bücher verboten, 1995 etwa Bret Easton Ellis’ Weltbestseller American Psycho, der erst 2001, nach mehreren Gerichtsverfahren, freigegeben wurde. Fast alle großen Klassiker, von Goethes Werther über Flauberts Madame Bovary und Prousts Récherche bis Joyces Ulysses oder Nabokovs Lolita (zuerst in einem pornographischen französischen Verlag erschienen, weil niemand sonst es drucken wollte), haben z. T. turbulente Verbotsgeschichten aufzuweisen. Doch Fuld widmet sich nicht nur der westlichen Welt. Auch China, Russland und die islamischen Länder hat er im Fokus. Weltweit ist die Liste verbotener Bücher schier endlos, und ständig kommen neue hinzu. Grund genug, ihnen und ihrer Geschichte endlich ein eigenes Buch zu widmen.“
„Gibt die Nachwelt jedem verbotenen Buch die ihm gebührende Würde zurück, wie Tacitus angesichts einer Bücherverbrennung vor 2000 Jahren prophezeite? Oder lassen die Flammen gar manche Schrift erst in hellem Licht erstrahlen, die sonst im Dunkeln geblieben wäre? Ovid wurde von Kaiser Augustus im Jahre 13 n. Chr. verbannt, auf dem Vatikanischen Index fanden sich zwar Kant und Gregorovius, nie jedoch Hitler, Lenin oder Marx. Mit ihnen befasst sich Fuld ebenso wie mit erotischer und ketzerischer Literatur, mit den Schwarzen Listen unter den Nazis, in der DDR und natürlich auch in der BRD, wo Texte als ’staatsgefährdende Schriften‘ verboten wurden, die als kommunistisch eingestuft wurden oder Kritik an der Bundesregierung oder den Alliierten übten. Noch heute werden hierzulande im Schnitt jährlich 300 Bücher verboten, 1995 etwa Bret Easton Ellis’ Weltbestseller American Psycho, der erst 2001, nach mehreren Gerichtsverfahren, freigegeben wurde. Fast alle großen Klassiker, von Goethes Werther über Flauberts Madame Bovary und Prousts Récherche bis Joyces Ulysses oder Nabokovs Lolita (zuerst in einem pornographischen französischen Verlag erschienen, weil niemand sonst es drucken wollte), haben z. T. turbulente Verbotsgeschichten aufzuweisen. Doch Fuld widmet sich nicht nur der westlichen Welt. Auch China, Russland und die islamischen Länder hat er im Fokus. Weltweit ist die Liste verbotener Bücher schier endlos, und ständig kommen neue hinzu. Grund genug, ihnen und ihrer Geschichte endlich ein eigenes Buch zu widmen.“
Via Galiani Verlag
Sabine Friedrich: Wer wir sind aus dem Deutschen Taschenbuch Verlag (dtv) geht an Martina A.
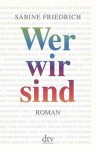 Ein Roman über die Mitglieder des deutschen Widerstands – von der Roten Kapelle und kommunistischen Widerstandsgruppen über die Weiße Rose und den Kreisauer Kreis bis zum 20. Juli.
Ein Roman über die Mitglieder des deutschen Widerstands – von der Roten Kapelle und kommunistischen Widerstandsgruppen über die Weiße Rose und den Kreisauer Kreis bis zum 20. Juli.
„Ein unvergessliches Werk, das Jahrzehnte überdauern wird! Noch nie wurden die Helden der Zivilgesellschaft, die gegen den Nationalsozialismus aufbegehrt haben, so detailreich und spektakulär dargestellt. ‚Wer wir sind‘ ist ein ganz wichtiges Buch! Mit großem sprachlichem Feingefühl erzählt Sabine Friedrich in diesem Werk, an dem sie über sechs Jahre gearbeitet hat. Melodisch und bilderreich beschreibt Susanne Friedrich, genauso aber auch kühl, hart und politisch. Sie findet für jede Szene den richtigen Ton. Sie gibt ihren Figuren ganz viel Leben. Man bekommt ein Gespür für diese echten historischen Figuren. Ein Buch wie ein Denkmal für die Helden des deutschen Widerstands. Ein Meilenstein der deutschen Literatur!“
Via Alex Dengler
Heinrich Mann: Professor Unrat aus dem Fischer Taschenbuch Verlag geht an Ingrid K.
 „Der vorliegende Roman gilt als einer der wichtigsten von Heinrich Mann. Er erschien erstmalig im Jahre 1905 und schildert die makabre Geschichte eines professoralen Gymnasiastenschrecks, einer Spießerexistenz, die in später Leidenschaft einer Kleinstadtkurtisane verfällt und aus den gewohnten bürgerlichen Bahnen entgleist.
„Der vorliegende Roman gilt als einer der wichtigsten von Heinrich Mann. Er erschien erstmalig im Jahre 1905 und schildert die makabre Geschichte eines professoralen Gymnasiastenschrecks, einer Spießerexistenz, die in später Leidenschaft einer Kleinstadtkurtisane verfällt und aus den gewohnten bürgerlichen Bahnen entgleist.
Mit diesem Frühwerk, dessen Verfilmung mit Emil Jannings und Marlene Dietrich unter dem Titel ‚Der blaue Engel‘ zu einem der wenigen wirklichen Welterfolge des deutschen Films wurde, gelang Heinrich Mann eine meisterhafte Karikatur der Wilhelminischen Zeit.“
Via Fischer Taschenbuch Verlag
Pierre Dietz: Briefe aus der Deportation. Französischer Widerstand und der Weg nach Auschwitz aus der Edition AV geht an Herbert H.
 „William Letourneur (…) ist Lederfacharbeiter in einem Vorort von Rouen in der Normandie. Nach dem Einmarsch deutscher Truppen schliesst er sich der kommunistischen Widerstandsgruppe „Front National“ an. Von einem Nachbarn denunziert, gerät er in die Mühlen der Gestapo und wird über Compiègne nach Buchenwald, Lublin und Auschwitz deportiert. Vom Tag seiner Verhaftung bis zur Evakuation aus Lublin, nutzt er jede Gelegenheit heimlich und offiziell Briefe an seine Frau Hélène zu senden.
„William Letourneur (…) ist Lederfacharbeiter in einem Vorort von Rouen in der Normandie. Nach dem Einmarsch deutscher Truppen schliesst er sich der kommunistischen Widerstandsgruppe „Front National“ an. Von einem Nachbarn denunziert, gerät er in die Mühlen der Gestapo und wird über Compiègne nach Buchenwald, Lublin und Auschwitz deportiert. Vom Tag seiner Verhaftung bis zur Evakuation aus Lublin, nutzt er jede Gelegenheit heimlich und offiziell Briefe an seine Frau Hélène zu senden.
Briefe in dieser Fülle und über einen solch langen Zeitraum sind eine historische Rarität. Offiziell durften Briefe zwar geschrieben werden, wurden aber zensiert und gelegentlich willkürlich vernichtet.“
Via Homepage von Pierre Dietz
Paul Graetz: Heimweh nach Berlin. Chansons und Texte von Paul Graetz, Walter Mehring, Friedrich Hollaender, Kurt Tucholsky u. a. CD2: …und wo hab ick Murmeln jespielt? Feature über Paul Graetz von Volker Kühn aus der Edition Mnemosyne geht an Peter R.
 „In den zwanziger Jahren galt er als der komischste unter den Komikern, den die Berliner Theater- und Kabarettszene hervorgebracht hat. Und als der berlinischste unter all den populären Schauspielern, die man mit dem Etikett ‚Schnauze mit Herz‘ versah. Paul Graetz (geb. 1890) war eine Berliner Institution. ‚Wenn du berlinisch brauchst – nimm Graetz!‘, heißt es in einem Tucholsky-Gedicht über den Mann, der in seiner Heimatstadt bald so populär war, daß selbst seriöse Kritiker von ihm zuweilen nur als dem ‚Paule‘ sprachen.
„In den zwanziger Jahren galt er als der komischste unter den Komikern, den die Berliner Theater- und Kabarettszene hervorgebracht hat. Und als der berlinischste unter all den populären Schauspielern, die man mit dem Etikett ‚Schnauze mit Herz‘ versah. Paul Graetz (geb. 1890) war eine Berliner Institution. ‚Wenn du berlinisch brauchst – nimm Graetz!‘, heißt es in einem Tucholsky-Gedicht über den Mann, der in seiner Heimatstadt bald so populär war, daß selbst seriöse Kritiker von ihm zuweilen nur als dem ‚Paule‘ sprachen.
1933 floh Paul Graetz nach England und von dort aus 1935 weiter in die USA. In Hollywood wollte er sein Glück versuchen. Aber er fand sich in der Neuen Welt nur schwer zurecht. Er spielte zwar kleine Rollen in sog. B-Pictures, aber an eine Fortsetzung seiner Berliner Karriere war nicht zu denken. Am 16. Februar 1937 starb er – ganze 46 Jahre alt – im ungeliebten Exil.“
Via Edition Mnemosyne
Blecken, Gudrun: Lyrik der Nachkriegszeit (1945-60). Interpretationen zu wichtigen Werken der Epoche aus dem C. Bange Verlag und Meno Burg: Geschichte meines Dienstlebens. Erinnerungen eines jüdischen Majors der preußischen Armee aus dem Verlag Hentrich & Hentrich geht an Gabriele W.
 „Der Band Lyrik der Nachkriegszeit aus der Reihe Königs Erläuterungen Spezial ist eine verlässliche und bewährte Interpretationshilfe für Schüler und weiterführende Informationsquelle für Lehrkräfte und andere Interessierte: verständlich, übersichtlich und prägnant. Mithilfe der ausführlichen Informationen zur Epoche, den wichtigsten Vertretern und deren Werken sind Schüler fundiert und umfassend vorbereitet auf Abitur, Matura, Klausuren und Referate zu diesem Thema.“
„Der Band Lyrik der Nachkriegszeit aus der Reihe Königs Erläuterungen Spezial ist eine verlässliche und bewährte Interpretationshilfe für Schüler und weiterführende Informationsquelle für Lehrkräfte und andere Interessierte: verständlich, übersichtlich und prägnant. Mithilfe der ausführlichen Informationen zur Epoche, den wichtigsten Vertretern und deren Werken sind Schüler fundiert und umfassend vorbereitet auf Abitur, Matura, Klausuren und Referate zu diesem Thema.“
Via C. Bange Verlag
 „Der erste und lange Zeit einzige jüdische Offizier Preußens, der ‚Königliche Major Meno Burg‘, durchaus respektvoll ‚Judenmajor‘ genannt, zählte zu den Honoratioren Berlins. Als er 1853 auf dem Jüdischen Friedhof in der Schönhauser Allee zu Grabe getragen wurde, folgten dem Sarg 60.000 Menschen – das war nahezu jeder siebente Berliner Bürger. Seine Kameraden, seine Glaubensbrüder, seine Freunde und Gönner konnten wenige Monate nach seinem Tod die Erinnerungen des ‚Judenmajors‘ an seine Dienstjahre im preußischen Heer lesen, die dieser kurz zuvor beendet hatte. Nach fast 150 Jahren fesseln die Memoiren den Leser wie zur Zeit ihrer ersten Veröffentlichung.“
„Der erste und lange Zeit einzige jüdische Offizier Preußens, der ‚Königliche Major Meno Burg‘, durchaus respektvoll ‚Judenmajor‘ genannt, zählte zu den Honoratioren Berlins. Als er 1853 auf dem Jüdischen Friedhof in der Schönhauser Allee zu Grabe getragen wurde, folgten dem Sarg 60.000 Menschen – das war nahezu jeder siebente Berliner Bürger. Seine Kameraden, seine Glaubensbrüder, seine Freunde und Gönner konnten wenige Monate nach seinem Tod die Erinnerungen des ‚Judenmajors‘ an seine Dienstjahre im preußischen Heer lesen, die dieser kurz zuvor beendet hatte. Nach fast 150 Jahren fesseln die Memoiren den Leser wie zur Zeit ihrer ersten Veröffentlichung.“
Via Verlag Hentrich & Hentrich
 Der Nationalratpräsidentin Mag.a Barbara Prammer ist es zu danken, dass die zahlreichen Veranstaltungen, mit denen heuer in Österreich vom Neusiedlersee bis zum Bregenzer Wald an die Novemberpogrome vor 75 Jahren erinnert wird, in der Broschüre „Gedenken 75 Jahre Novemberpogrom“ zusammengefasst vorliegen.
Der Nationalratpräsidentin Mag.a Barbara Prammer ist es zu danken, dass die zahlreichen Veranstaltungen, mit denen heuer in Österreich vom Neusiedlersee bis zum Bregenzer Wald an die Novemberpogrome vor 75 Jahren erinnert wird, in der Broschüre „Gedenken 75 Jahre Novemberpogrom“ zusammengefasst vorliegen.