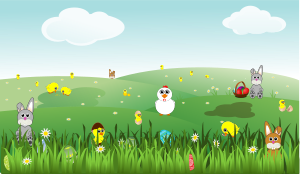Kurze Erinnerung an Ingeborg Bachmann
Dienstag, 12. Juli 2016Die österreichische Schriftstellerin Ingeborg Bachmann wurde am 25. Juni 1926 in Klagenfurt geboren. Sie starb am 17. Oktober 1973 in Rom (gelegentliches Pseudonym Ruth Keller). Sie gilt als eine der bedeutendsten deutschsprachigen Lyrikerinnen und Prosaschriftstellerinnen des 20.Jahrhunderts. Ihr zu Ehren wird seit 1977 jährlich der Ingeborg-Bachmann-Preis verliehen.
Von 1945 bis 1950 studierte sie Philosophie, Psychologie, Germanistik und Rechtswissenschaften an den Universitäten Innsbruck, Graz und Wien.
Als historischer Werdegang soll ein kurzer unvollkommener Überblick über ihr literarisches Schaffen dienen:
Die erste Veröffentlichung von ihr ist die Kurzerzählung: „Die Fähre“. (Erschienen 1946, in der Kärntner Illustrierten.)[1]
Weiters ist ihre Zeit als Hörfunkredakteurin beim Wiener Sender Rot-Weiß-Rot, (1951–1953) erwähnenswert. Sie schrieb 1952 ihr erstes Hörspiel „Ein Geschäft mit Träumen“ und verfasste elf Folgen der sehr beliebten wöchentlichen Radiofamilie und je zwei weitere mit Jörg Mauthe bzw. Peter Weiser.[2][3] 1953 las sie zum ersten Mal auf der Tagung der Gruppe 47.
Mit Hans Werner Henze entstanden ab 1955 das Hörspiel „Die Zikaden“, die Textfassung für die Ballettpantomime „Der Idiot“ und die Opernlibretti „Der Prinz von Homburg“ und „Der junge Lord“.
1956 veröffentlichte Ingeborg Bachmann ihren zweiten Gedichtband „Anrufung des Großen Bären“. Ebenfalls 1958 entstand das Hörspiel „Der gute Gott von Manhattan“, [4]
Der erste Erzählband von ihr „Das dreißigste Jahr“ erschien 1961. Dafür bekam Sie den Deutschen Kritikerpreis. Die zwei Geschichten „Ein Schritt nach Gomorrha“ und „Undine geht“ wird zu den frühesten feministischen Äußerungen der deutschsprachigen Literatur der Nachkriegszeit gezählt.[5]
Ungefähr 1965 begann Sie an der unvollendet gebliebenen Romantrilogie „Todesarten“ zu schreiben, von der sie 1971 den ersten Band „Malina“ veröffentlichte.
Sibylle Gramer schreibt: „In der Literatur von Ingeborg Bachmann sterben die Frauen am Denken, an ihrer scheinhaften Existenz als Männerphantasien, ihrer kulturellen Fremdheit und Außenseiterschaft. Sie gehen an ihrer Geschlechtsidentität zugrunde, die mehr und etwas anderes ist als die sexuelle Differenz vom Männlichen.[6]
Die österreichische Dichterin plante einen Umzug von Rom nach Wien, als sie nach einem Unfall, bei dem sie sich schwere Brandwunden zugezogen hatte, drei Wochen danach, am 17. Oktober 1973, ihren Verletzungen im San-Eugenio-Krankenhaus von Rom erlag.“
Wie genau sie sich mit den Verhältnissen in Österreich beschäftigte, geht aus einem Artikel von Ilse Leitenberger in der Tageszeitung „Die Presse“ aus dem Oktober 1973 hervor. Teile dieses Artikels wurden wortgleich zwei Jahre zuvor in „DIE ZEIT“ vom 9. April 1971 veröffentlicht, das Interview führte damals Toni Kienlechner. Leitenberger war als NSDAP-Mitglied im Zweiten Weltkrieg Redakteurin im Nachrichtenbüro des Goebbels-Ministeriums. Später avancierte sie zur Herausgeberin des Literaricum der Presse und zur stellvertretenden Chefredakteurin der Tageszeitung. Es scheint so, dass noch im Nachhinein diese Figuren, indem sie sich billige Nachrufe erlaubten, über die Antifaschistin Ingeborg Bachmann gesiegt haben. Sie schreibt: ”… ich habe schon vorher darüber nachgedacht, wo fängt der Faschismus an. Er fängt nicht an mit den ersten Bomben, die geworfen werden, … Er fängt an in Beziehungen zwischen Menschen. Der Faschismus ist das erste in der Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau …” (GuI S. 144)
Auf die innere Auseinandersetzung – nach dem: „sozialen Befund in „Malina“ von Kienlechner befragt, antwortete Bachmann: „…, für mich wäre es wichtiger, dass beschrieben wird, wie aus dem schwarzen Markt der Nachkriegsjahre der wirkliche schwarze Markt geworden ist – der damals gar nicht so schwarz war wie der heute.Das hat natürlich nichts mit einer Analyse der Wirtschaftsstruktur zu tun, müsste sie aber auf die eine oder andere Weise treffen. Denn auf diese andere Weise trifft man die universelle Prostitution, die Prostitution des Menschen in allen Zusammenhängen und in der Arbeit …“.
Im Nachruf von Friedrich Heer über Ingeborg Bachmann in der Presse, erzählte er, dass sie ihm in Rom im Februar 1973 erzählt habe, sie möchte sich nur mehr mit österreichischen Problemen befassen, literarisch befassen, und dass es deshalb eben notwendig sei, in diese Stadt (Wien), die ihr unheimlich wär, unheimlich dem Mädchen aus Kärnten, das scheu mit seinen großen Augen die Welt sieht, wie sie ist, diese ungeheuerliche Welt. … .
Sie wurde 47 Jahre alt. Damals sah sie in der 68er Bewegung eine Weltjugend, die in Empörung und Verzweiflung aufbricht.
1. Kärntner Illustrierte: Die erste Veröffentlichung von Ingeborg Bachmann, die Kurzerzählung: „Die Fähre“.
2. Ingeborg Bachmann: Die Radiofamilie. Hrsg. Joseph McVeigh, Suhrkamp, Berlin 2011, ISBN 978-3-518-42215-1, S. 402 f.
3. Ina Hartwig: „Die Ingeborg hat ein Ei gelegt.“ Im Nachlass entdeckt: „Die Radiofamilie“. Ingeborg Bachmann überrascht als famose Unterhaltungsautorin. In: Die Zeit. Hamburg, Nr. 22, 26. Mai 2011, S. 54.
4. zum Hörspiel siehe Jean Firges: Literatur
5. Biographie auf Fembio.org
6. Gramer Sibylle, Von weiblicher Autorschaft zu feministischer Literatur.. Das Beispiel Österreichischer Autorinnen. Erschienen in „Literarische Moderne, Europäische Literatur im 19. Und 20. Jahrhundert. Rowohlt, 1995. Herausgegeben von Burghard König.
Ingeborg Bachmann – Biographie auf Wikipedia
Ilse Leitenenberger – Biographie