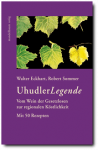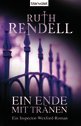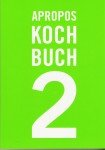Eine Rezension am Prüfstand
Sonntag, 15. März 2009Markus Berger hat Helmuth Schönauers Ansichten über die Anthologie „Rote Lilo trifft Wolfsmann“ – Literatur der Arbeitswelt kritisch unter die Lupe genommen.
Wir danken ihm für die zur Verfügungstellung des Textes.
Eine Reihe weiterer Rezensionen und Pressemeldungen über die „Rote Lilo“ finden Sie auf der Seite „Pressemeldungen und Hinweise“ im „Duftenden Doppelpunkt“
Rote Lilo trifft Wolfsmann – Rezension und Kommentar auf biblio.at
Österreichisches Bibliothekswerk – eine wunderbare Site zum Thema Literatur
Ich habe das Buch „Rote Lilo trifft Wolfsmann“ vor einigen Wochen gelesen und bin kürzlich auf die obige Rezension von Helmut Schönauer gestoßen.
Ich teile die Ansicht von Helmut Schönauer nicht und möchte hier meine Gedanken dazu äußern.
Eine gelungene Rezension gibt den Lesenden eine wertvolle Entscheidungshilfe für die Auswahl von Lektüre. Idealerweise ist sie nicht nur vom Geschmack und den Vorlieben der Rezensierenden abhängig, sondern versucht auch auf der Grundlage von Fakten, sowohl die Stärken als auch die Schwächen des jeweiligen Werkes herauszuarbeiten. Durch eine, ich möchte sie solidarisch-kritische Buchbesprechung nennen, gewinnen alle. Sie hilft den Lesenden, einen Fehlkauf zu vermeiden und sie kann den Schreibenden durchaus wertvolle Anregungen für die literarische Arbeit „liefern“.
Von Rezensenten erwarte ich dreierlei: Interesse am Buch, grundlegendes Wissen über die zu besprechende Literaturgattung und ein aufmerksames Lesen.
Helmut Schönauer erfüllt diese Ansprüche an eine qualitätvolle Rezension meinem Dafürhalten nach in keiner Weise. Einige Beispiele gefällig?
„Bei dieser Dokumentation eines Literaturwettbewerbes geht es nämlich erst ziemlich spät um Literatur, in der Hauptsache wird verhandelt, wie Einsender/innen ausgesiebt, in Vorläufe und Hauptläufe gesteckt, und schließlich von Tutoren so richtig für die Literatur der Arbeitswelt her gebraten worden sind.“
Das Taschenbuch „Rote Lilo Trifft Wolfsmann“ Literatur der Arbeitswelt umfaßt 154 Seiten. Das Vorwort der Herausgeber umfaßt ganze 5 Seiten. In ihm wird die Anthologie vorgestellt und ein kurzer Abriss des Literaturpreises, dessen Ergebnis das Buch darstellt, gegeben. Auf weiteren 4 Seiten gibt Michael Tonfeld einen Überblick über die Geschichte der „Literatur der Arbeitswelt“ von ihren Anfängen im deutschsprachigen Raum bei Weerth, Freiligrath und Herwegh bis in die Gegenwart.
Ich glaube nicht, dass Menschen, die an der „Literatur der Arbeitswelt“ Interessse finden, eine Einleitung von 9 Seiten als zu lange empfinden.
„Die Sieger des ersten Vorlaufs verwenden Außenseiterpositionen, um die Arbeitswelt darzustellen. […] In Hildegard Kaluzas Beitrag Be-Hinderung arbeiten in einer geschützten Werkstätte die Protagonisten sorgfältig und mit größter Hingabe. Sie erzeugen Stecker, aber fragen sich nie, wo diese eigentlich abgeliefert werden. Als der Auftraggeber die Firma schließen will, weil offensichtlich zu teuer produziert wird, bricht großes Heulen aus.“
Vergleicht man den Inhalt des Buches mit der Rezension, so tauchen Fragen über Fragen auf: Behinderte als Außenseiter? Darf da ein etwas seltsames Menschenbild seitens des Rezensenten vermutet werden?
Wirklich zu teuer produziert? Warum übernimmt Herr Schönauer, scheinbar unreflektiert, den Standpunkt des Unternehmers im Text? Sitzt er vielleicht auf einem dicken Bündel Aktien? Wahrscheinlicher scheint, dass dem Autor die Literatur zum Elfenbeinturm gerät und seine Kenntnisse der Arbeitswelt und Lohnarbeit zu wünschen übrig lassen. Hat er noch nie gehört, dass zum Zwecke der Gewinnmaximierung ganze Fabriken „über Nacht“ geschlossen werden und die Produktion in sogenannten Billiglohnländer verschoben wird?
Und das große Heulen? Das bricht übrigens keineswegs aus. Liest man den Text zu Ende zeigt sich: Die behinderten Menschen sind bereit, um ihren Arbeitsplatz zu kämpfen. Sie beschließen, gemeinsam den Auftraggeber aufzusuchen und mit ihm zu sprechen. Klugerweise haben sie zuvor Kontakt zu den Medien Aufgenommen, ein Mann vom Fernsehen ist mit von der Partie und die letzten beiden Sätze von Hildegard Kaluzas Text lassen hoffen: „Der kann uns die Stecker nicht wegnehmen, oder?“, fragt sie leise. Dennis schüttelt den Kopf: „Nein“, sagt er, „nein.“
Markus Berger