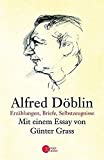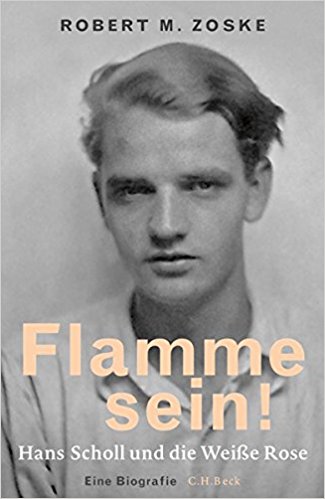Zurück zu den blauen Bänden
Eine Anthologie von Werken Alfred Döblins vereint Lebenszeugnisse und Fiktionen
Von Jan Wiele
Noch immer ist Alfred Döblin vielen nur als Autor von "Berlin Alexanderplatz" bekannt: Schwerpunktthema ist der Roman im Abitur, unberührt aber stehen die restlichen, oft drohend umfangreichen Bände der hellblauen Gesamtausgabe in den Regalen der Seminarbibliotheken.
Zum fünfzigsten Todestag Döblins (26. Juni 2007) hat die Mitherausgeberin des Gesamtwerkes Christina Althen eine Anthologie zusammengestellt, die den Spagat zwischen "Leben" und "Werk" versucht, also sowohl aus Erzählungen und Romanen als auch aus autobiografischen Schriften schöpft. Ein solches Unterfangen - der Band umfasst nur knapp 200 Seiten - kann wohl "allenfalls dazu beitragen, Sie neugierig zu machen, Sie zu Döblin zu verführen, damit er gelesen werden möge".
Dies zumindest war der Wunsch von Günter Grass, als er zum zehnten Todestag 1967 an Döblin erinnerte; sein bereits oft zitierter Lobgesang "Über meinen Lehrer Döblin" steht dem Buch voran. Die Aufmachung durch den Verlag darf man wohl etwas reißerisch nennen - so bezeichnet der Klappentext Döblin als "großen Schriftsteller", seine Sprache als "spritzig, frech und modern". Dass man Döblin heute erst noch das Attribut "modern" verleihen muss, ist schon ein starkes Stück, die Kombination mit "spritzig" und "frech" klingt dazu wie aus einem Frisurenkatalog. "Modern" scheint hier also im nivellierten Sinne von "der Zeit voraus" gemeint zu sein. Dies wiederum, so bedauerlich die Werbestrategie auch ist, liefert letztlich die volle Rechtfertigung des Bändchens: dass nämlich Döblins Prosa nicht nur neben der seiner Zeitgenossen, sondern selbst neben vieler heute erscheinender geradezu avantgardistisch wirkt.
Mit sicherem Blick hat die Herausgeberin kurze und aussagekräftige Textstücke ausgewählt, die Döblins Lebensstationen, abgesehen von der als paradiesisch empfundenen Stettiner Kindheit, bald als lange "Kette von Vertreibungen" erweisen: nach Berlin, nach Frankreich und Kalifornien bis zur Rückkehr ins Nachkriegsdeutschland. Das sind bewegende Szenen des zwanzigsten Jahrhunderts. Die Scheidung von Fiktion und Leben wird ganz deutlich, wenn Döblin selbst im Rückblick auf den komischen Roman "Babylonische Wandrung", dessen göttlicher Erzähler Entthronung und Exil leichtfüßig und heiter auf sich nimmt, resümieren muss: "Dieser Gott war ich - nicht. Ich erfuhr es langsam, teils allmählich, teils ruckweise."
Aber auch, was die literarische Schreibweise angeht, ist die Sammlung als Augenöffner gedacht: Den "Döblinismus", auf den sich Döblin 1912 im Dialog mit dem Futuristen Marinetti berief, gibt es wirklich. Seine Merkmale sind Lakonie und Sachlichkeit im Angesicht des Schrecklichen und Schrecklichsten, die doch Sympathie und Mitleid des Lesers nur steigern, ob nun das Endstadium der Schüttellähmung bei Döblins Mutter oder der "Mord an Karl und Rosa" beschrieben wird. Natürlich denkt man dabei auch wieder an Franz Biberkopf, an Schlachthofszenen und die Mieze. Aber das gerade ist ja die Einsicht, die hier dankbar vermittelt wird: Die Darstellungsweise des "Alexanderplatz" war nicht ein einmaliger Wurf, sondern eine noch immer gültige Methode, mit der eine extreme Welthaltigkeit von Literatur erreicht werden kann. Effektiver kann man nicht erzählen - so etwa, wenn Gesprächsfetzen der heimtückischen Mörder Karl Liebknechts montiert werden: "Unfallstation am Zoo, wir liefern ihn ab, wir sind die feinen Leute, Samariter, haben ihn unterwegs auf der Chaussee irgendwo gefunden, blutend. Haben solche Angst, ist er vielleicht noch zu retten?" Dieser Schlussteil des Großromans "November 1918", der auch für sich stehend eine geschlossene Erzählung abgibt, gehört ins Lesebuch für die Oberstufe.
Glasklar zeigt sich schließlich noch der Satiriker Döblin in "Fotos ohne Unterschrift", einem in vorgeblicher Unkenntnis der dargestellten Personen verfassten Kommentar zu acht Künstlerporträts, für den der Band allerdings den Quellennachweis schuldig bleibt. Mit dieser ulkigen Absage an die Physiognomie steht Döblin in bester Lichtenberg-Tradition, sagt es aber wiederum in seinem ganz eigenen Ton: "Die Natur fühlt sich eben nicht verpflichtet, aus der Visage ein Aushängeschild zu machen." So sieht der Beschreiber in Max Slevogt einen Beamten, "der an seinen Abschied denkt", in Oskar Kokoschka gar einen "slawischen Revolutionär": "Niedrige Stirn, fester Blick, das starke Kinn: dieser junge Mann wird Eisenbahnen in die Luft sprengen."
Aus der Fülle der versammelten Textsorten stechen zudem immer wieder die Themen hervor, die Döblin besonders am Herzen lagen - so etwa seine Sympathie für Menschen mit Wahnkrankheiten, die der psychiatrische Arzt mehrfach als Dichter verarbeitet hat. "Die Fahrt ins Blaue", Dokumentation eines Gesprächs mit einem befreundeten Arzt, berichtet vom Schicksal der Insassen Berliner Irrenanstalten im Nationalsozialismus, die vom Personal selektiert und in Vernichtungslager geschickt wurden.
Weil solchermaßen die stilistischen und thematischen Linien durch das Werk unmittelbar ersichtlich werden, kann die Auswahl als gelungen gelten. Auf ebenso konzise Weise spannt dann noch das Nachwort der Herausgeberin einen Bogen über das Gesamtwerk, wobei viele Wegbegleiter Döblins zu Wort kommen und eine vergnügliche Abgrenzung Döblins von Thomas Mann vorgenommen wird. Es ist zu hoffen, dass sich nach diesem Amuse-Gueule (besonders Berliner Schnauzen wird es schmecken) wieder mehr Leser an das Regal mit den hellblauen Bänden wagen.
|
||