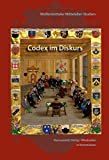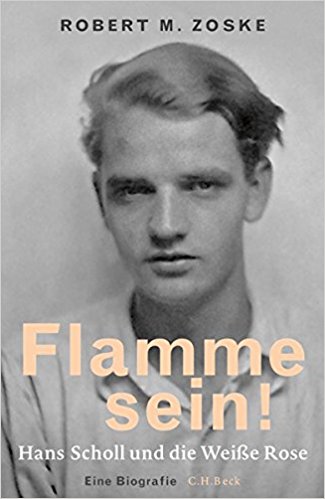Mittelalterliche Büchergeschichten
Neue Inputs zur Codex-Forschung aus dem Wolfenbütteler Mediävistischen Arbeitskreis
Von Monika Studer
Unter dem Titel „Codex im Diskurs“ erschien der Band zur gleichnamigen Tagung, die 2008 als zweite in einer Reihe zu „Theorie und Geschichte des Codex“ in Wolfenbüttel stattfand. Der Begriff des „Diskurses“ wird dabei – wie so häufig – relativ weit gefasst: Die Herausgeber Thomas Haye und Johannes Helmrath wollen darunter das „Sprechen über den Codex im Mittelalter“ verstanden wissen. Während der „Diskurs“ also einleitend kurz, knapp, verständlich und ohne theoretisches Brimborium definiert wird, scheint der Terminus „Codex“ keiner Erklärung zu bedürfen. Hingegen werden die damit zusammenhängenden Begriffe „Kodikalität“ und „Kodifizierung“ vorgestellt, was auf jeden Fall wichtig ist. Die beiden Termini stammen aus dem Wolfenbütteler Kontext und begleiteten alle drei Tagungen zu „Theorie und Geschichte des Codex“. Sie sprechen Aspekte der Materialität und der Sinnhaftigkeit von mittelalterlichen Codizes ebenso an wie Fragen der Buchproduktion. Ob diese Begriffe nachhaltig fruchtbar sein werden für die Codex-Forschung, wird sich weisen.
Im Anschluss an die Einleitung von Haye und Helmrath folgt der Beitrag von Bernd Michael, welcher programmatisch den folgenden Aufsätzen voransteht. Michael greift die Wissenschaftsgeschichte der Kodikologie auf, deren Anfang er bei Friedrich Adolf Ebert, Bibliothekar in Dresden und Wolfenbüttel, im zweiten Viertel des 19. Jahrhunderts sieht. Die von Ebert formulierten Erfordernisse für die Analyse mittelalterlicher Handschriften sind, gemäß Michael, bis heute gültig, was an mehreren Beispielen vorgeführt wird.
Schon Michaels Titel „Büchergeschichten“ macht deutlich, dass im Mittelalter der Diskurs über den Codex sehr häufig parallel läuft zum Diskurs über das Buch per se. Auch die drei nachfolgenden Beiträge von Christian Kiening (über Bücher im Kontext von Frauenmystik des 13. Jahrhunderts), Christel Meier (über Visionsliteratur im 12. und 13. Jahrhundert) und Hartmut Bleumer (über den Codex Manesse) verdeutlichen die engen Verschränkungen von „Sprechen über den Codex“ und „Sprechen über das Buch“ bis ins Spätmittelalter hinein. Dies mag angesichts der Zeit vor der Erfindung des Buchdrucks nicht erstaunen, doch fragt man sich als Leserin, ob dem Terminus „Codex“ nicht vielleicht doch auch ein paar einführende Worte gut getan hätten. Der Codex ist zwar das mittelalterliche Buch schlechthin und man kann von der Leserschaft ein allgemeines Grundverständnis erwarten. Trotzdem stellt sich aber beispielsweise die Frage, inwieweit die angesprochenen Diskurse tatsächlich als codexspezifisch und nicht – allgemeiner – als buchspezifisch anzusehen sind. Dass im Wolfenbütteler Arbeitskreis der Begriff des „Codex“ durchaus relativ weit gefasst wird, zeigt beispielsweise der Beitrag von Ingo H. Kropač, welcher mittelalterliche Amtsbücher als Codizes untersucht. Für das Verständnis von einem spezifischen „Diskurs über den Codex“ wäre es zudem vielleicht hilfreich gewesen, wenn ein Beitrag sich noch mit einem allfälligen „Diskurs über die Buchrolle“ beschäftigt hätte.
Dass Diskurse über unterschiedliche Medientypen ineinandergreifen, wird spätestens im Beitrag von Dieter Mertens deutlich, der die Übernahme von codexspezifischen Elementen in die Druckpraxis untersucht. Auch der folgende Beitrag von Ulrich Eigler befasst sich mit dieser Thematik, während der abschließende Aufsatz von Zsuzsanna Kiséry eine humanistische Handschrift behandelt und damit nochmals das Medium wechselt.
Die Gesamtheit der Aufsätze macht deutlich, dass es das ganze Mittelalter hindurch zumindest implizite Diskurse über Bücher gab – und „Buch“ war weitgehend mit „Codex“ gleichzusetzen. Ab dem Humanismus trat dann ein expliziter Diskurs über den Codex zu Tage, der bald auch durch die unterschiedlichen medialen Voraussetzungen von Codex und gedrucktem Buch angetrieben wurde. Die thematisch, zeitlich und methodisch so unterschiedlich ausgerichteten Beiträge unterstreichen die Variabilität von Codices, aber auch von Diskursen. Dass sie die Frage nach dem „Sprechen über den Codex im Mittelalter“ nicht abschließend beantworten können, dürfte klar sein. Doch gelingt es den Beiträgen im Sammelband, exemplarisch einzelne Aspekte des vielfältigen Potenzials von Codices, das weit über ihre Funktion als Übermittler von Text hinausgeht, aufzugreifen.
Ein Beitrag aus der Mittelalter-Redaktion der Universität Marburg
|
||