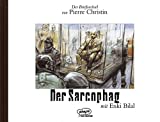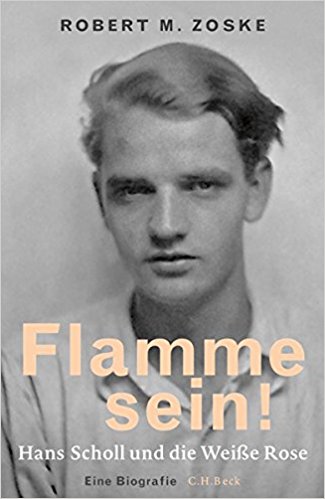Tschernobyl, Museum der Zukunft
Provokante Comic-Hommage zum Jahrestag der Katastrophe
Von Christoph Schmitt-Maaß
Satire sei die letzte Möglichkeit der Darstellung der Realität, merkte Friedrich Dürrenmatt einst an. Und hat damit einen möglichen Leitspruch zur Erschließung des neuen Werks von Enki Bilal und Pierre Christin aufgestellt. Nach ihrer erfolgreichen Zusammenarbeit Mitte der 70er Jahre (etwa die Polit-Fiction "Das steinerne Schiff") haben beide sich zunehmend voneinander entfernt: während Pierre Christin, der für das Szenario (die Story also) verantwortlich zeichnet, immer nüchterner und in der Recherche der Themen immer präziser wurde, überzog Enki Bilal - verantwortlich für die Zeichnungen - seine Geschichten mit einem Schleier des Unwirklichen. Das liegt nicht zuletzt an der verwendeten Zeichentechnik und der beinahe lähmenden Statik der Bilder.
Nun sind beide wieder mit einem Werk hervorgetreten, das es Lesern wie Kritikern schwer macht. "Ein Briefwechsel" haben Sie es genannt, eine bitterböse Satire ist es geworden.
"Der Sarkophag" ist eine Bezeichnung für das heutige Tschernobyl, besonders für jenen mehrmals in Beton eingegossenen Block 4. Anlässlich der Jährung dieses Ereignisses haben sich Bilal und Christin etwas Besonderes einfallen lassen: einen Entwurf zu einem Ausstellungskonzept, das Tschernobyl nicht nur einbindet, sondern es sogar als Ausstellungsfläche nutzt - die Besichtigung des Grauens also. "
"Der Sarkophag" ist ein Führer in ein und für ein Museum der Zukunft. Ist er aber ein Comic? Aus Gründen der Einfachheit könnte man antworten: Bilal und Christin haben neuerlich die Grenzen des Mediums gesprengt. Betrachtet man jedoch den Aufbau des Buches näher, so lässt sich die Frage viel detaillierter beantworten.
Dem ersten Eindruck nach könnte es sich zumindest auch um ein Bilderbuch handeln. Viele großflächige Ganzseiten-Illustrationen stehen neben reinen Textabschnitten; das Ganze wird immer wieder durch in Schwarz gehaltene Fotostrecken und Interviewzitate unterbrochen. Es handelt sich hier um zwei prinzipiell voneinander abgesetzte Leseebenen: zum einen um den "Museumsführer", dessen Text anschaulich mit den Bildern Bilals illustriert ist, zum anderen um die "schwarzen Seiten", welche Ausschnitte aus Dokumentationsfilmen zum Tschernobyl-Unglück darstellen, die durch kontrastierende Wechselrede von Interviewzitaten Betroffener und Verantwortlicher in ganz eigener Weise eine Imagination des Vorgefallenen ermöglichen. Sowenig die Zeichnungen Bilals den Text einbinden - sie beziehen sich lediglich auf ihn, illustrieren ihn - so sehr sind Bild und Text auf den "schwarzen Seiten" miteinander verknüpft. Bilal und Christin haben also das Prinzip des grafischen Erzählens im Comic umgedreht: Die Einbindung des (verbalisierten) Erzählens in das Bild gelingt nur in der Realität ("schwarze Seiten"), nicht in der Fiktion. Ein erster Hinweis auf den Satirecharakter dieses Werkes.
Der zweite Hinweis ist wesentlich offensichtlicher: im "Museum" sind Utopien des Politischen (von Lenin bis Pol Pot) ebenso ausgestellt wie technische Machbarkeitsphantasien. Die entsprechenden Ausstellungsräume tragen so schöne Titel wie "Der neue Spiegelsaal" oder "Saal der Unsterblichkeit". Die Kommentare sind so drastisch wie ironisch, dass jedes Lachen auf der Strecke bleibt. Tschernobyl als Museum der Zukunft - eine Provokation. Aber eine gelungene.
Ein Lob geht auch an den Ehapa-Verlag, der mit der sorgfältigen Produktion dieses Bandes (Hardcover, Leinenrücken) zeigt, dass große Comicverlage nicht nur Wegwerf-Mangas produzieren.