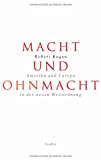Die groben Unterschiede
Robert Kagan und Gret Haller diskutieren die Differenzen zwischen den USA und Europa gänzlich konträr
Von Lennart Laberenz
Zu den auch in Deutschland hochgelobten Publikationen über das Verhältnis zwischen den USA und Europa gehörte zu Beginn des letzten Jahres der schmale Essay von Robert Kagan über "Macht und Ohnmacht" als politische Zustandsbeschreibung der beiden Kontinente. Jener Robert Kagan, dies sollte man wissen, entstammt der politischen Kaste Ronald Reagans und hat den Think Tank "Project for the New American Century" mitgegründet - ein Verein, der sich deutlich am rechten intellektuellen Rand der Konservativen in den USA befindet. Kagan ist Redaktionsmitglied in Rupert Murdochs rechtsintellektueller Zeitschrift "Weekly Standard". Seine Beiträge in der Washington Post sind unter anderem Grund genug für die progressive Wochenzeitschrift "The Nation" im Umfeld des Irak-Krieges von den "Washington Post Warriers" zu sprechen. Die Perspektive von Kagan ist dementsprechend die eines ideologisch standfesten Analysten, dessen politische Analysen zu keinem Zeitpunkt von selbstreflexiver Kraft als vielmehr durch polemisch versierte und redundante Postulate charakterisiert sind.
Kagans begriffliche Interpretation ist so grobschlächtig-amerikanisch (wie sich Europäer die rechtskonservativen Amerikaner gerne vorstellen), wie feststellbar ist, dass Gret Hallers vorsichtig-rekonstruktive Beobachtungen europäisch sind. Haller schöpft dabei eine vordergründige Überzeugungskraft ihrer Darstellungen einerseits aus ihrer politischen Arbeit, die sie unter anderem als Präsidentin des Schweizerischen Parlaments und als Botschafterin beim Europarat in Strassburg sammeln konnte. Insbesondere hat sich ihr politischer Blick auf die transatlantischen Differenzen allerdings in ihrer fünfjährigen Tätigkeit als Ombudsfrau für Menschenrechte in Bosnien-Herzegowina (1996-2000) geschärft. Ihr Buch "Die Grenzen der Solidarität" ist eine Art Erfahrungsbericht, in welchem sie ihre Arbeit in Bosnien-Herzegowina zusammenfasst und gewissermaßen von dort aus auf die Frage nach Differenzen und Übereinstimmungen zwischen der US-amerikanischen und europäischen Art Politik zu praktizieren, zu rezipieren und zu kommentieren hinweist.
Die Krise um den Bürgerkrieg in Jugoslawien steht in beiden Ausführungen als zentraler Ausgangspunkt für den weiteren Vergleich zwischen Europa und den USA. Für Kagan markiert sie das "europäische Versagen" und gleichzeitig als Ausweis der "militärischen Ohnmacht" sowie der "politischen Uneinigkeit Europas; der Kosovokonflikt am Ende des Jahrzehnts offenbarte die transatlantische Kluft im Bereich der Militärtechnologie und der Fähigkeit zur modernen Kriegführung." Dabei verschwendet er keine Zeile an eine interpretative Dimensionen, die eine Entstehung des Balkankonflikts mitdenkt oder der zugegebenen Unfähigkeit der EU oder den Staaten Europas gegenüberstellt. Auch scheint ihm die ausschlaggebende US-amerikanische Verantwortung für den Machterhalt Slobodan Milosevic's keine Silbe wert - hatte doch die Regierung Bill Clintons eben diesen zum zentralen Verbündeten in den Verhandlungen zum Friedensabkommen von Dayton im Jahre 1995 gemacht. "Washington hatte mit seiner Strategie maßgeblich dazu beigetragen, dass sich Milosevic in der Folge so lange hat halten können," urteilt Haller und verdeutlicht an diesem Beispiel einige Strukturmomente US-amerikanischer Politik: die bewusste Prinzipienlosigkeit und beinahe ausschließliche Orientierung auf kurzfristige Erfolge unter der Überschrift des "Pragmatismus".
Dabei hatte die Unterstützung des Ethnonationalismus in der Region durch die rasche Anerkennung der Teilstaaten, maßgeblich gefördert von der konservativ-neoliberalen deutschen Regierung durch den damaligen Außenminister Hans-Dietrich Genscher, den militärischen Konflikt eingeleitet. Der unheimliche Stolz den "Kommunismus" an allen Fronten zu besiegen rannte zu jener Zeit durch die Korridore der Macht und verbaute die Sicht auf mittelfristige Konsequenzen. In der unterkomplexen kaganschen Diktion verbleibend, könnte festgestellt werden, dass die Politik der Europäischen Union beinahe "amerikanisch" funktionierte.
Indem aber Kagan mit derart selbstgewählter Blindheit internationale Politik analysiert und ein bemerkenswert unterkomplexes Instrumentarium zur "Lösung" gleich bei der Hand hat, entkleidet sich offensichtlich eine Qualität der Politikbetrachtung, die gleichsam zum kulturellen Verständnis der Administrationen der USA gehört. Kagan versucht eine Gegenüberstellung von "Amerika", welches er in gewohnter Überheblichkeit mit den USA gleichsetzt und "Europa", womit er die fünfzehn Staaten der EU meint. Sein zentrales tertium comparationis ist dabei ein Begriff von "Macht", der bei ihm eigentlich nur durch militärische Potenz, dargestellt in Verteidigungshaushalten, charakterisiert ist. Jenes Amerika verortet er in der Hobbesschen Welt des universalen Krieges, Europa dagegen befindet sich nach seinem Verständnis in einem "postmodernen Paradies" eines ewigen kantischen Friedens. Zwischen diesen beiden Welten existiert für Kagan ein relativ simpel gestricktes Voraussetzungsverhältnis: "Weil Europa weder willens noch fähig ist, sein Paradies selbst zu schützen und es davor zu bewahren, geistig wie körperlich von einer Welt überrannt zu werden, die die Herrschaft des ,moralischen Imperativs' erst noch akzeptieren muss, ist es abhängig geworden von der Bereitschaft Amerikas, seine militärische Macht einzusetzen, um überall auf der Welt all jene abzuschrecken oder zu besiegen, die noch immer an Machtpolitik glauben." Die USA funktionieren dabei als Inkarnation und (militärischer) Verteidiger der westlichen Welt wie auch ihrer Werte.
Eine solche Betrachtung ist kaum mehr als eine unverfrorene Verteidigung unilateraler Politik, die sich zunehmend auf militärische Mittel stützt. Die Erstschlagsdoktrin der Regierung Bush und der pathetisch aufgeblasene Duktus der Verteidigung der amerikanischen Interessen (schon arg verrutscht wirkt hier der Versuch Kagans den tocquevillschen Begriff des "aufgeklärten Eigeninteresses" als Grundmuster US-amerikanischer Außenpolitik zu deklarieren) als Verteidigung der freien Welt, lassen das Buch gerade im Kontext des umfangreichen Scheiterns der US-amerikanischen Militärpolitik in Afghanistan und im Irak in einem anderen Licht erscheinen. Kagan ist in diesem Sinne ganz Apologet einer Illusion der imperialen Übermacht, deren Handeln Recht und Unrecht zu definieren hat. "Die USA haben den ,unipolaren Augenblick' definitiv verpasst," schrieb dazu Claus Leggewie unlängst "und tagtäglich bestätigt sich nun im Irak wie in Afghanistan, in welche Kalamitäten sie mit ihrem Alleingang geraten sind." Mit Kagan präsentiert sich allerdings einer jener einflussreichen Strategen, die belegen, dass es wohl auf absehbare Zeit keine Kursänderung zu erwarten gibt. Diktion und intellektuelles Niveau weisen Kagan als einen kalten Krieger auf dem geläufigen Stand der Post-11. September-Konjunkturen aus. Die militärische Lösung ist nach Kagan nicht die ultima ratio der internationalen Politik, sondern ihre allgemeine Perspektive und ihr Sinn gleichermaßen. Gleichsam als "natürlich" versucht Kagan deshalb auch die USA als Hegemonialmacht zu legitimieren. "Der Wunsch, eine bedeutende Rolle auf der Weltbühne zu spielen, ist tief im amerikanischen Charakter verwurzelt." Jener Charakter des Cowboys, dem Immanuel Wallerstein warnende und kritische Worte entgegenhält, wird hier als geschichtlich-logische Disposition affirmiert - ein einfacher Weg um skrupellose Großmachtpolitik der "unverzichtbaren Nation" ohne großes Federlesen zu rechtfertigen. Deshalb fühlt sich Kagan auch dazu berechtigt den Europäern den Rat zu geben, "ihre Angst und ihren Zorn auf den Oberschurken [zu] überwinden und sich wieder daran [zu] erinnern [...], dass ein starkes Amerika, ja die Vormachtstellung Amerikas für die Welt und besonders für Europa eine unabdingbare Notwendigkeit ist."
Während also derzeit beispielsweise die Bevölkerung des Iraks oder Afghanistans direkt zur Kenntnis zu nehmen hat, dass man "die außerordentliche Stellung [der USA] in der Geschichte, ihre Überzeugung, dass ihre Interessen und die Interessen der Welt identisch seien, [...] nicht in Zweifel ziehen [soll]", müsste dies für Europäer eigentlich bedeuten, die Illusion einer diplomatischen Struktur von Politik zu überdenken. Indem jede Form von Stabilität für Kagan - und diese Sichtweise ist keineswegs weit entfernt von jener der US-amerikanischen Regierung - als "strategische Stabilität" unter dem Rubrum der militärischen Potentiale gesehen wird, scheint Peter Gowan Recht zu behalten, wenn er formuliert, dass die "zehn ruhmreichen Jahre des triumphierend über den Globus marschierenden atlantischen Liberalismus entgültig vorbei sind. [...] Auf transnationaler Ebene verliert die altbekannte Mischung aus Neoliberalismus und Menschenrechtskosmopolitismus allmählich an Zugkraft." Vielmehr arbeiten die USA nach dem Versuch der Verschleierung jener Politiken durch Bill Clinton wieder offen und unverbaut an einer Brutalisierung ihrer militärisch-ökonomischen Hegemonie. Kagans Ausführungen erscheinen so als politische Theorie im Format von Sabine Christiansen.
Tatsächlich fehlt allerdings in Gret Hallers Analysen genau die Dimension der Ökonomie. Zwar zeichnet sich ihr Beitrag in grober Differenz zur Kaganschen Propagandaschrift durch eine ausgefeilte und nachdenkliche Gegenübersetzung historischer und somit kultureller Unterschiede US-amerikanischer und EU-europäischer Politiken aus, allerdings überstrapaziert sie häufig die Geltungsmacht der US-amerikanischen Traditionen. So gerät der durchaus ökonomisch zu lesende Machtdiskurs hinter traditionellen Verhaltensweisen nicht in den Blickwinkel ihrer Ausführungen - wiewohl gerade dazu zahlreiches kritisches Material vorliegt.
Von der Wegegabelung des Friedensvertrages von Münster und Osnabrück im Jahre 1648 ausgehend, diskutiert sie ohne moralische Überlegenheiten feststellen zu wollen die Differenzen im Rahmen von Querschnittsbegriffen wie dem Verständnis von Staat als Institution, der historischen Konstruktion der USA aus der Quelle der Religiösität, die daraus abgeleiteten, unterschiedlichen Rezeptionen des Nationenbegriffs und gänzlich konträre Rechtsphilosophien. Ob aber die mehrheitsfähigen Positionen der US-Waffenlobby und der großen Automobilkonzerne einzig aus dem historisch gewachsenen Individualismus, welcher sich seine Freiheit konträr zu europäischen Entwicklungen, gegen den Einfluss von staatlichem Handeln, herausbildete, erklärbar ist, bleibt fraglich. Tatsächlich entdeckt Haller bei allen gesellschaftsbildenden Momenten grobe Differenzen - ohne allerdings gleich in den arrogant-wertenden Duktus Kagans einzufallen. In diesem Sinne will Haller vielmehr den "gesellschaftliche[n] Rückhalt" der Differenz zeigen und entwickelt eine solche Analyse insbesondere die Kernpunkte der Staatlichkeit und des Rechts. Tatsächlich zeigt Haller so nur die Tatsache der Differenz auf und blendet wichtige Momente der Genese und der noch aktuellen Begründbarkeit der politischen Ökonomie der USA aus. Haller stellt ganz grundsätzlich ein "fehlendes US-amerikanisches Verständnis für ,Politik' im europäischen Sinne" fest. Und Politik meint in diesem Sinne eine breite Spanne von außenpolitischen Interventionen bis zum völligen Mangel auch nur des Gedankens an soziale Kohäsion.
Tatsächlich werden in den USA mittel- und langfristige Strategeme anders gedacht und berechnet. Insbesondere unter dem amtierenden Präsidenten zeigt sich ein völlig differentes Verhältnis zwischen Politik und Ökonomie in den USA, als dies in europäischen Ländern der Fall ist - ein Umstand den Haller nicht leugnen würde, jedoch auf den sie nicht genau genug einzugehen weiß. Über die private Wahlkampffinanzierung, die traditionelle Rekrutierung der Politiker aus der reichen, gebildeten und immer noch vorrangig weißen Elite, den Aufbau von Machtstrukturen, das Rechstssystem und gesellschaftliche Einflussfaktoren auf die institutionelle Verfassung der Gesellschaft, entblättert sich ein wesentlich ökonomistischer Diskurs der Macht, dessen Intention keineswegs eine parlamentarisch-deliberative Funktion im Sinne einer Gesamtheit der Gesellschaft bildet.
Deshalb also machen sich politische und gesellschaftliche Prozesse ohne die kritische Berechnung ökonomischer Zusammenhänge blass aus. Hallers sorgfältige Rekonstruktionen soziomoralischer und traditioneller Wurzeln aus der Geschichte der USA sind verdienstvoll aber redundant und erkennen in manchen Momenten blanke Rhetorik nicht als solche vor ihrer tieferliegenden Rationalität. Sicherlich ist das individualisierte Selbstverständnis der Bürger der USA historisch gewachsen, allerdings steht hinter einem solchen Postulat auch eine ökonomische Rationalität, die eine rhetorische Beförderung jener spezifischen Individualisierung im Sinn hat. Und wenn staatliche Interventionen im Sinne einer Umverteilungspolitik, bzw. im Sinne einer sozialstaatlichen Kompensation für die tägliche Arbeit in der kapitalistischen Wirtschaft nicht als Merkmal eines politischen Diskurses festzustellen ist, so steht dahinter ebenfalls die Materialität einer Klassen- und Milieustruktur, die den Staat als solches ausmachen. Dies im Blick gerät Hallers vage Aussicht auf US-Amerikanisierungstendenzen des Zusammenspiels von Ökonomie und Politik erheblich bedrohlicher, als sie selbst diese postuliert: "Wenn sich Europa sozialpolitisch dem US-amerikanischen Modell annähern würde, so erfolgte Hand in Hand damit auch eine Annäherung an das US-amerikanische Rechtsverständnis und den Umgang dieser Nation mit der Gewalt." Das gleichsam quasireligiös den Vorgaben der USA folgende Engagement Großbritanniens, die Interessen Italiens, Spaniens oder auch Polens hinter dem Feldzug gegen die Achse des Bösen, lässt sich aus keinem der kulturalistischen Analyseansätze genügend erklären, allerhöchstens würde Kagan hier eine Art "Einsicht in die Vernunft" geltend machen.
Tatsächlich bietet Haller eine gelungene Zusammenstellung über Strukturmerkmale gesellschaftlicher und außenpolitischer Phänomene der USA. So erfahren die Leser am anekdotischem Beispiel aus ihrer Arbeit in Bosnien-Herzegowina, was es heißt hinter einer gleichklingenden Rhetorik komplett widersprüchliche Rationalitäten aufzufinden. Somit erklären sich die von Kagan postulierten westlichen Werte zum Mythos aus der bipolaren Welt. Während der eine also jene Rhetorik für die neuerliche Verhüllung imperialer und selbstherrlicher Politik verwendet, tritt die andere nicht recht aus dem Kreis eines gängigen sozialdemokratischen Standes von Weltwahrnehmung hinaus.
|
||||