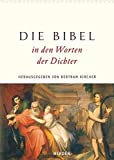Schatzkiste mit Schönheitsfehlern
Bertram Kircher fand nicht nur literarische Kostbarkeiten
Von Ursula Homann
Unlängst stellte Paul Kersten das vom Lippoldsberger Schriftsteller und Literaturarchäologen Bertram Kircher herausgegebene Buch "Die Bibel in den Worten der Dichter" im NDR-Kulturjournal als "schönste Neuerscheinung des Frühjahrs 2005" vor und pries es als "eine Schatzkiste voller literarischer Perlen." In der Tat, wer das Buch zum ersten Mal in die Hand nimmt, darin herumblättert und liest und sich alsbald festgelesen hat, wird geneigt sein, in Kerstens Loblied einzustimmen, selbst dann, wenn die etwas süßlichen, leicht kitschig wirkenden Illustrationen aus der Bilderbibel des Nazareners Julius Schnorr von Carolsfeld, mit denen der Band geschmückt ist, nicht gerade dem eigenen Geschmack entsprechen.
Offensichtlich hat Bertram Kircher hier alles an literarischen Texten versammelt, was er in der deutschsprachigen Literatur vom Mittelalter bis zur Gegenwart auftreiben konnte. Von Otfried von Weissenburg bis Ingeborg Bachmann, vom Wessobrunner Gebet aus dem Jahr 814 bis Bertolt Brecht, von Goethe und Schiller bis Ulla Hahn und Peter Handke.
Von der Schöpfungsgeschichte bis zur Geheimen Offenbarung des Johannes wird der gesamte Kosmos der Bibel in seiner Nachwirkung erfasst: von Abrahams Kindheit, Jakob und seinen Söhnen, von Mose im Alten Testament bis Johannes dem Täufer, den einzelnen Stationen im Leben Jesu, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten und Apokalypse im Neuen Testament.
Das Werk beginnt mit einem Gedicht von Rose Ausländer:
",Am Anfang war das Wort
und das Wort
war bei Gott.'
Und Gott gab uns
das Wort
und wir wohnen
im Wort.
Und das Wort ist
unser Traum
und der Traum ist
unser Leben."
Es folgen epische und lyrische Texte von Johann Gottfried Herder, Gertrud Fussenegger, Hilde Domin, Ernst Barlach, Wilhelm Hauff, von dem noch unbekannteren jungen Autor Georg Lauer, von Ludwig Börne, Franz Mehring, Christoph Martin Wieland, Thomas Mann, Gertrud Kolmar, Erich Mühsam, Dorothee Sölle, Nelly Sachs und Jochen Klepper. Unter den Texten befinden sich auch zwei schlichte, poetische Erzählungen von Karl Heinrich Waggerl, ein Gedicht über "Adam und Eva" von Christian Morgenstern, eins über "das verlorene Paradies" von Annette von Droste-Hülshoff und vieles andere mehr.
Klabund beklagt Hiobs Geschick, Erich Fried fordert "Gewaltlosen Verzicht auf Gewaltlosigkeit". Der ehemalige HJ-Poet Hans Baumann beschreibt "Wie Herodes Einhalt geboten wurde", und der einstige Staatspoet und Kulturminister der DDR, Johannes R. Becher, den Einsturz des Turms von Babel. Plötzlich erscheinen die alten Texte in einem ungewohnten Licht und wecken skeptische Fragen wie etwa die, ob nicht auch Judas im Namen der Erlösung ähnlich wie Jesus für die Menschheit ein großes Opfer dargebracht habe, für das er allerdings nur Verachtung erntete. Biermann stellt burschikos und schnoddrig über ihn fest: "Wahr ist, dass besagter Verräter seinen Chef / Auf dessen eigenen Wunsch hin hochgehn ließ."
Ein hintersinniges Gedicht aus diesem Band stammt von Wilhelm Busch. Es zeigt, dass man nicht leicht und ohne weiteres ins Paradies gelangt. Leiser Spott klingt in Georg Weerths biblischer Romanze an, in der davon die Rede ist, dass der keusche Joseph das Angebot der Frau Potiphar, mit ihr zu schlafen, ausschlägt. Georg Weerth reimt in seiner biblischen Romanze "Herr Joseph und Frau Potiphar": "So sprach Madame Potiphar und konnt ihn nicht erweichen - / Der Stockphilister Joseph war ein Esel sondergleichen. / Er schritt wohl auf die Hausvogtei und hat sich sehr verwundert: / Wie also sehr verderbet sei sein lasterhaft Jahrhundert."
Der Spötter Heinrich Heine wiederum meint: "Wenn jetzt ein Heiland aufsteht, braucht er sich nicht mehr kreuzigen zu lassen, um seine Lehre eindrücklich zu veröffentlichen ... er lässt sie ruhig drucken und annonziert das Büchlein in der ,Allgemeinen Zeitung' mit sechs Kreuzern Inserationsgebühr."
Ludwig Börne nimmt die Geschichte von der Erstarrung der Frau Lot zu einer Salzsäule zum Anlass, um eine ernste Mahnung an seine rückständigen Zeitgenossen auszusprechen. Sieht er doch im Schicksal von Frau Lot "ein treffendes und warnendes Bild für die Konservativen der alten Zeiten, die auch stehenbleiben und zurücksehen."
Aus Georg Christoph Lichtenbergs Sudelbuch hat der Herausgeber die Umdichtung eines Psalms mit übernommen, von Heinrich Böll eine aktuelle Nachdichtung über die "Kunde von Bethlehem" und von Joseph von Eichendorff ein Gedicht über "Die Flucht der Heiligen Familie" sowie von Christian Morgenstern das Poem "Der einsame Christus".
Viele Fundstücke hat Kircher zusammengetragen, aber keineswegs nur literarische Kostbarkeiten. Nicht alle hier vertretenen Autoren haben in der deutschsprachigen Literatur Rang und Namen - und das zu Recht.
Doch deutlich wird, dass zahlreiche biblische Figuren eine beachtliche literarische Wirkungsgeschichte aufweisen, und dass die Bibel die Fantasie unzähliger Schriftsteller immer wieder angeregt und sie zu eigenen Schöpfungen inspiriert hat. Immerhin findet man im Buch der Bibel alles, was das literarische und auch sensationslüsterne Herz begehrt: Brudermord, Flutkatastrophe, Verwüstung, Versprechen, Verrat, Liebe, Eifersucht und viele andere Dramen der Menschheit. Selbst für einen ungläubigen Menschen, wie es der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki nach eigenem Bekunden ist, hat die Bibel einen hohen literarischen Wert und enthält "streckenweise wunderbare Literatur." Zudem zeigen die hier abgedruckten Texte unabhängig von ihrer literarischen Qualität einen spannenden, freien Umgang mit unserem religiösen Erbe, einerlei ob ihre Verfasser gläubig oder atheistisch waren.
Enttäuschung stellt sich allerdings ein, sobald man das Gelesene vertiefen möchte und im Anhang nach genauen Quellenangaben sucht. Die Bibelstellen, auf die sich die Texte beziehen, werden zwar genannt, nicht aber Zusammenhang und Stellenwert, den die Texte im Werk der Schriftsteller einnehmen. Ihr Herkunftsort wird nur unklar umrissen, zumindest erfährt man nicht, aus welchem Buch oder Werk das herausgeschnittene Bruchstück stammt. Von Goethe beispielsweise hat Kircher sechs Texte aufgenommen, doch bei der Quellenangabe hat er sich mit dem vagen Hinweis auf "Sämtliche Werke, hrsg. von E. v. Hellen, Stuttgart 1902-1907" begnügt. Dabei dürfte diese alte Ausgabe kaum jemand besitzen. Ähnlich verfährt der Herausgeber bei Johann Peter Hebel, bei Johann Gottfried Herder, Stefan Andres und vielen anderen Autoren. Das ist schade, denn dadurch bekommt die Sammlung nicht nur einen unwissenschaftlichen, sondern auch einen willkürlichen und beliebigen Anstrich.