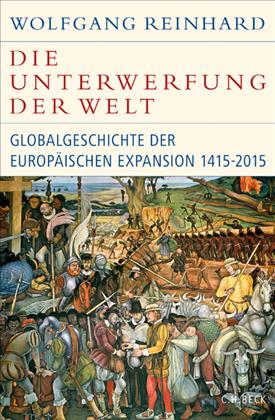Medien - Macht - Kultur zwischen Empfindsamkeit und Aufklärung
Tagungsband des Gleimhauses Halberstadt
Von Christoph Schmitt-Maaß
Geselligkeit und Bibliothek - was aus heutiger Perspektive als undenkbarer Gegensatz erscheint, war im 18. Jahrhundert literarische Praxis. Der rezeptive Umgang mit Bibliotheken war in weiten Teilen weniger durch individuelles Lesevergnügen als vielmehr durch gesellige Kommunikation geprägt. Das komplexe Wechselverhältnis von Literaturvermittlern wie Autoren, Verlegern, Kritikern, Buchhändlern und Bibliothekaren lässt sich innerhalb dreier Fragestellungen, die Markus Fauser einleitend entwickelt und die den aus einer Tagung von 2000 hervorgegangenen Band gliedern, weiterentwickeln: "Geselligkeit und Leserkultur" fragt nach soziologischen, "Institutionen und Medien" nach medialen und "Bibliothek und Lesekultur" nach anthropologischen Dimensionen von Geselligkeit und Bibliothek im 18. Jahrhundert. Der Vorteil einer solchen mehrdimensionalen Herangehensweise liegt auf der Hand: Sie erlaubt, Lesekultur im 18. Jahrhundert weniger als lineare Entwicklung zu begreifen denn als multifaktoriale Beeinflussungen und Wechselwirkungen. Die Entwicklung der Medien- und Verlagslandschaft im 18. Jahrhundert, aber auch die Verknüpfung von pädagogischen, psychologischen und (populär-)philosophischen Gedanken lassen eine solche Perspektivierung sinnfällig erscheinen.
Der einleitende Aufsatz zur ersten Sektion "Geselligkeit und Lesekultur" von Emilio Bonfatti nimmt den Briefwechsel zwischen Lessing und Gleim in den Blick und zeichnet nach, wie das literarische Gespräch über den abwesenden Dritten - Ewald von Kleist - die beiden Freunde zunehmend in Distanz bringt und ästhetisch entfremdet. Wolfgang Braungarts Untersuchung erweist sich in der Fragestellung wie im Ergebnis als ungleich spannender: Schillers Verriss von Bürgers Gedichten in der Jenaer Allgemeinen Literatur-Zeitung dient als Ausgangspunkt. Braungart zeichnet nach, dass die literarische Geselligkeit des Hainbunds maßgeblichen Einfluss auf Bürgers "Leonore" hatte, dass der Dichter in der Folge dieses Erfolgs unter einem lebenslangen Überbietungsdruck stand, der ihn jedoch - der Göttinger Geselligkeit enthoben - zum Epigonen seiner Selbst werden ließ.
Gonthier-Louis Fink nimmt den europäischen Zusammenhang der Lektüre von Romanhelden in den Blick. Der empfindsame Roman inszeniere die Lektürewahl des Helden als Mittel der Charakterisierung in erheblich stärkerem Maße, als es der aufgeklärte Roman getan habe. Der interkulturelle Ansatz ist bei Fink nicht modische Formel, sondern notwendige Voraussetzung zum Verständnis der gleichfalls interkulturellen Lektüre der empfindsamen Romanhelden (erinnert sei an Manon Lescaut oder die Nouvelle Heloïse). Goethes Werther schließlich markiert hinsichtlich der Mehrfachkodierung des Romanhelden einen nicht wieder erreichten Höhepunkt europäischer Romankunst.
In seinem anregenden Aufsatz geht Gunter E. Grimm den im Briefwechsel zur Sprache kommenden Lektüren Herders und seiner späteren Ehefrau Caroline Flachsland nach. Diesen falle, so Grimm, eine entscheidende Bedeutung im Selbstverständigungsprozess der späteren Eheleute zu: Herders konservatives Frauenbild erfahre durch Caroline Flachslands Lektüren Brechungen und Wandlungen.
Johann Nikolaus Schneider schließlich zeigt auf, dass das vielbeschworene Verständnis von Lyrik des 18. Jahrhunderts als Hör- statt als Sehtext ambivalent ist: Neben dem Lese- und dem Hörtext sei ein - Schneider weist dies an Klopstocks Teone eindringlich und anschaulich nach - Sehtext denkbar.
In ihrem die zweite Sektion ("Institutionen und Medien") eröffnenden Beitrag liest Rosemarie Zeller Ulrich Bräkers Tagebuchnotizen zur Literatur als Realitätsflucht, die dem Schweizer Autodidakten ein fiktives Gespräch mit den literarischen Größen und ihren Figuren ermögliche.
Peter J. Brenner entwickelt die Rezeption des Briefwechsels Gleim - Uz - Ramler neu, indem er nicht den Freundschaftskult, sondern die Entkörperlichung und Entmaterialisierung als wesentliche Voraussetzung der Korrespondenz ausmacht. Dafür spräche etwa der Ausschluss der Ehefrauen oder die räumliche Distanz der Briefeschreiber, die auch nicht durch gegenseitige Besuche aufgehoben werde.
Anhand von Sophie von La Roches in literarischen Periodika festgehaltenem Lektüre-Verhalten zeichnet Barbara Becker-Cantarino schließlich die wenig systematisch exzerpierende Lektüre als typisch für die Bildung und Literarisierung von Frauen des 18. Jahrhunderts nach.
In ihrem etwas unstrukturiert wirkenden Eröffnungsbeitrag (Sektion "Bibliothek und Lesekultur") skizziert Giulia Cantarutti die Rolle des italienischen Gelehrten Gian Cristoforo Amaduzzi (gestorben 1792) bei der Vermittlung von Gessners Idyllen in Italien, die einen idealisierenden Gegenentwurf zu den damals am römischen Hof herrschenden "korrupten Sitten" geliefert hätten.
Den Versuch einer Rekonstruktion der 'virtuellen Bibliothek' der Brüder Schlegel aus den Athenaeums-Kritiken, Briefen und Essays unternimmt Elena Agazzi und weist auf den Einfluss dieser Bibliothek auf den literarischen Kanon der Frühromantik hin.
Peter Seibert liest zwei kurze, bislang weitgehend vernachlässigte Texte Ludwig Tiecks unter der Fragestellung, wie sich die literarischen Vergesellschaftungsformen im Zuge der Frühromantik veränderten. Tieck führe vor, wie die im ersten Text inszenierte indiskrete Veröffentlichungspraxis der Autorfigur die fiktionale literarische Öffentlichkeit auf sich selbst zurückwerfe, statt sich der Gesellschaft zu öffnen. Anhand der Lektüre eines zweiten Tieck-Texts zeichnet Seibert das gewandelte Literaturverständnis nach, das neue Distributionsformen mit sich bringt: Das lyrische Erzeugnis, nach einführender Interpretation durch ihren Urheber, vor einer literarischen Gesellschaft zu Gehör gebracht, ist nicht weiter von Belang, sondern dient als "Projektionsfläche eigener Egozentrik".
Eben dieses gewandelte Literaturverständnis nimmt auch York-Gothart Mix in den Blick: Vor dem Hintergrund eines enorm expandierenden Buchmarkts Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts wandelt sich das Selbstverständnis von Literaturkritik. Die bislang gepflegte Praxis, möglichst jedem Werk individuell gerecht zu werden, wird zugunsten einer Scheidung von literarischer "Fabrikware" und Besprechungswürdigem verabschiedet. Unter Rückgriff auf Schillers Verurteilung der Gedichte Bürgers, die schon Braungart im selben Band zum Ausgangspunkt seiner Überlegungen machte, zeichnet Mix nach, wie Schiller versucht, Bürger als Lohnschriftsteller zu diffamieren und so als Konkurrent aus dem Feld drängen.
Ernst Rohmer tritt der These entgegen, Johann Peter Uz habe in Ansbach ein isoliertes Dasein geführt. Die gemeinsamen Horaz-Übersetzungen mit den Freunden Cronegk und Hirsch ermöglichten die Ausbildung einer literarischen Gruppenidentität; mit seinen Verdiensten ums Ansbacher Gymnasium und Gesangbuch wirkte Uz zudem zurück auf die Gesellschaft und schuf damit einen intellektuellen Gegenpol zum Ansbacher Hof.
So fundiert die einzelnen Beiträge auftreten, stehen die Sektionen doch teilweise recht unvermittelt nebeneinander. Auch hätten die einzelnen Aufsätze besser aufeinander abgestimmt sein können (wobei die 'Doppelung' der Ausführungen Braungarts und Mix' durchaus auch das Spektrum und die Perspektivierung der Annäherungsmöglichkeiten zeigen).
Das Gleimhaus, das seit den 1980er Jahren diese Tagungen ausrichtet (seit 1999 regelmäßig), bietet den idealen Hintergrund für die Beschäftigung mit Literatur und ihren Archiven und Institutionen, ohne dass die dogmatische Beschäftigung mit Gleim Voraussetzung der Analyse wäre. Insgesamt demonstriert der Tagungsband das durchgehend hohe Niveau der gegenwärtigen Spätaufklärungsforschung. Es bleibt zu hoffen, dass in Zukunft hieran angeschlossen wird - vielleicht unter stärkerer Berücksichtigung des akademischen Nachwuchses, einer partiell besser abgestimmten Organisation der Beiträge untereinander und einer zügigeren Publikation der vorgelegten Forschungsergebnisse.
|
||