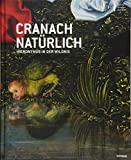Er hat die Tiere und Pflanzen zu geheimen Hauptdarstellern erhoben
Dem Landschaftsmaler Lucas Cranach des Älteren wird in einer neuen Publikation nachgespürt
Von Klaus Hammer
Zu den Sammlungen des Tiroler Landesmuseums Innsbruck gehören wesentliche Werke Lucas Cranachs des Älteren, darunter auch der Hl. Hieronymus in der Einöde (um 1525), das den Kirchenvater als Büßer nicht in der eigentlich der Legende nach geforderten syrischen Wüste, sondern in einer wilden, uns aber vertraut-heimischen Wald- und Felsenlandschaft zeigt. Diese minutiös ausgeführte Landschaft ist hier der Buße und Wissenschaft vereinigenden Hieronymus-Figur gleichberechtigter ekstatischer Ausdrucksträger und zugleich Schauplatz subtiler Symbolik. Die Tiere und Pflanzen sind zu geheimen Protagonisten erhoben worden, die dem Betrachter etwas mitzuteilen haben.
Ausgehend von Cranachs Hieronymus-Bildern – erst kürzlich ist wieder ein Hieronymus-Gemälde aufgetaucht, das wohl der Werkstatt Cranachs des Älteren zuzurechnen ist – hat das Innsbrucker Museum in einem interdisziplinären Ausstellungsprojekt (bis 7. Oktober 2018) systematisch Cranachs Naturdarstellung erforscht und ist dabei zu erstaunlichen Ergebnissen gekommen. Auch für Cranach und seine Zeitgenossen war die allegorische Lesart der Natur noch allgegenwärtig. Die Spannung zwischen Empirie und Symbol, Sinnlichkeit und Übersinnlichkeit, neuem und tradiertem Wissen wird eben auch im Innsbrucker Hieronymus-Gemälde sichtbar: Zwar zitiert der exotische Löwe mit seinen eigentümlichen „Schläfenlocken“ eher das Vorbild Dürers, aber sonst sind die Lebewesen durchaus detailliert und auch nahezu naturgetreu dargestellt. Zugleich wird jedoch eine symbolische Ebene augenscheinlich. So finden sich Fabelwesen in diesem Naturraum. Die Harpyien, Vögel mit menschlichen Köpfen, versinnbildlichen Sündenfall und Buße. Ihre Spiegelung in der Wasseroberfläche deutet auf Selbsterkenntnis. In den Naturdetails entfaltet sich eine Allegorie, die den Weg des büßenden Hieronymus von der Sünde zur Tugend und durch die Buße ins Himmelreich anzeigt. Auffordernd richten die Wesen im Vordergrund ihre Blicke auf den Betrachter, dem der Weg der Titelfigur nahegelegt wird.
Das früheste Hieronymus-Bild Cranachs stammt aus dem Jahr 1502, als der Maler sich in Wien und in den Gelehrtenzirkeln um Conrad Celtis aufhielt. In diesem humanistischen Umfeld wurde viel über Hieronymus und auch über den „germanischen Wald“ diskutiert. Darauf reagierte Cranach, indem er die „Hieronymus-Wüste“ in seinem Gemälde als bedrohlichen, wilden Wald erscheinen ließ. Die dramatisch dargestellte Natur spiegelt den verzweifelten Bußvorgang des seelisch aufgewühlten Kirchenvaters wider. In der linken oberen Bildecke haben sich drei Vögel versammelt und formen ein humanistisches Bilderrätsel. Der Hieronymus-Holzschnitt von 1509 platziert dann die Titelfigur an einen lichten, heiteren Waldrand mit sprudelnder Quelle. Hier kann der Wald nicht nur wie im frühen Wiener Gemälde die bedrohliche Einsamkeit verbildlichen, sondern auch auf das als Lohn für die Buße erwartete Paradies hinweisen. Der Stein in der einen und das Buch in der anderen Hand des Hieronymus weisen auf dessen Buße und Gelehrsamkeit hin, während der V-förmige Zug der Kraniche am Himmel Mahnung ist, sich Gottes Leitbild anzuvertrauen. Schließlich zeigt Der hl. Hieronymus in felsiger Landschaft (um 1515) unseren Protagonisten in der Einsamkeit der Natur als Gelehrten. Doch ist er gleichzeitig Büßer geblieben, der sich der Grenzen seines eigenen Verstandes bewusst ist. Die Natur hat hier eine korrigierende Rolle von Hieronymus als Wissenschaftspatron übernommen. Anstatt sich im „Buch der Bibel“ dem undurchdringlichen Geheimnis Gottes zu widmen, sucht dieser im „Buch der Natur“ die Geheimnisse der Natur zu erforschen.
Nicht nur den heiligen Hieronymus, sondern auch andere religiöse Themen kombinierten Cranach und seine Zeitgenossen mit der Darstellung der Natur. Einerseits lebte die mittelalterliche Sicht auf die Natur und ihr Verständnis als Ausdruck des Übersinnlichen weiter, andererseits machten in diesem „Zeitalter der Entdeckungen“ die Naturwissenschaften wichtige Entwicklungsschritte hin zu einem modernen Verständnis. Die Innsbrucker Ausstellung zeigt naturgeschichtliche Standardwerke wie das um 1350 entstandene Buch der Natur des Regensburger Kanonikers Konrad von Megenberg, das auch Cranach noch benutzt hatte. Das Kräuterbuch des Mediziners Leonhart Fuchs von 1542 wurde zu einem Gründungswerk der Botanik. Der Universalgelehrte Conrad Gessner schuf mit seiner Historia animalium (Geschichte der Tiere, 1551-58) ein Schlüsselwerk der frühen modernen Zoologie. Diese Werke waren reich illustriert und dienten auch den Künstlern als Vorlagebücher. Da zu Cranachs Aufgabengebieten als Hofmaler in Wittenberg auch die Darstellung der kurfürstlichen Jagd gehörte, kam es hier zu weiteren Tier- und Naturdarstellungen, so bei der Bekehrung des römischen Feldherrn Eustachius, des Schutzpatrons der Jäger, zum Christentum, nachdem ihm auf der Jagd ein Hirsch mit dem Kreuz im Geweih erschienen war (Der hl. Eustachius, um 1515-1520). Das Gemälde David in der Wüste Siph (um 1530), das eine Episode aus dem Alten Testament erzählt, gehört zu den wenigen „Wüstenbildern“ im Schaffen Cranachs, deren Landschaftsform an die realen Begebenheiten einer Felswüste erinnert.
Die Ausstellung und der reich bebilderte Begleitband, der Arbeiten aus verschiedenen Schaffensphasen Cranachs sowie von dessen Zeitgenossen mit naturkundlichen Quellenwerken, naturwissenschaftlichen Exponaten, illuminierten Manuskripten und kostbaren Druckwerken dieser Zeit in einen Zusammenhang setzt, eröffnen neue Deutungshorizonte. Agnes Thum – die zusammen mit Helena Perena die Ausstellung kuratiert –beschäftigt sich in ihrem einleitenden Beitrag mit der Naturdarstellung in Cranachs Hieronymus-Bildern. Sie sieht in der Verbindung des „Tiergartens“ des Hieronymus mit seiner Darstellung als Wissenschaftler die Vermischung der beiden in der Renaissance geläufigen Bildtypen: des elitären Philologen und Humanistenpatrons „im Gehäuse“ und des volkstümlichen Bußvorbildes „in der Einöde“. Dies geschieht entweder durch die Verlegung des Studierzimmers in die Bußlandschaft (Lucas Cranach des Älteren und Werkstatt, Der hl. Hieronymus in der Einöde, um 1515-1520; Albrecht Dürer, Der hl. Hieronymus in der Felsgrotte, 1512) oder aber durch das Eindringen der Bußlandschaft ins Studierzimmer (Lucas Cranach des Älteren, Der hl. Hieronymus in felsiger Landschaft, um 1515). Wie kommt es, fragt Helena Perena, dass sich in den Hieronymus-Darstellungen des 16. Jahrhunderts die „Wüste“ in eine Waldlandschaft verwandelt hat? Einerseits kann der Wald als Wildnis wichtige „Funktionen“ der Wüste übernehmen, andererseits ermöglicht er eine heimische Nähe zum Betrachter. Der Wald galt nicht nur für Eremiten als Rückzugsort, sondern auch für die Humanisten als ein patriotischer Ort, der auf eigentümliche Weise die Wildnis mit der Kultur vereint. Gabor Endrödi beschäftigt sich mit der Symbolbedeutung der Vögel auf Cranachs Wiener Hieronymusbild, während Thum sich noch einmal speziell mit der Sprache der Natur in Cranachs Innsbrucker Hieronymus auseinandersetzt. Andreas Tacke unternimmt bedenkenswerte Interpretationsversuche zu Cranachs Gemälden, die Kardinal Albrecht von Brandenburg als Hieronymus zeigen.
Wie Cranach zu der auch von den Humanisten so gerühmten Naturnähe in seinen Gemälden gelangt, fragt Nils Büttner. Er erläutert, damit stehe die Beobachtung, dass Cranachs Gemälde eher einem gestalterischen Ideal verpflichtet sind als der Abbildung konkreter Orte, keineswegs im Widerspruch. Cranach ging es um die auch in den gezeigten Details wirksame Dominanz des Typischen über das Individuelle, während wir heute eine Landschaftswiedergabe als genau erleben, wenn gerade die individuellen Züge eines spezifischen Stücks gesehener Natur hervortreten. Zu Zeiten Cranachs waren bei der allegorischen Betrachtung der Natur durchaus unterschiedliche Lesarten möglich und auch erwünscht. Mit der Rolle der Naturwissenschaften in der Renaissance beschäftigt sich Dominic Olariu in seinem Beitrag. Er zeigt, wie bei der Visualisierung von Naturalia gerade bildende Künstler – so auch Cranach – eine führende Stellung in der Wissensvermittlung einnahmen. Schließlich verweisen Peter Morass und Michael Thalinger aus naturwissenschaftlicher Sicht auf einige prägnante Besonderheiten der Tier- und Pflanzenwelt in ausgewählten Arbeiten Cranachs und leisten damit eine wesentliche Interpretationshilfe. Im Anhang werden eine Kurzbiografie des „Naturmalers“ Cranach, die Liste der ausgestellten Objekte und eine Auswahlbibliografie angeführt.
Welche Erkenntnisse vermitteln Ausstellung und diese so bedeutsame Publikation? Zum einen wirkt bei Cranach die Symbolik des Mittelalters weiter, in der jedes Tier, jede Pflanze eine geheime Bedeutung hat. Zum anderen offenbart sich bei ihm ein neuer Realismus, der im Kontext der noch jungen Naturwissenschaften seinen Ort findet. Cranach war nicht nur der Maler der Reformation, der Bildgeber Luthers, er war auch der „Naturmaler“, der an der Schwelle vom Mittelalter zur Neuzeit das neue Interesse an Welt und Landschaft bediente, indem er zahlreiche Naturdetails zur Darstellung brachte. Es lag ihm weniger an einer klaren, räumlichen Ausdehnung der Natur als vielmehr an einer den Deutungsradius weit ausschreitenden Verbindung von Figur und Landschaft. Dem Verlangen nach Erkenntnis noch unbegriffener Zusammenhänge konnte eine solche Bildauffassung in besonders wirksamer Weise dienen.
|
||