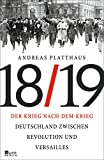Revolutionäre Unrast: Deutschland zwischen Krieg und Frieden
Andreas Platthaus beschreibt die Monate von November 1918 bis Sommer 1919
Von Jens Flemming
Es geschah am helllichten Tag. Am 21. Februar 1919, morgens gegen 10 Uhr trat ein junger Mann aus einem Hauseingang hervor, wo er sich versteckt hatte, und streckte mit zwei Pistolenschüssen den bayerischen Ministerpräsidenten Kurt Eisner nieder. Dieser, ehemals Redakteur beim Parteiorgan Vorwärts, der sich unter dem Eindruck der Burgfriedenspolitik für die Unabhängige Sozialdemokratie entschieden hatte, war auf dem Weg zum Landtag, um nach der verlorenen Wahl vom 12. Januar seinen Rücktritt anzubieten. Unter den Münchener Revolutionären gehörte er zu den profilierteren Köpfen, er vertrat einen entschiedenen Pazifismus, war von der deutschen Schuld am Krieg überzeugt und hatte entsprechende Dokumente veröffentlicht. Der Attentäter, Spross eines alten Adelsgeschlechts und Leutnant a.D., Graf Anton von Arco auf Valley, studierte in München Rechtswissenschaften und war Mitglied der Thule-Gesellschaft, einer Vereinigung im Milieu des völkischen Rechtsradikalismus. Wegen seiner jüdischen Mutter hatte man ihn allerdings ausgeschlossen; mit den Schüssen auf den sozialistischen Politiker Eisner, obendrein ein Jude, suchte er sich bei seinen Gesinnungsgenossen zu rehabilitieren. Die strafrechtliche Ahndung erfolgte schleppend. Zunächst wurde Arco vom bayerischen Volksgericht zum Tode verurteilt. Der Justizminister hob diesen Spruch alsbald auf und wandelte ihn in lebenslange Festungshaft um. Bereits nach vier Jahren wurde er auf Bewährung entlassen und 1927 vom Reichspräsidenten Hindenburg amnestiert.
Beides – die Tat ebenso wie der justizielle Umgang damit – spiegelt Probleme und Konstellationen, mit denen die Weimarer Republik von Geburt an behaftet war. Impulse für eine gedeihliche Entwicklung und Chancen für gesellschaftliche Stabilität boten sie nicht. Die Gerichte reagierten auch in vergleichbaren Situationen relativ verständnisvoll und werteten die behaupteten ‚patriotischen’ Motive der Angeklagten als strafmildernd. Eisner war zudem nicht der einzige Mord, der auf das Konto antidemokratischer Kräfte ging. Nach der Niederschlagung des sogenannten Spartakusaufstandes im Januar 1919 hatten Angehörige der in Berlin operierenden Garde-Kavallerie-Schützendivision die Führer der Kommunistischen Partei Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht im Auftrag des Generalstabsoffiziers Waldemar Pabst liquidiert, im März folgte Luxemburgs Gefährte Leo Jogiches, im November 1919 der Vorsitzende der USPD Hugo Hasse, im August 1921 Matthias Erzberger, der im November 1918 das Waffenstillstandsabkommen unterschrieben und bei der konservativen Opposition entsprechend verhasst war. Im Sommer 1922 traf es den Außenminister Walter Rathenau, der von Mitgliedern einer im Untergrund agierenden Zelle ehemaliger Militärs, der „Organisation Consul“, auf offener Straße erschossen wurde. Diese Fälle, denen weitere hinzuzufügen wären, zeigen zum einen, dass die Justiz bei politische Straftaten, die von rechts begangen wurden, mit Nachsicht bis an den Rand der Rechtsbeugung verfuhr, zum andern, dass der Krieg nur in einem formalen Sinne beendet worden war. Tatsächlich blieb er im Laufe der zwanziger und frühen dreißiger Jahre immer präsent: Militanz und Gewalt richteten sich einstweilen nicht mehr gegen den äußeren, wohl aber gegen diejenigen, die man zum inneren Feind, zu ‚Volksverrätern’ und ‚Schädlingen’ stempelte. Ihre Propagandisten saßen auf der rechten ebenso wie auf der linken Seite des politischen Spektrums.
All dies gehört zu jenen Phänomenen, mit denen Andreas Platthaus in seinem Buch über 1918/19 den „Krieg nach dem Krieg“ illustriert. Der war mit der Verabschiedung des Versaillers Friedensvertrages keineswegs zur Ruhe gekommen. Putschversuche von links wie von rechts waren Ausdruck nervöser Unrast, stifteten Verwirrung und kosteten Opfer, scheiterten zwar, offenbarten aber, wie fragil das junge republikanische Staatswesen war. Fatal wirkte sich hier aus, dass eine selbstkritische Auseinandersetzung mit der Kriegspolitik des kaiserlichen Deutschlands – von Ausnahmen abgesehen – unterblieb. Die Gründe für den Zusammenbruch im Herbst 1918 wurden weithin verdrängt. Der Chef der vollziehenden Gewalt, der Sozialdemokrat Friedrich Ebert, empfing Anfang Dezember die heimkehrenden Truppen am Brandenburger Tor in Berlin mit dem denkwürdigen und politisch unbedarften Satz: „Kein Feind hat Euch überwunden.“ Das lief – wie Platthaus zu Recht hervorhebt – auf „Umdeutung und Mythisierung der deutschen Niederlage“ hinaus, war – noch – nicht die Dolchstoßlegende, die Monate später Marschall Hindenburg unter die Leute brachte, kam ihr jedoch bedenklich nahe. Gegen fortgesetzte Anwürfe aus dem Lager der Konservativen, die der Monarchie nachtrauerten, boten Eberts Worte jedenfalls kein wirksames Palliativ. Schon am 10. November, einen Tag nach der Installierung der Revolutionsregierung, giftete die Deutsche Tageszeitung, das Blatt des antisemitischen Bundes der Landwirte: „Das Werk, das unsere Väter mit ihrem kostbaren Blut erkämpft – weggewischt durch Verrat aus den Reihen des eigenen Volkes!“ Und weiter hieß es: „Das ist eine Schuld, die nie vergeben werden kann und nie vergeben wird.“ Von hier war der Weg zur hämischen und diskreditierenden Rede von den „Novemberverbrechern“, mit denen fortan die Repräsentanten der Demokratie überschüttet wurden, nur kurz.
Für die Kriegführung waren die Militärs zuständig. Deren großer Operationsplan für den Zweifrontenkrieg, der Schlieffenplan, war bereits im September 1914 an der Marne in den Orkus gefallen, die Erschöpfung der Truppen wie die der Bevölkerung daheim, auch das Zerbrechen der Fronten im Sommer 1918 gingen allein auf ihr Konto. Insofern war es, woran Platthaus keinen Zweifel lässt, ein geschickter Schachzug, sich davon zu stehlen, die eigene Weste sauber zu halten und die Federführung bei den Waffenstillstandsverhandlungen den ansonsten verachteten Zivilisten unter Leitung des Zentrumspolitikers Erzberger zuzuschieben. Hier lagen die Wurzeln der alsbald anhebenden Polemik und Agitation gegen diejenigen, die aus staatpolitischer Verantwortung in die Bresche gesprungen waren und sich abmühten, inmitten widriger Bedingungen zu retten, was zu retten war. Hindenburgs Memoiren, die 1920 auf den Markt waren, brachten das mit einer Anleihe aus dem Nibelungenlied auf unnachahmlich selbstgerechte Weise zu Gehör: „Wie Siegfried unter dem hinterlistigen Speerwurf des grimmigen Hagen, so stürzte unsere ermattete Front“. Schuld waren, lautete die Botschaft, nicht die Generäle und Offiziere in der Obersten Heeresleitung, sondern die anderen: die Querulanten und Defätisten in der Heimat, die Drückeberger und Kriegsgewinnler, die Parlamentarier, die 1917 für einen Frieden der Verständigung eingetreten waren, und natürlich: die Juden, die von der politischen Rechten zu ubiquitären Sündenböcken erkoren wurden.
Den Verzweigungen der revolutionären und gegenrevolutionären Bewegungen, der Gewaltbereitschaft, die sich auf beiden Seiten manifestierte, auch den Bürgerkriegen in den verschiedenen Regionen des Reichs widmet Platthaus eher kursorische Aufmerksamkeit. Sein Hauptinteresse gilt den Auseinandersetzungen um den Entwurf einer künftigen Friedensordnung. In Deutschland mündete der „innere Kampf“, der darüber ausgefochten wurde, in eine frühe „Entzweiung“, von der sich die Gesellschaft nie wieder erholen sollte. Auf der internationalen Ebene setzten die Siegerstaaten den Krieg, um den berühmten Satz des preußischen Militärtheoretikers Carl von Clausewitz abzuwandeln, mit den Mitteln der Diplomatie fort. Das Ziel, das die Franzosen mit Ministerpräsident Georges Clemenceau an der Spitze verfolgten, orientierte sich in gewisser Weise am Dogma der Vernichtungsschlacht. Ihnen ging es um Revanche und Genugtuung, um Demütigung des Gegners und Egalisierung der Schmach von 1870/71, vor allem aber zielten sie auf eine nachhaltige, gleichsam endzeitlich gedachte Schwächung der gefürchteten Militärmacht jenseits des Rheins.
Dies kam, wie der Autor anschaulich zeigt, nicht allein in den vertraglichen Bestimmungen zur Geltung, sondern darüber hinaus in einer ganzen Reihe symbolpolitischer Gesten und Inszenierungen. Gleichwohl wuchsen ihre Bäume nicht in den Himmel. Dafür sorgten die mit den ihren nicht in jedem Punkt konformen Bedürfnisse und Perspektiven der Verbündeten. Wohl waren sich England und Frankreich einig, den Deutschen möglichst hohe Reparationen abzuverlangen, um die kriegsbedingten Zerstörungen zu beseitigen, ihre Budgets zu entlasten und die in den USA angehäuften Schulden zu reduzieren. Aber das Vereinigte Königreich war doch bemüht, die französischen Hegemonialambitionen auf dem Kontinent einzudämmen. Hinzu kam, dass der Vertrag, der am Ende in Versailles unterzeichnet wurde, in mancher Hinsicht den 14 Punkten des Präsidenten Woodrow Wilson, mit denen dieser den Eintritt in den europäischen Krieg legitimiert hatte, widersprachen. Nicht das Selbstbestimmungsrecht der Völker dominierte, sondern wesentlich machtpolitisches Kalkül. Daran scheiterte nicht zuletzt die Vision Wilsons und seiner Berater, den Völkerbund zum Instrument einer effizienten Friedenspolitik zu machen. Die Welt wurde rasch gewahr, dass der Krieg von 1914/18 nicht, wie Wilson im April 1917 im Kongress verkündet hatte, für erdenkliche Zeiten der letzte sein würde.
Darstellungstechnisch ingeniös, weil das vorher Gesagte teils noch einmal ins Licht hebend, teils um neue Aspekte erweiternd, sind die höchst informativen kulturhistorischen Exkurse, die Platthaus den drei Teilen des Buches jeweils hinzufügt. Der erste lenkt das Augenmerk auf den Physiker Albert Einstein, der im September 1918 erklärt hatte, die „Rettung Deutschlands“ sehe er allein in der schnellen und radikalen „Demokratisierung nach dem Vorbild der Westmächte.“ Er plädierte für maßvolle Friedensbedingungen: „Wenn England und Amerika besonnen genug sind, um sich zu einigen“, meinte er, „kann es Kriege von einiger Wichtigkeit überhaupt nicht mehr geben.“ Vielleicht um sein Vertrauen darauf zu bewahren, hielt er die Klauseln des Versailler Vertrags für „glimpflich“, und anders als die Mehrheit der Deutschen glaubte er an „einen allmählichen Erfolg des Völkerbundes.“ Darin unterschied er sich von Theodor Wolff, dem Chefredakteur des Berliner Tageblatts, dem Protagonisten des zweiten Einschubs. Dieser lehnte wie zuvor einen deutschen nun auch einen alliierten Siegfrieden ab. Zugleich wandte er sich früh gegen die sich abzeichnende Verschiebung der Verantwortung und die von den Militärs betriebene Verdrehung der Tatsachen: „Wir wollen nicht“, schrieb er schon im Oktober 1918, „daß ein Oberlehrer seinen Schülern vorreden könne, die Demokratie habe das deutsche Volk um den Sieg gebracht.“
Der dritte Exkurs schließlich lenkt das Augenmerk auf Claude Monet, der kurz vor dem Krieg begonnen hatte, einen Zyklus großformatiger Seerosenbilder zu malen. Diesen wollte er der französischen Nation zur Feier ihres Sieges stiften. Als Sachwalter dieser Idee fungierte sein Freund Clemenceau. Die Suche nach einem geeigneten Ort zur Unterbringung der Gemälde gestaltete sich allerdings schwierig. Die in Aussicht genommene Orangerie nahe der Place de la Concorde musste umgebaut werden. Das zog sich hin, das Interesse an der Sache erlahmte, das Projekt drohte zu scheitern. Als im Mai 1927 die Bilder endlich an ihrem Platz hingen, war Monet schon einige Monate tot. „Achteinhalb Jahre nach dem Ende der Kämpfe an der Front“, resümiert Platthaus, hatte Clemenceau „nun auch den letzten Kampf im Land gewonnen.“ Richtig gewürdigt wurde Monets Werk jedoch nicht, die Hochzeit des Impressionismus war längst passé, die Aufmerksamkeit des Publikums gefesselt von anderen Stilrichtungen. Die Geschichte endet daher mit einer ironischen Pointe. 1928 wurde Clemenceau eingeladen, eine Monet-Ausstellung in Berlin zu eröffnen. Das sagte er zwar ab, aber berührt war er von einer im Blick auf die Vergangenheit derart unwahrscheinlichen Geste schon. „Den letzten Triumph seines Lebens“, so Platthaus abschließend, „verschafften ihm die Deutschen gegen Frankreich.“
|
||