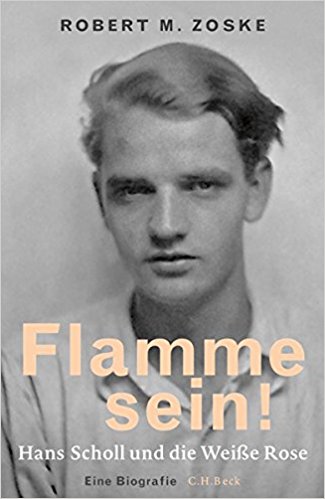Wiederentdeckung eines bedeutenden kinderliterarischen Werks
Wissenschaftliche Analysen zu Leben und Werk des Kinderbuchautors und -illustrators Franz Josef Tripp (1915–1978)
Von Torsten Mergen
Über den 1915 in Essen geborenen und 1978 verstorbenen Schriftsteller, Illustrator und Journalisten Franz Josef Tripp, der auch als Maler und (Werbe-)Grafiker tätig war, ist in der größeren Öffentlichkeit heute kaum noch etwas bekannt. Dabei hat er Spuren hinterlassen, die auch aktuell nachwirken: Nachdem ihm die damalige Verlegerin des Thienemann Verlags, Lieselotte Weitbrecht, in den 1950er Jahren angeboten hatte, das Buch Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer zu illustrieren, zählte Franz Josef Tripp in der Folgezeit zu den großen Namen der Illustratoren-Szene mit einer Hundertschaft an Kinder- und Jugendbüchern, die vom ihm (mit-)gestaltet wurden. Das Publikationsverzeichnis Tripps liest sich wie das Whoʼs Who der Nachkriegs-Kinder- und Jugend-Literatur-Landschaft: Außer den beiden Jim Knopf-Bänden illustrierte Tripp für den Thienemann Verlag unter anderem Boy Lornsens Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt sowie Otfried Preußlers Das kleine Gespenst und die drei Räuber Hotzenplotz-Bücher. Markenzeichen und nicht unwesentlicher Beitrag zum publizistischen Erfolg stellten die heiteren und kraftvollen Illustrationen des Kinderbuchillustrators dar, der auch für zahlreiche andere Verlage wie etwa Ehrenwirth, Schaffstein, Ueberreuter, Loewe, Rowohlt, Breitschopf, Schneider oder Oetinger tätig war. Seine – quasi omnipräsenten – Illustrationen haben Generationen von Kindern dazu eingeladen, sich auf visuelle Entdeckungsreisen zu begeben. Seine grafischen Ideen inspirierten auch die Verfilmungen vieler Kinderbücher.
Mirijam Steinhauser hat sich in ihrer verdienstvollen Studie Von Jim Knopf bis Hotzenplotz. Die Kinderbuchwelten des Franz Josef Tripp, die an der Pädagogischen Hochschulen Weingarten als germanistische Dissertation unter der Betreuung von Anja Ballis entstanden ist, auf den Weg gemacht, mehr über das Leben und Werk Tripps in Erfahrung zu bringen. Dazu leistet ihre umfangreiche und gut lesbare Arbeit – trotz einiger Redundanzen bei der Darstellung – einen ersten wesentlichen „Beitrag zur Erschließung von Tripps sehr umfangreichem und heterogenem Gesamtwerk“. Denn Steinhauser kann nach Musterung der knappen und lückenhaften Forschungsliteratur konstatieren, dass „noch keine ausführliche Auseinandersetzung mit Tripps Biografie und Werdegang sowie seinem Gesamtwerk stattfand.“
Dieses Desiderat kann hinsichtlich der Biografie Tripps, der sie ein knappes Kapitel widmet, nur partiell behoben werden. Zurückzuführen ist dies darauf, dass Tripps „Nachlass nicht archiviert“ ist. Akribisch hat Steinhauser daher Fremdäußerungen und familiäre Zeugnisse befragt sowie versucht, Parallelüberlieferungen archivarisch zu erschließen. Im Ergebnis muss sie jedoch ernüchtert festhalten: „Eine Schwierigkeit bei der Suche nach Dokumenten zu Tripp ist […] die mangelnde Archivierung bzw. fehlende Erschließung kinderliterarischer Nachlässe. Die eingeschränkte Quellenlage bedeutet, dass hier nur ein fragmentarischer Eindruck von Tripps Biografie und Werdegang gegeben werden kann.“ Sie beleuchtet die Herkunft aus einer künstlerisch ambitionierten Familie, zeichnet die Rolle der bündischen Jugend für Tripps Sozialisation sowie die Tätigkeit in NS-Organisationen (wie der Hitlerjugend) und dem Reichsarbeitsdienst nach. Des Weiteren geht sie auf Wehr- und Kriegsdienst als Gebirgsjäger sowie die Tätigkeit als Frontberichterstatter im Zweiten Weltkrieg ein. Dies verknüpft sie mit Analysen zu Publikationen Tripps aus diesem Zeitraum, unter anderem seines ersten Buchs Zwischen Meer und Moor (1938) und seiner Beiträge für die schwäbische Soldatenzeitung Front und Heimat. Nach dem Zweiten Weltkrieg gründete Tripp eine Familie – seit 1945 lebte er in der Nähe von Oberstdorf im Allgäu – und machte eine Ausbildung zum Grafiker mit anschließender Selbstständigkeit als Werbegrafiker. Erst in den 1950er Jahren erfolgte der Wechsel des Tätigkeitsschwerpunktes, was sukzessive zu zahlreichen Buchprojekten geführt habe: „In den 60er- und 70er-Jahren war Tripp ein vielbeschäftigter Illustrator, der mit seinen Zeichnungen zu mehr als 200 Büchern bis zu seinem Tod […] insbesondere den Kinderbuchmarkt prägte.“ Dabei habe er, wie Steinhauser differenzierend zeigt, durchaus „autodidaktisch in der Illustration“, als ausgebildeter Grafiker einen eigenen künstlerischen Stil entwickelt, den es zu entdecken und zu analysieren gelte. Daneben publizierte Tripp selbst drei eigene Kinderbücher, die allerdings kein publizistischer Erfolg wurden.
Da der biografische Zugang durch die mangelhafte beziehungsweise fragmentarische Quellenbasis verwehrt ist, fokussiert die Studie den Werkzusammenhang. Unter Rückgriff auf Gérard Genettes Paratext-Konzept entwickelt Steinhauser eine ambitionierte paratextorientierte Werkanalyse, die sie plausibel herleitet und deskriptiv erläutert: Bei einer solchen Analyse werden „einer Bewegung von außen nach innen folgend zunächst im Rahmen einer literatursoziologischen Betrachtung […] Produktion und Rezeption der Werke betrachtet […]. Anschließend werden Anfänge und Enden […] in verschiedenen Stufen behandelt, um danach den Textblock […] zu untersuchen. Zum Textblock werden sowohl der Text selbst als auch die innerhalb des Textes befindlichen Peritext-Elemente gerechnet.“ Dies führt zum umfangreichsten Kapitel der Studie, der Analyse der Illustrationen beziehungsweise des Text-Paratext-Verhältnisses in Marco und der Hai, von Tripp selbst geschrieben und 1956 veröffentlicht, in Michael Endes Jim Knopf und in Otfried Preußlers Räuber Hotzenplotz-Trilogie. Die Detailanalysen, die fast 200 Druckseiten umfassen, gehen minutiös auf alle genannten paratextorientierten Analysebereiche ein, manches Detail ist dabei, der wissenschaftlichen Akribie der Autorin geschuldet, sehr ausführlich herausgearbeitet. Steinhauser weist die unterschiedlichen Werkanteile Tripps sehr plausibel nach, sie beschreibt die jeweiligen peritextuellen Strategien und ihre Wirkungen auf die Rezipienten und betont die wichtige Rolle von Tripps Erstlingsroman für die Arbeit als Illustrator anderer Autoren. Zu Tripps märchenhaft-fantastischem Kinderbuch Marco und der Hai konstatiert die Studie etwa: „So wie sich der Protagonist Marco nach Verewigung sehnt und am Ende in Text und Bild gewürdigt wird, verewigt sich Tripp selbst in diesem Buch durch selbstreferentielle und metafiktionale Verfahren“.
Die paratextorientierten Analysen der beiden Kinderbuchklassiker Endes und Preußlers belegen die Funktion eines Illustrators gerade im Bereich der Kinderliteratur. Steinhauser verwendet mit guten Gründen den Begriff „multiple Autorschaft“, um zu zeigen, dass und in welcher Weise Tripp die Rolle eines Koautors zukommt: „Er überformt […] die Rahmenbereiche der Bücher, trägt pseudofaktuale Texte und handschriftliche Elemente bei und bringt sich selber über (visualisierte) Signaturen ein. […] Sowohl Endes als auch Preußlers prägnante Figurenbeschreibungen reizen ihn zur visuellen Umsetzung in Form von Characters, also memorierbaren Figurentypen wie Jim Knopf und Lukas oder dem Räuber Hotzenplotz.“
Man wird als Leser nicht jeder Detailaussage und -beobachtung zu illustrativen beziehungsweise paratextuellen Einzelelementen zustimmen müssen, jedoch hat Steinhauser durch die zahlreichen Abbildungen respektive genauen Einzelanalysen eine hohe Belegdichte eingeführt, die für weitere wissenschaftliche Studien zur Funktion von Illustrationen in Kinderbüchern Maßstäbe setzen kann.
Mit großem Gewinn wird daher die weitere Forschung die in der Studie entfaltete und praktizierte Methodik nutzen können. Sie liefert exemplarisch für Tripps Schaffen das Fundament für sich ergebende, vertiefende Forschungsfragen, wie dies die Autorin im fünften Kapitel der Studie, dem Schlusskapitel, präzise herausarbeitet. Nimmt man den umfangreichen, fast 50 Seiten umfassenden Anhang hinzu, der neben einem Biogramm vor allem erstmals ein detailliertes Werkverzeichnis der Texte Tripps liefert, dann steht einer intensiven Beschäftigung mit dessen Schaffen nichts mehr im Weg. Gleichfalls innovativ zeigt sich die Studie im Methodischen. Dies wird besonders deutlich, wenn Steinhauser abschließend zur Problemfrage „Der Illustrator als ‚unauffälliger Partner des Autors‘?“ mit Blick auf die zukünftige KJL-Forschung resümiert:
Zum einen wäre eine Hervorhebung der verschiedenen Beteiligten, also eine Ausrichtung an der Perspektive der multiplen Autorschaft entgegen einer Fokussierung auf den Textautor wünschenswert. So könnte in Bezug auf zahlreiche weitere kinderliterarische Klassiker in der historischen KJL-Forschung verstärkt die Frage gestellt werden, welche Bedeutung die darin enthaltenen Peritexte für die Rezeption haben bzw. hatten und wie die Beteiligung des Illustrators bei der Werkentstehung aussah.
|
||