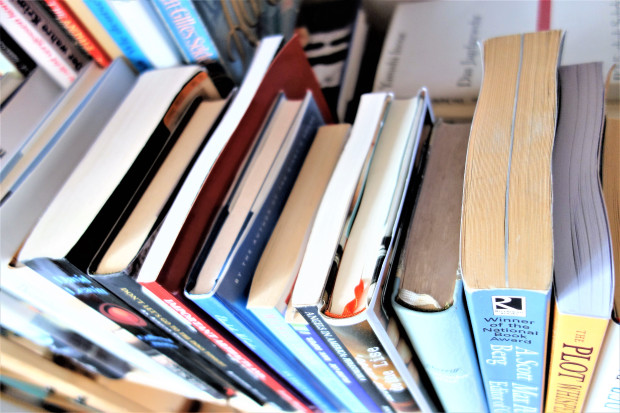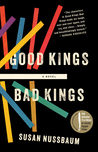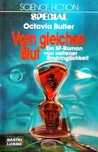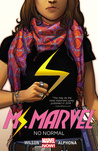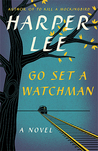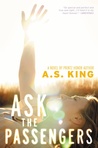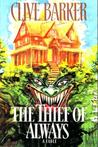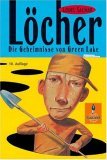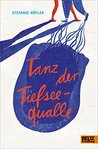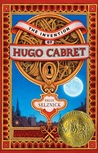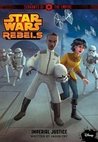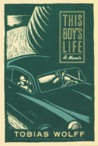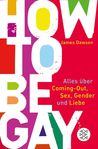.
.
Seit Ende Juni 2016 erscheinen im Blog von „Merkur – Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken“ Texte über strukturelle Probleme, Sexismus und Machtgefälle an Schreibschulen und -Instituten in Deutschland und der Schweiz – gesammelt, redaktionell betreut und wunderbar lektoriert von Lena Vöcklinghaus und Alina Herbig. Bisher sind diese Essay ins drei großen Dossiers gesammelt und nachzulesen:
[Update:
.
.
Heute erscheint das vierte Dossier, mit u.a. einem Text von mir:
ein persönliches Essay über Microaggressions – alles, was Menschen sagen, um sich zu zeigen „Achtung: Wir sind nicht gleich. Hier verläuft eine Grenze: Ich bin auf der besseren Seite. Dein Pech!“ Kurze Szenen, Momente, die mich im Studium verunsicherten oder bremsten.
Und viel von dem, was ich anderen Leuten antat – aus Geltungsdrang, Arroganz, aus Ungeduld oder Wut.
.
Am 8. Juli las ich eine 12-Minuten-Version des Textes am Literarischen Colloquium Berlin. Für den Merkur-Blog habe ich diese Kurzversion ausgeweitet, umgestellt: Wer 15 Minuten Zeit hat – drüben auf Merkur-Zeitschrift.de steht alles, was ich dringend zur Debatte beitragen will. Wie in allen Beiträgen dort sind die Namen aller Lehrenden anonymisiert („der Professor“, „die Professorin“): Es geht um strukturelle Zustände, Grundsätzliches. Nicht um einzelne Personen.
Hier im Blog, in einer längeren Version, wird es präziser, persönlicher, anekdotischer, ausführlicher: ein langer Text, der möglichst konkret, detailliert erzählt, was in fünf Jahren holperte und glückte, schief lief oder mich überraschte. Hier benutze ich Klarnamen; in einigen Fällen Kürzel wie A, Ö, X.
Der Text sammelt die Schwierigkeiten und Probleme. Ein anderer Text, als Gegengewicht: „Stephan Porombka: 100 Fragen“
.
Austeilen, Abgrenzen, Angstmachen, Einstecken.
Fünf Jahre als Schreibschüler
von Stefan Mesch
.
Du schreibst.
Du willst vom Schreiben leben.
Du bist 14, 15, 16 und führst Tagebuch, stellst Filmkritiken ins Netz, gehst zur Schüler-, dann zur Lokalzeitung. Du gründest ein Fan-Magazin zu „Sailor Moon“.
Du liest Videospiel-Testberichte, Comics, Science Fiction, Stephen King; du liest jedes Wort der Fernsehzeitung und suchst Filme mit möglichst vielen Sternchen, Punkten in den Kategorien „Kultfaktor“ und „Anspruch“.
Du machst Abitur und hast – dank Tipps in Magazinen, dank Zufallsfunden in der Fußgängerzone, ab 16 dank dem Internet – jetzt Lieblingsautoren, Lieblingsdrehbuchautoren, Lieblingskritiker, Lieblingsjournalisten. Du hast ein Dutzend Lieblingsserienschöpfer und liest Hunderte Interviews über ihre Arbeit.
Du machst Zivildienst, du wirst 20 und weißt, wie Thomas Wolfe zum Autor wurde – in Harvard, kurz nach dem ersten Weltkrieg. Wie Janet Frame oder Simone de Beauvoir ihre literarische Arbeit organisierten – in Intellektuellenzirkeln der 60er, 70er. Wie Kevin Williamson Drehbücher umsetzen konnte – Mitte der 90er. Doch du weißt nicht, wie man in Deutschland schreiben kann: 2003, in einem Dorf zwischen Heidelberg, Karlsruhe und Heilbronn.
Du kennst keine Schriftsteller*innen, Kritiker*innen persönlich. Keiner, der mit dir spricht, geht in die Oper, sammelt Kunst, studierte Geisteswissenschaften, arbeitet beim Film.
Du hast keine Lieblings-Serienschöpferin – weil Serien fast nur von Männern geschrieben werden. Du hast keine Lieblingskritikerin, -Journalistin, weil fast keine Frauen für die Filmzeitschriften, die es im Supermarkt gibt, schreiben. In 13 Schuljahren hast du keine 30 Bücher von Autorinnen gelesen, und keine fünf davon im Unterricht.
.

.
zwei:
Du bist normal. Deine Eltern sind getrennt – doch dein Vater hilft dir beim Umzug. Er verdient so viel, dass du nicht BaFög-berechtigt bist. Deine Schulfreunde werden Grundschullehrerin, Pädagogin, Pädagogin, Realschullehrerin, Bankberater, Programmierer. Einer macht eine Ausbildung zum Fotografen in der Kreisstadt: Er tut dir Leid. Eine studiert Medizin, 600 Kilometer nördlich: Sie macht dich stolz. Doch dich enttäuscht, keine künftigen Architekten, Rechtsanwälte, Kulturarbeiterinnen, Politikerinnen zu kennen.
Du kennst keine Punks, keine Aktivisten, keine Lesben und nur einen Schwulen, das Abitur machst du ohne Muslime oder Menschen mit Behinderung. Kein Mensch aus deinem Freundeskreis lebte als Teenager je in Miete: Alle Eltern haben Häuser, Garagen, sichere Jobs.
Du bist normal gebildet. Das heißt, du kennst die Kiwi-Taschenbücher – doch „Kiepenheuer & Witsch“ hast du noch nie gehört. Du weißt, dass auf der Seite der Rhein-Neckar-Zeitung, die mit „Feuilleton“ betitelt ist, Konzert- und Opernkritiken erscheinen. Du liest 30 Bücher im Jahr und gehst fünf, sechsmal in Theater – doch Ingeborg Bachmann, Adorno, Klopstock, Thomas Bernhard, Christian Kracht, Rainald Goetz? Niemand, den du kennst, erwähnt solche Namen. Im vierten Semester lernst du das Wort „Poetik“.
Dein Vater ist KfZ-Meister und prahlt damit, im ganzen Leben kein Buch gelesen zu haben. Deine Mutter ist Arzthelferin, seit der Ausbildung im Bertelsmann-Club – und in vier heiklen Schwangerschaften las sie wochenlang im Bett: Johannes Mario Simmel, Utta Danella, Konsalik. Suhrkamp ist dir ein Begriff – denn 15, 20 Suhrkamp-Paperbacks stehen in der Wohnwand. Alle von Hermann Hesse und Isabel Allende.
In der Lokalredaktion der Zeitung schreiben keine Frauen. Es gab den Pfarrer mit Büchern im Büro, und in der Kreisstadt zwei, drei Gymnasiallehrer und Buchhändler. Im Jahr, als du dein Abitur bestehst, schafft Joey aus „Dawson’s Creek“ den Sprung auf eine Elite-Uni: Sie studiert Kreatives Schreiben. Dawson aus „Dawson’s Creek“ arbeitet an Drehbüchern: Er schafft es auf die Filmhochschule. Du googelst „Kreatives Schreiben“ und „Filmhochschule“ – und, zur Sicherheit, „Medienwissenschaften“ und „Psychologie“.
.

.
drei:
Ein Professor sagt, es bräuchte eigentlich ein ganzes erstes Semester – nur, um allen beizubringen, wie man lebt, schläft, kocht und sich ernährt. Du weißt bis heute nicht, ob er damit Grundlagen, Routinen, erstes Ankommen im Studium meint. Oder Lebenskunst und Bildungsbürger-Basics wie „Welchen Wein trinke ich zu Austern?“. Im ersten Semester empfiehlt er, Bachs Kunst der Fuge zu hören – um ein Gefühl für Timing in Texten zu entwickeln. Im fünften Semester empfiehlt er einen Monblanc-Füller für 500 Euro.
Dein Psychologie-Lehrbuch sagt im Kapitel zu Belastungen: 150 Punkte áuf der Stress-Skala werfen Menschen meist aus der Bahn. Der Tod eines Bruders, einer Schwester hat 80 Punkte. Ein Studienbeginn für sich allein schon über 100.
Die Filmhochschule Ludwigsburg verlangt den Nachweis eines Praktikums in der Branche: Du kennst niemanden beim Film – und bewirbst dich nicht. Die HFF Potsdam lädt dich zum Auswahlgespräch ein – doch das Komitee findet deine Urteile über Filme, Bücher gernegroß. Du triffst den Ton nicht. Aber weißt nicht, wen du hättest fragen können, um ihn zu treffen.
Das Literaturinstitut Leipzig lädt dich ein – doch das Studium dauert nur drei Jahre. Wer dort studiert, ist oft schon Mitte 20: Du sagst in der Prüfung, dass du mit Älteren, die Abschlüsse in Europarecht und Kirchenmusik haben oder gelernter Steinmetz sind, nicht mithalten kannst.
Deine Mutter fährt dich an alle drei Unis. Ihr übernachtet in Pensionen. Nichts an Hildesheim macht dir Angst, schüchtert dich ein. Zum Studienbeginn gibt dir dein Vater ein gebrauchtes Auto. Deine Mutter hilft oft bei der Miete.
.

.
vier:
Wie viele bewarben sich: 400? Neun Frauen, fünf Männer kommen durch: Julia hat ein Kind, Nora wird schwanger. Lucias Eltern kommen aus Rumänien und China. Jan wuchs in Marseille auf. Martin macht Live-Rollenspiele. Xs Mutter lebt mit einer Frau zusammen. Y war auf einem Jesuiten-Internat.
Noch nie nahmen dich so verschiedene, erfahrene Frauen ernst: A ist gelernte Kosmetikerin, B jobbte im Kino, C schreibt für Focus Online, D verkaufte ein Jahr lang Brötchen. Alles beeindruckt dich – denn du hast keine älteren Geschwister oder Freunde, und bist noch heute unsicher bei Menschen, vier, fünf Jahre älter: Thomas Klupp, Wiebke Porombka, Paul Brodowsky… Wer dir zwei Schritte voraus ist, macht dir Angst. Du hältst Abstand – damit niemand denkt, du willst dich ranschmeißen.
Der Frauenanteil liegt bei 80, 85 Prozent – unter den Studierenden. Fast alle Kurse am Literaturinstitut leiten Männer. 2008, du bist fast fertig, bewerben sich ein Mann und eine Frau auf eine Professur. Beide langweilen dich. Der Mann erhält den Job. „Warum hörst du die Vorträge?“, fragt Sabrina. „Das ist wie ‚CSI‘. Ich weiß, wie Hanns-Josef Ortheil spricht. Wie Stephan Porombka spricht. Die Fälle aller CSI-Versionen sind austauschbar. Die Ermittler nicht!“ Du hättest gern noch einen anderen Sound gehört. Verschiedene Arbeitsweisen, Zugriffe, Gemüter.
Dein Hauptfach: Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus. Dein Nebenfach: Film, Theater, Medien. Dazu Musik oder Kunst. Und Politik, oder Psychologie, oder Pädagogik, oder Philosophie.
.
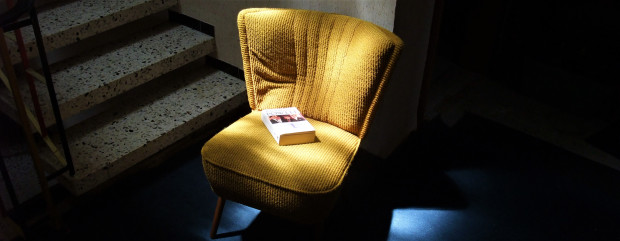
.
fünf:
Über Jahre wirst du ermuntert, über euch, die Stadt, dein Lernen und Scheitern zu sprechen: 2005 führen Erstsemester Tagebuch. Als Tutor liest und kürzt du alle Texte und montierst daraus ein 400-Seiten-Projekt, „Kulturtagebuch: Leben und Schreiben in Hildesheim“. Ortheil spornt dich in jeder Phase an. Du fühlst dich in keinem Wort als Nestbeschmutzer.
2008 veröffentlichst du einen 20-Seiten-Text über die Tiefschläge und privaten Konflikte deines ersten Semesters. 2012 schreibst du das Vorwort der jährlichen „Landpartie“-Anthologie. 2014, für „Irgendwas mit Schreiben: Diplomschriftsteller im Beruf“ listet du deine Ziele als Autor auf. Hildesheim bringt dir bei, kritisch auf Orte und dich selbst zu blicken. Ambivalenzen für ein Publikum greif- und sichtbar zu machen.
2004 bittet Stephan Porombka, je 100 Digitalfotos zu sammeln, in denen sich die Stadt zeigt und erklärt. 2005 sollt ihr eine Hildesheimer Bushaltestelle beobachten, 2007 ein Semester lang eine Kneipe eurer Wahl besuchen, mit Gästen sprechen, ethnografisch über das Milieu schreiben. Ihr lernt, die Stadt zu öffnen. Eure Positionen zu hinterfragen. Euch selbst beim Beobachten zu beobachten.
.

.
sechs:
Du bist enttäuscht, dass ein Student den Grundkurs Kreatives Schreiben leitet – statt Ortheil selbst. Dich ärgert, dass es kein Seminar für euch 14 Auserwählte gibt – sondern alle Kurse auch dem größeren Fachbereich offen stehen: Kulturwissenschafts-Student*innen, „KuWis“.
Fast alle KuWis, mit denen du sprichst, wollten auf Musik-, Kunst-, Schauspielschulen – und scheiterten an der Eignungsprüfung. Dich ärgert, wie viele Leute, die „nur mal testen wollen“ statt beruflich zu schreiben, in allen Seminaren hängen, und dort vor allem über Unlust, Zweifel sprechen.
Als du studentische Anthologien betreust, Texte lektorierst, hörst du fast nur „Ich schreibe eigentlich nie“ und „Für mich ist das ganz neu“. In endlosen gemeinsamen Überarbeitungen – in Absprache mit KuWis, die nie vorhatten und sich nie zutrauten, druckreife Texte zu liefern – macht ihr Texte stärker. Du lernst, respektvoll, konstruktiv zu lektorieren; doch ärgerst dich, dass du so viele unwillige Jüngere anfeuerst, mentorierst – statt selbst gecoacht zu werden.
In deinen Kunst- und Psychologie-Kursen sind KuWis. Vor allem aber Leute aus der Region, die auf Lehramt studieren: Viele haben keinen Mut oder keine Mittel, fürs Studium den Landkreis zu verlassen. Die Kunstseminare sind schleppend und verschult. Die Psychologie-Professorin tut dir Leid, weil alle drei Minuten jemand kräht „Hä? Kommt das in der Klausur?“ oder „Sie – ich raff es einfach nicht!“
Statt mit Ortheil im kleinen, elitären Kreis an eigenen Texten zu arbeiten, stehst du in tausend kalten Wassern. Brauchst deine Zeit, Energie für interdisziplänere Versuche, Projekte, Pflichtaufgaben, bei denen ein Fünftel professionell schreiben will – der Rest nur fragt, warum ihr aggressiven Schnösel alles ändern, lektorieren, verwerten müsst: fürs Radio, auf Lesungen, in Anthologien, im Netz.
Du hältst viele KuWis für Störfaktoren, Ballast – und hast Angst, selbst nur Ballast zu sein: Jo Lendle gibt eine Textwerkstatt, geht zwar auf jeden Text respektvoll ein… doch sagt am Ende, er habe ein höheres Niveau, weniger Anfänger erwartet.
Porombka und Ortheil bieten erst nach fünf Monaten Feedback zu je einem Text eurer Wahl. Porombka nennt deine Erzählung „Trash“. Ortheil findet dich sprachlich unpräzise – und empfiehlt Hemingways Kurzsätze als Gegenmittel.
In den Semesterferien liest du zwölf Bücher von Hemingway.
.

.
sieben:
Du willst, dass alle gut sind. Wäre jemand schlecht, hieße das: Auch du bist vielleicht schlecht. Die Eignungsprüfung irrte. Dir fehlt das Zeug zum Autor.
K bricht das Studium ab. Weil K Kulturjournalismus wichtiger ist als Literatur, fragt Ä: Was, wenn ich falsch bin hier – mit meinem Journalismus-Schwerpunkt? War K unerwünscht? Fühlte sie sich unwillkommen?
Ö ist Filmexpertin und schreibt eine Rezension zu Philip K. Dick und „Blade Runner“. Porombka will, dass sie den Text überarbeitet. Sie ist nervös, verunsichert – und auch nach mehreren Mails bleibt ihr Text unveröffentlicht. Ö fragt sich, ob Porombka sie für nervig, talentlos hält. Sie schreibt nie wieder für die Uni Rezensionen.
Ü schreibt eine Comedy-Kurzgeschichte für die Jahrgangsanthologie. Mit Comedy kann keiner der Lehrenden viel anfangen. Er bewirbt sich für ein Sat.1-Förderprogramm, macht im zweiten Semester einen Workshop in Berlin, tritt im Studium kürzer – und hat bald eine Karriere als TV-Autor. Ä fragt sich jahrelang: Freut sich das Institut über den Erfolg? Oder tat Ü gut daran, zu gehen?
Du besuchst jede Ortheil-Veranstaltung, die dir offen steht. Du hörst irrsinnig gern zu – vor allem, weil dir sein Ton, seine Helden, sein Blick meist neu und fremd sind. Du kaufst, liest Ortheil-Bücher und weißt: Du wirst, kannst, willst niemals über seine Themen schreiben, in seiner Sprache.
Du magst „Sailor Moon“ – weil dort keine fähige, heroische Ausnahme-Frau für sich allein steht. Sondern zehn verschiedene Frauen mit eigenen Wesenszügen aneinander wachsen – ohne, dass die Serie sie gegeneinander stellt: Es gibt dort keine korrekte, einzig gültige Art, Heldin zu sein.
Ortheils Wissen ist dir ein Gewinn. Als Role Model macht er dir Angst: Was Ortheils Texte auszeichnet, kannst du dir nicht erarbeiten. Und was von dem, was du sagen, geben kannst, wird jemand suchen, kaufen, hören, feiern, der sonst Hanns-Josef Ortheil sucht, kauft, einlädt, feiert?
Bei vier Romanciers, zehn Professor*innen, fünf CSI-Ermittler*innen, zehn Kriegerinnen… lastet viel weniger Druck auf jedem möglichen Vorbild, Beispiel.
.

.
acht:
Ä fragt sich, ob die Professoren Poetry Slams verachten. Ä fragt sich, ob die Professoren Sozialkritik verachten. Ä fragt sich so lange, was die Professoren interessiert, bis sie sicher ist, dass IHRE Texte die Professoren nie interessieren werden. Sie schreibt immer weniger. Ihr streitet viel: Du hältst ihre Ängste für selbsterfüllende Prophezeiungen.
Die Professoren helfen zwei Männern aus dem Jahrgang, einen Verlag zu gründen, der zukünftig alle Studiengangsprojekte verlegt. Ä fragt sich, warum sie nicht gefragt wurde, und diese Gespräche geheim blieben.
Ortheil mag die Kurzgeschichten von B, lässt sie in einem eigenen Buch des neuen Verlags drucken: als Teaser, um B an Publikumsverlage zu vermitteln. Ihr fragt euch, ob ihr schreiben solltet wie B, was er an B besonders mag und, ob ihr keine Chance auf seine Hilfe habt, wenn ihr anders schreibt.
Porombka beschäftigt zwei männliche HiWis. Ä fürchtet, Porombka kann nur mit Männern.
Du brauchst viel Zeit, Ä zuzuhören – während sie fragt, welche Professoren oder älteren Studenten wann, wie, mit wem sprechen: Wer wird eingeladen, eingebunden, wer wird gelobt – wer nicht? Ä fragt: „Denkst du, der findet mich langweilig?“, „Denkst du, der findet mich hässlich?“, „Denkst du, wenn ich femininer, zustimmender wäre, hätte ich andere Jobs und Positionen hier?“
.

.
neun:
Du kennst ein Journalisten-Liebespaar, bis heute Inbegriff deiner liebsten Beziehungsdynamik: Clark Kent und Lois Lane. In Hildesheim suchst du eine Partnerin oder einen Partner, die oder der selbst schreibt.
Du fühlst dich nur ambitioniert-verbissenen Schreiber*innen nah: KuWis fehlt oft Schreiblust, Selbstbewusstsein, die Legitimitation durch Ortheil und Porombka. Lehrämtler*innen sind für dich Hufflepuffs: Du hasst, so oft als einziger Schreiber eines Psychologie- und Kunstkurses Schreib-Zeit zu verlieren.
Ä schlägt vor, im benachbarten Hannover zu daten. „Wen finde ich da? Da gibt es keine Schreibschule!“ Du ignorierst Hannover fünf Jahre lang.
Hildesheim ist recht arm, schroff, fromm – es gibt kaum Lesungspublikum: Student*innen bleiben in einer Blase. Du fühlst dich reicher, verdienstvoller, gebildeter als fast jeder, den du auf der Straße siehst.
In einem Filmseminar zur Nouvelle Vague sollen alle kurz sagen, was sie mit Nouvelle Vague verbinden. Von 60 Studierenden sind 55 Frauen, und gut ein Drittel sagt „Mein Vater hatte diese Filme archiviert, führte mich sehr früh an sie heran. Ich wurde mit ihnen erwachsen.“ Dein Vater weiß nicht, was Nouvelle Vague ist. Du gehst – weil du nicht hören willst, wie 20 höhere Töchter jede Woche von ihrer Bildungsbürger-Kindheit schwärmen.
Du ignorierst KuWi-Theaterstücke – verpasst Performerinnen, Regisseurinnen. Du ignorierst KuWi-Konzerte – merkst viel zu spät, wie ambitioniert viele Musik-KuWis studieren. Dich langweilt Hochschulpolitik – du lernst keine aktivistischen Stimmen kennen. Nur KuWi-Filmstudenten hörst du dauernd. In allen Kursen, mit selbstverliebten Kommentaren.
.

.
zehn:
Ihr sprecht kaum über Geld. Du weißt nicht, wie arm oder reich eure Eltern sind. Oft wirken Männer abgerissen, ungesund, asketisch – doch haben ganz andere finanzielle Polster.
Du hältst dich für normal. Das heißt: Du wohnst allein, in einer großen Dachwohnung – doch hast kein Geld, sie richtig zu beheizen. Du frierst fünf Monate im Jahr, fünf Jahre lang. Du hast ein Auto und musst nie mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Uni – aber kein Geld für Urlaub, Restaurants. Dein Kontostand ist oft bei 20 Euro – doch nie im Minus.
Kommiliton*innen arbeiten u.a. bei Schlecker. Du machst keinen einzigen Job fürs Geld – und darfst fünf Jahre lang nur lesen, schreiben, lernen. Du verachtest jeden, der den Pizzaservice ruft, sich Cocktails oder Häagen-Dasz-Eis leistet – doch rauchst jeden Tag 30 Zigaretten. Deine Mutter zahlt gebrauchte Bücher: Du lässt dir nie eine Bibliothekskarte ausstellen – weil du nur kaufst, oder Karten von Freund*innen benutzt.
Zwei Jahre lebst du ohne Internet, recherchierst nachts im Rechenzentrum. Als dein Vater einen Anschluss legen lässt – du denkst: eine Flatrate –, du Downloads startest und 400 Euro nachzahlen sollst, hilft er dir aus, ohne Klage. Du bist 400 Kilometer weit weg, fast ohne Verpflichtungen. Aber weißt: Du kannst fast immer um Hilfe rufen – und wirst von deiner Familie aufgefangen.
Deine Mutter macht sich Sorgen, weil deine große Wohnung hinter dem Bahnhof liegt, in der Nordstadt. Du bist sicher, der belesenste Mensch der Straße zu sein. #gentrifizierung
.

.
elf:
Egal, was du sagst oder schreibst – du siehst dich im direkten Vergleich mit den vier Männern des Jahrgangs. Neun Frauen haben es schwerer – noch mehr, sobald sie aus der Masse weiblicher KuWis stechen müssen: Jede Frau hier kennt fünf andere, die ihr ähnlich sehen, und jeder Mann und fast jede Frau debattieren, sortieren, werten, ranken diese Frauen ständig gegeneinander – ihr Aussehen, ihre Kompetenz, ihre Stellung an der Uni.
Alex macht eine Performance: Sie zieht sich aus, vor einem leeren Ladenlokal, will dort eine Woche lang nur mit Objekten leben, die ihr Fremde schenken oder leihen. „So will sie auffallen?“, fragen Männer aus dem Studiengang. „Ein alter Mann gab ihr seinen Pulli, damit sie nicht mehr nackt auf der Straße steht.“
Jede Party rekrutiert sich aus kaum 500 potenziellen, immer gleichen Gästen. V kommt enttäuscht nach Hause: „Heute war es eine Wasserloch-Party.“ Du stellst dir eine Savanne vor: Räuber, Beutetiere. „Nein“, sagt sie: „So nennt man Mädchen, die es nötig haben. Wegen dem Männermangel. Sie werden feucht, wenn auch nur EIN Mann kommt: Wasserlöcher.“
2007 bist du mit Q auf Hs Kostümfest. Du weißt nicht, ob du H gefällst. Zwei Frauen, X und Y, bleiben bis zum Schluss. X hat einen Freund, aber flirtet mit dir. Als du nicht darauf eingehst, tauscht sie Küsse mit Y. Q sagt: „Am Ende hätten all drei Frauen mit dir rum gemacht – aus Verzweiflung.“
Kurz darauf sagt Q, sie habe oft Angstzustände und sei einsam. „Ich will nichts von dir. Aber ich würde gern bei dir liegen können, wenn ich Attacken habe. Als Dank können wir auch Sex haben.“
V sagt, bei einer KuWi-Performance lud eine nackte, mit Schokolade beschmierte Studentin alle ein, an ihr zu lecken. V sagt, bei einer Theater-Semesterabschluss-Performance zum Thema Gender hätten sich mit Seifenlauge beschmierte nackte KuWis mit Sekt betrunken, bis es zu Gruppensex auf der Bühne kam. „Prüfer kuckten zu. Und wieder alles nur aus Frustration.“
Anne Köhler schreibt, sie fuhr für Dates mit einem Kommilitonen übers Wochenende nach Hamburg: In Hildesheim wären sie alle drei Meter erkannt, beurteilt worden.
.

.
zwölf:
Eine KuWi ist lange in dich verliebt. Du denkst nur: „Nein – das liegt daran, dass hier kaum Männer sind.“ Zum ersten Mal fühlst du dich wahrgenommen, begehrt, sexuell relevant. Alle Frauen fühlen sich ungeliebt, auswechselbar wie nie.
Viele KuWis tragen Rock über Hose, bunte Tücher im Haar. Frauen, die sich strenger oder femininer kleiden, stehen schnell unter Tussi-Verdacht. Der KuWi-Look ist so eingängig, uniform, dass deine Mutter bis heute, wenn sie Autorinnen, Moderatorinnen beschreibt, oft sagt „Das war keine richtige Frau. Das war halt so ein KuWi-Mädchen.“
Deine Exfreundin hat Besuch von Kommilitonin Simone. „Na? Bist du auch so ein KuWi-Mädchen?“ – „Ich bin Simone. Ich bin eine Frau. Und ich studiere Kulturwissenschaften.“ Simone wird deine beste Freundin. Du sagst nie wieder „KuWi-Mädchen“.
Eine KuWi mit leiernder Stimme stellt verwirrte Fragen. Sie wirkt androgyn und abgemagert: Hat sie eine Essstörung? Du und eine Freundin nennt sie „Gender Bender“.
Ein KuWi trägt einen Nasenring, schwarze Fingernägel und das Glitzerlogo einer Glam-Metal-Band, Cinderella. Du und eine Freundin nennt ihn „Cinderella“.
Es gibt zwei schwarze Frauen im Fachbereich, einen Mann. Bei lesbischen und bisexuellen Frauen spekuliert ihr, ob sie nicht nur „verzweifelt“ sind. Mit der Zeit lernt ihr drei, vier KuWis kennen, die aus einfachen Elternhäusern stammen. Oft gingen sie schon in Hildesheim zur Schule.
Sina finanziert ihr Studium mit Auftritten in Gerichts-Shows auf RTL. Als sie in einem Seminar zu Literaturkritik ihre Mailadresse angibt, rollen alle die Augen und finden sie „absurd“ und „prollig“: 156-cm-purer-sex@web.de
.

.
dreizehn:
Alle haben Angst, verwechselt, übersehen, ersetzt oder übergangen zu werden – in Freundschaften, Beziehungen, Projekten. Wer zögert oder Pflichten nicht übernehmen will, weiß: Es gibt genug genügsamen, motivierten Ersatz. Und weil sich alle ähneln, braucht es wenig, um zu irritieren:
Matthias Karow mag Gedichte von Bastian Winkler. Er gründet einen Verlag, um sie bekannter zu machen. „Nur einem Freund zuliebe?“, fragt ein Gastdozent: Matthias soll sagen, ob er schwul sei. Tatsächlich kennst du in den ersten drei Jahren keinen schwulen Schreiber oder KuWi. („DAS ist jetzt anders!“, lacht eine Freundin, seit 2016 in Hildesheim.)
Alex‘ WG feiert eine Party unter dem Motto „Spießer“. Um aufzufallen, herauszustechen, trägst du eine Lederjacke und Kajal. „Warum?“, fragt Cinderella. „Warum nicht: Jetzt sehe ich EINMAL metrosexueller aus als du!“ Er lässt dich stehen, doch nimmt deine Entschuldigung bald an. Du schämst dich bis heute.
Eine Frau schreibt über Sex mit einem älteren, dominanten Mann. Eine andere über eine Schülerin, die auf der Feier einer Freundin beim Tanzen von deren Vater angefasst wird. „Sexueller Missbrauch, autobiografisch?“ – „Stefan: So was passiert jeder von uns mal. Ich wollte das einfach aufschreiben.“ Du selbst schreibst eine plakative, vulgäre, absurde Geschichte über Pädophilie – um zu beweisen, dass du jedes Genre bedienen kannst.
In Woche 2 liest ein Kommilitone einen Text aus Sicht eines unglücklichen Bisexuellen. Du verliebst dich in ihn. Drängst, ob der Text autobiografisch ist. Er weist dich zurück – und für zwei Jahre gehst du auf keine Party.
Jule leitet das Erstsemester-Tutorium, trifft die 10, 15 neuen Schreiber*innen als erste. „Tolle Leute dabei?“, fragst du jedes Jahr. 2004 gibt es nur sieben Neue. 2005 passt keine*r zu dir. In Jahr 3 kommt eine Frau, von der Jule glaubt, du wirst sie mögen. Du stürzt ins nächste Seminar, bist hingerissen… und merkst: Sie stellt wirre Fragen. Wieder nichts! Ein weiteres Jahr Warten – auf Lois-Lane-artige Neue.
.

.
vierzehn:
Du lernst Menschen kennen, hast sie satt – doch weißt: Du siehst sie jetzt noch neun Semester lang in jedem Seminar, Projekt, musst alles mit ihnen abstimmen.
Du hasst, wie viele Texte, Vorschläge von dir Redaktionen und Lektorate passieren müssen, geführt von Leuten, die du seit Monaten oder Jahren meiden willst.
Du weißt: Jedes Jahr kommen etwa 100 neue KuWis, 15 Schreiber*innen. Das ist der Pool. Sonst gibt es niemanden.
.

.
fünfzehn:
Deine Vermieterin ruft an: „Beseitigen Sie das mit Ihrem Auto!“ Jemand türmte 30, 40 gelbe Säcke auf den Polo, über Nacht. Dir fallen 50 Menschen ein, die dich steif, unangenehm genug finden, um darüber zu lachen. Doch kein einziger, der dich so wenig mag, um sich diese Mühe zu machen. Ein Scherz? Berechtigte Aggressionen?
Jule will für Frauenzeitschriften schreiben, und machte ein Praktikum beim Stadtmagzin Prinz. „Na, wenn das kein Kulturjournalismus ist!“, sagt Porombka. Jule hört das als Kompliment. Du denkst, er spottet.
„Es gibt verschiedene Sorten Literaturkritik. Das Feuilleton. Und dann mehr das, was Stefan macht: Brigitte-Journalismus.“ Jule denkt, Porombka scherzt. Du traust dich nicht, zu fragen.
Direkt danach fragt er, wer Radiofeatures zum Thema „Literatur und das Bett“ recherchieren will. „Proust schrieb im Bett.“ Du willst alles lesen, über Pfingsten. Porombka nickt. „Nur heißt der Pruuust, Stefan. Nicht Brauwst.“
Um zu beweisen, dass du keinen „Trash“, „Brigitte-Journalismus“ schreibst, liest du in zehn Tagen 4.200 Seiten Pruuust; und bis zum Herbst 50 Romane für ein Essay über Provinz. „Gut getrickst: Klingt fast, als hättest du das echt gelesen“, sagt Porombka und zwinkert.
.

.
sechzehn:
Du bist stolz, nie mit „strategisch wichtigen“ Menschen gefeiert zu haben. 2005 bietet Ortheil ein Seminar zum Schreiben in Venedig. Du scheiterst nicht am Geld: Du hast keine Lust, Energie, tagelang freundlich-professionell-interessierte Distanz auszustrahlen.
2008 fährt Ortheil mit allen 40 Helfer*innen des Literaturfestivals PROSANOVA auf Sylt. Als einziges Mitglied der Leitung bleibst du in Hildesheim: Du willst, dass Leute mit dir arbeiten, weil sie deinen Ton, deine Texte mögen. Du willst kein Klima, bei dem dein Verhalten auf einer Reise oder an einer Bar entscheiden kann, welche Kompetenzen, Posten dir übertragen werden.
2006 bietet dir Porombka eine Stelle als Hilfskraft an. Du brauchst die Zeit zum Lesen, Schreiben und sagst ab. „Dir ist deine Selbstverwirklichung also wichtiger?“ mailt er – und du hast Angst, ihn vor den Kopf gestoßen zu haben. „Mach sowas nicht!“, klagt deine Mutter. „Du bist von diesen Männern abhängig!“ Das sagte sie schon über alle Lehrer deiner Schulzeit.
Du fürchtest ein paar Monate, dass dich Porombka schneidet oder hängen lässt. Dann merkst du: Nein. Er meint es ernst. Schreiben und Selbstverwirklichung sind wichtiger!
Du leitest ein Tutorium, vergütet als halbe Hiwi-Stelle – doch findest deine Steuernummer nicht und kümmerst dich nicht weiter um die 200 Euro Lohn. Eine Mitarbeiterin schreibt, sie streicht das Geld und sagt Ortheil, dass du ihre Briefe ignorierst. Du denkst: Wer Zeit für Steuernummern nimmt, hat weniger Zeit, der beste Tutor zu sein, der er sein könnte. Ortheil wird das verstehen.
Du glaubst, wer sich ums Geld kümmert, wirkt unfein, gierig. Noch 2010 prahlst du damit, nie nach Stipendien gefragt zu haben – weil du befürchtest, dass dich Kritiker als saturierten Schreibschul-Streber verlachen, der Steuergelder verbraucht. Erst Armutsexperte (und KuWi) Christian Huberts macht dir deine Privilegien klar: 200 Euro in den Wind schießen – das geht, weil deine Eltern halfen. Es ist keine Leistung oder Charakterstärke.
.

.
siebzehn:
Martin schreibt Rezensionen im Netz, bei der „Berliner Literaturkritik“. Um nachzuziehen, aber Martin Raum zu lassen, bewirbst du dich bei „Literaturkritik.de“. Nach zwei Jahren Studium hast du endlich externe Autoritäten, die deine Arbeit schätzen, verbessern.
Davor aber haben 14 Menschen meist die selben wenigen Ziele, wollen auf die gleichen Posten: Wer darf den Grundkurs Kreatives Schreiben leiten? Muss man dafür erst Hiwi werden? Wer wird Tutor*in für neue Jahrgänge? Redakteur*in beim Webmagazin Lit04? Lektor*in der Landpartie-Anthologie? Betreuer*in neuer Buchprojekte?
Du schickst Kurzgeschichten an BELLA triste – eine Zeitschrift für junge Literatur, gegründet von Studierenden, mit denen du nicht zu sprechen wagst, weil sie zwei, drei Jahre länger in Hildesheim sind. 2005 wird Prosa von dir gedruckt. 2006 wirst du Redakteur – doch weil die erste Generation das Ruder an Jüngere übergab, fehlen dir Prestige und Anerkennung: Du glaubst, dass dich „die Älteren“ peinlich finden.
Für Lit04 liest du alle Bücher Vladimir Nabokovs. Porombka sieht die Ausschreibung für eine Konferenz an der Cornell University – und fragt, ob du den Call for Papers beantworten willst. Du weißt nicht, was ein Call for Papers ist. Doch dein Vater zahlt dir das Ticket nach New York, eine Germanistin bietet dir einen Schlafplatz an, der Vortrag glückt: Du sprichst an Nabokovs alter Uni… und merkst, wie viel entspannender, sachlicher du dich außerhalb Hildesheims verhandeln kannst.
.

.
achtzehn:
„Drei von euch können später von Romanen leben“, warnt Ortheil 2003, beim ersten Treffen. Zu lange glaubst du, das heißt: Drei sind gut genug. Tatsächlich haben von 14 mittlerweile erst drei Romane veröffentlicht – doch fast alle sonst Sachbücher oder große Reportagen, Hörspiele, Kinderbücher, Kurzgeschichten, eine eigene TV-Serie.
Wer heute, 14 Jahre später, noch Romane schreiben will, schreibt und veröffentlicht sie: Einige Türen stehen offen. Viele aber nehmen andere Türen – weil sie rentabler sind oder mehr Spaß machen. Du dachtest, Ortheil sagt: 11 Menschen scheitern an Romanen. Doch wer keine Romane schreibt, schreibt mittlerweile fast immer in Formaten, die ihr oder ihm besser liegen.
Im Studium hörst du das „drei von euch“ als „drei sind es wert“, „drei sind vielleicht interessant“, „für drei werde ich mich einsetzen“, „drei interessieren mich“.
Du liebst eine Ortheil-Porombka-Vorlesung im ersten Jahr, „Jetztzeit“. Zwei Stunden im Audimax, schnell wie eine Samstagabendshow, mit Filmszenen, Livemusik und kurzen Präsentationen älterer Studierender. Dein ganzes Studium überlegst du: Was an meiner Arbeit, meinem Ton, meinen Texten ließen beide auf diese Bühne? Was kann ich bieten, das Porombka interessiert? Ortheil?
Porombka, erst 36, verhandelt sich mit euch. Ihr spürt: Euer Feedback hat Gewicht. Er will gehört, verstanden werden. Ortheil spricht im Fernsehen, kennt Politiker, in Lesungen sitzt ein viel älteres Publikum. Welchen Stellenwert hat euer Blick, eure Meinung für ihn?
Du horchst auf, sobald die beiden jemanden bewundern. Porombka mag Flaneure, Spieler, kleine Formen, Ironie. Auch Ortheil legt euch nahe, klein anzufangen – mit Skizzen und Notaten. Weil er Skizzen bewundert? Oder weil er glaubt, für Größeres seid ihr zu kleine Geister?
Du willst ein Seminar zur Popliteratur geben. Ortheil hält es gemeinsam mit dir, 2007. Du bist begeistert über die Freiräume, die er dir lässt – doch hast dauernd Angst, ihn zu langweilen. Du sprichst mit ihm wie mit deinem Vater: Betonst, wie hart du arbeitest. Merkst dir jede Wertung, jedes Urteil. Doch gehst, so schnell du kannst. Du fürchtest bis heute bei vielen Männern dieser Generation: Je besser sie deine Werte, Prioritäten kennen… desto läppischer, alberner finden sie dich.
.

.
neunzehn:
Wie viele Seminare waren von Männern? Wie viele von Frauen?
Alle fünf Psychologiekurse machst du bei der selben ungewürdigten, von Lehrämtler*innen angeblafften Professorin. In Kunst unterrichten dich fünf Männer, eine Frau. Du brauchst keine Mühe, um aufzufallen. Träge Pflichtkurse, die Zeit und Kraft verschlingen.
In Film-Theater-Medien doziert eine grandiose Frau of Color, Mohini Krischke-Ramaswamy, schon 2003 über Fanfiction und lesbische Liebe in „Xena“. Patricia Feise zeigt Grundlagen der Gender Studies am Blick auf „Akte X“ und Seven of Nine. In einem Filmseminar von Corinna Antelmann lernst du an zwei Wochenenden mehr über Spannungsführung als in vier Jahren.
Hans-Otto Hügel ist Professor für Popkultur. In deiner zweiten Woche fragst du nach Pop- und… „…echter Kultur? Wissen Sie, was ich meine?“ – „Kann jemand dem Kommilitonen erklären, dass es ‚E-Kultur‘ heißt?“
Erst ärgert dich, wie viel Jargon vorausgesetzt wird: von Lehrkräften, angeheuert, um euch einzuführen. Schnell aber siehst du Seminare scheitern – weil im Poetik-Seminar fast jeder denkt, es ginge um Gedichte. In Film-Seminaren dauernd Leute fragen, ob Filme überhaupt Kultur seien. Immer neue Anfänger*innen alles ausbremsen, mit Grundsatzdiskussionen.
Noch einmal „Sailor Moon“: Weil Klaus Siblewski der einzige Lektor bleibt, der in drei Jahren Kurse gibt, glaubst du, als Lektor müsse man sein wie Klaus Siblewski. Ist Felix Huby der einzige TV-Autor, glaubst du, man müsse sein wie Felix Huby. Beide sind 35 Jahre älter und – in Habitus, Ton, Naturell – entmutigend weit weg von jeder Rolle, die du beruflich füllen könntest.
.

.
zwanzig:
An welchen Stellen entlarvst, disqualifizierst du dich – weil du feine Unterschiede nicht kennst?
2013 sagt S: „Ach, die erste BELLA-Redaktion mit ihrem Tocotronic-Look“ und dir wird klar, dass die Frisuren, Trainingsjacken, Schuhe, Zitate für jeden, der deutschsprachige Musik hört, augenfällig sind. Mit 21 macht dich irre, woher alle Adam Green, David Foster Wallace, n+1 kennen – doch kein Mensch Elke Heidenreich zuhört oder die SZ-Bibliothek liest. Weshalb lieben diese älteren Studierenden Tannenzäpfle-Bier aus dem Schwarzwald – und verachten Energy-Drinks? Menschen in deinem Dorf feiern Senseo-Kaffeepad-Maschinen. Hier zählen Espressokannen auf Gasherden in Altbau-WGs – und jede dritte Kurzgeschichte enthält das Wort „Holunderblütensirup“.
2006 willst du deine Rezensionen auf Amazon zweitveröffentlichen. Porombka glaubt, du verkaufst dich unter Wert. Alle sind geschockt, dass du auf die Idee kamst. 2012, beim Literaturwettbewerb Open Mike, liest du aus deinem Roman – und brennst Daten-CDs mit den ersten 100 Seiten, falls Zuhörer*innen mehr wollen. „Du demontierst dich!“, warnt Vea Kaiser. Sie findet, du machst dich und dein Buch lächerlich.
Über TV-Serien spricht niemand am Institut. Dann zeigt Porombka eine Szene aus „Der Bachelor“: Reality-TV ist diskutabel? Im zweiten Semester siehst du einen „Spider-Man“-Sammelband in seinem Regal. Du achtest genau, wer was erwähnt oder lobt: Sind also auch Comics hier erlaubt, salonfähig?
2017 fotografiert sich Porombka in Stützstrümpfen, Unterwäsche – als Bildwitz für die ZEIT. Du merkst, dass du bis heute mental Buch führst: Was er tut, zeigt, was Journalist*innen gerade tun dürfen – ohne, dass Verlage, Redaktionen Achtung verlieren. Je sorgloser, spielerischer Porombka im Netz agiert, desto sicherer darfst du sein, dass dich der Betrieb nicht plötzlich ausspuckt.
2004 kommt die Schriftstellerin, Journalistin Annett Gröschner ans Institut, lehrt über Literatur und Arbeitswelt. Sie ist kompetent, humorvoll – doch trumpft irritierend wenig auf. Gegen Abend ihres ersten Blockseminars (zu Sachbüchern) fragt sie in die Runde, ob jemand Buletten will. „Ortheil, Porombka würden kein Essen anbieten. Oder nur extravagante Snacks. Auf keinen Fall selbst gemachte Buletten: Annett versteht nicht, was hier läuft“, denkst du.
Ab 2009 postet KuWi Merlin verbitterte Links zur Hochschulpolitik: Dir ist nicht klar, wer Carsten Maschmeyer ist. Warum Dozierende nach Jahren gehen müssen – obwohl sie dringend bleiben wollen. Merlin sieht die Uni als fragwürdigen, drittklassigen Sumpf, voll schlecht versteckter Klüngelei.
.

.
einundzwanzig:
Fast alle Männer, mit denen du studiert hast, arbeiten heute im Kulturbetrieb oder sichereren, lukrativen Branchen: Bildung, Werbung. Viele Frauen brachen das Studium ab.
Den längsten Atem haben oft Männer, die durch die Schreiber-Prüfung fielen, als KuWi ein Jahr alle Seminare besuchen, im zweiten Versuch bestehen. 2005, in einer Rauchpause, sagt KuWi Leif Randt, er schaut oft „Samt & Seide“ mit seiner Mutter: eine ZDF-Soap, mit der niemand kulturell punkten kann. Du fragst dich ernsthaft, ob er wegen solcher arglosen Sätze abgelehnt wird.
2008 planst du PROSANOVA, Tag und Nacht – doch eine Stunde pro Woche triffst du deine echten Freund*innen. Ihr schaut „Desperate Housewives“. Je läppischer, alberner die anderen Festivalleiter*innen das finden, desto trotziger, glücklicher sitzt du in der WG, vor dieser Soap.
In einem öffentlichen Poetiktext nennt Lyrikerin Ann Cotten die PROSANOVA-Leitung „Hildesheimer Bubi-Mafia“. Ihr seid vier Männer, zwei Frauen – und dich freut, dass sie den Player-, Poser-, Mauscheltonfall deiner Kollegen nicht ernst nehmen will.
Martin Kordic mag Milena Bodrozic und Sasa Stanisic. Als du Jagoda Marinic zu PROSANOVA holen willst, ist er auf deiner Seite. Dir scheint das etwas billig: Frauen unterstützen demonstrativ Frauen? Ostdeutsche fragen nach Ostdeutschen? Herr -ic will Texte von -ic-Autor*innen? Seilschaften oder Bonuspunkte für biografische Gemeinsamkeiten?
Später lernst du, umgekehrt zu fragen: Warum sucht niemand außer Martin Kordic südeuropäische Stimmen? Warum kennen Heterofrauen im Literaturbetrieb kaum aktuelle lesbische Autorinnen? Welche Journalisten auf Twitter empfehlen Texte von Menschen mit anderem Geschlecht, anderer Hautfarbe? Lobt ein Autor, der selbst vor allem von älteren Frauen bewundert, gekauft, gehört wird, vor allem andere Männer? Du hast den größten Respekt vor Multiplikator*innen, die sich für Menschen außerhalb ihrer In-Group interessieren und stark machen.
.

.
zweiundzwanzig:
Jule liebt Praktika. Sie kann sich eine größere Bandbreite an Jobs vorstellen als alle anderen. Auch Ortheil ist beeindruckt. Er schreibt schon 2005, Jule wird „irgendwann mühelos über den Fluss gehüpft“ sein und ihm „von der anderen Seite aus zuwinken“.
Im Studium hast du Angst vor diesem Fluss: Hast du die Kraft, zu hüpfen? Brauchst du Ortheils Hilfe, um Redaktionen und Jobs zu finden? Dich macht stolz, ihn in fünf Jahren nur einmal direkt um eine Gefälligkeit gebeten zu haben: ein Empfehlungsschreiben für ein Praktikum am Goethe-Institut. Du hast zu kurzfristig gefragt. Er hatte keine Zeit. Das Institut will dich trotzdem.
Herausgeberschaften, Redaktionen, HiWi-Stellen, Tutorien, Lehraufträge, später Promotionen: Einige von euch werden ermutigt, eingeladen, angefragt. Andere suchen Nischen: Sie machen Radio, finden Anschluss bei Theater-, Film-, Medien-KuWis, profilieren sich außerhalb des Instituts, geben das Wettrennen auf.
Vielen Menschen im Studiengang, die sich in Porombka oder Ortheil kaum erkennen, zeigt Annett Gröschner einen dritten Weg: Sie wird Role Model. Dir selbst liegt Porombkas Witz, Schwung, Netz-Euphorie. Wie toll Annett ist, merkst du, als du ihre Texte liest. In persona bleiben die Männer im Mittelpunkt.
2017 erscheint „Es ist Liebe“ – ein Traktat, in dem Porombka Ton, Formen, Arbeitsweisen der Romantik mit neuen Formen von Dialog und Intimität im Netz vergleicht: Tinder, Snapchat, Instagram. „Er schreibt jetzt nicht mehr so extrem“, lobt deine Mutter. „In Hildesheim wolltet ihr immer aus dem Rahmen fallen, schockieren. Jetzt höre ich euch lieber.“ Sie liest das Buch zweimal.
Alle Freundschaften werden leichter, seit ihr nicht dauernd neben-, gegeneinander schreiben, sprechen, wirken müsst. Du hast keinen Spaß an deinem Text über eine Hildesheimer Bushaltestelle – erdrückt, überstrahlt, verwechselbar mit 40 ähnlichen Texten ähnlicher, verwechselbarer Menschen, alle begraben im selben Buch.
.

.
dreiundzwanzig:
Ortheil hat keinen Blog und nutzt kein Twitter, Facebook. Auch Vea Kaiser, 28, sagt 2016 ihren Followern, dass sie jetzt online kürzer tritt. All deine Jobs, Einladungen, Engagements, Kontakte ergaben sich, weil Literaturvermittler*innen dich im Netz lasen, hörten. Dass Kaiser und Ortheil es sich leisten können, diese Kanäle zu ignorieren, zeigt dir: Es gibt noch einen zweiten, analogen Literaturbetrieb – in dem man dich nicht kennt? Wie kommst du rein?
2014 schreibt Florian Kessler, aus Hildesheim und Leipzig schaffen vor allem „Absolventen mit den hochrangigsten bundesrepublikanischen Eltern“ den Sprung in Buchhandlungen, Redaktionen, Professuren: Arztsöhne, Professorentöchter, „ein Managersohn wie Leif Randt“.
„Aber Leif schaut ‚Samt und Seide‘! Er läuft rum wie ein Skater“, protestierst du: „Sein Habitus war so… Suhrkamp-fremd, dass er es auf der Uni schwerer hatte als viele!“ 2003 beschworen alle das literarische „Fräuleinwunder“: Hast du das falsche Geschlecht? Dann starb die Popliteratur: Bist du zu jung? Dann warf man Schreibschulen vor, Texte seien weltfremd, klinisch: Stellt dich deine Studienwahl ins Aus? Und jetzt watscht Florian Leute ab, weil sie reiche Eltern haben? Eure Eltern kamen im Studium nie zur Sprache!
Du brauchst lange, um zu verstehen, auf wen Florians Text befreiend wirkt. Welche Debatten er anstößt – und, dass es nie darum ging, Menschen für ihre Eltern zu strafen. „Leider stimmt in der Polemik unseres geliebten Flo Kessler, den Hildesheim aufgezogen, genährt und gepäppelt hat (bis es ihm zuviel werden musste und er das Zuviel ausgekotzt hat) kaum etwas“, schreibt Ortheil in einem Text zu PROSANOVA 2014 – ohne weiter ins Detail zu gehen.
Statt dir Verbündete, Mentor*innen, Plattformen, Publikum zu suchen, glaubst du von 2003 bis 2008, vor allem abwägen zu müssen, was du zwei einzelnen Professoren zeigen, bieten kannst. Und, wie du auffällst – ohne, dich lächerlich zu machen. Kommuniziert hast du dabei möglichst wenig: Meist war Ortheils Hilfskraft Kai für dich Botschafter, Mittler, Orakel.
Heute – mit Facebook, Blogs, digitalen Orten für Erstkontakt und Dialog – sprichst du viel freier, bringst dich schneller ein: Du kannst alle Texte jeder denkbaren Redaktion anbieten. Hast neue, diversere Kontakte, die notfalls gern vermitteln. Porombka und Ortheil waren gute Professoren. Doch sie waren auch – strukturell – ein Nadelöhr, ein Hegemon, der einzige Fokus. Die Stadt war viel zu klein. Dein Blick zu eng.
Bei PROSANOVA 2017 öffnest du Planetromeo und Grindr. Wie viele queere Männer sitzen mittlerweile hier, in Lesungen? Der Studiengang wirkt bunter, selbstbewusster. Doch die Apps zeigen einen einzigen queeren User: Leif-Randt-Käppi, weit über 30. Nach zwei Tagen wird dir klar: Das war kein Hildesheimer. Sondern der Regisseur eines feministischen Theaterstücks – fürs Festival aus Berlin angereist.
Unnötig wenige Stimmen. Gesichter. Optionen. Hildesheim, das war für dich zu lange: Mangel.
.
„Ich habe in Hildesheim übers Schreiben nichts gelernt. Was in Hildesheim funktioniert, ist sich für einen überschaubaren, also erträglichen Zeitraum Zuständen auszusetzen, modellmäßig und auf Probe, die so ein zukünftiges Autorenleben fingieren, und eine Ahnung dazu zu entwickeln, ob man das aushält“, schreibt Maren Kames.
„Ich weiß, man hört es nicht gern, aber auch an der wunderschönen Uni Hildesheim im superkuscheligen Fachbereich Kulturwissenschaften habe ich Rassismus-Erfahrungen gemacht. Ansonsten hatte ich genau die gleichen Probleme, die wir alle hatten: zu viele Fächer, zu wenig Zeit, zu viel Bürokratie“, schreibt Simone Dede Ayivi.
„Immer wieder klagt jemand, KuWi Hildesheim müsste eigentlich an eine Fachhochschule: Wissenschaftlich nicht auf dem Niveau einer Universität, künstlerisch nicht auf dem einer Kunsthochschule“, schreibt T. – der in Hildesheim promovierte.
.


















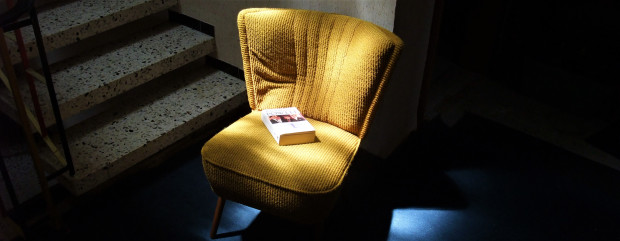




































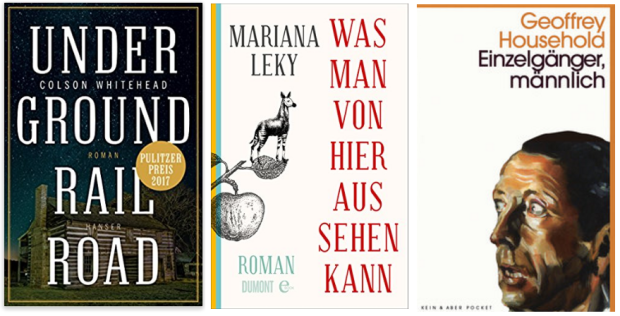

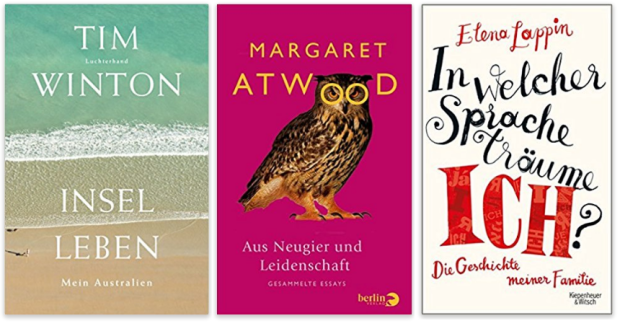
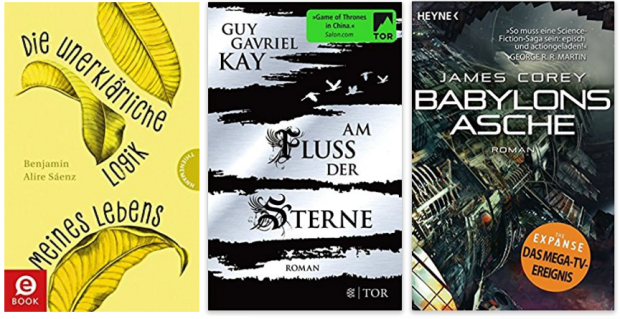







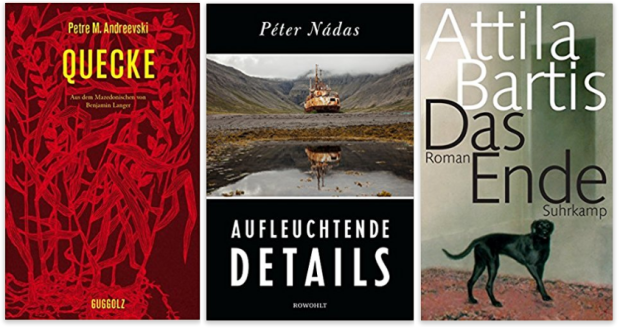

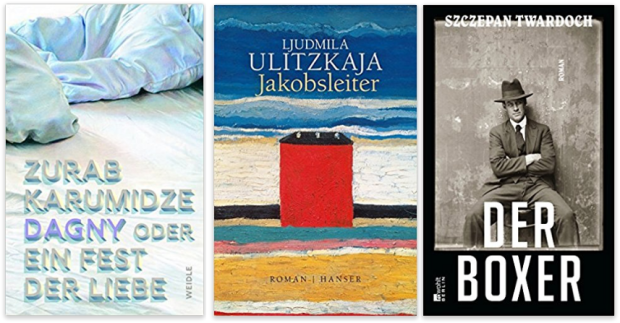

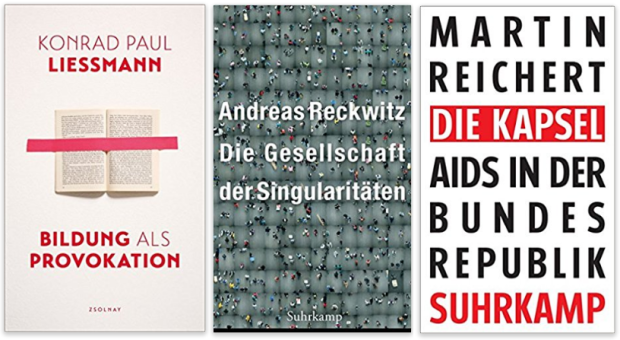
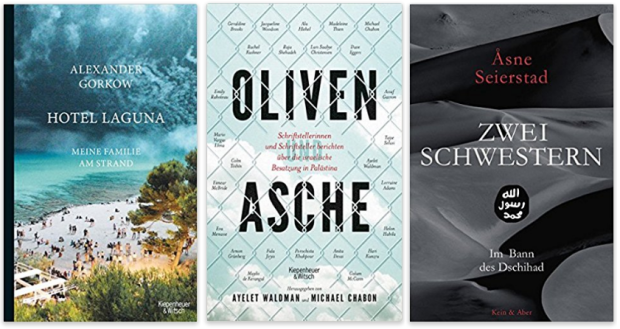
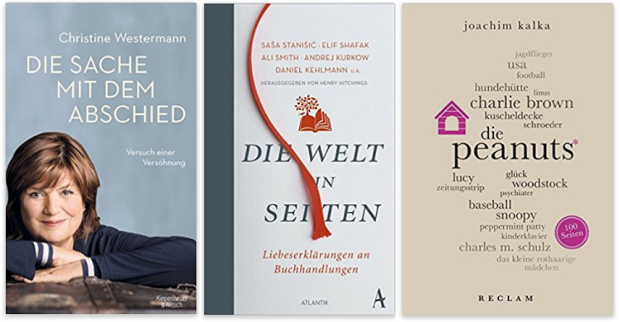





























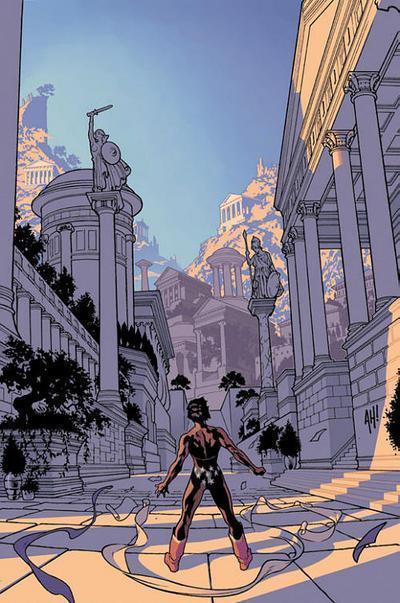



































































 .
.





 .
. .
. .
.






 .
.



 .
.