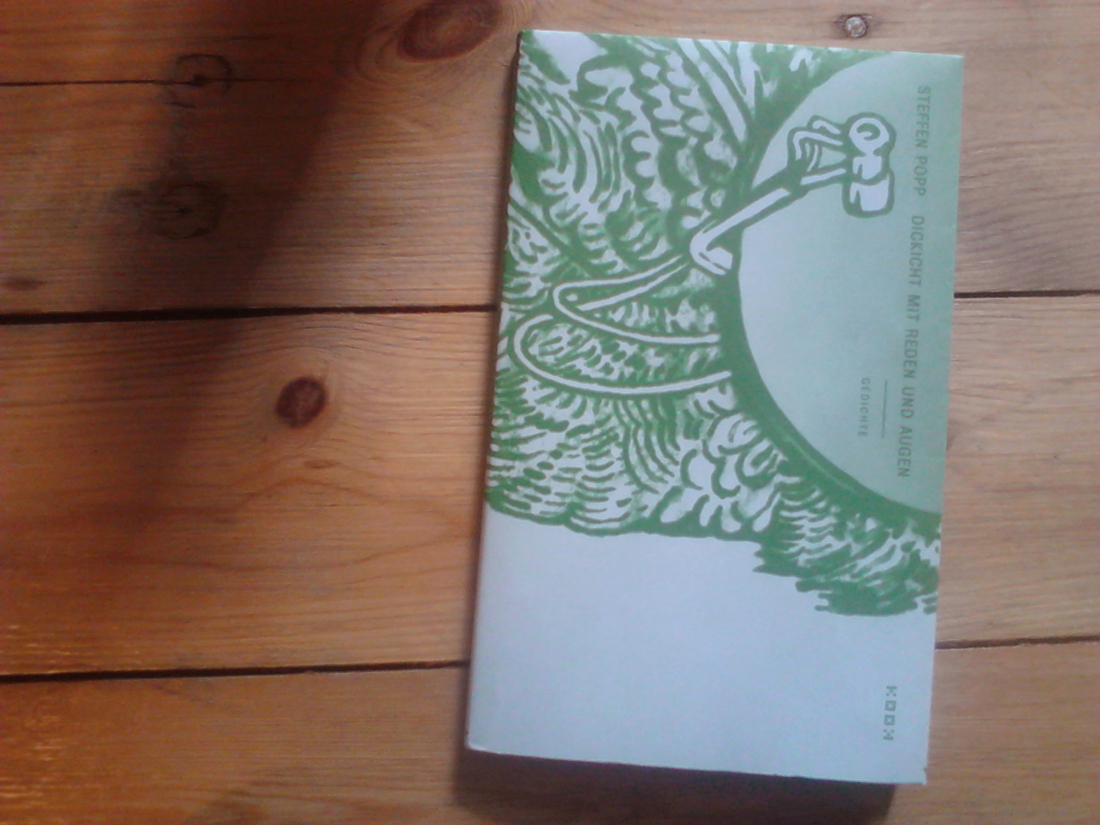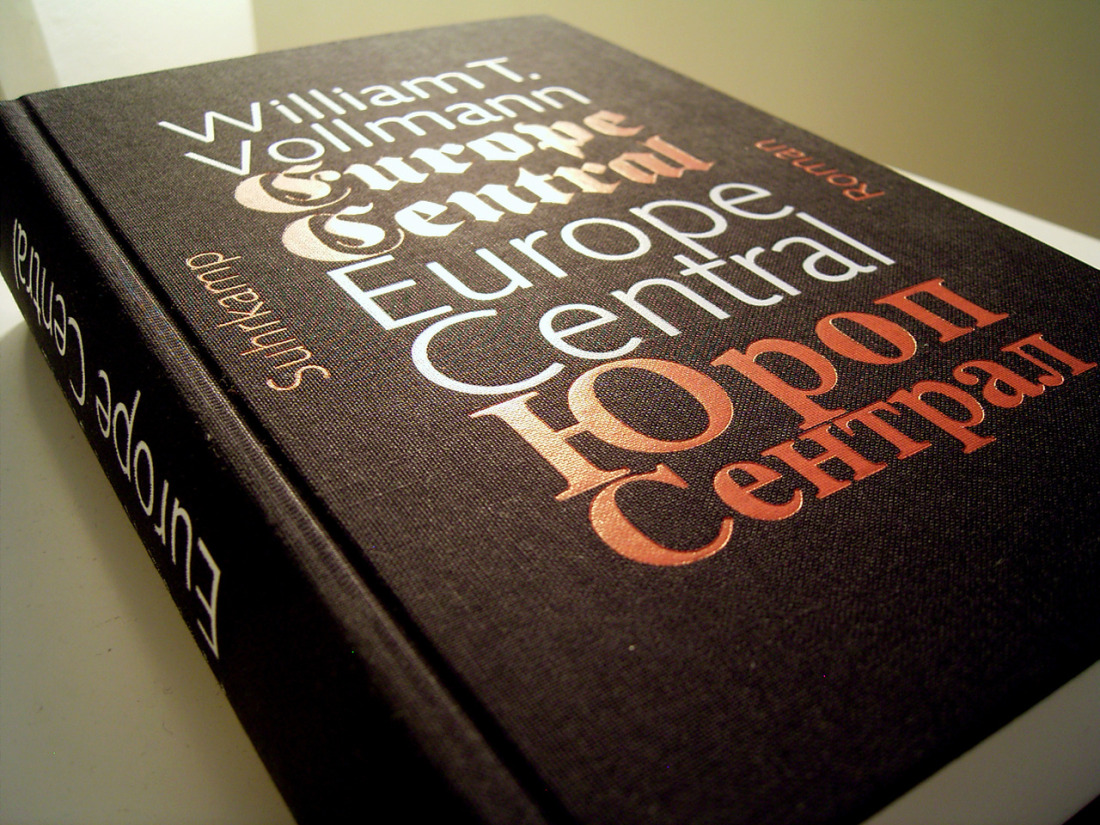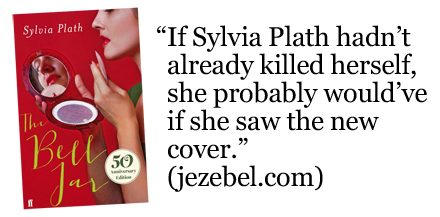Journalistische Dramolette III: Juli Zucker und Andreas Thamm schreiben für Zeitungen und das Internet, beide studieren Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus in Hildesheim. Im Zuge der #balticdiscovery der #kreativsaison Mecklenburg-Vorpommern bereisen die beiden die Ostsee-Region zwischen Wismar und Rostock. Ihre Eindrücke werden an dieser Stelle verarbeitet.
Das Ende einer Reise: Juli Zucker und Andreas Thamm berichten von den kulinarischen Genüssen einer fast vergessenen Region. Es gibt zwar Fisch, aber kaum so oft, wie man meinen möchte.
A: Daniela di Lorenzo wollte eigentlich mal Botschafterin werden. Jetzt lebt sie in Aarhus, Dänemark, und wird Politikjournalistin. Sie kennt sich gut mit Fisch aus. Früher war sie auch selber angeln, und sie widerlegt die von dir, liebe Juli, aufgestellte These, es gäbe überhaupt nur einen einzigen Fisch. Tatsächlich gibt es einen, den hat die geangelt, in Italien, der ist so hässlich, dass sein Name, den ich vergessen habe, auch als Beleidigung verwendet wird, sagt Daniela.
J: Daniela sagt auch, dass das Erste, was sie in unserer viersternigen Hotelresidenz in Kühlungsborn, „Upstalsboom“, gemacht hat, ein ordentlicher Bettjump war, den sie für mein Dokumentationsvideo freundlicherweise erneut vorgeführt hat. Wir haben viel über das Hotel geredet, weil wir arme Lumpen sind und dementsprechend natürlich 90 Prozent der Teilnehmer der #balticdiscovery von ihren Gefühlen überwältigt waren, als wir die gigantische Hotelhalle betraten und unter dem Kronleuchter standen – der ungefähr die Größe meines Badezimmers besitzt, aber: am intensivsten haben wir natürlich über die Schokoladenbällchen gesprochen, die neben einem persönlichen Brief und einem bestialisch großen Teller Fremdobst für uns zur Begrüßung bereit gestellt wurden. Ich mach immer so lange Sätze. Ätzend.
A: Amen. Worauf ich hinauswollte: Es gibt so Verknüpfungen und Erwartungen. Wenn ich in Wismar über dieses Knöchelbrecherkopfsteinpflaster gehe, aus geringer Entfernung die Backsteinbauten am Hafen bewundere und es erstmals so salzig riecht, ist mir, wie sonst nie, nach Fischbrötchen. Ich glaube Daniela geht’s genauso. Man muss über einen gewissen Wagemut verfügen, um, nach all dem, was wir vorgesetzt bekommen, zu fragen: When will we have fish? Aber wirklich: When?
J:Wenn ich in Wismar über dieses Knöchelbrecherkopfsteinpflaster gehe, oder in Rostock oder sonst wo, denke ich, dass die Inlineskateindustrie gut daran tun würde, sich weniger um einen Vertrieb in Mecklenburg-Vorpommern zu kümmern. Ansonsten vielleicht auch daran, dass wir uns bei unserer Tour auch auf Essen verstärkt konzentriert haben und die Meckpommer auch kein Problem damit haben, hervorragende Speisen zu zaubern und diese Speisen ebenso sehr zu lieben, beispielsweise der dicke Käseverkäufer in Wismar, der seine runden Käselaibe von der einen Ecke seines Wagens in die andere trägt, uns ansieht, wie wir bei ihm vorbeischlendern, und uns gerade entgegen schreit: LECKER, LECKER. Damit wir wissen, woran wir sind.
A: Man muss sagen, er sang es. Noch mal kurz und knapp: Maximo aus Cadiz beziehungsweise Bornemouth steht nicht so auf Fisch, Juli aus Niederbayern denkt, es gibt nur einen Fisch, aber den isst sie, vorzugsweise mit Meerrettich von Schamel, Daniela aus Mailand beziehungsweise Aarhus will Fisch, Andreas aus Oberfranken ebenfalls.
J: Was der Künstler und Kunsttherapeut Andreas Renner über Fisch denkt, ist unklar, aber er besitzt zumindest ein Herrenhaus sowie das dazugehörige ehemalige Wasserschloss in Büttelkow, einer mikroskopischen Ortschaft mit nur 24 Einwohnern. Nach einer gediegenen Kunsttherapie, bei der jeder irgendetwas in einen Topf voller Wachs eintunkt – seien es die eigenen Hände oder sämtliche Naturalien – und daraus sonst etwas bastelt und somit per Kunsttherapie regeneriert wird, bereitet uns Andreas, ebenfalls dem Freistaat Bayerns entsprungen, mit seiner Frau Spätzle zu und zwar mit einer Extraportion Liebe, die wir vertilgen, als hätten wir zehn Tage ohne jegliches Lebensmittel auf einer grasgrünen Wiese in den Weiten Mecklenburg-Vorpommerns verbracht (was nicht stimmt, in Wirklichkeit wurden wir von #balticdiscovery nahezu gemästet). Das Frühstück am nächsten Tag ist nicht weniger erhaben und Andreas und Antje, seine Lebensgefährtin und als Wissenschaftlerin tätig, stehen uns bei wie in der Nacht zuvor am Lagerfeuer und ebenso am Bahnhof in der nächstgelegenen Ortschaft Kröpelin, und winken zum Abschied mit strahlend weißen Stofftaschentüchern.
A singt: Der Meerettich von Schamel … Unsere erste Regieanweisung, geil, was?
J: Genauso begeistert wie ich von der Dimension dieses Hauses und der Harmonie bin, die das Einzige ist, was mich in Mecklenburg-Vorpommern richtig fertig macht, mit den überhaupt nicht dunklen Straßen in Wismar, wo sich ein farbiges Haus neben das nächste stellt und wo in Rostock ein Fischer neben dem anderen steht und seine Angel auswirft, ist Maximo, unser spanischer Fotograf, der sich gerne was gönnt, und sich also zum Beispiel im Luxushotel ein Peeling und eine Massage kauft, begeistert von den Schokobällen, von denen er am Spätzletisch erzählt. Wie genussvoll er sie in seinem Bademantel gesessen haben muss, nachdem das Salz vom Masseur ihm den Stress von der Haut gekratzt hat, können wir nur an seinen philosophischen Ergüssen über Schokolade im Allgemeinen erahnen.
A: Darf ich zitieren? And then the chocolate melts in the mouth like chocolate. Der Punkt ist, wir kommen am Endpunkt der Reise an, Rostock. Wir spazieren am Hafen entlang, Glasbauten, kleine Segelboote und, wirklich, Schulter an Schulter stehen die Angler und halten ihre Ruten ins Wasser. Es ist nicht mal so, dass sie sich durch die schiere Anzahl gegenseitig Konkurrenz machen würden – wenn man sich auf die Stufen setzt, und ein wenig zuschaut, kann man sehen, wie sie die zappelnden Silberlinge quasi im Zehnsekundentakt aus dem Wasser ziehen. Manchmal hängen zwei oder drei an der Leine. Ein Blick in so einen Eimer macht mich, obwohl die auch da immer noch zappeln, hungrig. Der fünfte Tag an der Ostsee, noch immer kein Fisch in meinem Mund.
J: Das ewige Warten auf den Fisch.
A: Daniela und Emilie kennen ja keine Schüchternheit, sie stellen sich dazu, ratschen ein wenig mit den knorrigen, alten Herren. Was sie da so rauszögen. Emilie spricht ja ganz gut Deutsch, der Angler, den sie sich rausgesucht hat, kann das gar nicht glauben, wo sie doch aus Dänemark käme, das heißt, dass sie ja unweigerlich an der Küste wohne, dass sie dann noch nie angeln gewesen sei, mit dem Großvater wenigstens. Es dauert nicht lange, bis Daniela und Emilie die Herren an ihren Angeln ablösen. Das scheint an irgendwas zu liegen heute, das besonders hohe Aufkommen von Fischlein, gerade im Hafen von Rostock, da gehört gar keine jahrzehntelange Erfahrung dazu. Bis Emilie vier am Stück rausholt. Rekord sagt ihr Mentor mit dem Klumpfuß, Rekord!
J:Ich sage nichts, weil ich mich nicht für Fische interessiere.
A: Aber jetzt wird’s erst interessant. Später am Abend, wir sitzen beim Abendessen, es gibt Fisch, und auch die Gespräche drehen sich um selbigen. Es geht darum, was die beiden, die Dänin und die Italienerin, da heute aus dem Wasser gezogen hätten. Makrel, sagt Emilie und Daniela pflichtet eifrig bei, das seien eindeutig Makrelen gewesen, und die Angler selbst, die dort seit Jahr und Tag, bei Wind und Wetter und so weiter stehen, die behauptet hätten, es handle sich bei diesen Fischen um Heringe, die hätten nicht Recht, mithin also keine Ahnung, die Profession verfehlt. Was uns zurück zu deiner, liebe Juli, Ausgangsthese bringt: Es gibt also doch bloß den einen Fisch. Den haben die geangelt.
J:Wie immer behalte ich das letzte Wort und auch Recht. Tschüß.
A: Werde Baumpate, Juli!
J: Ok.

Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen...