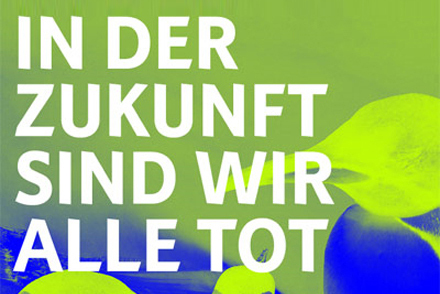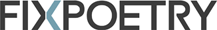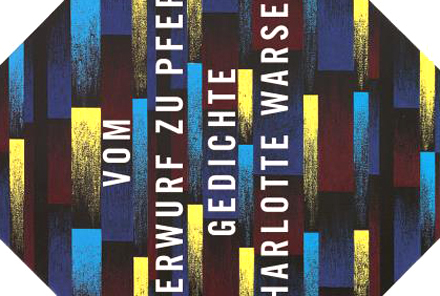Lukas Bärfuss hat einen sehr ernsten, sehr traurigen Roman über den Selbstmord geschrieben: Der Erzähler, selbst erst noch über Kleist forschend, wird darin plötzlich mit dem Suizid seines Bruders konfrontiert.
Wie schon in seinem Afrika-Roman Hundert Tage erweist sich Bärfuss erneut als ein unerbittlicher Erzähler. War es damals der in seiner Brutalität unbegreifliche Völkermord in Ruanda, nähert er sich hier einem ebenso unbegreiflichen Thema, dem unerwarteten Tod eines nahen Verwandten, mit aller Schärfe und Präzision des Beobachters, für den das Aufschreiben gleichsam Bewältigung eines Traumas ist.
Ein wenig Trost in der sehr bedrückenden, beklemmenden Atmosphäre dieses Romans bietet das titelgebende Tier, der Koala, das der Verstorbene von seinen Kameraden als symbolisches „Totemtier“ erhalten hat. Die auffallend lange Beschreibung des Koalas und seiner Lebensumstände verschafft dem Erzähler Erleichterung; das ist beim Lesen deutlich spürbar und lockert schließlich auch die düstere Atmosphäre einer Erzählung, die sonst kaum zu ertragen wäre, merklich auf.
Die längste Zeit hatte das Tier ohne Namen existiert, zwanzig Millionen Jahre wurde es von niemandem gerufen, und doch streifte es schon durch die Steppen, ein Wesen von unbekannter Gestalt, von dem sich nichts als eine Zahnreihe erhalten hat. Es war schon da, als sich die Kontinentalplatten zerrieben, sich Bruchrinnen und hoch im Norden, am großen Meer, das man Tethys nennt, die ersten Dehnungsrisse bildeten. Der alte Kontinent zerbrach, eine Scholle löste sich und trennte das Tier von seiner Gattung, trug es fort, nach Norden und nach Osten, hinein in die warmen Winde, die in den folgenden Jahrmillionen feuchte Luft vom Meer her in das Land trugen. Im schweren Regen verwandelte sich das Tier, es war zu jener Zeit, als sein Rücken kürzer wurde und es den Schwanz verlor. Und noch einmal brach das Land entzwei, Antarktika fuhr in den Süden, erstarrte und wurde zu seiner eigenen Geschichte. Es wurde kühler um das Tier, trockener, die Regenwälder verschwanden und machten Akazien und Eukalypten Platz.