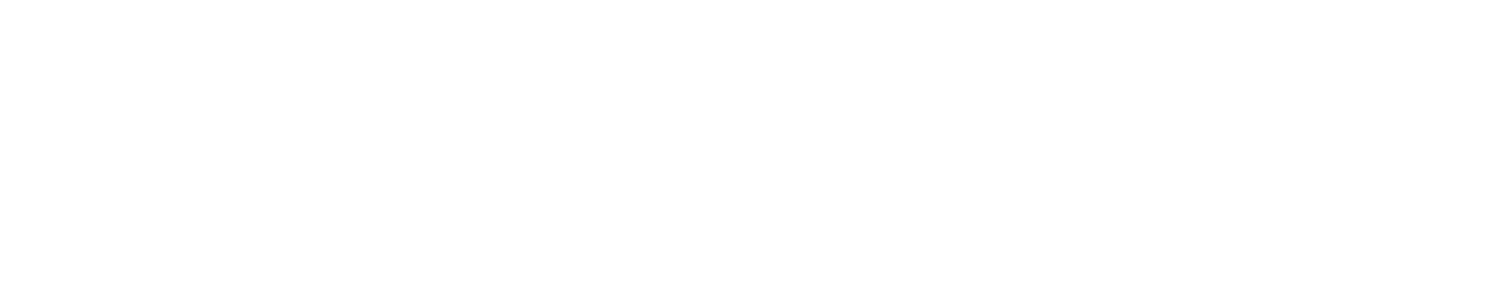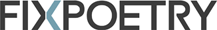Wie Arcade Fire auf Opium: Viet Cong zerlegen das noch junge Jahr mit nur sieben Tracks fein säuberlich in seine Einzelteile.
Brutalistischer Höhepunkt des selbstbetitelten Debütalbums der Band aus Calgary, Alberta, die sich aus den Trümmern der aufgelösten Women zusammengefunden haben, ist das ungefähr ab Minute 6:40 einsetzende, in Dauerschleife hämmernde Schlagzeugdonnern im Schlusstrack „Death“, der das Album in einem atonalen Gewitter zu beschließen scheint, bevor nach zwei Minuten Dauerbeschallung noch einmal der treibende Rhythmus und abgehackte Gesang vom Anfang einsetzt.
Dieses Vorgehen beschreibt schon ziemlich gut den dramaturgischen Aufbau dieses sehr klug komponierten Albums, das zwar durchweg harte Töne anschlägt, aber immer wieder durch spontane Wechsel zwischen purem Geräusch und gefühlvoller Melodie, exorzistischem Austoben und stupendem Innehalten, lustvoller Irritation und anbiedernder Gefälligkeit überrascht. So im in der Mitte des Albums positionierten „March of Progress“, der mit einem fast White-Noise-artigen Intro loslegt, dann in einen kinderliedhaften Gesang, unterlegt von einer übersteuerten Harfe, übergeht und schließlich in einen mitreißenden Sturzbach von Synthesizern mündet, bei dem tatsächlich nicht viel zur Arcade-Fire-Theatralik fehlt. Als weitere Referenzen, vor allem aus dem Post-Punk-Bereich, wurden bereits Bauhaus, Joy Division und Interpol benannt – nur dass hier von allem noch ein bisschen mehr noch ein bisschen dicker aufgetragen wird. Man sollte dieses Album laut hören und unbedingt verfolgen, wie es mit dieser Band weitergeht. Die ersten Deutschlandkonzerte sind bereits ausverkauft.
Viet Cong: Viet Cong, Jagjaguwar, 2015, 36:04 Min., ca. 10 €
Ist denn hier ein Schloss?

Im Stroemfeld Verlag entsteht in Zusammenarbeit mit dem Heidelberger Institut für Textkritik seit 1995 die historisch-kritische Franz Kafka Ausgabe. Als neuester Supplement-Band ist nun Das Schloss in einer hochwertigen Faksimile-Ausgabe erschienen. So soll ein unverstellter Blick auf die frühe Editionsgeschichte von Kafkas Werk ermöglicht werden.
Im Vergleich zum Prozess, der im edlen Leinen, mit gelbem Oberschnitt und Schutzumschlag einer Luxus-Variante des Romans am nächsten kommt (zumal wenn das Kleingeld für eine Erstausgabe fehlen sollte), erweckt das unscheinbare, graue Softcover der Schloss-Aufmachung auf den ersten Blick den Eindruck einer Studienausgabe. Tatsächlich handelt es sich aber um die genaue Reproduktion zwar nicht der ersten gebundenen, so doch der dritten, auch damals als einfache Broschur erschienenen Ausgabe noch aus dem Jahr nach der Ersterscheinung, also 1927. Ein Grund für die Entscheidung des Verlags für diesen Weg mag die besonder Bewandtnis sein, die es mit der Vorlage für die Herstellung des Faksimiles hat: Sie stammt aus dem Privatbesitz von Kafkas letzter Lebensgefährtin Dora Diamant, die sie wiederum dem Schauspieler Herman Greid zum Geschenk machte, wie man der handschriftlichen Widmung, datiert mit „Chanukka 5688“ (=1927), entnehmen kann, die auf der ersten Seite ebenfalls minutiös reproduziert ist.
Im Anhang informiert Roland Reuß über Entstehungsgeschichte und Editionsprozess; beigegeben sind auch Vorabdrucke aus der Frankfurter Zeitung und Anzeigen für das Börsenblatt, die die Bestrebungen des Kurt Wolff Verlags um eine starke Bewerbung des neuen Titels mithilfe von Hermann-Hesse- und Max-Brod-Blurbs („Franz Kafkas Faust-Dichtung“) dokumentieren. Frappierend, wie auch bereits beim Prozess, ist die schiere Dicke des Bandes: Die etwas mehr als 500, in einer groß gesetzten und sehr angenehm zu lesenden Garamond bedruckten Seiten wirken, auch aufgrund der Papierstärke, wie 700. Das Buch muss also in den Buchhandlungen ein echter Hingucker gewesen sein – und ist es jetzt wieder, dem Stroemfeld Verlag sei Dank.
Ich schreie in das leere Haus

Tom Bresemanns neuer Gedichtband Wohnen und Arbeiten im Denkmal ist sarkastisch, zornig und steht in krasser Opposition zu jeglicher Idylle.
Klar, Bresemann und Berlin, das gehört zusammen. Aber wo in Berliner Fenster die Zeilen noch weitestgehend ordentlich gebunden waren, geht es nun doch nochmal eine Spur wilder zu: Das lyrische Ich stellt Fragen, die es sich im selben Atemzug beantwortet, mal kursiv hervorgehoben, mal in Klammern, mal springen die Absätze von links nach rechts, Groß- und Kleinschreibung wechseln sich ab, Durchstreichungen, Schimpfwörter sprengen den Text – man meint, dieser Autor könnte kaum an sich halten mit dem, was er zu sagen hat.
Dass das alles ein Konzept hat und sehr genau gearbeitet ist, verdeutlicht der Blick in den Anmerkungsapparat: Hier gibt Bresemann Quellen an, von Luther bis zu Angela Merkel, von Arbeiterliedern bis zu Interviewfragen an den ehemaligen NPD-Chef Holger Apfel; im Textteil liest sich das dann so („die schuld dem fleische“): „wenn die schönen wesen zur 13. stunde/erscheinen, werden sie den menschen/endlich sagen, dass sie ein nazi sind?“
In den Fakten planschen
Jakob Nolte erzählt in seinem Roman Alff mit archivarischem Furor und irritierender Genauigkeit – eine Zumutung im besten Sinne.
Wer ist dieser Jakob Nolte? Selbst der Name seiner Heimatstadt, Barsinghausen am Deister, klingt wie ausgedacht. Wer ist dieser Jakob Nolte, der eine Hälfte des Autorenduos Nolte/Decar bildet, die auf dem PROSANOVA-Festival in Hildesheim 2014 ein Talkshow-Format präsentierten, das mit der eigenen Langeweile kokettierte, und Stücke schreiben, in denen allein die Variationen des Titels vier Seiten in Anspruch nehmen (Helmut Kohl läuft durch Bonn, UA 2014 ebendort)?
Zu Beginn sei vorgewarnt, dass auch dieser Artikel wenig Licht in das Mysterium der Autorenfigur Jakob Nolte bringen wird, der seinen Texten gerne Motti von Alternative-Bands wie den Silver Jews voranstellt, sich einen ganzen Aufsatz lang der Neil-Young-Ballade „Cortez The Killer“ widmet (in: Neue Rundschau 125/1) oder auf die wichtige Unterscheidung zwischen Skateboarding und der Skateboarding-Szene hinweist („Sanft wie die untere Haut am Schwanz“, in: BELLA triste 39). Zu den verlässlichen Fakten: Jakob Nolte wurde 1988 in Barsinghausen am Deister geboren, studierte szenisches Schreiben an der Universität der Künste in Berlin, in der Spielzeit 12/13 wurde am Landestheater Salzburg sein Stück Agnes uraufgeführt, im Herbst letzten Jahres feierte eine Bearbeitung der Christoph-Willibald-Gluck-Oper Die Pilger von Mekka am selben Ort Premiere. In diesem wenig bekannten Singspiel, einer Art Urversion von Mozarts Entführung aus dem Serail, begibt sich ein Aristokrat auf die Suche nach seiner Verlobten, die von Piraten entführt wurde. Am Hof des Sultans findet er sie wieder, die Flucht der beiden scheitert, doch der Sultan erkennt schließlich die Unverletzlichkeit der Liebe und lässt sie frei. Die Salzburger Nachrichten schrieben von einer „buffonesken Umtriebigkeit“, mit der sich die Schauspieler in das „ziemlich sinn- und zweckfreie Treiben auf der Bühne“ fügten.