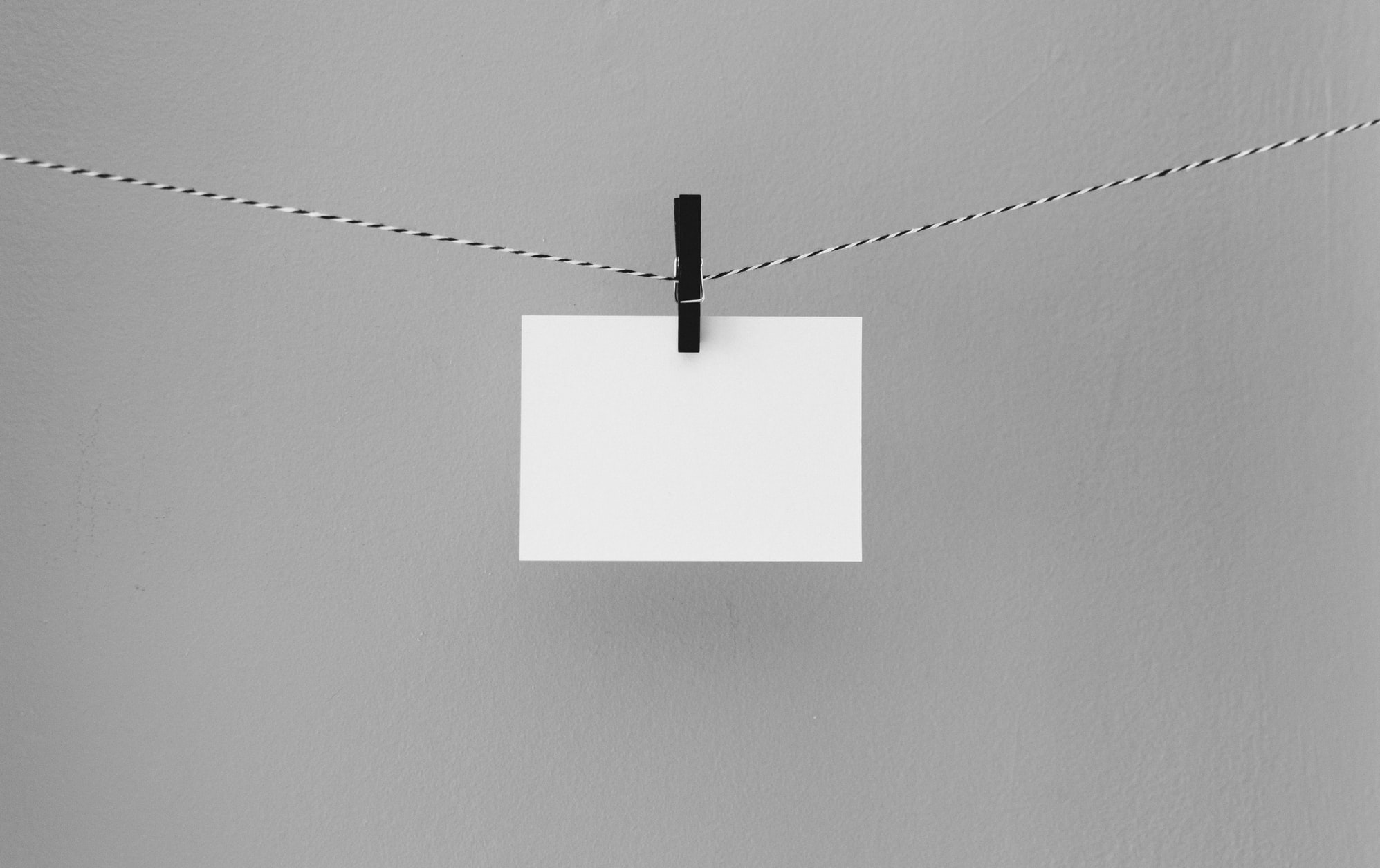In den letzten Jahrzehnten hat die Konjunktur des Kitschvorwurfs nachgelassen. Populären Autoren wie Takis Würger oder Karl Ove Knausgård, die ihre Texte durch Semi- oder Autofiktionalität gern mit Natürlichkeitspathos aufladen, wird er zwar manchmal gemacht, dabei aber nicht mit der verallgemeinernden Ablehnung alles Trivialen, die sonst oft dazugehörte. Während Urheber und populärer Gegenstand in Zweifel gezogen werden, ist man vorsichtiger geworden, dessen Rezipienten zu stark zu kritisieren. Was den Kitschvorwurf nämlich besonders problematisch macht, ist die mit ihm verbundene Unterstellung, nicht nur mit dem Werk, sondern auch mit den Fans des Kitsches sei etwas nicht in Ordnung. Doch diese soziale Dimension des Kitschvorwurfs heißt nicht, dass es den Kitsch als ästhetisches Phänomen nicht gäbe und der Begriff nicht zur Analyse bestimmter Texte gerade aufgrund ihrer Funktion im politischen Diskurs hin hilfreich sein kann.
In Anknüpfung an Kritiken von Massenkultur aus den Nachkriegsjahrzehnten bestimmte der französische Sozialpsychologe Abraham Moles 1972 den Kitsch als „Kunst in der Häßlichkeit“, als „guten Geschmack in der Geschmacklosigkeit“, der Ansprüche an Rezipienten suggeriert, aber nur anspruchslos konsumiert werden kann. Moles zielte damit auf das Potenzial dieser Ästhetik, zur Stabilisierung von Gruppenidentitäten beizutragen. Diesen Ansatz nutzte Saul Friedländer in seinem Essay Kitsch und Tod (1982), in dem er die Kunst des Nationalsozialismus und ihre Wirkung auf den Film der damaligen BRD besprach. Friedländer stellte fest, dass im Propagandafilm der Nationalsozialisten auf widersprüchliche (kitschige) Weise Tod, Gewalt und Harmonie aufeinandertrafen und damit als klassische und romantische literarische Motive in einen neuen Zusammenhang gestellt wurden.
Der neue rechte Kitsch
Seitdem sich um eine Gruppe ehemaliger Journalisten und Wissenschaftler medial eine neue rechtsradikale Bewegung in Deutschland formiert hat, deren parteipolitischer Arm die AfD ist, ist auch der rechte Kitsch wieder in ganzer Kraft da. Dieser Kitsch will der Anti-Kitsch sein, in ihm verbinden sich jedoch Massenkultur und deutsche Kulturkritik. Am Beispiel des ehemaligen FOCUS-Redakteurs und heutigen AfD-Beraters Michael Klonovsky kann das gut demonstriert werden, denn Klonovsky ist der zweifelhafte Meister des neuen rechten Kitsches.
Klonovsky hat nicht nur rassistische FOCUS-Coverstorys verfasst und ist vor allem für seinen Blog bekannt, sondern auch ein halbes Regal mit Aphorismen-, Rezensions- und Essaybänden gefüllt. Als Mitarbeiter von Alexander Gauland schreibt Klonovsky heute die Reden für den AfD-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag. Davor übte er diese Tätigkeit für Frauke Petry und ihren Ehemann Marcus Pretzell aus. Wie Uwe Tellkamp und einige andere Figuren aus der rechten Dresdner Kulturszene ist der ursprünglich ebenfalls aus Sachsen stammende Klonovsky einer von mehreren ostdeutschen Autoren, die aus einer Kritik am DDR-Regime eine Kritik an der Politik und Kultur der Bundesrepublik ableiten wollen. Dies äußert sich beispielsweise in Gleichsetzungsversuchen der Medien der DDR und der BRD, vor allem aber in der Konstruktion bildungsbürgerlicher Dissidenz, der sie ihre eigenen Texte hinzuzählen wollen.
Seit Jahren gilt Klonovsky als „Edelfeder“ der konservativen Publizistik, also als Autor, der sich nicht nur inhaltlich, sondern auch stilistisch besonders auszeichne. Klonovsky veröffentlichte 2005 bei Rowohlt einen Roman (Land der Wunder), der zwar nur gemischte Rezensionen bekam, aber seinen Ruf als Künstler-Feuilletonist begründete. So konnte er dann auch bei Reclam die Aphorismen des kolumbianischen Reaktionärs Nicolás Gómez Dávila herausgeben, obwohl diese Texte längst einer historisch-kritischen Kommentierung bedurft hätten. Zu Klonovskys zahlreichen Fans gehört der Philosoph Peter Sloterdijk, der ihn für „Feuilletons von ungewöhnlicher Brillanz“ lobte, und die Pathosschraube noch einen Grad höherdrehte, weil man sich bei ihm „in die Zeit von Tucholsky zurückversetzt“ fühlte, „als die deutsche Sprache noch vibrierte.“ Diese Vibrationen spürte offenbar auch der Schriftsteller Eckhard Henscheid, der Klonovsky mal für „schwärmerisch, verschwärmter und zugleich kenntnisreich“ hielt. Im Nachwort zu Klonovskys erst im letzten Jahr erschienenen Kolumnenband Der fehlende Hoden des Führers: Essais erkennt Lorenz Jäger sogar „Einsichten … [in] die unendliche Verletzlichkeit des Schönen, des Heiligen, der Leuchtenden, des Lebendigen, des Differenzierten, des Intelligenten.“ Ein stilistisches Hufeisen entwarf neulich Harald Martenstein in der ZEIT, der Klonovsky mit dem verstorbenen konkret-Herausgeber Hermann Gremliza verglich, weil beide Autoren von links- und rechtsaußen „elegant“ und „auf dem Niveau des Kritisierten“ den bürgerlichen Mainstream angriffen.
Schon in den 2000ern publizierte Klonovsky für die rechtslibertäre Zeitschrift eigentümlich frei, in der sich – oft ziemlich selektive – Staatsfeindlichkeit und genereller Autoritarismus ideologisch verbinden. Wie Klonovskys Texte aus dieser Zeit zeigen, hat er sich seitdem eigentlich kaum radikalisiert. Durch seine Anstellung im Parteiapparat hat er lediglich einen weiteren Schritt in der Explizitmachung einer Position gemacht, die längst klar und fertig ausgebildet dastand. Das unterscheidet ihn auch vom Stamm der AfD-Vorfeldautoren, etwa Matthias Matussek, Rainer Meyer oder Roland Tichy, die ihre formelle Unabhängigkeit vom parteipolitischen Rechtsradikalismus nutzen, um auch ideell als unabhängig zu gelten. Das ist eine allerdings ziemlich theoretische Unterscheidung, wenn man diese Bewegung als diskursives Phänomen versteht, in dem ähnliche Ideologien vertreten sind und ähnliche rhetorische Strategien angewandt werden.
Klonovskys Manifeste der Männlichkeit
Klonovsky will als Feuilletonist die „Ästhetik“ und „Schönheit“ gegen „die Ethik“ stark machen, verfügt aber selbst nur über einen Begriff von Ästhetik, der Moral und Besitzstand einer protestantischen Kleinstadt zur ästhetischen Norm umdeutet und das als Aufstand versteht. So hat Klonovsky in seiner Sammlung Lebenswerte (2009/2013), die einige seiner Kolumnen für die Zeitschrift eigentümlich frei zusammenfasst, einen „maskulinen“ und „hedonistischen“ Tugendkanon zusammengestellt, der über die Notwendigkeit männlichen Konsums soziale Ungleichheit rechtfertigen will. Durch diese Lebensphilosophie will sich Klonovsky nicht zuletzt ästhetisch von den angeblich genussfeindlichen Progressiven absetzen, die ihm die Objekte seiner Leidenschaften nehmen wollen. Zum Teil stimmt das auch, denn Klonovskys Buch ist insbesondere ein Programm zur Legitimierung der sexuellen Übergriffigkeit gegenüber Frauen. So schreibt er im Lebenswert-Kapitel „Brüste“:
„Es gibt auf der Welt zirka drei Milliarden Mädchen und Frauen. Mindestens 1,5 Milliarden befinden sich im sexuell aktiven Alter. Macht also – kein Mensch ist wirklich symmetrisch – drei Milliarden unterschiedliche Brüste. Wer mag, kann sich die planetarische Biomasse Brust gern in Kilogramm ausrechnen. Geht man davon aus, dass, individueller Geschmack hin oder her, ungefähr jedes zehnte oder fünfzehnte Brüstepaar so gebaut ist, dass der Drang, sich seiner zu bemächtigen, für einen Mann immens wird, ergibt dies theoretisch 200 bis 300 Millionen Optionen.“
Doch mit dieser puren Geschmacklosigkeit, die Kulturmenschen wie Sloterdijk und Jäger offenbar goutieren können, beginnt noch nicht der Kitsch, denn dazu gehört das Moment des Geschmacks, das den Rest aufwerten soll. So schreibt Klonovsky in anderen Lebenswert-Stichwörtern auch über „Klaviere“, „Lyrik“, „Bücher“, „Malerei“ und die „Oper“. Wie die Überschriften bereits andeuten, hat er sich dabei einfach alles herausgesucht, was seinen statusorientierten Lesern zufolge Kultiviertheit ausmacht.
Wie Ludwig Giesz Anfang des 20. Jahrhunderts in seiner Phänomenologie des Kitsches herausstellte, ist der Kitsch eben eine Haltung, das „Gerührtsein über die eigene Rührung“, also selbstgefällige Trägheit angesichts des Gefühls der eigenen Überlegenheit. Und wie Klonovsky „die Frauen” konsumieren will, so will er „die Lyrik“ eben auch bloß „genießen“, also Rilke und Hölderlin als gehobenes Entertainment für zwischendurch. Gegen einen solchen Medienkonsum spricht natürlich gar nichts, nur läuft es diametral seiner Vorstellung entgegen, seine Form des Konsums sei irgendwie ungewöhnlich, wie im Kapitel „Ungleichheit“ suggeriert wird: „Nur in einer Welt eklatanter Niveau-Unterschiede vermag das Leben zu fließen.“ In Lebenswerte gibt es jedenfalls ausreichend Beispiele, die Klonovskys eigenen Niveauanspruch in Frage stellen:
„Kinder machen bereits Probleme, wenn sie noch gar nicht auf der Welt sind. Zwar werden die Brüste der Frau appetitlich prall, aber man ahnt, dass ein Abschied dahinter steckt. … Die Frau nimmt eine Form an, die man nicht für möglich hielt. Der Mode folgend will sie, dass man bei der Geburt anwesend ist. Nie wieder wird er sich so hilflos fühlen wie im Kreißsaal. … Ansonsten mag der Sinn dieser Maßnahme darin bestehen, dass ihm die Lust auf Sex und sogar aufs Fremdgehen für eine beträchtliche Zeit vergällt ist.“
Und kaum war man in den italienischen Olivenhainen und dem Anzugladen, geht es wieder ins Hotel:
„Das Hotel ist ein durch und durch erotischer Ort. In jedem Zimmer treibt es ein Paar miteinander oder liegt ein einsamer Gast und denkt an Sex. Das Hotel ist der ideale Platz für Huren. Es ist anonym, sauber, grenzenlos beschmutzbar und besitzt jenen Reiz des Fremden oder gar Exotischen, der spezielle Lüste hervorruft. Er denkt es fast zwanghaft. Und geht nach unten, wo die Mädchen sitzen, die schon am Vorabend dort saßen und zwischendurch verschwunden waren und wiederkamen und sich das Make-Up nachzogen. Und nimmt sich eine mit aufs grenzenlos beschmutzbare Zimmer, in der Stadt, wo ihn niemand kennt.“
Offensichtlich kann Klonovsky mit seiner positiv konnotierten Verknüpfung von ungehemmter männlicher Sexualität, männlichem Besitzstand und männlichem Intellekt an eine Rhetorik anknüpfen, die man nicht nur aus der Werbung im Lufthansa-Magazin kennt, sondern die auch in der Literaturgeschichte immer wieder zur Konstruktion von Männlichkeit eingesetzt worden ist. Und natürlich hat sich der Autor auch das Kulturverfallsthema nicht ausgedacht, das er unablässig bedient, um sich als vermeintliche letzte Elite hochleben zu lassen. Diese Texte wollen vor allem ein Manifest sein, in dem der Mann zum Widerständler und zur Minderheit erklärt wird – eine Ideologie, die er mit jedem 4chan-Incel teilt, die aber hier als Variante für den Salon brauchbar gemacht werden soll, der sich ja vermeintlich vom Stammtisch unterscheidet.
Kitschästhetik als neurechte Kunstreligion
Klonovskys Lebenswerte können als Vorläufer von Thea Dorn und Richard Wagners Bestseller Die deutsche Seele (2011) gelesen werden. Denn obwohl er sich als „franko- und italophil“ versteht, der sexuell die „idealtypische Französin meiner Landesgenossin“ vorziehen würde und „die Russin erst recht“, versucht er das Deutschnationale durch den Verweis auf angebliche deutsche Partikularismen zu propagieren. Wie Dorn und Wagner, die aus Abendbrot, Dauerwelle und Männerchor die deutsche Essenz ableiten wollten, nutzt Klonovsky das Kulturelle, um ein politisches Programm zu begründen. Diese De- und Rekontextualisierung führt zur Verkitschung von Begründungsinhalten, in denen kulturhistorisch ohnehin schon reichlich Menschenfeindlichkeit steckte. Wie im Heimatfilm holt er die deutsche Romantik, die deutsche Ingenieurskunst und den deutschen Heldenmut hervor, universalisiert dagegen aber deutsche Verbrechen, um sie zu relativieren: Wenn die Nazis „Kinder in Güterwaggons tausende Kilometer durch Europa fahren“, ist das „fairerweise mit allen anderen Kindermassenmördern der Geschichte“ gleichzusetzen.
Die Frage ist an dieser Stelle nicht, ob es diese Art der sprachlichen, gedanklichen und moralischen Haltung ist, die Klonovsky zum Redenschreiber von Alexander Gauland qualifizieren. Entscheidend ist, dass diese Niveaulosigkeit das politische Programm ausmacht. Solche Kitschästhetik ist die Grundlage, mit der die rechtsradikale Szene heute ihr bürgerliches Publikum zu mobilisieren versucht, weil in diesen Texten die unreflektierte Angst um die in „Stil“ und „Kultur“ umgedeutete Angst um den Privilegienverlust steckt und einfache Identifikation bietet. Da Klonovsky Hotels, Brüste und Deutschland zu seinen Lebenswerten erklärt, ist er einerseits ziemlich ehrlich in der Zielstellung eines klassistischen, sexistischen und rassistischen Programms, zeigt aber auch, dass es dafür keine hinreichende Begründung außerhalb einer sich in die Ideologie des Ästhetischen gehüllten Anspruchsdenkens gibt. Passenderweise kann man das Buch mittlerweile auch auf CD hören, natürlich in Kombination mit klassischer Klaviermusik, die Klonovskys Ehefrau beigesteuert hat.
Zwischen Schleimereien und Verdammungen ist in dieser politisch überdrehten Ästhetik, die neue Kunstreligion sein will, nicht viel Platz. Klonovsky neuestes Buch Der fehlende Hoden des Führers: Essais (2019) besteht aus alten FOCUS– und eigentümlich frei-Kolumnen und einigen seiner Reden, vor allem aber Porträts verschiedener kanonischer Musiker, Politiker und Schriftsteller. Wiederum geht es darum, „Schönheit“ und „Bildung“ „der Moderne“ entgegenzuhalten, als ob das nicht ohnehin schon moderne Konstrukte wären. Also macht Klonovsky aus Immanuel Kant einen Gegner aller politischen Ideologien oder zitiert Hans-Georg Gadamer ausgerechnet für das Lob der Mütterlichkeit, um diese alten weißen Männer für einen durch und durch modernen Rechtsradikalismus einzuspannen.
Variationen altbekannter Stammtischparolen und Naziwitze
Wenn Klonovsky mal wieder dazu aufruft, die „Weinbestände zu füllen und zu leeren“, „Bücher statt Zeitungen“ zu lesen, sich von „der allgemeinen Verwahrlosung“ nicht anstecken zu lassen und „manierlich und heiter“ zu sein, fragt man sich, ob diese Plattitüden nun die Sprache ist, die „vibriert” (Sloterdijk) oder das nun „der Einblick ins Schöne, Heilige, Leuchtende, Lebendige“ (Jäger) ist. Aber ein bisschen Biedermeiercouch-Geruch reicht offenbar schon aus, um sich dieses Lob zu verdienen, denn es gilt ja lediglich, den üblichen Klassismus, Rassismus und Sexismus zu veredeln. Es zeigt sich, dass Ästhetik und Politik nicht nur nicht voneinander zu trennen sind, sondern dass Autoren wie Klonovsky letztlich nur aufgrund ihrer politischen Haltung jahrzehntelang überhaupt Publikationsmöglichkeiten und Leser gefunden haben.
In seiner Bonmotsammlung Aphorismen und Ähnliches, die seit 2008 in erweiterten Neuauflagen erscheint, wird wiederum deutlich, wie eng in diesem Kitsch Form und rechtsradikaler Inhalt miteinander verbunden sind. Durch mittlerweile 136 Seiten (2017) zieht sich zunächst ein Strom aus klischeebeladenem Namedropping (u.a. Heidegger, Dürer, Goya, Cézanne, Thukydides, Proust, Bach, Vélazquez, Kleist, Homer, Shakespeare, Luhmann) und zwischen Traurigkeit und Unoriginalität schwankenden Self-Help-Kalendersprüchen:
„Es gibt Leute, die verzeihen einem das Talent nie.“
„Was keine Feinde hat, ist nichts wert.“
„Wo das Team regiert, wird Bildung zum Stigma.“
„Wo die Individualität blüht, welkt die Persönlichkeit.“
„Lieber im Unrecht als in irgendeiner Meute.“
„Der originäre Denker ist der Feind des Professors.“
Nur ausgestattet mit der Rhetorik der Allgemeinbildung, mit der sich ein Publikum umschmeicheln lässt, das sich kulturell überlegen fühlt, können dann Klonovskys krasse Ausfälle gegen Frauen, queere Menschen und PoC dann für manche Leser nicht wie pathetische Variationen altbekannter Stammtischparolen und Naziwitze wirken, obwohl sie auch einfach als klassische Stammtischparolen und Naziwitze daherkommen:
„Evolutionsbiologisch betrachtet ist die Frau in ihrer jetzigen Gestalt ein Produkt des männlichen Begehrens. Es wird Zeit, dass die Lesben sich dafür bedanken.“
„Zuerst bekämpft die Homosexuellenbewegung die Homosexuellenphobie, dann erzeugt sie sie.“
„Islamistische Anschläge in Europa? Wozu das Haus demolieren, in das man einzieht.“
„In Berlin gibt es ein Denkmal für Ernst Röhm: Homosexuelle, die während der Naziherrschaft ermordet wurden.“
„In der Idee, schwulen Paaren das Adoptionsrecht zu geben, weht der Geist der Paralympics.“
„Der General Franco hat eine schlechte Presse, weil er die Kommunisten geschlagen hat.“
„Es ist nur folgerichtig, daß die schleichende Privilegierung der Frauen mit ihrer überlegenen sozialen Intelligenz letztbegründet wird; die andere ist ja halbwegs meßbar.“
„Einst galt es als Rassismus, wenn jemand sagte, schwarz sei schlecht. Heute handelt es sich bereits um Rassismus, wenn einem auffällt, daß schwarz schwarz ist.“
Dieser Auswahl könnte man entgegenhalten, dass dies nur „Stellen“ seien: Doch wie viel Textzusammenhang braucht ein Aphorismus? Trotzdem noch ein paar inhaltlich weniger grelle Beispiele, die immer dem stilistischen Prinzip folgen, Begriffe rhetorisch ineinander aufzulösen oder in Gegensatz zueinander zu setzen und damit Erkenntnis vorzutäuschen:
„Eben weil der Mensch nicht unsterblich ist, sollte er vor allem die Unsterblichen lesen.“
„Wer kommuniziert, hat nichts zu sagen.“
„Der Feminismus müßte eigentlich Maskulismus heißen.“
„Zu den Basalmythen der Demokratie gehört, daß es sie gibt.“
Natürlich hält der Aphorismus schon als Genre reichlich Möglichkeiten bereit, um ohne Begründung, nur im Vertrauen auf die Zustimmung der Leser, dahinpostulieren zu können. Diese Stilwahl, die nur anspruchsvoll hinsichtlich der Vorurteile der Leser ist, soll wie in Lebenswerte aber überhaupt nicht vergessen lassen, dass das Buch ein frauenfeindliches Pamphlet ist, sondern vor allem, dass es sich um frauenfeindliche Klosprüche handelt. Daher greift Klonovsky auch gern mal tief ins Abflussrohr, um bloße Codewörter der Kultiviertheit wieder herauszufischen:
„An Menschen, die keine Gedichte auswendig wissen, ist jede Zeit verschwendet.“
„Bildungsferne schafft Publikumsnähe.“
„Gönnen ist göttlich.“
„Welchen Gegenstand ein Buch behandelt ist zweitrangig verglichen damit, auf welche Weise es ihn behandelt.“
„Der jeweilige Zeitgeschmack ist die Schlacke in den Kunstwerken; mit abnehmendem Verunreinigungsgrad wächst ihre Beständigkeit.“
„Steve Jobs kann nicht in der Hölle schmoren, weil er zu ihren Ausstattern gehört.“
„Der gebildete Mensch erzählt nicht, wovon ein Buch handelt, sondern auf welche Weise es von etwas handelt.“
„Die geistige Befruchtung benötigt weder Semester noch Module.“
Um einen Aphorismus des Autors zu beantworten: „Stellen Sie sich vor: Dieser Autor ist sexistisch, rassistisch und reaktionär! … Aber schreibt er auch schön?“ Nein. Wie Norbert Bolz ist Klonovsky einer der vielen heutigen Zirkus-Zarathustras, die einem Publikum, das sich in den Dörfern und Villenvierteln nach Erregung sehnt, passende Schenkelklopfer und Untergangsromantik bietet. Dieser neue rechte Kitsch verknüpft sexistische Erotik und rassistischen Hass mit bildungsbürgerlichen Statussymbolen, die das eigene Anspruchsdenken veredeln und damit legitimieren sollen. Das zeigt, wie wenig hinter dem Symbol stecken muss, damit Autoren wie Sloterdijk oder Jäger, die als Inbild von Bürgerlichkeit gelten, nicht nur Gehör, sondern auch gleich ihr Qualitätssiegel schenken.
Mit ihrem makaberen Bestehen auf Stil und Form liefern Klonovskys Texte eine Strategie, mit Hilfe von ein bisschen Mozart-Hintergrundmusik Gewalt entweder zu übertönen oder erst recht attraktiv zu machen. Offensichtlich stellt der Diskurs der „bürgerlichen Mitte“ dafür ausreichend Anknüpfungspunkte bereit und zeigte sich jahrelang auch mehr als willig, Autoren wie Klonovsky selbst zur „Mitte“ zu machen, solange nur die richtigen Kultur-Knöpfe gedrückt werden. Zu diesen auf Distinktion abstellenden Praktiken, mit denen ausgegrenzt werden kann, hat natürlich auch immer wieder das Kitschurteil gezählt. Wenn es heute noch einen Wert hat, sollte es vor allem gegen die neuen Kulturuntergangspropheten und ihre Fans selbst gewendet werden.
Bild von Michael Gaida auf Pixabay





 „Arbeitstitel des Romans, von dem ich behaupte, ich würde ihn schreiben, den ich aber nicht schreiben kann, weil mich langes Erzählen langweilt: Die abgeschnittene Person.“ So schreibt Sarah Berger in Textfragment 503 von bitte öffnet den Vorhang. Das Label “Roman” wird mit langem erzählerischen Atem assoziiert, es ist in dieser Textstelle aber nur noch eine vorgeschobene Behauptung, unzeitgemäß und langweilig. Dieser kurze Ausschnitt verdeutlicht den erheblichen Wandel, dem der Literaturbetrieb gerade unterliegt – eine turbulente Situation, die sich nicht nur durch die verstärkte Medienkonkurrenz erklären lässt, in der literarischer Texte gegenwärtig stehen. Viele dieser Veränderungen stehen in enger Verbindung mit dem drastischen Wandel unseres Lese- und Schreibverhaltens aufgrund der Digitalisierung. Auch wenn es mittlerweile ein Allgemeinplatz ist, lohnt es sich immer wieder zu betonen, dass Menschen nicht weniger als früher lesen, sondern nur anders und an anderen Orten. Aber wie verändert sich das Schreiben oder – noch spezifischer – das Erzählen in Zeiten sozialer Medien? Wie nehmen Schreib- und Lesegewohnheiten im Internet Einfluss auf die Literatur und das Erzählen selbst?
„Arbeitstitel des Romans, von dem ich behaupte, ich würde ihn schreiben, den ich aber nicht schreiben kann, weil mich langes Erzählen langweilt: Die abgeschnittene Person.“ So schreibt Sarah Berger in Textfragment 503 von bitte öffnet den Vorhang. Das Label “Roman” wird mit langem erzählerischen Atem assoziiert, es ist in dieser Textstelle aber nur noch eine vorgeschobene Behauptung, unzeitgemäß und langweilig. Dieser kurze Ausschnitt verdeutlicht den erheblichen Wandel, dem der Literaturbetrieb gerade unterliegt – eine turbulente Situation, die sich nicht nur durch die verstärkte Medienkonkurrenz erklären lässt, in der literarischer Texte gegenwärtig stehen. Viele dieser Veränderungen stehen in enger Verbindung mit dem drastischen Wandel unseres Lese- und Schreibverhaltens aufgrund der Digitalisierung. Auch wenn es mittlerweile ein Allgemeinplatz ist, lohnt es sich immer wieder zu betonen, dass Menschen nicht weniger als früher lesen, sondern nur anders und an anderen Orten. Aber wie verändert sich das Schreiben oder – noch spezifischer – das Erzählen in Zeiten sozialer Medien? Wie nehmen Schreib- und Lesegewohnheiten im Internet Einfluss auf die Literatur und das Erzählen selbst?





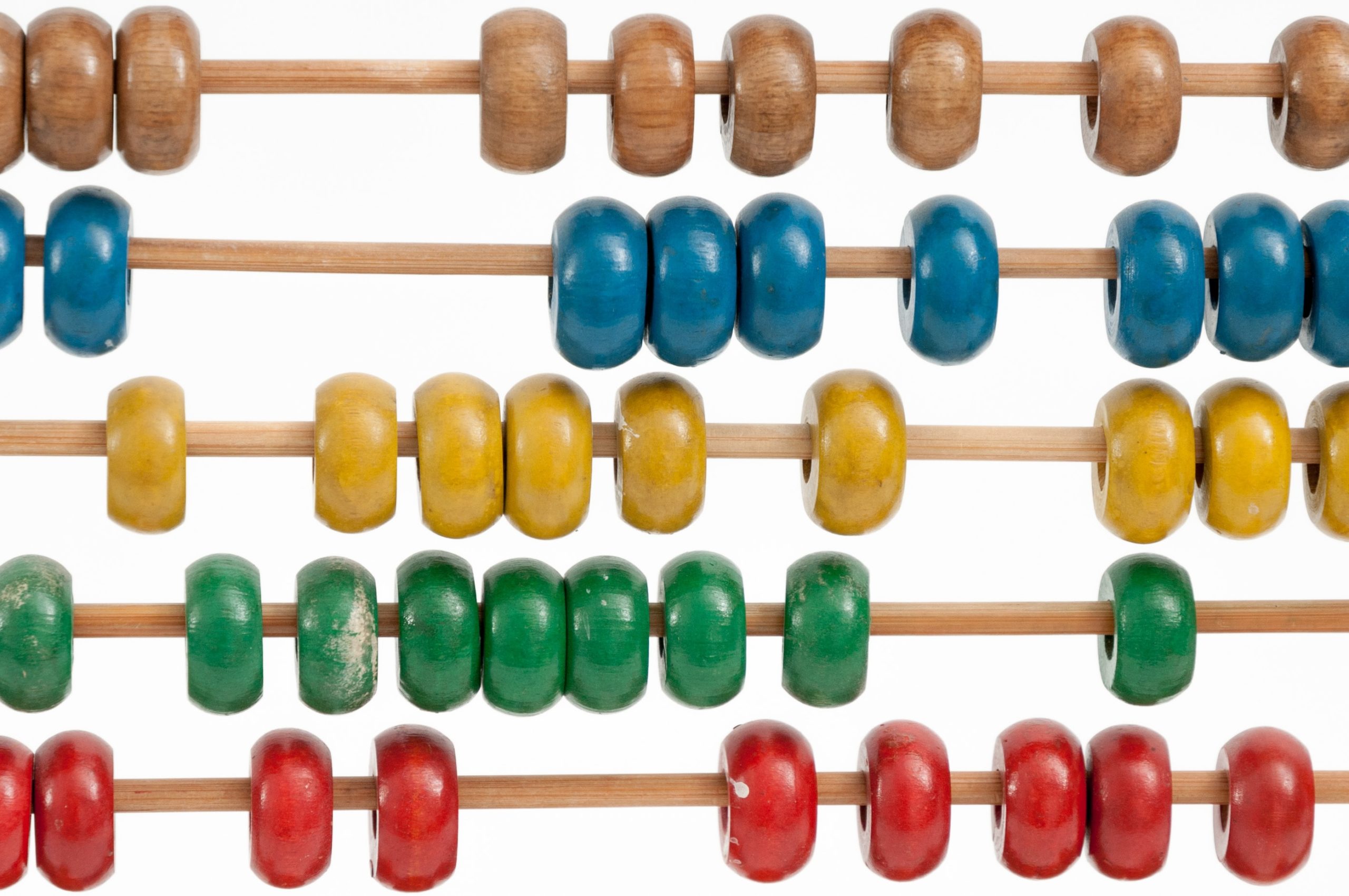
 Arztbesuch, Öffentliches Leben und Katastrophenmanagement – nutzt sie als Schauplätze, um evidenzbasiert (also auf Basis empirisch ausgewerteter Daten) die Benachteiligung von Frauen vorzuführen. Es geht ihr darum, die (Gender-)Neutralität von Algorithmen in Frage zu stellen und die weibliche Hälfte der Bevölkerung zu rezentrieren. Denn obwohl wir geradezu manisch Daten sammeln, bleiben Frauen zu oft unsichtbar: „Frauen werden nicht gesehen, und man erinnert sich nicht an sie, weil Daten über Männer den Großteil unseres Wissens ausmachen.“
Arztbesuch, Öffentliches Leben und Katastrophenmanagement – nutzt sie als Schauplätze, um evidenzbasiert (also auf Basis empirisch ausgewerteter Daten) die Benachteiligung von Frauen vorzuführen. Es geht ihr darum, die (Gender-)Neutralität von Algorithmen in Frage zu stellen und die weibliche Hälfte der Bevölkerung zu rezentrieren. Denn obwohl wir geradezu manisch Daten sammeln, bleiben Frauen zu oft unsichtbar: „Frauen werden nicht gesehen, und man erinnert sich nicht an sie, weil Daten über Männer den Großteil unseres Wissens ausmachen.“