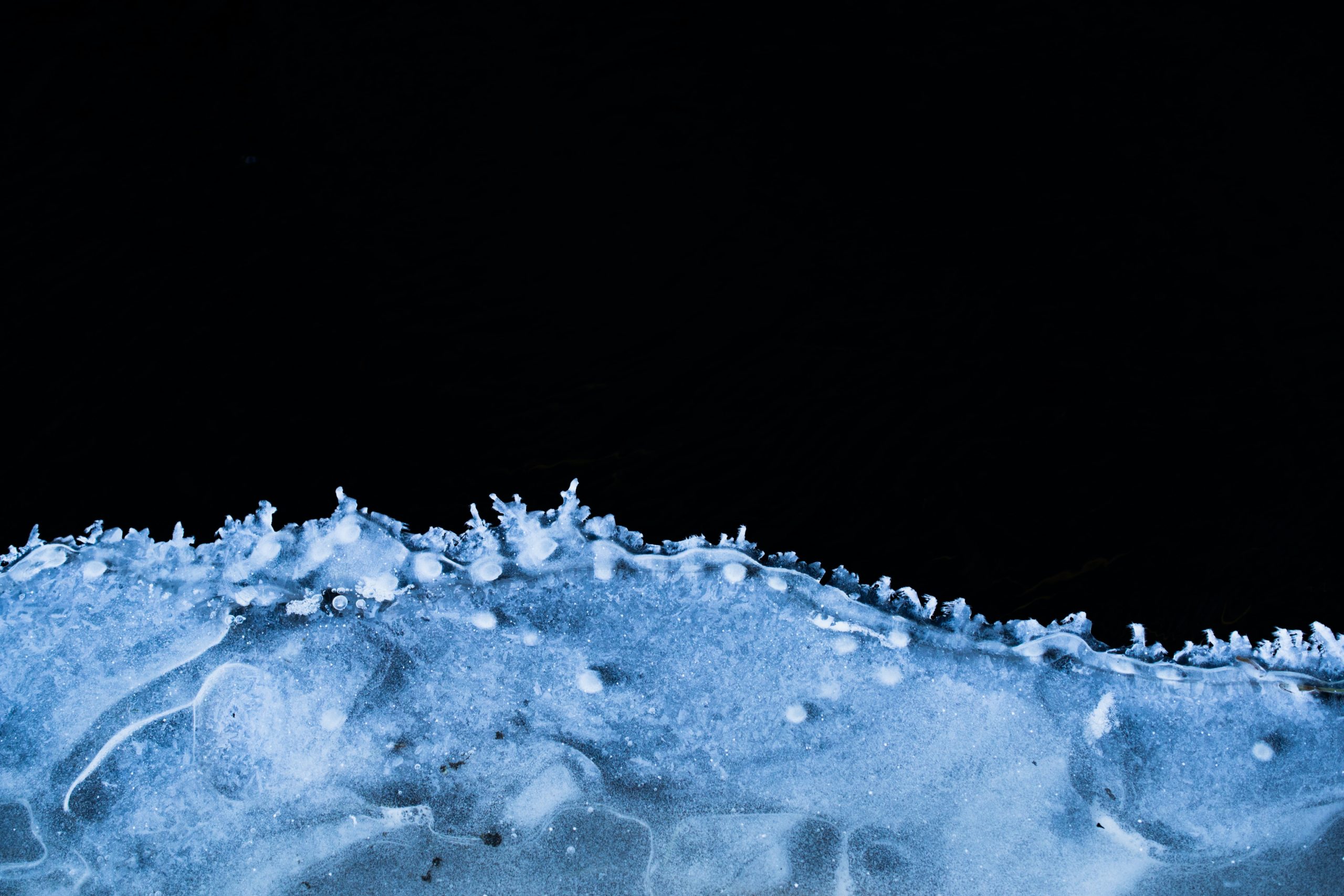von Christina Dongowski
Die Kunstgeschichte als moderne Wissenschaft beginnt mit einer Fälschung: 1760 feiert Johann Joachim Winckelmann das Fresko Jupiter küsst Ganymed, das aus einer geheimen Grabung stammen soll, als authentisch antike Wandmalerei. Tatsächlich hatten Winckelmanns Freund Anton Raphael Mengs und dessen Schüler Giovanni Battista Casanova das Fresko 1758/59 geschaffen. Es handelte sich um ein kunsthistorisches Experiment: Würde Winckelmann einem Objekt widerstehen können, in dem in Komposition, Thema und stilistischer Ausführung alles zusammenkam, was er an antiker Kunst schätzte? Und das außerdem eines der heißesten Begehren der Kunstkenner und Antiquare des 18. Jahrhunderts erfüllte, endlich ein großes, nahezu intaktes antikes Gemälde zu finden, das dem entsprach, was man sich anhand der Beschreibungen durch antiker Kunstschriftsteller als Malerei in der Nachfolge des Künstlers Appelles vorstellte. Winckelmann biss an. Er ließ das Fresko von Casanova stechen und nahm es, mit ausführlicher Beschreibung und Belobigung, in die erste Ausgabe der Geschichte der Kunst des Alterthums von 1763 auf.
Nachdem in den Künstler- und Gelehrtenkreisen Roms Gerüchte aufkamen, das Fresko sei ein Hoax, untersuchte Winckelmann es erneut – und kam nun zu dem Schluss, es sei doch nicht antik, sondern zeitgenössisch. Er war sich auch ziemlich sicher, wer das Werk tatsächlich geschaffen hatte – ein Werk, das 20 Jahre später von Goethe immer noch außerordentlich geschätzt und dessen Echtheit bis weit ins 19. Jahrhundert hinein von vielen Kennern energisch verteidigt wurde. Winckelmanns Ruf als Experte für antike Kunst trug zwar ein paar Kratzer davon, geschadet hat ihm der Missgriff allerdings nicht wirklich, auch aufgrund des hohen künstlerischen Ranges, der der Fälschung eingeräumt wurde. Und die beiden Fälscher kamen gänzlich ungeschoren davon: Mengs war ein Star der europäischen Kunstszene, dem so eine künstlerische Eskapade gerne verziehen wurde. Casanova wurde 1764 nach Dresden berufen und einer der Mitbegründer der Dresdner Zeichenakademie, der er ab 1776 als Direktor vorstand. Zahllose deutsche Zeichner des Klassizismus haben bei ihm gelernt, wie man einen klassisch-schönen Umriss zeichnet. Die Freundschaft und Arbeitsbeziehung zwischen Mengs und Winckelmann überlebten die Affäre dagegen nicht.
Die Gelassenheit, mit der außer Winckelmann so ziemlich jeder in Rom auf die Fälschungsvermutung reagierte, beruht auf einem Verständnis von Originalität, das sich noch stark von unserem Begriff unterscheidet. Gerade durch kreative Nachahmung der Antike oder auch eines großen Renaissance-Meisters zeigt man, was für ein Originalgenie man selbst ist. Mengs zeigt seinen Rang als Genie, indem er ein Fresko erschafft, das nicht nur mit den antiken Vorbildern mithalten kann, sondern diese sogar übertrifft: Die dargestellte Szene selbst ist aus keinem bekannten antiken Text entnommen und sie findet sich auch bei keinem anderen antiken Kunstwerk. Genau die Elemente, die für Winckelmann im zweiten Anlauf Indizien für die Nicht-Antiquität des Freskos waren, zeichneten es für die Zeitgenossen (und auch für Winckelmann selbst) gleichzeitig als bedeutendes Kunstwerk aus.
Während dieser Begriff von Originalität noch zur alten Welt der Antiquare und vor-modernen Ästhetik gehört, formiert sich mit den Akteuren, „technisch und kunsthistorisch versierte Künstler(fälscher)“ versus „Kunsthistoriker ohne technische und künstlerische Praxis“, bereits die Konfliktlinien um die Definitionshoheit über das, was echte Kunst sei. Mengs wollte Winckelmann nicht einfach auf den Arm nehmen und ein wenig den hochgespannten Idealismus verspotten, mit dem sein Freund antike Kunstwerke betrachtete. Hier markiert auch ein renommierter Künstler den Anspruch, dass die Kompetenz über Wert und Bedeutung eines Kunstwerks zu urteilen, bei Kunst-Praktikern liege, nicht bei Leuten, die nur darüber schreiben können. Um 1760 geht der Konflikt noch unentschieden aus. Mit der Etablierung von Kunstgeschichte als akademischer Disziplin und der Installation von Kunstmuseen als Bildungsanstalten bürgerlicher Subjekte erringen die Kunsthistoriker dann aber die Deutungshoheit über Kunst.
Kunstfälschungen werfen interessante Fragen auf, wenn es darum geht, was wir bereit sind, als Kunst zu akzeptieren. Die Memoiren von Kunstfälschern werden trotzdem sehr selten als Beiträge zu dieser Debatte ernst genommen. Was auch deswegen schade ist, weil sie, im Gegensatz zu vielen Beiträgen von legitimen Kunsthistoriker*innen, meist sehr unterhaltsam sind – und tatsächlich von vielen Lai*innen auch gelesen werden. Biographien und Memoiren von enttarnten Kunstfälschern, bringen es regelmäßig zu Bestsellern. In Großbritannien ist die Autobiographie des Allround-Fälschers Shaun Greenhalgh, A Forger’s Tale. Confessions of the Bolton Forger von 2017 sogar als Observer Art Book 2018 ausgezeichnet worden. Zurecht, denn bei Greenhalgh bekommt man detaillierte Einblicke in künstlerische und kunsthandwerkliche Techniken. Schließlich hat er selbst seine Fälschungspraxis als eine Art experimentelle Kunstgeschichte verstanden. Seine Confessions sind außerdem eines der wenigen Bücher, aus denen man etwas darüber erfährt, wie sich außer- und unterhalb bürgerlicher Mittel- und Oberschichten die ästhetische Erziehung des Menschen konkret abgespielt hat; und das ohne ein schlechtes Gewissen darüber, die eigene Herkunft durch den sozialen Aufstieg verraten zu haben. Greenhalgh hat das Buch im Gefängnis geschrieben, nicht auf einem Lehrstuhl für Soziologie.
Auch bei ihm ist, wie in den meisten Fälscher-Biographien, die Bête Noire weniger die Polizei, sondern die Kunstexpert*innen, die ihm eigentlich schon längst auf die Schlichte hätten kommen müssen. Stattdessen haben sie eine Fälschung nach der anderen in den Handel durchgewunken – und erst jetzt, als klar ist, dass eines der “bedeutendsten” Meisterwerke, das Vermeer oder Campendonck oder Van Goghs jemals geschaffen haben, gar nicht von deren Hand ist, erscheint denselben Experten plötzlich augenfällig, dass das ja gar kein Vermeer oder Van Gogh oder Campendonck sein kann, so schlecht wie die Fälschung gemacht sei.
Tatsächlich hat die Transformation vom Meisterwerk zu Schrottwert, die ein Kunstwerk in dem Augenblick erfährt, wenn die eigentliche Urheberschaft erkannt ist, etwas Mystisches: Eben noch Campendoncks bestes Gemälde, nun schlecht ausgeführter Expressionismus-Kitsch. Es sind offensichtlich weniger die dem Werk immanenten ästhetischen Qualitäten, die es zum Meisterwerk machen oder seine ästhetische Beurteilung bestimmen, sondern es muss die Hand des Meisters auf sich gespürt haben. Wird sie abgezogen, verschwinden plötzlich die sichere Linienführung, die subtile Komposition und die exquisite Farbigkeit oder was auch immer die Superiorität des Bildes begründet haben soll. An ihrer Stelle erscheint ein aus Geldgier, Geltungssucht und Selbstüberschätzung zusammengeschmiertes Machwerk. Das Kunstwerk als Berührungsreliquie.
Die Wandlung funktioniert natürlich auch in die andere Richtung. Das spektakulärste Beispiel für die Transformation von Schrottwert zu Meisterwerk ist das 2018 für offiziell 450 Millionen Dollar an einen damals anonymen Käufer versteigerte Gemälde Salvator Mundi von Leonardo da Vinci, das 2005 von einem Kunsthändler in einem kleinen Auktionshaus in Louisiana für 1.175 Dollar gekauft worden war. Der vom Auktionshaus angesetzte untere Preis betrug 1.200 Dollar, – und selbst der wurde noch unterschritten, weil das Bild angeblich nur noch Materialwert hatte. Auch wenn Robert Simon, der Käufer des Bildes, bereits beim Anblick einer niedrig aufgelösten Schwarz-Weiß-Version des Fotos im Auktionskatalog auf seinem Computer gespürt haben will, dass ihn hier ein echter Leonardo anschaue, passierte die Wandlung von Schrott zu Hot nicht ganz so schnell und einfach. Um ein Bild als Leonardo in den Markt zu bringen, braucht es mehr als einen, der daran glaubt. Es braucht mindestens einen als unabhängig angesehenen, renommierten Experten, der öffentlich bezeugt, die Hand Leonardos habe auf dem Bild gelegen. Was uns wieder zu echten Kunstfälschungen bringt. Denn genau so jemanden braucht man z. B. auch, wenn man eine Fälschung als echten Max Ernst für einen Millionenbetrag verkaufen will.
Mit Martin Kemp hat in der Geschichte um Salvator Mundi von Leonardo da Vinci ein Kunsthistoriker die wertsteigernde Expertenrolle inne, der möglicherweise bereits einen Shaun Greenhalgh, Sally from the Coop, als La Bella Principessa Leonardo da Vinci zugeschrieben hat. Die Zeichnung einer jungen Frau in Renaissance-Kostüm tauchte erstmals 1998 auf dem Markt auf: Sie wurde da noch als Nazarener-Zeichnung (German School, Early 19th Century) von Christies versteigert. Kemps Ehrgeiz, sich seinen Platz in der Kunstgeschichte als der Mann zu sichern, der dem schmalen malerischen Werk Leonardos entscheidendes Neues hinzugefügt hat, machte ihn zum idealen Kandidaten für jeden, der genau das auch vorhatte – aber nicht über das entsprechende kulturelle und akademische Kapital verfügte. Und vielleicht auch nicht über einen echten Leonardo.
In Fälschergeschichten wird mit der Fälschung immer auch der Experte enttarnt: Aus dem die höheren Weihen der Kunst quasi priesterlich verwaltenden Kunstexperten wird dann schnell ein Schaumschläger, den der Fälscher mit seinen eigenen Mitteln geschlagen hat. Der akademisch gescheiterte Fälscher führt die von sich selbst überzeugte, akademisch hochdekorierte Expertenschar an der Nase herum. Er wird vom Publikum gleichzeitig für die hohe Virtuosität seiner Fälschung bewundert und dafür, dass er mit so einer offensichtlichen Fälschung die Gatekeeper genarrt hat. Kunstwissenschaftliche Expertise wird also gleichzeitig anerkannt und als scharlatanische Praxis denunziert. Für die Kunstexperten bleibt nur die Rolle des Schwätzers, der auf sein eigenes Geschwätz von ästhetischer Qualität und künstlerischer Meisterschaft hereingefallen ist. Die Fälscher werden dafür bewundert, dass und wie sie ein System mit dessen eigenen Mittel schlagen, das aus ein bisschen Farbe und Leinwand oder Holz Luxusobjekte macht, die mit Summen bezahlt werden müssen, die es mit dem Kulturetat vieler Städte aufnehmen können – oder sogar mit deren ganzem Haushalt.
Kunsthistorische Expertise ist daher die Superkraft, die man als Fälscher neben erheblichen technischen künstlerischen Fähigkeiten benötigt, um gerade im oberen Preis- und Kanon-Segment erfolgreich zu sein. Erfolgreiche Fälschungen, deren Entdeckung Furore macht, sind fast nie Kopien im strengen Sinn, sondern „Nachschöpfungen“. Der Fälscher schafft ein Werk, dass Maler X gemalt haben könnte, vielleicht sogar gemalt haben müsste – wenn er seinen eigene, von Kunsthistoriker*innen rekonstruierten Werkverlauf und künstlerische Entwicklung ernst nimmt. Wolfgang Beltracchi verwendet, ähnlich wie Shaun Greenhalgh, in seinen Memoiren viele Seiten darauf, sich gegen die akademisch ausgebildeten Kunsthistoriker als der mindestens genauso kompetente Hermeneut und Rekonstrukteur des Werks der von ihm gefälschten Künstler*innen zu profilieren. In Selbstporträt beschreibt er nicht nur technisch sehr detailliert, wie zum Beispiel die von ihm geschätzten rheinischen Expressionisten gearbeitet haben, sondern entwickelt auch aus seiner sehr genauen Kenntnis ihrer Mal- und Kompositionstechniken heraus interessante Theorien zur Genese einzelner originaler Werke oder ganzer Werkphasen. Erst sein genaues Verständnis dessen, was zum Beispiel Campendonck malerisch interessiert hat, habe ihn selbst in die Lage versetzt, in Rotes Bild mit Pferden ein von Experten als ein Meisterwerk Campendoncks gefeiertes Werk zu schaffen.
Viele der Kunsthistoriker*innen, die sich systematisch mit dem Thema Kunstfälschung befassen, sehen bei solchen Behauptungen tatsächlich Rot: Sie können darin nichts als den Versuch der Fälscher erkennen, den eigenen, in Wirklichkeit rein materialistischen Motiven die höheren Weihen genuin künstlerischen oder kunsthistorischen Interesses zu verleihen. Doch die Geschichte der Kunst ist reich an bewunderten und gefeierten Protagonisten, bei denen sich künstlerische oder wissenschaftliche und ökonomische Motive kaum voneinander trennen lassen. Der ökonomisch uninteressierte, nur von seinem Willen zur Kunst und zum Selbstausdruck getriebene Künstler war bereits ein Mythos, bevor er von den großen Kunsthändlern der Moderne als ideales Marketing-Konzept für Kunstwerke aufgebaut wurde; als Nonkonformist, der sich den Repräsentationslogiken der bis dahin hegemonialen Ästhetiken verweigerte, dafür aber umso besser als Distinktionsmarker für neue Eliten geeignet war. Auch der Posterboy der Legende von der Armut der Kunst, Vincent van Gogh, wollte seine Werke verkaufen. Seine Briefe an seinen Bruder Theo, der als Kunsthändler arbeitete, sind voller Ideen und Vorschlägen, wie man sein Werk an den Mann bringen könnte, und voller Vorwürfe, Theo arbeite nicht hart genug daran, ihn zu vermarkten. Und das erscheint noch harmlos im Gegensaz zu Künstlern wie Degas, Matisse oder Picasso, deren kaufmännische Kompetenz beim Wahren der eigenen ökonomisch-künstlerischen Interessen bei Händlern und Sammlern gefürchtet war.
Ökonomische Motive nicht nur als irrelevant, sondern auch als illegitime Kategorien für die künstlerische Praxis und den kunsthistorischen Diskurs abzuwerten, führt nicht nur zu der von Wolfgang Ullrich in seinem Buch Siegerkunst. Neuer Adel, teure Lust (Berlin: Klaus Wagenbach Verlag, 2016) diagnostizierten analytischen Blindheit von Kunstkritik und Kunstwissenschaft gegenüber den hyper-kapitalistischen Phänomenen und Praktiken, die gegenwärtig die Wahrnehmung von Kunst bestimmen. Wer sich die kunsthistorischen Ambitionen von Beltracchi, Greenhalgh, van Meegeren oder Lothar Malskat mit dem Hinweis Interesse am schnöden Geldmachen vom Hals halten will, kann auch zu den erstaunlich weit verbreiteten Praktiken des Fälschens innerhalb der als legitim anerkannten Kunst wenig sagen.
Gemeint sind damit nicht künstlerische Praktiken wie Appropriation Art und Institutional Critique. Hier achten Künstler*innen, Kurator*innen und Kunstwissenschaftler*innen peinlichst darauf, dass die persiflierten, plagiierten, pastichisierten oder exakt kopierten Künstler*innen oder die Besitzer der entsprechenden Bildrechte informiert und um Zustimmung gebeten werden. Alle bewegen sich auf kunsthistorisch sicherem Gelände, niemand ist darüber im Unklaren, ob wir es hier mit Kunst- oder derivativem Machwerk zu tun haben.
Eine echte Herausforderung für das, was wir uns angewöhnt haben, als Kunst und ihre Fälschung voneinander zu trennen, scheinen mir dagegen die zahlreich belegten echten Fälscherpraktiken im Werk von Künstlern zu sein, die bereits als Genies kanonisiert wurden. Fälschungskünstler auf der Suche nach dem eigenen Platz in der Kunstgeschichte sind dann auch von den Biographien Légers, De Chiricos und anderer kanonisierter Künstler fasziniert, deren Werk teilweise aus Fälschungen besteht. Sind sie doch der Beleg, dass man mit künstlerischen Praktiken, die vom Fälschen kaum oder gar nicht zu unterscheiden sind, ein als legitim anerkannter Künstler sein kann. Vielleicht sogar ein Genie, selbst Michelangelo hat gefälscht.
Der mystisch-magische Akt der Verwandlung ungeklärter künstlerischer Praktiken in legitime Kunst vollzieht sich aber auch hier nicht dadurch, dass man ein paar Meisterwerke abliefert. Vollziehen muss ihn jemand, der als Kunstkenner und anerkannter kunsthistorischer Experte dazu autorisiert ist. Für kunsthistorisch autorisierte Texte über Kunstfälschungen stellen die Künstler, die als kanonisierte Heroen der Kunst und als dokumentierte Fälscher auf beiden Seiten der Grenzen stehen, deswegen ein Autoritätsproblem dar.
So tauchen Fernand Légers freimütige Bekenntnisse, bei akuter Mittellosigkeit Bilder im Stile anderer Künstler gemalt und verkauft zu haben, in Büchern über Kunstfälschungen meistens nur deswegen auf, weil sie für die Selbstdefinition berühmt gewordener Fälschungskünstler als eben Künstler eine wichtige Rolle spielen. Dass Léger seinen charakteristischen Stil der 20er und 30er Jahre gerade in der Auseinandersetzung mit Malern entwickelt hat, die er auch fälschte, fasziniert die Fälscher, die von Kunsthistorikern geschriebene Geschichte der Kunstfälschungen ignoriert den Zusammenhang mit Légers „echter“ Kunst.
Ein deutlich schwierigerer Fall für das kunsthistorische Grenzen-Management zwischen echter Kunst- und Machwerk stellt Giorgio de Chirico dar, der nicht andere Maler, sondern sich selbst fälschte. Ungefähr seit Anfang der 30er Jahren begann er systematisch, neben seinem aktuellen Stil, der sich immer stärker zu einer altmeisterlichen, anti-modernen und offensiv konservativen Malerei entwickelte, Bilder im Stil seiner frühen Pittura metafisica zu malen und in die entsprechenden Jahre zu datieren. Dieses Selbstplagiat war ursprünglich ökonomisch motiviert: Pittura metafiscia war zu De Chiricos Signature Style geworden. Die meisten Sammler sowie Museen wollten einen De Chirico, auf dem auf menschenleeren Plätzen oder in leeren Räumen Schneiderpuppen bedeutungsvoll herumstehen, nicht die pastos gemalten Ölschinken mit weiblichem Akt oder heroischem Reiter, die er als sein eigentliches Hauptwerk ansah. Also lieferte er – voller Verachtung für die Unfähigkeit von Kunstexperten und Sammler*innen, die Qualität seiner „wahren“ Kunst zu begreifen.
Wann De Chirico klar war, dass er mit seinen Selbstplagiaten und -fälschungen grundlegende kunsthistorische und kunstkritische Konzepte wie „künstlerisches Gesamtwerk“, „Originalität“, „Authentizität“ und „künstlerische Handschrift“ untergrub, ist schwer zu sagen. Gebremst hat ihn das nicht, im Gegenteil: Als seine Händler und einige wichtige Sammler versuchten, die Pittura metafisica-Werke aus der Zeitmaschine zu kontrollieren, wenigstens aber einigermaßen zu dokumentieren, nutzte De Chirico andere Distributionskanäle, um damit weiter Geld zu verdienen. Völlig ruinös für jedes nach etablierten kunsthistorischen Maßstäben seriöse Werkverzeichnis war es dann, dass De Chirico in den 1950er begann, Museen und Sammler darüber zu informieren, welche ihrer De Chiricos gar nicht echt seien: entweder falsch datiert, unautorisierte Version, falscher Name oder gar nicht von ihm. Ob das jeweils stimmte, weiß man bei erstaunlich vielen bis heute noch nicht. Für De Chirico-Fälscher hat der Maler damit eine ideale Situation geschaffen: der Urheber, der sich selbst als Referenz für Zu- und Abschreibungen abschafft, eröffnet anderen die Möglichkeit, sich selbst als De Chirico zu versuchen.
Kunsthistoriker*innen, die zu De Chirico arbeiten, können kaum ignorieren, dass er mit seiner künstlerischen Praxis eines der grundlegenden methodische Projekte der Kunstgeschichte seit 1800 ad absurdum führt: die Idee des individuellen künstlerischen Werkes, das sich über die Jahre entwickelt, und dann in der Rekonstruktion durch die Kunstgeschichte erst als Werk in seinen genauen Konturen sichtbar wird – mit unterschiedlichen, aufeinander aufbauenden Werkphasen, Meisterwerken, schwächeren Werken und daraus folgend dann die Einordnung in die allgemeine Kunstentwicklung. Viele Ressourcen werden trotzdem darauf verwendet, De Chirico mit einem echten, weil chronologisch richtig geordneten Œuvre zu versehen. Es scheint, als könnten vor allem Museen nicht anders. Dem Dispositiv, in einer Abfolge von Räumen die Geschichte der Kunst als organische Entwicklung bis in die Gegenwart begehbar zu machen, entkommt man nicht so leicht. Interpret*innen, die De Chiricos fälschungskünstlerische Praxis ernst nehmen, lesen sie als strategische Interventionen gegen genau diesen Kunstbegriff, für den eine teleologisch auf die Moderne zulaufende Kunstgeschichte und ein analog konstruierte Künstlerbiographie konstitutiv sind. So wird De Chirico zu einem der Väter der Postmoderne – und die Grenze zum Fälschertum wieder ordentlich befestigt.
Trotz ihres Anspruches, Kunstfälschung systematisch zu betrachten, belassen es auch die aktuellen großen deutschsprachigen Übersichtsdarstellungen zur Geschichte und Praxis der Kunstfälschung von Henry Keazor (Täuschend echt. Eine Geschichte der Kunstfälschung, Darmstadt: Konrad Theiss Verlag, 2015) und Hubertus Butin (Kunstfälschung. Das betrügliche Objekt der Begierde, Berlin: Suhrkamp, 2020) weitgehend beim Anekdotischen: Fälschern werfen sie die Unlauterkeit ihrer Motive mit großer Emphase vor, Künstler mit großer kunstfälscherlicher Praxis wie De Chirico oder Dali werden dagegen an den Rand der Geschichte der Kunstfälschungen delegiert. Während es Wolfgang Beltracchi und Co. auf nichts weniger als die Korruption der Kunstgeschichte abgesehen haben, erscheinen die seltsamen Gepflogenheiten mancher Künstler oder ihrer Nachlass-Verwalter*innen nur als bedauerliche Verirrungen.
Gegen die Popularität von Wolfgang Beltracchi anzuschreiben, der sich mit geschickter Medienarbeit die Deutungshoheit über seine Karriere als Künstler und Kunstfälscher erarbeitet hat, scheint für beide Autoren ein zentrales Motiv zu sein: Dass es sich bei Kunstfälschungen nicht um ein Kavaliersdelikt oder eine gut bezahlte Eulenspiegelei handele, sondern um ein Verbrechen vor allem gegen den Geist der Kunst selbst (Kunstfälschung an sich stellt keinen Straftatbestand dar), soll der Leserin mit detaillierten Schilderungen der selbst schon kanonisch gewordenen großen Fälscherstories des 19. und 20. Jahrhunderts verdeutlicht werden. Was tatsächlich deutlich wird, ist die Stabilität der Strukturen im Kunstbetrieb, die es Kunstfälschern seit gut 200 Jahren ermöglichen, auch im Spitzensegment erfolgreich zu arbeiten. Kunsthändler, für die selbst eine zweifelhafte Zuschreibung an einen großen Namen geschäftlich attraktiver ist als die Rückgabe an den Verkäufer; Sammler, die vom Ehrgeiz getrieben sind, ihre Sammlung zu komplettieren und auch etwas von diesem großen Namen zu besitzen; Kunstexperten, die sich mit einem wiederentdeckten Meisterwerk selbst in die Kunstgeschichte einschreiben wollen und deswegen Warnsignale nicht erkennen. Keazor und Butin machen jeweils Vorschläge, was der Kunsthandel, die Rechteinhaber und Nachlassverwalter von Künstlernachlässen sowie Werkverzeichnis-betreuende Institutionen tun müssten, um Kunstfälschern das Geschäft schwerer zu machen. Die meisten, wie beispielsweise eine Online-Datenbank aller Objekte, deren zweifelhafte Authentizität bereits belegt ist, erscheinen so selbstverständlich, dass man sich fragt, warum sie bisher nur ansatzweise oder gar nicht umgesetzt wurden.
Eine Antwort geben Stefan Koldehoff und Tobias Timm in Kunst und Verbechen (Berlin: Galiani 2020). Die beiden True Art Crime-Experten stellen anhand konkreter Fälle die als legal, zumindest aber als legitim anerkannten Praktiken des Kunsthandels vor, die ihn für wirtschaftskriminelle Ambitionen aller Art so attraktiv machen: von der Steuerhinterziehung über die Geldwäsche bis hin zur Hehlerei von Raubgut aus Krisen- und Konfliktgebieten. Wer die Statements von Kunst- und Antiquitätenhändlern gelesen hat, die ihre Kooperation mit extrem dubiosen Geschäftspartnern aus Krisen- und Kriegsgebieten damit rechtfertigen, sie retteten so immerhin das kulturelle Erbe der Menschheit vor dem Verschwinden, dem erscheinen im Vergleich die Rechtfertigungen von Fälschungskünstlern wie Beltracchi oder Greenhalgh als naiv. Koldehoff und Timm machen auch klar, wie eng die gesellschaftliche Privilegierung von Kunst mit dem Selbstverständnis von Kunsthändlern und Sammlern zusammenhängt, für ihre Geschäfte hätten andere Gesetze und Regeln zu gelten als die sonst üblichen. Wer Kunstwerke vor allem als den herausragenden Ausdruck menschlicher Kreativität begreift, für den erscheinen sonst übliche Regeln und Normen schnell als Beschneidung genau dieser Kreativität. Über diese strukturelle Verstrickung der Kunstgeschichte und ihrer Grundbegriffe in den Prozess, der aus Ergebnissen künstlerischer Praxis die Ware “Meisterwerk” und das Branding zum “Genie” macht, hätte man bei Butin und Keazor gerne etwas gelesen. So bleiben Fälscher wie Wolfgang Beltracchi und Shaun Greenhalgh die eigentlichen Theoretiker des autonomen Kunstwerks als Grundform der Ware.
Aufmerksamen Leser*innen wird aufgefallen sein, dass ich im Text kaum inklusive Formen verwende. Das hat Gründe: Der Price Gap zwischen Künstlern und Künstlerinnen im Kunsthandel ist enorm, ganz gleich ob seit Jahrhundert tot oder zeitgenössisch. Die Zuschreibung neu aufgefundener Werke an Künstlerinnen ist daher eher selten. Zum einen weil für Werke von Malern deutlich höhere Preise erzielt werden können, zum anderen weil als qualitätvoll erkannte Objekte immer noch eher Männern zugeschrieben werden. Denn trotz Meisterinnen wie Artemisia Gentileschi, Judith Leyster oder Sofonisba Anguissola und über 40 Jahren feministischer Kunstwissenschaft ist gerade der Bereich der Disziplin Kunstgeschichte traditionell geprägt, der sich vor allem mit den richtigen Zuordnungen von Werken zu Namen beschäftigt. Das heißt: Hier gilt das Vorurteil, Frauen produzierten im besten Fall solides Handwerk, noch als Wissen. Die Meisterwerke der genannten drei Künstlerinnen beispielsweise wurden nach ihrem Tod, vor allem im 19. Jahrhundert, oft Männern zugeschrieben: ihren Vätern, Brüdern, Lehrern oder wie bei Gentileschi und Leyster an Caravaggio respektive Frans Hals. Kaum war die richtige Zuschreibung an eine Malerin etabliert, verloren die Werke nicht nur an ökonomischen Wert, sondern wurden auch von Museumskuratoren und Kunsthistorikern oft auf hintere Plätze im Kanon und ins Depot durchgereicht. Dass Gemälde von Artemisia Gentileschi in Museen heute wieder da hängen, wo sie hingehören, in den Hauptsälen neben Carravagio und Carracci, verdankt sich kunsthistorischen und kunstwissenschaftlichen Denkweisen und Ansätzen, die sich kritisch zu den traditionellen Kategorien und Methoden verhalten, die bei der wissenschaftlichen Expertise für den Kunstmarkt immer noch dominieren. Erst der Abschied von der Genie-Mystik als Paradigma künstlerischer Praxis hat es Kunstliebhaber*innen und Wissenschaftler*innen ermöglicht, die tatsächliche historische Vielfalt künstlerischer und kreativer Praktiken jenseits der “Alten Meister” wieder zu sehen.
Photo by Anna Kolosyuk on Unsplash
Nachkriegsmoderne ist, kann man jedoch ganz ohne Verweise auf ihre Biographie verstehen, und es lässt sich jetzt endlich zum ersten Mal auch auf Deutsch nachvollziehen. Der Zürcher Diaphanes Verlag hat in diesem Frühjahr eine Übersetzung veröffentlicht. Und Ice wirkt erschreckend zeitgemäß. Die Welt wird von populistischen Regierungen beherrscht, die halboffizielle Kriege gegen eine isolierte, eingeschlossene Zivilbevölkerung führen, während eine Eisschicht sich unaufhaltsam auf der Erdoberfläche ausbreitet und „monstrous epidemics“, „ungeheure Seuchen“, wüten (ich zitiere im Folgenden das Original und die Übersetzung von Silvia Morawetz und Werner Schmitz). Ein namenloser Erzähler macht rücksichtslos, aber romantisch verbrämt Jagd auf eine unerreichbare Frau, der er bei jeder Begegnung Gewalt antut, und die er die ganze Zeit nur „the girl“ nennt, „das Mädchen“. Wir hätten hier also: Trump und andere ähnliche Staatsoberhäupter, Klimakatastrophe, Pandemie, Lockdown und patriarchale Gewalt, kurz: das Jahr 1967 streckt seine kalte Hand nach 2020 aus.