Dies ist der neunte Teil unseres kollektiven Tagebuches, in dem wir mit zahlreichen Beiträger*innen fortlaufend sammeln, wie der grassierende Virus unser Leben, Vorstellungen von Gesellschaft, politische Debatten und die Sprache selbst verändert. (hier Teil 1, Teil 2, Teil 3, Teil 4, Teil 5, Teil 6, Teil 7, Teil 8)
Das mittlerweile über 120 Seiten umfassende kollektive Tagebuch “Soziale Distanz – Ein Tagebuch” gibt es auch als vollständige Leseversion in Google Docs.
Es schreiben mit:
Andrea Geier: @geierandrea2017, Anna Aridzanjan: @textautomat, Berit Glanz: @beritmiriam, Birte Förster: @birtefoerster, Charlotte Jahnz: @CJahnz, Elisa Aseva, Emily Grunert, Fabian Widerna, Jan: @derkutter, Janine, Johannes Franzen: @johannes42, Magda Birkmann: @Magdarine, Maike Ladage @mai17lad, Marie Isabel Matthews-Schlinzig: @whatisaletter, Matthias Warkus: @derwahremawa, Nabard Faiz: @nbardEff, Nefeli Kavouras, Philip: @FreihandDenker, Rike Hoppe: @HopRilke, Robert Heinze: @rob_heinze, Sandra Gugić: @SandraGugic, Sarah Raich: @geraeuschbar, Shida Bazyar, Simon Sahner: @samsonshirne, Slata Roschal, Sonja Lewandowski: @SonjaLewandows1, Svenja Reiner: @SvenjaReiner, Tilman Winterling: @fiftyfourbooks, Viktor Funk: @Viktor_Funk
10.04.2020
Viktor, Frankfurt
Zwei Bekannte berichteten mir, dass sie ganz überrascht darüber sind, wie intensiv und positiv sie die Zeit mit ihren Kindern erleben (es sind zwei Mütter). Die eine meint, sie überlege sogar, ihre Kinder vom Kindergarten abzumelden (was sie nicht tun wird, da bin ich mir sicher). Vor diesen Gesprächen war in der FR der Leserinnenbrief einer Psychologin aus Mainz, die in einer Familienberatungsstelle arbeitet und die berichtete, dass die Gewalt in einigen Familien steigt. Sie nannte einige Beispiele von Misshandlungen und Überforderungen, die ganz akut waren.
Das klingt abgedroschen, aber es trifft wohl zu: Wenn wir mit einer nicht zu ändernden Situation konfrontiert sind, dann zeigen sich Charakterzüge, die wir sonst nicht sehen würden oder unter anderen Umständen verstecken können.
Was mir auch auffällt: Menschen, die am Anfang der Corona-Krise sagten, sie kämen allein sehr gut zurecht, sagen nun, dass es doch einen Unterschied gebe, ob sie freiwillig oder gezwungenermaßen allein sein müssen.
Slata, München
Eine gewisse abstrakte Freude macht sich breit, das schon, Schokoladenküken, Stifte zum Eierfärben, Marzipanbonbons, ich stelle mir einen idealen Tag vor, einen wenigstens in den fünf Wochen, wie das glückliche Kind die Blumentöpfe auf dem Balkon absucht, Topf für Topf, eine Schokoladenfigur nach der anderen, den vollgefüllten Korb zufrieden auf den Küchentisch stellt, und dann färben wir Eier und backen einen Kuchen und es wird so wunderbar alles, so gut organisiert, durchgeplant und vorbereitet. Die Nachbarn haben Ostereier aus Neonplastik in ihrem Garten hängen. Die Schweißnaht auf diesen Eiern sieht nach einem Kaiserschnitt aus, die Küken rausgeholt, wieder zugeklebt, als wäre nichts passiert. Ich will konsumieren, sage ich, Die einfachste, billigste, im übertragenen Sinn, Art von Freude, will alte Sachen wegschmeißen und neue Sachen kaufen, Sommerkleider, leichte Leggins, Leinenröcke, koreanische Gesichtspeelings, dann noch Plastikeier halt, will wenigstens einmal die Woche reduzierte Wintermützen anprobieren, die Adrenalinkicks bleiben aus, und ich beginne ernsthaft zu überlegen, ob das gerade etwas ist, was man Enthaltsamkeit nennt.
Sandra, Berlin
Mein Partner sagt ja gern, ich bin die größte (aber trotzdem seinerseits sehr geschätzte) Klugscheißerin, die er kennt. Oh, und wie er recht hat. In diesem Sinne, to whom it may concern: https://www.duden.de/sprachwissen/sprachratgeber/der-oder-das-Virus
Ansonsten: Ich schreibe lebe schreie schlafe und wache hier weiter, in meiner kleinen Lebensbox. Ab und zu muss ich hier raus (kein Balkon, kein Garten, ein Kind). Und nein, wir hatten keinerlei Besuch seit dem KontakteinschränkungsDings, nur auf meinem Bildschirm treffe ich mich mit Freund_innen. Wir trinken, reden, spekulieren, widersprechen uns. Eigentlich nehmen wir uns mehr Zeit füreinander als üblich, ich führe lange Gespräche mit Menschen, die ich sonst selten sehe. Täglich gehe ich mit dem Kind raus, wir sind süchtig nach Licht und Sonne, beobachten Käfer, Katzen, Eichhörnchen, Menschen, sammeln Äste und Steine, untersuchen die Erde, lauschen den Geräuschen der Vögel. Das Kind grüsst alle Vorbeikommenden, brabbelt energisch gestikulierend drauflos und steckt so gut wie alle mit seiner unerschöpflich guten Laune an, die auch seine Stürze, und damit einhergehende Schrammen nur kurzfristig trüben können. Ein einziges Mal waren wir ultrakorrekt Distanzspazieren mit einer Freundin, aber davon schrieb ich ja schon. Ich habe bis heute große Schwierigkeiten mit Hierarchien, Regeln und Beschränkungen, aber hier mache ich, machen wir keine Ausnahmen. Gestern brachte der Paketbote eine Packung schwarze Plastikhandschuhe aus Latex Größe M. Sie erinnern mich an den Frühling vor zwei Jahren, die Hände meiner Tätowiererin, das Surren der Nadel, das Vibrieren unter der Ruhe, die einsetzt, wenn die Nervenenden den Schmerz akzeptieren, Körper und der Geist loslassen. Ein bisschen wie der innere Dialog beim Meditieren. Oder beim Schreiben. Heute ist der erste Osterfeiertag, mir waren Feiertage nie wichtig, meist arbeite ich. Das lange Wochenende beginnt mit der letzten Überarbeitungsrunde an meinem Romanmanuskript. Ich bin unruhig, ich drücke mich vor dem Anfangen vor dem Ende, so auch mit diesem Text. Eigentlich ist ein Text niemals fertig, es ist unmöglich. Das Ende ist niemals das Ende. Aber es gilt, rechtzeitig loszulassen.
Und dann fällt mir noch mein Lieblingsneologismus von 2010 ein: ESKAPISMUSKATAPULT
Fabian, München
Ich kann jetzt sechzehn Fesnter neben- und übereinander gleichzeitig darstellen; ein unwahrscheinlicher Luxuseffekt der Situation, der ohne sie zumindest nicht so bald zustande gekommen wäre. Nicht, dass sich dadurch irgend’was änderte, am Blick auf und in die digitale Umwelt. Aber es fühlt sich anders an. Etwas weiter, immerhin, und ganz sicher wire wie jede Adaptierung von Perspektivenschnipseln allein der Eindruck sich bald verflüchtigen, oder so sehr in die Gewohnheit übergehen, wie innerhalb von wenigen Tagen die Covid-19-Situation. Nur ein paar Tage lang fühlte ich mich bedroht, stellte an mir, ganz offensichtliche allerdings, Phantomsymptome fest, ohne mich mit der ausführlichen, möglichen Symptomatik ausführlich auseinandergesetzt zu haben, die sich dann aber dann direkt proportional zur Intensität sozialer Kontakte verflüchtigten und im selben Maß wieder auftraten – heute videotelefonierte ich zwei Stunden mit einer Freundin, Romanbesprechungen, trainierte und beobachtete, wie die vor Kurzem gepflanzten Chili-Pflänzchen die direkte Sonneneinstrahlung draußen am Balkon inzwischen sehr viel besser zu vertragen scheinen, ohne den ganzen Tag lang mehr als den Müll runtergebracht zu haben, und einen riesigen Verpackungskarton. Mir ist klar, dass es, an und für sich, eine Luxusposition ist, nicht zu vegetieren, gerade, für jemanden, der auch sonst die großen sozialen Räume eher scheut.
11.04.2020
Viktor, Frankfurt
Vielleicht verstehe ich die Krise immer noch nicht umfassend. Ich wundere mich über so viel Angst um mich herum. Ich sehe Menschen mit Masken im Wald, wo der Abstand zu anderen sehr groß ist oder wo es kaum anderen Menschen gibt. Ich sehe Menschen nervös werden, wenn sie jmd für einen Moment zu nahe kommen. In Umfragen ist die Bereitschaft sehr groß, den Lockdown zu verlängern, manche wollen härtere Maßnahmen. Eltern wollen die Schulen länger geschlossen halten.
Ich traf letztens jmd im Wald mit seinem Kind, unsere Kinder düsten dann auf ihren Rädern hin und her, der Bekannte erzählte, er hätte einige Nachbarn seit Wochen nicht gesehen, die hätten sich komplett abgeriegelt.
Die MHH (Medizinische Hochschule Hannover) testet jetzt eine Tuberkulose-Impfung, die das Immunsystem stärken und so abwehrstärker gegen das Coronavirus machen soll. Vor dem Spiegel stehend sehe ich auf meinem linken Oberarm die Narben der Tuberkulose-Impfungen, die ich als Kind bekommen habe.
Persönlich kann ich dieser Zeit etwas abgewinnen. Aber ich merke auch, dass ich nicht so recht die Angst um mich herum verstehe, ich nehme sie nur wahr.
Slata, München
Trennungsraten natürlich auch, Scheidungsraten, massenweise laufen Pärchen auseinander, suchen wieder nach bezahlbaren Einraumwohnungen, Ehegatten zerren an den Kindern, streiten sich über Unterhalt und Elternrecht, googeln, jeder heimlich, abends, an seinem Handy, der eine auf dem Ehebett, der andere auf dem Sofa im Wohnzimmer, wie viel ein Anwalt kostet und wie man die Kinder für sich behalten kann. Alte Greise gar, die das erste Mal Monate zusammen verbringen auf kleinstem Raum, vierundzwanzig Stunden am Tag, stellen plötzlich fest, dass es ja nicht auszuhalten ist, dass sie sich geirrt haben in ihrer Wahl und die Jahrzehnte, das ganze Leben davor vielleicht mit jemand Falschem verbracht, die Enkel sind schockiert, rufen sie besorgt an, aber die Alten bleiben standhaft, sie diktieren einzeln Einkaufslisten und bitten, ab jetzt zwei gesonderte Lebensmitteltüten vor der Tür abgestellt zu bekommen, getrennte Haushaltsführung, Trennung von Tisch und Bett.
Fabian, München
Maxim Biller fühlt sich intellektuell unterfordert. Spannend daran, dass er über die mediale Überrepräsentation der Pandemie hinaus seine Unterforderung kurz und knapp mit Desinteresse begründet. Er interessiert sich nicht für Biologie, etc. und vielleicht ist es das ehrlichste, was jemand bisher über das eigene Verhältnis zur gegenwärtigsten Gegenwart gesagt hat, die uns zur Verfügung stand, um einfach darüber hinweg zur Literatur zu gehen, als hätte er und in Bezug auf die gegenwärtigste Gegenwart nichts zu gewinnen. Man kennt vielleicht keinen anderen Gegenwartsautoren, der auch nur mit im Ansatz vergleichbarer Präzision die eigene Egozentrik dialektisch zu kontrastieren in der Lage wäre.
Rike, Köln
Das Gefühl von 50er jahren in der 2020 Trashversion. Alle (viele) spielen Kernfamilie, selbst die, die nicht wollen. Menschenfahrradketten von ausflügenden Muttervaterkindern mit Helmen und Fähnchen, die dürfen, rosa/blaue Farbkonzepte, der Rest rumbummelnde Einzelmenschen oder Pärchen, selbst die, die nicht wollen, sehen phänotypisch so aus. Lippenstift auflegen für das Einkaufen gehen, weil Highlight des Tages. Raus in die Natur sagen oder den Rasen mähen, ein Heim werkeln, Samstag Abend den Grill anschmeißen und niemanden einladen. Diese Vibes. Ich ziehe mir mein türkises Frotteeshirt an, das mich an Handtuch und Sonnencreme erinnert und rede mir ein, ich lauf zum Strand. Es klappt überraschend gut, paradoxe Intervention nennt man das glaube ich, vielleicht ist das auch der falsche Begriff. Durst nach Gesprächen mit Unbekannten. Lust auf Mayo-Ei und Cocktailobst im Supermarkt. Samstag Abend alleine Sektbowle trinken am offenen Fenster und den Dackel beobachten, (Freddy), der seinem Herren seit Tagen davon läuft. Der Herr brüllt dann immer. Dass ich den Namen seines Hundes kenne, seinen aber nicht.
Marie Isabel, Dunfermline
- Wut ist kein österliches Gefühl. Also fülle ich sie in Flaschen und lagere sie bis nach den Feiertagen. Beschriftet: Dem NHS mangelt es an Schutzkleidung = mehr Medizinier und Krankenschwestern sterben (https://www.bbc.co.uk/news/health-52242856). Auffallend viele von ihnen People of Colour. Der Gesundheitsminister schiebt die eigene Verantwortung anderen in die Schuhe = Masken etc. würden verschwendet, u.a. von der Bevölkerung (https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/coronavirus-face-masks-uk-shortages-nhs-workers-matt-hancock-a9460011.html). Während sie anderswo verpflichtend werden. Man fordert medizinisches Personal im Ruhestand auf, wieder in den NHS zurückzukehren – mit direktem Patientenkontakt. Wo doch das Risiko mit dem Alter zunimmt. = Die ersten sind bereits tot. Personalmangel, klar. Planerisches Versagen der letzten Jahre? Exodus von EU-Bürgern wegen des Brexit? Erwähnen die Tories nicht. Stattdessen sprechen sie von ‘gefühlten’ Mängeln (https://www.bbc.co.uk/news/uk-52252470). Voll funktionsfähige Beatmungsgeräte werden vom Set einer Krankenhausserie der BBC an Krankenhäuser gespendet … Ich werde noch viele Flaschen brauchen.
- Trotz allem scheint nach anfänglichem Zögern die Sonne, und auf Gründonnerstag folgt Karfreitag, und schon ist Ostersamstag. Ich gehöre keiner Konfession an, aber die Emotionalität und Symbolik des christlichen Osterfests tut mir in diesem Jahr gut. Der Gottesdienst im Fernsehen (aufgezeichnet schon im Winter in der King‘s College Chapel in Cambridge) wirkt wie der sprichwörtliche Balsam. Ich erinnere mich an Ostern in einer kleinen Vorortkirche im weißrussischen Minsk, das Segnen des Brotes, das von Kerze zu Kerze weitergereichte Osterlicht, den freudigen Ton der getauschten Grußworte: Christus ist auferstanden! – Er ist wahrhaftig auferstanden! Mich überkommt Dankbarkeit.
- Dankbarkeit dafür, dass ich gesund bin und meine Familie und Freunde – einige von ihnen sind chronisch krank – bisher von der Pandemie verschont wurden. Dass ich mein Leben mit einem geliebten Menschen teile, für den ich morgen früh ein Riesenschokoladenei im Garten verstecken werde. Dass ich die Wohnung österlich dekorieren kann, einen Hefezopf backen, Gedichte schreiben, in Feld und Wald spazieren gehen. Dass es warm genug ist für leichtere, luftige Kleider. Dass plötzlich vor unserer Haustür Pflanzenableger für unseren kleinen Garten auftauchen – Geschenk einer Nachbarin. Dass ich relativ schmerzfrei bin. Dass es Menschen gibt, die ihr Leben für andere aufs Spiel setzen. Dass sie es vielleicht auch für mich tun würden.
- Am Abend dann noch einmal Nachdenken: Für alle, die nicht an Covid-19 erkrankt sind und niemanden kennen, der positiv getestet wurde, die im home office arbeiten und keine Verwandten im Gesundheitswesen haben, findet die Pandemie hauptsächlich im Fernsehen und im Supermarkt statt. Abstrakt trotz der persönlichen Einschränkungen und irgendwie weit weg. Vielleicht daher die ab und an in den Knochen nagende Angst. Klar, die Luft draußen ist sauberer. Flugzeuge sieht und hört frau kaum noch. Fahrzeuge weniger. Dafür sind manche Waren noch nach Wochen ausverkauft. Hefe, zum Beispiel. Weswegen eine Freundin jetzt versucht, selbst welche herzustellen. Was dabei vor allem wächst, sind Zweifel. Überhaupt gibt es momentan so viele Gründe zu zweifeln. U.a. der ungenügenden Zahl von Tests auf der Insel besteht Unsicherheit über die tatsächlichen Fallzahlen. Soll man nun eine Maske tragen oder nicht? Auf Twitter fragen Menschen, ob sie die einzigen seien, die ihren Einkauf desinfizieren. Nein, machen wir auch, ruft man ihnen entgegen. Fluch und Segen der sozialen Medien. Alle können sich mit allen anderen vergleichen. Dazu kommt, dass je nach Land unterschiedliche Regeln gelten. In Dänemark beispielsweise, whatsApped mir eine Freundin dort, sind Zusammenkünfte von bis zu 10 Personen erlaubt. Kein Wunder, dass sich neben mehr oder minder genauen Informationen irgendwann auch Falschinformation und Verschwörungstheorien multiplizieren.
12.04.2020
Rike, Köln
Ich verstecke jetzt Ostereier vor mir selber in meinen 3 Blumentöpfen, das ist keine paradoxe Intervention, eher Schizophrenie, aber keine andere Wahl und das gesuchte Gefühl. Die Kinder mit dem Garten von oben beobachten beim Eiersammeln. Immer wenn die große Schwester losrennt, rennt der Bruder auch (panisch). Das Gefühl völliger Sicherheit, beim Beobachten nicht entdeckt zu werden, weil selten Menschen in den Himmel schauen. Notiz: Mehr in den Himmel schauen, wenn Stresspanik. Hans sagt, sie kann das nicht zu lange machen, sie kriegt dann Platzangst. Sie kriegt Angst vor der eigenen Kleinheit. Die Kinder schlagen Sprachnachrichten für die Oma vor. Verschiedene Oma-Opa-Sprechchöre werden aufgenommen. Als sie frohe Ostern Oma Gerswid aufsagen, kriegen sie so eine Stimme. Roboterkinder, Dressurstimme, dabei hat ihnen das in dem Moment niemand vorgesagt. Wieder das Gefühl von 50er Jahre.
Shida
Auf dem Land ist wirklich so ziemlich alles anders als in der Stadt. Ich bin auf dem Land aufgewachsen und habe seit dreizehn Jahren in fünf mehr oder weniger großen Städten gelebt, die im Vergleich zu meinem Herkunftsort reine Metropolen sind. Mir sind die Unterschiede zwischen Stadt und Land in ihren Facetten völlig egal, denn auf dem Land langweile ich mich und will schnell weg, das ist alles, was mich interessiert.
Corona verändert mal wieder alles. Corona färbt jede noch so kleine Eigenheit des städtischen bzw. des ländlichen Lebens, macht die Unterschiede sichtbar, für die ich nie Interesse hatte.
Hier, wo ich gerade unterkommen konnte, wohnt man in Häusern, nicht in Wohnungen. Man kann den Müll rausbringen, wann man will und muss nicht durch ein belebtes Treppenhaus gehen, Türen und Tonnen anfassen, die man sich mit Nachbar:innen teilt und die den ganzen Prozess des Müllrausbringens zu einer weiteren Corona-Falle machen. Hier sitzt man im Garten oder im Vorderhof, weil einem zwar ein komplettes Haus zur Verfügung steht, man trotzdem ein Gefühl der Enge hat. Hier muss man ein Auto haben, um einkaufen zu können und dass man einen Wocheneinkauf für eine ganze Familie im Einkaufswagen stapelt, ist hier auch außerhalb Coronas die reinste Selbstverständlichkeit. Hier gibt es keine Türsteher:innen am Eingang des Supermarktes, denn im Supermarkt sind sowieso nur drei Leute. Die drei Leute fahren keine U-Bahn, müssen aktuell nicht auf Menschenansammlungen verzichten, denn die gibt es hier sowieso nie, und sie wären mit Markierungen auf dem Boden vermutlich maßlos überfordert. Das haben sie nämlich noch nicht auf Fotos im Internet gesehen, denn das Internet funktioniert hier nur so rudimentär, dass man ewig auf jedes Foto wartet.
Ich bin nun seit zwei Wochen hier, in erster Linie wegen der Personen, mit denen ich die Isolation verbringe und für die der Faktor des Rausgehen-Könnens elementarer ist als für mich. In den zwei Wochen sind mir eine Millionen Dinge aufgefallen, die sich hier so grundsätzlich von meinem Leben in der Stadt unterscheiden und die alle den Effekt haben, dass Corona uns hier mehr und mehr als Idee und immer weniger als reale Gefahr erscheint. Mir fällt wieder ein, dass ich es deswegen unerträglich fand, auf dem Land aufzuwachsen. Man kann sich hier immer einbilden, man hätte mit der Welt da draußen nichts zu tun. Egal, welche Debatten geführt werden, welche politischen Umwälzungen geschehen, welche Viren rumgehen: Die Illusion, dass man selbst die ferne Insel ist, die nichts damit zu tun hat, will sich immer wieder aufdrängen und bestätigt wissen. Im Fall der Viren genieße ich es zum ersten Mal, dass die Zahlen hier tatsächlich so viel geringer sind.
P.S.: Superviel Liebe für alle Klugscheißer:innen da draußen! Ich korrigiere meinen privaten Klugscheißer jetzt sofort und fange an, alle zu verwirren und einfach mal DIE Virus zu sagen. Vielleicht setzt es sich durch. Und wenn Corona vorbei ist, habe ich gewonnen.
Marie Isabel, Dunfermline
Ich schaue per Video meinem dreieinhalbjährigen Neffen in Suffolk beim Ostereiersuchen vor dem Aufstehen zu. Die Begeisterung des Kleinen wird übertroffen vom Fleiß der großen Versteckt-Habenden. Das Beutelchen für die Süßigkeiten, das an seinem linken Handgelenk baumelt, scheitert schon am ersten Riesenei (gibt es die mittlerweile in Deutschland eigentlich auch?). Am Ende ist seine Mutter bepackter als er selbst, und er verkündet glücklich: ‘Come on, let’s go eat chocolate!’ Als später mein Mann das Erwachsenenosterei findet, das ich für ihn im Garten versteckt habe, sehe ich, wie seine Augen leuchten. Ich freue mich mit. Mit meinem Neffen. Mit meinem Mann. Mit mir selbst, als ich ein auf Daumendruck blökendes Minischaf auspacke, das uns meine Schwester zu Ostern geschickt hat. Es steckt eben doch ein Kind in uns allen.
Slata, München
Waren wir früher fast stolz darauf, auf genügende Distanz zu achten, jedem sein Revier zu überlassen, mittlerweile abends jeder seins zu machen, Respekt und Gleichgewicht und, ja, den anderen ein gutes Beispiel geben (Was, er geht abends echt ins Kino, ohne dich? Was, fährst du für eine Woche weg, alleine?), stellt sich nun heraus, dass es kosmetisches Gehabe war. Planten wir selbst die seltensten Urlaubsreisen sorgsam, keine zehn Tage, nie, eine Woche mehr als genug, was sollen wir da machen, die ganze Zeit zusammen, und jetzt, fünf Wochen ‒ Sprechen wir nun zueinander, vermeiden wir Blickkontakt und sagen etwas vor uns hin, in den Raum hinein, oder richten unsere Rede an das Kind oder an jemanden Imaginären, den großen Anderen vielleicht, ekeln uns voreinander schon, lassen sich die besten Gefühle füreinander nicht durch Homeoffice vernichten, und etwas groß zu sagen gibt es auch nicht mehr.
13.04.2020
Janine, Flensburg
Meine dänische Schwiegermutter hat Ostern gefeiert, im Kreise ihrer Geschwister und deren Familien. Sie hätten extra einen besonders großen Tisch ausgeliehen, damit sie mit Abstand sitzen konnten. Mir fällt dazu sehr viel ein, aber ich sage nichts; mein Dänisch ist zu schlecht und mit Englisch ist es in diesem Fall einfach nicht dasselbe.
Shida
B. und ich haben ungläubig hin- und herdiskutiert, am Ende den Kalender rausgeholt, ganz am Ende mit dem Kontroll-Finger die Wochen abgezählt: Es sind vier Wochen Rückzug aus dem normalen Leben, aus der Welt, aus allem. Diese Erkenntnis wiederum ist nun vier Tage her. Sind vier Wochen und vier Tage Isolation nun viel oder wenig? Das ist wohl genau das, was wir auch nicht einschätzen konnten, deswegen das Hin- und Herdiskutieren. Gibt man zu, dass es viel ist und nimmt sich damit die Energie, womöglich noch länger so weitermachen zu müssen? Meine Strategie von Anfang an war, nicht anzufangen, von Corona genervt zu sein. Wenn man nicht weiß, wie lang es am Ende dauern wird, ist das die Energie, die wir noch brauchen werden. Genervtsein ist der Luxus, den man sich aufsparen muss für die wirklich harten Momente. Innerlich pendelt man seine Geduld trotzdem auf den 19.April ein, in der vollkommen naiven Hoffnung, dass es danach normal weitergeht (was es nicht wird, I know). In den kommenden Tagen wird man mehr wissen und es ist doch immer der letzte Abschnitt der Strecke, auf dem man die Geduld dann doch verliert und gerne aufgeben möchte. Gleichzeitig denke ich: Wie viele Leute haben (zumindest hier auf dem Land, wie gesagt, besondere Rahmenbedingungen, eigener Umgang) Ostern irgendwie doch nicht mehr so richtig an den Vorgaben festgehalten, wie viele Leute gehen gerade im Kopf mehr und mehr die Ausnahmen durch, die man vielleicht doch auch langsam machen könnte, weil man doch einiges getan hat, um das Risiko möglichst gering zu halten. Wäre also vielleicht gerade doch der wichtigste Zeitpunkt für klare Hinweise, Anweisungen, Ausblicke, und wenn sie lauten: Die Schulen und Kitas bleiben weitere vier Wochen geschlossen, jetzt reißt euch alle noch mal zusammen.
Hier in dem winzigen Dorf gehen die Kinder “klappern”, um die Kirchenglocken traditionell über Ostern zu ersetzen. Es scheppert einige Minuten auf den Straßen, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass hier überhaupt Kinder vorhanden sind und dass die dann auch noch ernsthaft um 7 Uhr morgens aufstehen, um Kirchenglocken zu ersetzen (und dabei dann zwei Meter Abstand zueinander halten und Mundschutz tragen? Hmm.). Dabei sind sie dieses Jahr vermutlich wichtiger als sonst. Selbst ich als Atheistin freue mich über ihr Signal, ihre Geräusche, ihr Dasein, ihr Engagement. Es ist vielleicht, neben dem geänderten Feiertagsprogramm im Fernsehen, das Einzige, was gerade an Ostern erinnert. Überhaupt, Fernsehen, das ist sowas, was ich letzte Woche wiederentdeckt habe und wie immer nach einer Zeit der Abstinenz haben mich die Werbespots in ihren Bann gezogen. Es gibt so viele Quarantäne-Werbespots, plötzlich so viel Werbung für Tiefkühlpizza und Abholservices. Mir hat das Fernsehgucken gutgetan, endlich hat die Werbung mal meine Lebenssituation verstanden.
Morgen geht der normale Arbeitswahnsinn wieder los. Ich mag meine Peergroup (ok, Kernfamilie ist das Wort, das man eigentlich dafür benutzt) und genieße unsere gemeinsame Zeit. Aber normaler Weise ist mein Zuhause mein Büro und damit der Ort meines einsamen, konzentrierten Denkens. Die Stunden am Tag sind normaler Weise die, in denen ich nicht nur meine eigene Chefin, sondern die Chefin meines Zuhauses bin. Seit Corona teile ich mein heiliges Büro plötzlich rund um die Uhr. Als hätte man plötzlich die freie Wildbahn um sich, weil man einmal nicht gut aufgepasst hat. Ich vermisse es so sehr, konzentriert allein zu arbeiten, die meditative Stille beim Denken. Und Alter, wie vermisse ich es, in Städte zu fahren, in Hotels unterzukommen, abends auf Bühnen zu sitzen, Menschen zu treffen, Menschen zu sprechen, ganz selbstverständlich Literatur im Fokus zu haben. Aber das sind diese Momente, in denen man wieder aufhören muss, zu denken. Sonst klappt gar nichts, falls es Mitte der Woche heißt: Die Beschränkungen werden um vier Wochen verlängert.
Sarah, München
Manchmal rasen die Katzen einfach los, über die schrundige Wiese und zur Gartentür hinaus, mit hochgestelltem Schwanz in einem ausgestreckten Galopp. Nach ein paar Minuten kommen sie dann wieder im Gang eines gelassenen, siegreichen Tigers. Wenn sie so rennen – es ist kein Jagdrennen, denn Katzen jagen nicht rennend, sondern lauernd – habe ich mir bis vor ein paar Wochen immer gedacht: Das muss die Furcht sein, die sie packt. Die Furcht, dass sie vielleicht plötzlich nicht mehr hinaus können. Sie kommen aus Rumänien. Straßenkatzen. Hungrig, aber frei. Dann kamen sie in die Tötung und von da nach Deutschland, wo sie zwei Jahre in einer kleinen Wohnung gelebt haben. Sie wissen also was es heißt, Freiheit zu verlieren.
Seit dem Shutdown denke ich jetzt jedes Mal, wenn die Katzen in ihrer Frucht um die Freiheit davonjagen: Ob es uns auch so gehen wird? Wenn das alles wieder vorbei ist? Wird uns die Furcht um unsere Freiheit manchmal überfallen wie ein Rasen, das uns in die Städte stürzen lässt? In die Bars, Kinos, Restaurants? Hungrig nach Freiheit und anderen Menschen? Werden wir wieder für unsere Grundrechte kämpfen? Für ein digitales Vergessen zum Beispiel?
Vielleicht kommt es aber auch so, dass wir ganz und gar vergessen, wie das geht, das mit der Freiheit. Weil das Gefängnis nicht der Lockdown ist, sondern die Angst. Und dass diese Angst uns bleiben wird. Je länger der Lockdown dauert, desto schwerer wird sie sich abschütteln lassen. Denn schon jetzt denken wir bei Bildern von Menschenansammlungen: AUSEINANDER! IHR WAHNSINNIGEN! Das muss hängenbleiben. Oder?
Trotzdem stelle ich mir die Zeit danach als Fest vor. Mit Tischen und Stühlen auf den Straßen, bunten Lampions in den Bäumen und Menschen, die einander in den Armen liegen. Und uns alle stelle ich mir als Tiger in Menschengestalt vor, die gelassen in ihr Revier zurückkehren, aus der Freiheit, von der sie doch wussten, dass sie auf sie gewartet hat.
Fabian, München
Man dürfe nicht davon ausgehen, das wire wie das “Es war eine Zeit” Bruce Willis’ in Lucky Number Slevin als Ausgangs- und Knotenpunkt der Erzählung. Es lässt sich vielleicht und ohne Weiteres behaupten, dass es sich dabei nicht um die cleverste mögliche Eröffnung eines durchaus sehr cleveren Films handelt. Nun ist der durchschnittliche deutsche, überregional-mediale Kommentar zumeist (intellektueller) deutscher Kommentatoren zweifellos kein clever geplotteter amerikanischer Film mit Millionenbudget, aber es ist doch auffällig, wie viele der sozusagen intellektuellen Kommentatoren der Krise sich dazu verschworen zu haben scheinen, die Komplexität aller möglichen und notwendigen und wahrscheinlichen Maßnahmen und Folgen und Begleiterscheinungen der und zur Bewältigung der Krise und entgegen jeder facherkenntlichen Enigmatik auf die Phrase, Corona habe “die Welt fest im Griff” herunterzubrechen. Das ist perfide, als ob es der Alternativlosigkeit der Feststellung bedürfte, um die jeweilige Alternativlosigkeit des Folgenden zu untermauern, umso perfider oder wahlweise achtloser, wenn die hohle Phrase dazu dient, eine Diskursverschiebung zu naturalisieren, die, nach allem was wir wissen, längst nicht ausgemacht sein kann. Wahlweise ärgerlich, wenn “wir” als Kollektiv, nagut, ganz zu schweigen von den kontemplierenden Individuen ihrer Beiträge, die sich der Phrase bedienen, genug über das Virus wüssten. Das Virus hat ganz sicher die Zellen fest im Griff, die es zur Reproduktion nutzt, wie Covid-19 die schwer erkrankten Körper vorweg aller Maßnahmen fest im Griff hat, aber alles darüber hinausgehende ließe sich höchstens als vielschichtiges Ineinandergehen von Entscheideungskaskaden und -bäumen im kausalen Zusammenhang zwar, immerhin, vorstellen, sodass sich eher, vielleicht, behaupten ließe, die Welte habe, als Diskursmoment, Corona fest im Griff.
Emily, Rostock
Inzwischen treffen mein Therapeut und ich uns einmal in der Woche in einem Chatroom um gemeinsam zu atmen. Ich weiß, dass wir uns dabei gleichermaßen lächerlich vorkommen, aber ich versuche, mir nichts anmerken zu lassen. Generell versuche ich mir nur noch wenig anmerken zu lassen.
14.04.2020
Jan, Hannover
Heute ist Nochntag. Mit lautem Getöse zerren die Männer von der städtischen Abfallwirtschaft die Müllcontainer aus ihren vergitterten Verschlägen und treiben sie auf dem Bürgersteig zusammen. Zumindest einmal in der Woche bringen sie so noch etwas Leben in die Straße. Seit dem Lockdown haben die Paketboten der konkurrierenden Dienste insgesamt exakt ein Päckchen für unsere Nachbarn bei mir abgegeben. Vor dem Lockdown kam ich oft schon an einem einzigen Tag auf drei bis vier Sendungen, die ich treuhänderisch bis zur ihrer Abholung in unserem Flur lagerte. So war ich jederzeit bestens über die breit diversifizierten Bedarfe und Bedürfnisse in unserem Haus informiert. Der Rekord waren acht Pakete an einem Tag. Jetzt aber hocken alle Nachbarn den ganzen Tag lang in ihren Wohnungen und warten wie Junkies selbst auf ihre verschiedenen Zusteller, als wären ihre Online-Orders die letzte Verbindung zu einer ansonsten unerreichbar gewordenen Außenwelt.
Kleiner Hund, die große Diva, kommt angewackelt, streckt sich und posiert vor seiner Bücherwand, als würde gleich eine Videokonferenz starten. Ich bin so unwichtig, dass ich seit Ausbruch der Pandemie noch nicht eine einzige richtige Videokonferenz hatte, nur Koch- und Trink-Calls, aber Kleiner Hund ist auf allen Kanälen bestens vernetzt. Das Tier, wie wir es liebevoll nennen, hat in den vergangenen Wochen etwas zugenommen, obwohl wir es achtsamer ernähren, als es uns bei uns selbst je gelänge. Dass wir die Walkies-Runden lockdownbedingt etwas kürzer gehalten haben, macht sich bemerkbar.
Gleich wird der Wecker klingeln, um uns aufgeregt an seine wichtige Rolle in unserem Haushalt zu erinnern, aber ich bin ihm bereits um eine Stunde voraus. Vor dem Badezimmerspiegel zwinge ich mich zu meinem morgendlichen Kniebeugen-Regime. Auch ich habe zugenommen, was den sportlichen Wert dieser Verrichtung natürlich spürbar erhöht; mehr Gewicht bedeutet mehr Kraftaufwand, ich kümmere mich um mich. Mein Haar wellt sich schon über die Ohren, und vergangene Woche ist auch noch der Barttrimmer kaputt gegangen. Die Krise hat viele Gesichter, meines wuchert langsam von allen Seiten zu.
Die Kids mit den BMX-Bikes (nennt man das heute noch so: BMX? Kids??), die ich früher nie hier gesehen habe, drehen schon wieder gelangweilt ihre Runden im Hof, die dicken Reifen surren über das Pflaster, aus einem Smartphone-Lautsprecher bellt heiserer Delinquenten-Rap. Frühaufsteher-Kids, aha, die werden es noch weit bringen. Der Wecker klingelt, Kleiner Hund antwortet mit kurzem, rhythmischen Fiepen. Gleich werde ich ein paar Downloads starten, meine Fähigkeiten zur Lokalisierung, Beschaffung und dezentralen Ablage digitaler Unterhaltungsinhalte haben sich seit dem Lockdown deutlich verfeinert. Catch and chill. Man kann vielleicht nicht mehr verreisen, aber man kann immer noch jederzeit seinen Standort im VPN ändern.
Die Barista-Boys haben den Espresso zu fein gemahlen. Meine Pyjamahose hat ein Loch. Heute ist Nochntag.
Shida
Der Bericht der Leopoldina in Halle ist eine der wichtigen Grundlagen für weitere Entscheidungen, hat Merkel mehr oder weniger angekündigt. Seit gestern liegen deren Einschätzungen vor. Ich bin von den möglicher Weise berechtigten Kritikpunkten, die Menschen daran finden, genervt, weil ich keine Ruhe habe, mich damit auseinander zu setzen. Der Bericht klingt in meinen Ohren plausibel (schrittweise zur Normalität zurück, Schulen für bestimmte Jahrgangsstufen in kleinen Gruppen und mit Mundschutz wieder öffnen, Negativfolgen auf Psyche der Menschen in Isolationszeit nicht unterschätzen und so weiter) und gleichzeitig ist es völlig egal, wem er wie plausibel erscheint denn er ist kein Garant für nichts, was in den kommenden Tagen entschieden wird. Ich finde, er klingt nach Hoffnung, nach dem kleinen Stück hellem Himmel, auf das man starrt, wenn es regnet. Die Vorschläge sind für meine persönliche Arbeitssituation trotzdem niederschmetternd. Die prall gefüllten Arbeitstage werden bleiben. Das ist nach wie vor alles machbar und händelbar und kein Grund zum Losheulen. Es würde nur wirklich sehr helfen, es gäbe eine Pause davon. Einmal ausschlafen zu dürfen, überhaupt einmal dem Schlaf, den der Körper für sich einfordert, nachgeben zu dürfen, nämlich so ungefähr 15 Stunden am Stück. Einmal kurz Wochenende von Corona bitte, dann geht es schon wieder.
Heute stürze ich mich wieder mit mehr Energie in den Roman, an dem ich arbeite. Figuren, die ich mir ausdenke, fühlen sich an wie der eigene Nachwuchs, ich will, dass es ihnen gut geht und sie tun mir mit ihrem Eigenleben wiederum gut. Im Moment würde ich ihnen gerne Dankeskarten dafür schicken, dass mir die Arbeit an ihnen eine Welt ohne Corona liefert. Eine Welt, in der ich entscheide, dass es hier kein Corona gibt und niemals geben wird.
Slata, München
Irgendwie soll da morgen was beschlossen werden, keine Ahnung, da wurde etwas gesagt vor ein paar Tagen im Radio, also das klang so, als ob da was beschlossen werden müsste, und auch, vielleicht, ob Schulen öffnen, Horte und Friseursalons, das, was uns fehlt gerade, stell dir vor, wie da alle auf einmal in den Urlaub aufbrechen, das wird was geben, hej, da wird wieder alles zusammenbrechen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig mitbekommen habe, also mitgehört, weil wir grad gegessen haben und die Hälfte verpasst, zum Ende hin erst auf laut gestellt, aber irgendwas muss da ja gesagt worden sein, woher hätte ich mir das gemerkt, dass morgen, am Mittwoch, irgendwas beschlossen werden soll, ich warte dann bis Mittwoch nochmal ab, ob da was verkündigt wird, und bestelle dann ein Set, ein einfaches, als Erste Hilfe sozusagen, einen guten Kamm, eine Schneidemaschine und eine scharfe Schere.
Nefeli, Berlin/Hamburg
Ich glaube, ich bin nicht mehr wirklich alltagstauglich seitdem ich kaum mehr Termine habe. Diese Woche wird irgendwas beschlossen und dann gibt es vielleicht wieder Normalität. Das ist für mich ein bisschen so angsteinflößend wie die Abwesenheit jeglicher Normalität. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie das geht. Zurück nach Hamburg gehen, ins Büro, Schlafrhythmus, die Liebsten treffen, auf der Straße Bier trinken, Termine ausmachen, Google Kalender pflegen. Mir kommt das alles befremdlich vor, jetzt wo ich mir all das abtrainiert habe. Ich sitze auf dem Fensterbank und die Sonne knallt rein. Beim Lüften merkte ich allerdings, dass es gar nicht warm ist. Ständig wird man reingelegt.
15.04.2010
Sarah, München
Seit wir auf uns selbst zurückgeworfen sind, koche ich noch mehr als sonst. Oder eher: Gewissenhafter und Detailverliebter als sonst. Denn vor Corona musste ja auch Essen auf den Tisch. Und in unserer Familie bin ich der Koch- und Einkaufmensch, während mein Mann der Wäsche- und Aufräummensch ist. Kochen war schon immer ein Weg, ohne großes Nachdenken kreativ zu sein. Nun nehme ich mir mehr Zeit, experimentiere herum, lese sogar in Kochbüchern nach, was ich sonst höchstens zu Weihnachten oder Geburtstagen mache.
Und ich merke, wie ich in meinem Kopf auf Reisen gehe, daran denke, wie wir entschieden haben, dass eine Familie ein Waffeleisen braucht. Oder der Reiskocher erinnert mich an meine ehemalige Mitbewohnerin, die ihn mir zum Auszug geschenkt hat und wie ich dastand, zwischen meinen Kisten, mit dem Kochtopf in der Hand und heulte. Und dann sind da noch die fünf rumänischen Kochlöffel. Handgeschnitzt. Ich koche gern mit ihnen. Sie liegen gut in der Hand, haben eine angenehme Größe und eine tatsächliche Mulde, so dass man mit ihnen auch gut abschmecken kann. Bis zum Fall des eisernen Vorhangs aß man in Maramures, wo die Löffel herkommen, auch mit diesen handgeschnitzten Löffeln. An die Zeit in Maramures erinnere ich mich eigentlich gern. Aber nicht so sehr an den Kauf der Löffel. Denn es war einer dieser Imperialisten-Momente, aus denen es keinen Ausweg gibt. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes kam ein Mann auf uns zu, sonnengegerbt und die linken drei Vorderzähne weg, vielleicht war er Mitte vierzig, oder fünzig, auf eine raue Art hübsch, trotz der Zähne. Er hielt die fünf Löffel in der Hand, streckte sie mir entgegen. Sehr fröhlich und siegesgewiss. Och wollte keinen Löffel. Er blieb eisern. Und schließlich kaufte ich alle fünf. Weil sie so unfassbar billig waren und ich mich in der Situation als reiche Touristin (in Maramures ist jeder, der es sich erlauben kann zum Spaß zu verreisen reich) zum Schreien unwohl fühlte.
Nun stehen die Löffel mit anderen Kochgeräten in einem alten Sektkühler. Und seit Corona erinnern sie mich nicht mehr nur an ihren Verkäufer und vermutlich auch Erschaffer. Sie erinnern mich auch an das Krankenhaus in Sighet (offiziell Sighetu Marmației), wo auf dem Klinikgelände das Rudel wilder Hunde lebt und in den Betten die Matratzen fehlen. Ich muss an die gespendete Klinikausrüstung aus Deutschland denken, die Rostflecken hat und aus den sechzigern ist. An die Ärzte und Schwestern, die schon vorher den Mangel verwaltet haben, würdevoll und ernst und mit viel Fachwissen. Wie viele Beatmungsgeräte es wohl bei ihnen gibt? Corona gibt es natürlich auch in Rumänien. Und es wird auch nicht vor der Idylle von Maramures haltmachen. Und wenn schon New York um Beatmungsgeräte betteln muss, wie wird es wohl dort gehen, dort, wo
Nabard, Bonn
“Was bringt dir das alles? Ist es überhaupt was Wert wenn du dich so aufopferst? Wozu machen wir das alles, nur damit am Ende ein Vollhorst unsere Arbeit kaputt macht oder die Leute es nicht wertschätzen!? Nabard! Pass bitte auf dich auf! Wann hattest du das letzte mal Zeit für dich? Für Musik? Kunst? Inspiration? Deine Umwelt? Verlier dich nicht, mein Bruder!”
Habe Alex seit London Anfang März nicht mehr gesehen, er ist wieder in Marburg. Ich in Bonn. Dennoch weiß er, spürt er, dass vieles mich momentan stresst.
Habe kurz runter gespickt und gesehen dass parallel zu mir jemand schreibt und nach mir fragt;
Hallo Sandra! Ja mir geht’s gut. Ich bin angehender Arzt im praktischen Jahr und war bis eben noch im Krankenhaus. Stressig aber ich liebe es. Und du? Wir haben einen Garten und während meiner Quarantäne war es mein Spot, ab der zweiten Woche, jeden Morgen dort frühstücken. Bis mittags sitzen und was lesen. Naja, meiste Zeit YouTube Videos schauen. Ich wollte gerade laufen gehen aber ich dachte ich tippe euch diese Zeilen.
Zurück zu Alex; ja, er hat recht. Sich für etwas einsetzen und engagieren kostet Kraft. Vieles bleibt auf der Strecke ohne das man es merkt. Virtuell ist man für alle da. Doch was ist virtuelles wert? Ersetzt es die Umarmung eines geliebten Menschen? Das gemeinsame chillen auf dem Balkon? Das Gefühl wenn beide von den Zeilen des Lieblingskünstlers berührt werden? Der Handschlag wenn man etwas fühlt und es zum Ausdruck bringen will?
Lustigerweise traf ich am nächsten Tag einen alten Arbeitskollegen aus der Zeit wo ich als MTRA in einem Bonner Krankenhaus arbeitete. Er arbeitet jetzt im Schwesternhaus und sprang gestern bei uns ein. Ich saß im Arztzimmer als er an der Tür stand und die Tür nicht aufbekam. Ich ging zur Tür, öffnete sie und sah ihn. Mit seinen 1,95 wirkte er vor fast 7 Jahren noch riesig jetzt sah ich ihm gefühlt in die Augen und ohne zu überlegen umarmten wir uns für mehrere Minuten! Lachten, freuten uns und ließen alle Emotionen heraus. Alt ist er geworden, er stehe kurz vor der Rente und freue sich dass ich es soweit geschafft habe. Seine beiden Söhne studierten jetzt. Er müsste wieder rüber, wir gaben uns beide die Faust zum Abschied.
Dieser Moment wo ich einen alten Freund umarmen konnte zeigte mir nochmal wie wichtig realer Kontakt mit unseren Mitmenschen ist. Hoffentlich verlernen wir es nach dieser Pandemie nicht.
An Sandra die gerade ihre Zeilen tippt, ich sehe welchen unendlichen Akt du und andere leistet. Worte können nicht ausdrücken wie sehr ich mir wünsche das es sich ändert! Ich will mit euch kämpfen. Hoffentlich können wir das gemeinsam ändern! Zu deiner letzten Frage; JA! Mit jedem Tag mehr. Hab einen schönen Abend und euch viel Vergnügen mit unseren Zeilen.
Sandra, Berlin
Wo war ich? Ah, auf dem Eskapismuskatapult. In neue Texte hineintauchen und alle 5 Minuten wieder hinaus. Rückenschmerzen vom Kind herumtragen. Kopfschmerzen vom andauernden Nachrichten hören lesen sehen. Kann mich nicht konzentrieren. Apropos:
Während ich diese Zeilen ins googledoc tippe, tippt ein anderer Mensch parallel zu mir. Ich sehe die Zeilen vorwärts und rückwärts laufen, wenn getippt korrigiert gelöscht wird. Das ist ziemlich witzig und ich stelle mir vor, dass mein unsichtbares Gegenüber sieht wie ich tippe mich vertippe lösche von vorne anfange. Hallo anderer Mensch! Wie gehts denn dir so? Hast du noch einen Job? Hast du einen Balkon? Einen Garten? Ein gutes Gewissen? Hast du dir deine Schreibzeit auch gestohlen?
Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich an die unzähligen Menschen denke, denen es viel schlechter geht an mir. Aber es geht mir trotzdem nicht gut. Ich bin zornig, ich bin müde.
In Merkels Rede kein Wort zur Carearbeit (Nein, es geht nicht um „Verzicht“!), zu den Eltern, die arbeiten und kinderbetreuen müssen, ich könnte auch Frauen schreiben, die arbeiten und kinderbetreuen müssen, denen niemand Ausfallshonorare zahlt, von denen erwartet wird beides zu schaffen, die unmöglich beides schaffen können, nicht auf Dauer. Alleinerziehende werden ohnehin wie so oft ignoriert. Diese unsere Gesellschaft schenkt den Frauen nichts.
Ohne Familienpolitik kann und darf Wirtschaftspolitik nicht mehr gedacht und gemacht werden. Und wie @bergdame so treffend schreibt: Familien sind alle Menschen mit Kindern, die Verantwortung für Kinder tragen.
Oh! Ich hab Antwort von meinem tippenden Kollegen. Hallo Nabard. Mir gehts nicht so gut. Siehe oben, ich bin sehr zornig, sehr müde. In meinem Kopf hab ich auch einen Garten. Muss mal wieder Blumen gießen, der Rasen sieht schon etwas angetrocknet aus, der Hund vom Nachbarn hat Löcher gegraben, die Katze einen Vogel gefressen. Federn überall. Willst du immer noch Arzt werden? War ein gutes Parallelschreiben, der wandernde Cursor hat mich motiviert. Jetzt beginnt meine Abendschreibschicht mit open end. Find ich gut, dass du nach wie vor Arzt werden willst, lieber Nabard. Take care!
Ich korrigiere und schreibe meine Texte meist endlos um. Aber jetzt lass ich das einfach mal so stehen.
Emily, Rostock
Was sich vor meiner Haustür abspielt: eine Gruppe Männer trinkt Bier auf einem Fensterbrett im dritten Stock. Ein Hinterhof wird umgegraben. Eine Schlange beim Bäcker, bei der Drogerie, beim Metzger. Ich kann nichts dagegen tun, dass mir die Situation mit jedem Tag unwirklicher vorkommt. Ich habe Angst und Sorge verlegt und manchmal muss ich mich auswringen, um sie wiederzufinden. Ein Gefühl als wollte ich mich zum Weinen zwingen. Ich muss mich aktiv daran erinnern, warum ich Ostern nicht mit der Familie verbracht habe, warum irgendwann das Geld knapp wird, warum mein Flug nach Griechenland vom namenlosen Kundenservice annulliert wurde.
Erst vor ein paar Stunden wurde beschlossen, wie die Lockerungen im Land aussehen werden. Fast beschämend: ich denke erstmals nicht an die Risikopatient*innen und die Kranken. Ich denke, dass ich mir die Ostseestrände ohne all die Menschen kaum vorstellen kann.
Marie Isabel, Dunfermline
Sagt einem ja keiner, dass in Flaschen abgefüllte Wut frau irgendwann kräftig um die Ohren fliegt. Hilft außerdem wenig, wenn du dann bedröppelt mitten im Schlamassel stehst und dein Blick auf immer neue Schlagzeilen trifft, die dich innerlich explodieren lassen.
Etwa, dass ein Viertel der Corona-Toten in Schottland aus Pflegeheimen gemeldet wurden (https://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-52292001). Auf BBC Radio4 schildert eine Frau, das Heim ihrer Mutter habe telefonisch mitgeteilt, dass Letztere im Fall einer Corona-Infektion keine Krankenhausbehandlung erhalten werde. Das, in Kombination mit dem grassierenden Mangel an Schutzkleidung, klingt fast wie ein Todesurteil. Ich möchte gern Juristen dazu hören: Auf welcher rechtlichen Grundlage werden solche Verfügungen über die Nicht-Versorgung von Menschen getroffen?
Dann wird heute verkündet, dass man wieder Abschied nehmen dürfe von sterbenden Angehörigen (https://www.bbc.co.uk/news/uk-52299590). Die Maßnahme wirkt irgendwie zynisch aus dem Mund von Gesundheitsminister Hancock, der Schutzkleidung und ausreichende Tests gefühlt jeden Tag neu verspricht, aber wenig zustande bringt, ganz zu schweigen von anderen Versagensbaustellen.
Teile der Bevölkerung bekleckern sich gerade ebenfalls mit wenig Ruhm, wie ein Beispiel aus Edinburgh zeigt: Da gibt es doch wirklich Menschen, die ihnen Fremde, die sich beim Spazierengehen zufällig treffen und miteinander unterhalten, unvermittelt anschreien, beschuldigen, nicht genügend Abstand zu halten und dann mit dem Maßband zur (scheiternden) Beweisführung schreiten (https://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-edinburgh-east-fife-52230081). Unter anderen Umständen: comedy gold.
Dann die Meldung über Channel 4 (https://www.channel4.com/news/pregnant-nhs-nurse-dies-with-coronavirus-but-baby-saved), dass am Ostersonntag eine 28jährige Krankenschwester an Covid-19 gestorben ist; nur Tage vorher war ihre jüngste Tochter durch Kaiserschnitt gesund zur Welt gekommen. Obwohl unklar bleibt, wie sie sich angesteckt hat, ist klar, dass sie bis ca. Mitte März noch Patientenkontakt hatte. Wieso man, in einer angekündigten Pandemie, eine hochschwangere Frau überhaupt einem Risiko ausgesetzt hat, bleibt mir schleierhaft. Ist es purer Zufall, dass es sich um eine Frau of Colour handelt?
Das ist natürlich nicht der ganze Katalog des gerade alltäglichen Wahnsinns, aber wenn ich jetzt noch von Flüchtlingen in Seenot oder Klassenunterschieden in der Bewältigung des Lockdown anfange, mag ja gar keiner mehr weiter lesen. Da hilft nur, mit etwas besseren Nachrichten die Wutflut einzudämmen: Also ende ich für heute mit dem fast 100jährigen Kriegsveteran Captain Tom Moore, der seit einiger Zeit mit einem Rollator unermüdlich rund um seinen Garten in Bedfordshire stapft, um Geld für den NHS zu sammeln. Eigentlich wollte er £1,000 zusammenbekommen. Inzwischen sind es mehr als £4 Millionen.
Prinzipiell ist die Idee, den NHS durch Spendenaktionen mitzufinanzieren, absurd; aber Fakt ist: das Geld fehlt, und die Großartigkeit dieses einen Menschen macht zumindest gefühlt manche Widrigkeit wett.
PS: Ich verspreche bald wieder weniger Presseschau und mehr Introversion oder was dafür gelten mag.
PPS: 16. April: Nun hat Captain Moore, noch vor seinem 100sten Geburtstag, 100 Runden um seinen Garten gedreht. Laut BBC sind £12 Millionen für den NHS zusammengekommen. !!!
Fabian, München
Was zur Hölle ist relevant. Was wäre konsequenter an der Annahme, die Fragen zu stellen wäre dem Versuch, sie sich zu beantworten, vorzuziehen. Etwas macht, etwas sieht zeitversetzt, die ganze “Corona-Kultur” ist eine Kultur inhärenten Zeitversatzes, ganz zweifellos, oder? Unser Unfähigkeit, die Welt zu erfassen, bestätigt sich in der zur Regel konvertierten Ausnahme von der Regel pluralistischer Berichterstattung; das ist zu einfach – was soll’s? Es gibt immerhin noch Nebenschauplätze, aber keinen Bezug auf die Krise dort, die sich nicht in der möglichen Welt unwahrscheinlicher Dramen realisiert. Zoos, die zur Ernährung der einen die Schlachtung der anderen Terie zur Disposition stellen, aus reinen, brutalen Kostengründen, Dispositiv der Fragilität von Institutionen, deren ganz selbstverständliche Stabilität des schönen Scheins in Friedenszeiten keiner infrage stellt. Und ganz sicher gibt es noch weniger plakative Beispiele und ganz sicher äußerst sich’s als unangemessen grobe Verkürzung, wenn man dabei das Gefühl hat, dass Facebook etwa schon einen Grund haben wird, mit dieser zweifelhaften Funktion der Vorfilterung der “relevantesten” Kommentare sehr häufig eher militante Eindimensionalist*innen zu bevorzugen, für die die Welt, und mit ihren engen Perspektiven durch die thematischen aber immer gleichen Bezüge, nicht in die Widersprüche, Zufälle und Ambivalenzen zu zerfallen scheint, die zur Verfügung stünden, immer.
Matthias, Jena
Die Fernseher sind so groß, dass es Wohnzimmerfenster gibt, die fast völlig davon ausgefüllt werden. Man schaut in ein fremdes Wohnzimmer und es ist einfach, als schaute man auf einen großen fernen Bildschirm, und genau das tut man ja auch. Das ist mir früher nie aufgefallen, aber ich gehe jetzt anders durchs Viertel.
Der Spielplatzsand, der in den vergangenen Wochen mit der Sandmaster-Siebmaschine durchgearbeitet und geharkt wurde, harrt hinter rotweißem Flatterband darauf, dass Kinder irgendwann wieder zum Spielen nach draußen dürfen.
Ich habe immer noch leichte Atemschwierigkeiten, die ich mir nicht erklären kann. Vielleicht nehme ich auch nur meinen ganz normalen Atem falsch wahr? Es ist leider aktuell völlig unmöglich, noch unmöglicher als sonst, sich unvoreingenommen mit der Wahrnehmung des eigenen Atems auseinanderzusetzen. Ein Leibphänomenologe hätte vermutlich seine Freude an mir. Ich will einfach nur, dass es aufhört.

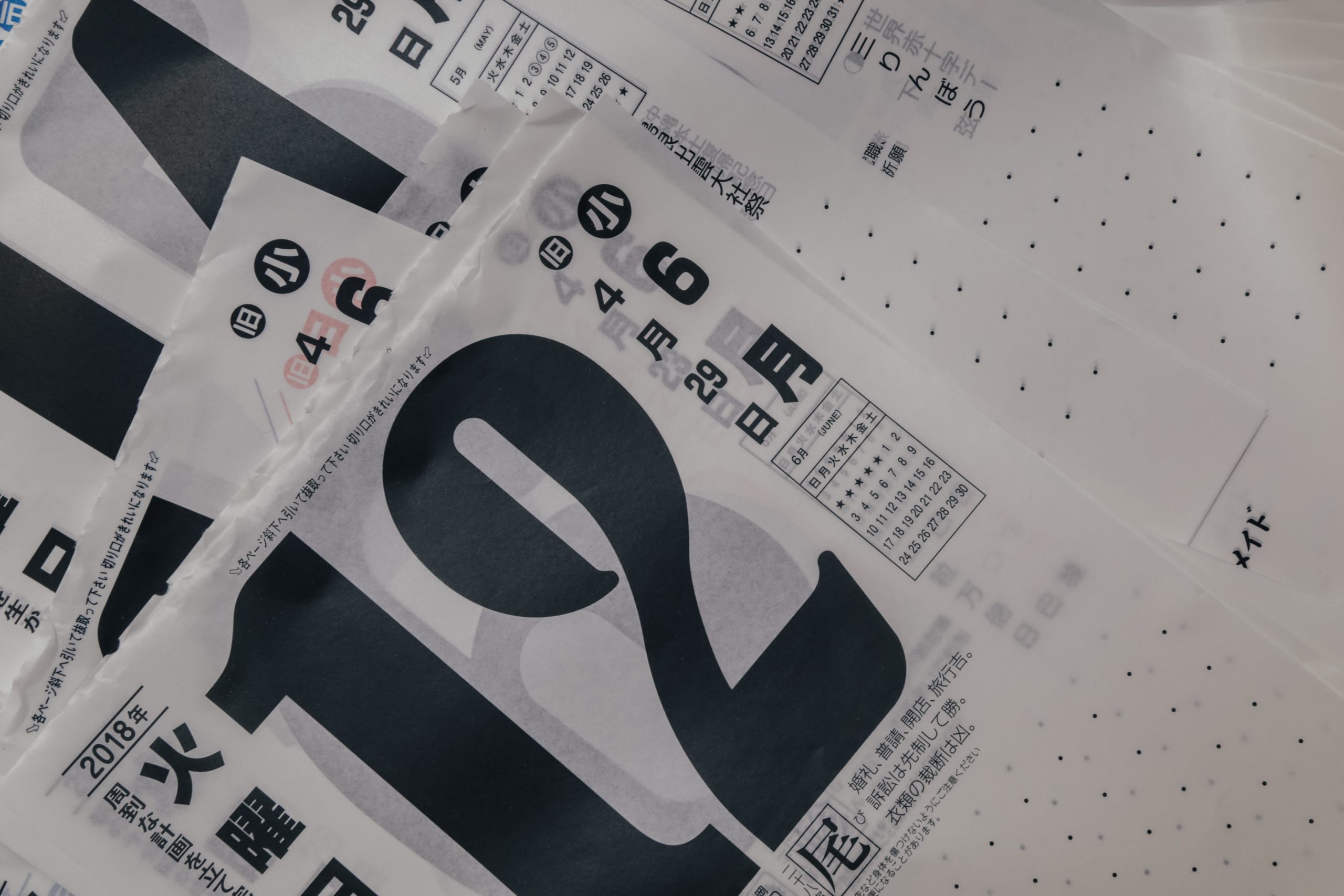

 die Sprache und Dichte der Inhalte, mit denen Evaristo erstere füllt, schon. Erfahrungen von Rassismus und Diskriminierung prägen den Alltag und das Verhalten ihrer Hauptfiguren. Die innerhalb dieses Rahmens behandelten Themen sind zu zahlreich, um sie alle aufzuführen. Neben sexueller und psychologischer Gewalt gehören die Suche nach der eigenen, eigentlichen Geschlechtsidentität, postnatale Depression, das Ringen um sozialen Aufstieg, das Dasein als Einwander:in sowie multiple, gesellschaftlich vermittelte Einhegungen weiblicher Identität dazu.
die Sprache und Dichte der Inhalte, mit denen Evaristo erstere füllt, schon. Erfahrungen von Rassismus und Diskriminierung prägen den Alltag und das Verhalten ihrer Hauptfiguren. Die innerhalb dieses Rahmens behandelten Themen sind zu zahlreich, um sie alle aufzuführen. Neben sexueller und psychologischer Gewalt gehören die Suche nach der eigenen, eigentlichen Geschlechtsidentität, postnatale Depression, das Ringen um sozialen Aufstieg, das Dasein als Einwander:in sowie multiple, gesellschaftlich vermittelte Einhegungen weiblicher Identität dazu. den Kindern reicher Eltern Englisch beibringt. Sie lernt den englischen Banker Julian kennen und beginnt eine Affäre, die geprägt ist von gegenseitiger Abhängigkeit, Anziehung, Verachtung, aber auch von gegenseitigem Verständnis zweier Expats. Spannend wird der Roman jedoch erst als Edith, eine junge Hongkongerin, auftaucht und Ava auch mit ihr eine Affäre beginnt.
den Kindern reicher Eltern Englisch beibringt. Sie lernt den englischen Banker Julian kennen und beginnt eine Affäre, die geprägt ist von gegenseitiger Abhängigkeit, Anziehung, Verachtung, aber auch von gegenseitigem Verständnis zweier Expats. Spannend wird der Roman jedoch erst als Edith, eine junge Hongkongerin, auftaucht und Ava auch mit ihr eine Affäre beginnt. und Olivia Sudjics – ist die Darstellung junger Menschen, vor allem Frauen, in ihren sozialen Gefügen, ihrem Beruf und ihrem Liebesleben insbesondere durch Dialoge. In allen diesen Roman wird permanent kommuniziert, sei es im direkten Gespräch oder im Messengerchat oder per Mail. Nicht nur dadurch sind diese Romane in ihrer Darstellung des Lebens von Millenials im mehr oder weniger akademischen Umfeld sehr nahe an der Realität. Gleichzeitig ist eines der großen Themen dieser Geschichten die Aushandlung von Macht und Sexualität. Geschrieben während einer Zeit, in der das Bewusstsein für dieses Thema in der Vordergrund getreten ist, sind die Texte damit auch die literarische Ausformung einer alltäglichen Auseinandersetzung mit Sex, Macht und Beziehung unter dem Einfluss gesellschaftlicher Debatten, ohne diese direkt zu benennen.
und Olivia Sudjics – ist die Darstellung junger Menschen, vor allem Frauen, in ihren sozialen Gefügen, ihrem Beruf und ihrem Liebesleben insbesondere durch Dialoge. In allen diesen Roman wird permanent kommuniziert, sei es im direkten Gespräch oder im Messengerchat oder per Mail. Nicht nur dadurch sind diese Romane in ihrer Darstellung des Lebens von Millenials im mehr oder weniger akademischen Umfeld sehr nahe an der Realität. Gleichzeitig ist eines der großen Themen dieser Geschichten die Aushandlung von Macht und Sexualität. Geschrieben während einer Zeit, in der das Bewusstsein für dieses Thema in der Vordergrund getreten ist, sind die Texte damit auch die literarische Ausformung einer alltäglichen Auseinandersetzung mit Sex, Macht und Beziehung unter dem Einfluss gesellschaftlicher Debatten, ohne diese direkt zu benennen.![Der unsichtbare Apfel: Roman von [Robert Gwisdek]](https://iza-server.uibk.ac.at/pywb/dilimag/20210113092156im_/https://i0.wp.com/m.media-amazon.com/images/I/31YOKs1TrcL.jpg?resize=208%2C322&ssl=1) Der Roman beschreibt nur ausschnitthaft das reale Leben. Diese Ausschnitte zeigen Schicksalsschläge, aber auch Igors Veranlagung, nicht mit der Welt klar zu kommen. Er stellt fragen an das Universum, doch dieses antwortet ihm leider nicht. Er merkt, dass alle „Erwachsenen“ nicht ruhig ihr Leben leben, weil ihnen die Antworten mit dem Alter in den Schoß gefallen sind, sondern weil sie sich mit den stummen Fragen abgefunden haben und nicht mehr neugierig sind. Als Igor das erkennt, rastet er aus und begibt sich auf eine Reise in sein Innerstes, um mit sich und dem Universum Frieden zu schließen.
Der Roman beschreibt nur ausschnitthaft das reale Leben. Diese Ausschnitte zeigen Schicksalsschläge, aber auch Igors Veranlagung, nicht mit der Welt klar zu kommen. Er stellt fragen an das Universum, doch dieses antwortet ihm leider nicht. Er merkt, dass alle „Erwachsenen“ nicht ruhig ihr Leben leben, weil ihnen die Antworten mit dem Alter in den Schoß gefallen sind, sondern weil sie sich mit den stummen Fragen abgefunden haben und nicht mehr neugierig sind. Als Igor das erkennt, rastet er aus und begibt sich auf eine Reise in sein Innerstes, um mit sich und dem Universum Frieden zu schließen. als Sklaven transportiert wurden. Die Autorin Nikole Hannah-Jones erzählt in sechs Folgen auch mit Blick auf die eigene Familie von der Geschichte der Sklaverei in den Vereinigten Staaten und verfolgt ihre Nachwirkungen bis in die Gegenwartsgesellschaft der USA. Deutlich wird dabei vor allem, wie stark die amerikanische Kultur und das gesellschaftliche Zusammenleben in den USA bis heute von den Erfahrungen und Folgen der Sklaverei geprägt sind. Besonders hervorzuheben ist meines Erachtens die Episode über die Musik der schwarzen Bevölkerung und ihre Wirkung auf die gesamte musikalische Kultur.
als Sklaven transportiert wurden. Die Autorin Nikole Hannah-Jones erzählt in sechs Folgen auch mit Blick auf die eigene Familie von der Geschichte der Sklaverei in den Vereinigten Staaten und verfolgt ihre Nachwirkungen bis in die Gegenwartsgesellschaft der USA. Deutlich wird dabei vor allem, wie stark die amerikanische Kultur und das gesellschaftliche Zusammenleben in den USA bis heute von den Erfahrungen und Folgen der Sklaverei geprägt sind. Besonders hervorzuheben ist meines Erachtens die Episode über die Musik der schwarzen Bevölkerung und ihre Wirkung auf die gesamte musikalische Kultur.  Vielleicht wegen des Konzepts des Buches: Es stellt dar, wie sich ein Ereignis (der Sprung einer jungen Frau von einem Hausdach) auf zehn mehr oder weniger miteinander in Verbindung stehende Figuren auswirkt. Dieser Aufbau erinnerte mich an
Vielleicht wegen des Konzepts des Buches: Es stellt dar, wie sich ein Ereignis (der Sprung einer jungen Frau von einem Hausdach) auf zehn mehr oder weniger miteinander in Verbindung stehende Figuren auswirkt. Dieser Aufbau erinnerte mich an  gehört habe, kann ich gar nicht mehr genau rekonstruieren, auf jeden Fall stand es schon eine ganze Weile ungelesen bei mir im Regal. Inspiriert von den zahlreichen Tweets und Artikeln schreibender Mütter, die seit Wochen an der enormen Mehrfachbelastung aus Kinderbetreuung, Homeschooling und Lohnarbeit verzweifeln, habe ich mir diesen leider inzwischen vergriffenen feministischen Klassiker nun endlich einmal näher angeschaut.
gehört habe, kann ich gar nicht mehr genau rekonstruieren, auf jeden Fall stand es schon eine ganze Weile ungelesen bei mir im Regal. Inspiriert von den zahlreichen Tweets und Artikeln schreibender Mütter, die seit Wochen an der enormen Mehrfachbelastung aus Kinderbetreuung, Homeschooling und Lohnarbeit verzweifeln, habe ich mir diesen leider inzwischen vergriffenen feministischen Klassiker nun endlich einmal näher angeschaut. sich mir zwei Optionen: Entweder durch die verzweifelten Menschen um mich herum, deren Flüge gestrichen wurde, verrückt werden – oder mich abschotten und Hemingways
sich mir zwei Optionen: Entweder durch die verzweifelten Menschen um mich herum, deren Flüge gestrichen wurde, verrückt werden – oder mich abschotten und Hemingways 