von Felix Lindner
Und wieder eine falsche Kuh. Also setzen sich die beiden Frauen, Gertrude Stein und Alice Toklas, noch einmal in den Ford und fahren weiter, bis zur nächsten Kuh. Steins Aufgabe ist es, zu schreiben, und sie schreibt am liebsten draußen, auf einem Campingstuhl, und zwischendurch, da braucht sie diese Aussicht. Und auch Alice Toklas hat eine Aufgabe: die Kuh zu finden, die zur Stimmung ihrer Freundin passt und sie in ihr Blickfeld bringen. Es ist oft die falsche. Ist eine gute Kuh gefunden, schreibt Stein manchmal, aber meistens, heißt es, meistens schaut sie einfach nur auf Kühe.
Das ist nur eine der 161 Miniaturen, die der Journalist Mason Currey schon vor ein paar Jahren in einem Büchlein zusammengestellt hat: Daily Rituals. How Artists Work heißt es und versammelt die Kreativroutinen der „Geistesgrößen der letzten 400 Jahre“. Darunter sind bekanntere und mittlerweile kanonisierte Anekdoten wie Kafkas Nachtarbeit mit Turnübung und Thomas Manns gestrenge Stundentaktung, weniger bekannte wie Stephen Kings tägliches 2000-Wort-Pensum und Prousts Schreibhaltung im Liegen – sowie den meisten wohl recht unbekannte wie die des Behavioristen B. F. Skinner, der seine Arbeitssessions mit einer Stoppuhr maß und dann auf einer Produktivitätskurve aus Wort- und Stundenzahl evaluierte. Die Angewohnheiten reichen von sympathisch – der Komponist und Möbelfetischist Morton Feldman meinte, wenn er endlich einen bequemen Stuhl fände, könne er es auch mit Mozart aufnehmen – über erwartungsgemäß sonderbar – John Cheever, der jeden Morgen im Anzug mit dem Fahrstuhl in den Lagerraum seines Hochhauses fuhr, um dort bis Mittag nur in Unterhosen zu schreiben – bis hin zur Tyrannei, wie bei Gustav Mahler, der seine Frau Alma eher aus Dekorationszwecken zu seinen stundenlangen Kreativspaziergängen mitnahm. Während er komponierte, hatte sie still zu sein und durfte ihn nicht ansehen.
Unter dem schrägen Titel Musenküsse erschien die Sammlung 2014 auch auf Deutsch, und das Feuilleton hatte viel Spaß damit. „Witzige“ und „amüsante“ Anekdoten und „Marotten“ „aus der wundersamen Welt“ der Künstler:innen hätte man da vor sich, die zeigten, „dass manche Klischees über Genies tatsächlich der Wahrheit entsprechen“, ja „[a]uch geniale Persönlichkeiten haben ihre Alltagsrituale“. Überhaupt sei das Buch, wie die Welt schrieb, „mehr als nur eine lustige Anekdotensammlung: Es ist die Aufforderung, den eigenen Lebensrhythmus zu analysieren.“ Der „Künstleralltag“, heißt es weiter, „inspiriert den Leser, seine eigenen Gewohnheiten zu ergründen und zu überdenken.“ Hier atmen wir kurz aus.
Dass das Buch als Ratgeber und nicht allein aus Arbeitsvoyeurismus rezipiert werden würde, scheint von Verlagsseite zumindest angenommen worden zu sein. Mason Currey jedenfalls fand sich bald in der Rolle des Kreativcoachs wieder, obwohl er doch nach eigener Aussage nur zeigen wollte, welche Verhaltensweisen zu „großartigen Werken“ geführt hätten. Das ist alles harmlos, solange Künstler:innen nicht zu erfolgreichen Unternehmer:innen gemacht werden und ihre Arbeitsweise zum Versprechen einer Produktivitätssteigerung. Dann nämlich werden gegenwärtige Imperative von Effizienz und Selbstunternehmertum von vermeintlich unschuldigen, weil künstlerisch wertvollen Vorlagen gestützt. Wer noch besser arbeitet, seinen Alltag noch nutzbringender kuratiert, scheint uns das Buch zu sagen, der wird auch erfolgreich sein. So wird nicht nur Disziplin zur Seinsaufgabe, sondern auch Prekarität als Lifestyle neutralisiert.
Diese Mischung aus scheinbar vorbildlichem Zeitmanagement und Schrullenhaftigkeit scheint hierzulande immerhin einen Nerv getroffen zu haben. Schon im nächsten Jahr erschien ein Folgebuch: Mehr Musenküsse, das unter Beteiligung des Journalisten Arno Frank speziell auf den deutschsprachigen Markt zugeschnitten wurde. Wir wissen nun, dass Sloterdijk zur Entspannung lange Fahrradtouren unternimmt, Handke bei Blockaden gerne Brombeeren sammelt und Scholl-Latour nie Mittag aß. Obendrein heißen sie alle drei auch Peter. Carl Gustav Jung schrieb zwei Stunden am Vormittag, Juli Zeh schreibt zwei am Tag, Franz Josef Wagner fängt um halb vier an und schickt seine Kakophonie einer Kolumne spätestens um sechs weg. Die Routinen sind sich auch im Folgeband allesamt schrecklich ähnlich und liefern Erkenntnis höchstens in der Summe.
Sieht man genauer hin, scheint man es hier mit einer noch recht jungen Art von Selbsthilfeliteratur zu tun zu haben, die Kreativität zum Maßstab gelungenen Alltagsmanagements erklärt. Der Wunsch nach dauerhafter kreativer “Transformation des Alltags“, heißt es in Andreas Reckwitz’ Die Erfindung der Kreativität, sei seit den 1990er-Jahren zu beobachten: Es gelte, einen „erfolgreichen kreativen Habitus“ anzulegen, sein „natürliche[s] Potenzial durch Arbeit an sich selbst zu realisieren“[1], und Künstler:innen stehen dabei Modell. Der Kurier fühlte sich durch die Musenküsse veranlasst, über den „perfekten Tagesablauf“ zu sinnieren und befand: „Nun, da mit dem 12-Stunden-Tag täglich bis zu vier Überstunden möglich sind, ist die Frage nach der optimalen Zeiteinteilung für maximale Produktivität aktueller denn je. […] Ob wir mit der Mehrarbeit jedoch dieselben Meisterleistungen wie Kafka schaffen, bleibt abzuwarten.“ Abgesehen davon, dass die Klientel dieses „Wir“ nur in einer gesellschaftlichen Schicht zu suchen ist, der Zeit überhaupt variabel zur Verfügung steht, erscheint es schlicht ignorant, den Lebensstil von schreibenden Junggesellen zu Beginn des 20. Jahrhunderts als sinnvolles Modell für heutige Arbeitnehmer:innen zu erklären. So nämlich werden ökonomische Strukturen zu individuellen Kompetenzfragen. Sagen Sie doch mal sorgearbeitenden Menschen, sie könnten ruhig ein wenig produktiver in ihrer Zeiteinteilung sein. Die machen das bereits. Kafka arbeitete übrigens halbtags.
Das führt zu einem weiteren Problem. Eher ungewollt zeigen diese Bände, wie viel Sorgearbeit von Frauen notwendig ist, die Wunschfigur des Kreativgenies überhaupt erst zu ermöglichen. Dass sich Sigmund Freud anscheinend sogar die Zahnpasta von seiner Frau Martha auftragen ließ, dass Mark Twain mit einem Horn von seiner Familie gerufen werden musste, steht in eklatantem Gegensatz zu Frauen wie Frances Trollope oder Sylvia Plath, deren Schreibarbeit oftmals um vier Uhr früh begann, um im Verlauf des Tages putzen, waschen und kochen zu können. Was bei den Männern inspirieren soll, das Künstlertum als role model, wirkt bei den Frauen in Anekdotenform allzu oft wie Hohn.
Wohl auch deshalb reagierte man im letzten Jahr mit einem dritten Band der Musenküsse, diesmal nur mit Künstlerinnen. „[G]leichermaßen Fortsetzung wie Korrektiv“ sollte er sein, und bis auf den Einband, bei dem man auf Birgit Nilssons Ausspruch „Mein kreatives Geheimnis sind bequeme Schuhe“ offenbar nicht verzichten konnte, scheint das auf den ersten Blick gelungen. Er sei nun „freier vorgegangen“, schreibt Currey, und habe auch Künstlerinnen porträtiert, „die keinem geregelten Tagesablauf folgten – entweder, weil sie sich diesen Luxus nicht leisten konnten, oder weil sie keinen Wert darauf legten“.
Dass das Ganze trotzdem überhaupt nicht aufgeht, liegt an der Prämisse dieser Sammlungen. Sie sollen zur Nachahmung anregen, kreative Archetypen liefern, vielleicht sogar Vertrauen in die eigene Arbeit schaffen. Mit dem Fokus auf die Widerstände weiblichen Künstlertums zeigen die Porträts aber eigentlich nur das, was sie verbergen wollten: schreibende Mütter statt Schriftstellerinnen, malende Hausfrauen statt Malerinnen, ein großes „Trotzdem“, das emanzipativ sein will, aber nur den Status quo der Repressalien abbildet, die nicht nachgeahmt, sondern überwunden werden müssen. Es ist dieses „Trotzdem“, trotzdem schreiben, trotzdem malen, trotzdem singen, das nicht richtig passen mag und an die „Starke Frauen“-Kalender erinnert. Das ist doppelt schade, weil es in der Sache wichtig, nur in der Form daneben ist.
Es ist die Form der Anekdotensammlung, der Miniaturen, die diese Bücher in ihrer Rezeption so problematisch macht. Das liegt zum einen daran, dass die Logik der Anekdote einen desaströsen Quellenumgang geradezu herausfordert. Currey unterscheidet wenig sorgsam zwischen Selbst- und Fremdaussagen. Gerüchte stehen neben Mutmaßungen und Briefstellen neben Biographien. Das lässt Künstler:innen gerade nicht zu Kreativexempeln werden, sondern zu mythischen Kreaturen, die im Stundentakt aus Kaffeepulver Gedichte pressen. Sammlungen als solche suggerieren obendrein, dass es hier so etwas wie Traditionslinien und Konstanten in den Unterschieden gibt, was bei dieser Bandbreite an Künstler:innen schon sozialgeschichtlich nicht der Fall sein kann.
Wer darstellen möchte, mit welchen Routinen, Störungen, Redundanzen und Kontingenzen Künstler:innen bei ihrer Arbeit konfrontiert werden, der muss den Blick auf die Bedingungen dieser Arbeit, nicht auf die Sache selbst lenken. Anekdoten aber machen diese Geschichte intransparent. Sie verwechseln Historie mit deren Wiedergabe, machen Zufälliges aus Notwendigem und aus einem ganzen Leben einen Satz. Sie machen unsichtbar, wie die Ränder künstlerischer Arbeit in deren Zentrum rücken, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, dass Männer abends turnen und Frauen morgens kochen. Kritik wird so unmöglich.
Wie man klug und sinnvoll darauf eingehen kann, zeigt die im November dieses Jahres erschienene und von Ilka Piepgras herausgegebene Sammlung Schreibtisch mit Aussicht. Schriftstellerinnen über ihr Schreiben. Auch hier soll der „Entstehungsprozess literarischer Arbeit“ gezeigt werden, aber mit dem Unterschied, dass die Künstlerinnen hier ausschließlich selbst zu Wort kommen. Es scheint fast so, als ob die vielen Mythen um geniale Männer gar nicht nötig wären, als ob der Klatsch nur zementieren würde, was man sich ohnehin schon gedacht hatte. Was die Texte von Terézia Mora, Zadie Smith, Antonia Baum oder Elfriede Jelinek den Anekdotenplaudereien von Curreys Sammlungen voraushaben, ist, dass sie etwas zeigen können, was der „Veröffentlichung eines Kunstwerks lange voraus[geht]“: die Vorurteile, die öffentliche Wahrnehmung, die sozialen Investitionen und institutionellen Widerstände, denen schreibende Frauen noch immer ausgesetzt sind. Diese Selbstaussagen erzählen von der Schwierigkeit und auch vom Glück, zu schreiben. Solch Geschichte hätte Currey auch an Männern zeigen können. Nur Anekdoten reichen dafür nicht.
Neben historischer Arbeit braucht das Kreativitätsparadigma dieser Bücher deshalb vor allem eins: Sensibilität. Das Bewusstsein dafür, dass man es in diesen Miniaturen weder aufseiten der Künstler:innen noch aufseiten der Leser:innen mit Luxusproblemen oder Privatsachen zu tun hat, sondern mit Geschlechter- und mit Wirtschaftspolitik, mit Sozial- und Institutionengeschichte. Wo das am wenigsten auffällt, ist es, wie so oft, am wirkungsvollsten – und man sieht am Ende nur die Kuh, aber nicht, wer sie dort hingeschoben hat.
[1] Andreas Reckwitz: Die Erfindung der Kreativität. Zum Prozess gesellschaftlicher Ästhetisierung. Berlin 2012, S. 230, S. 323 sowie S. 346.
Photo by Content Pixie on Unsplash














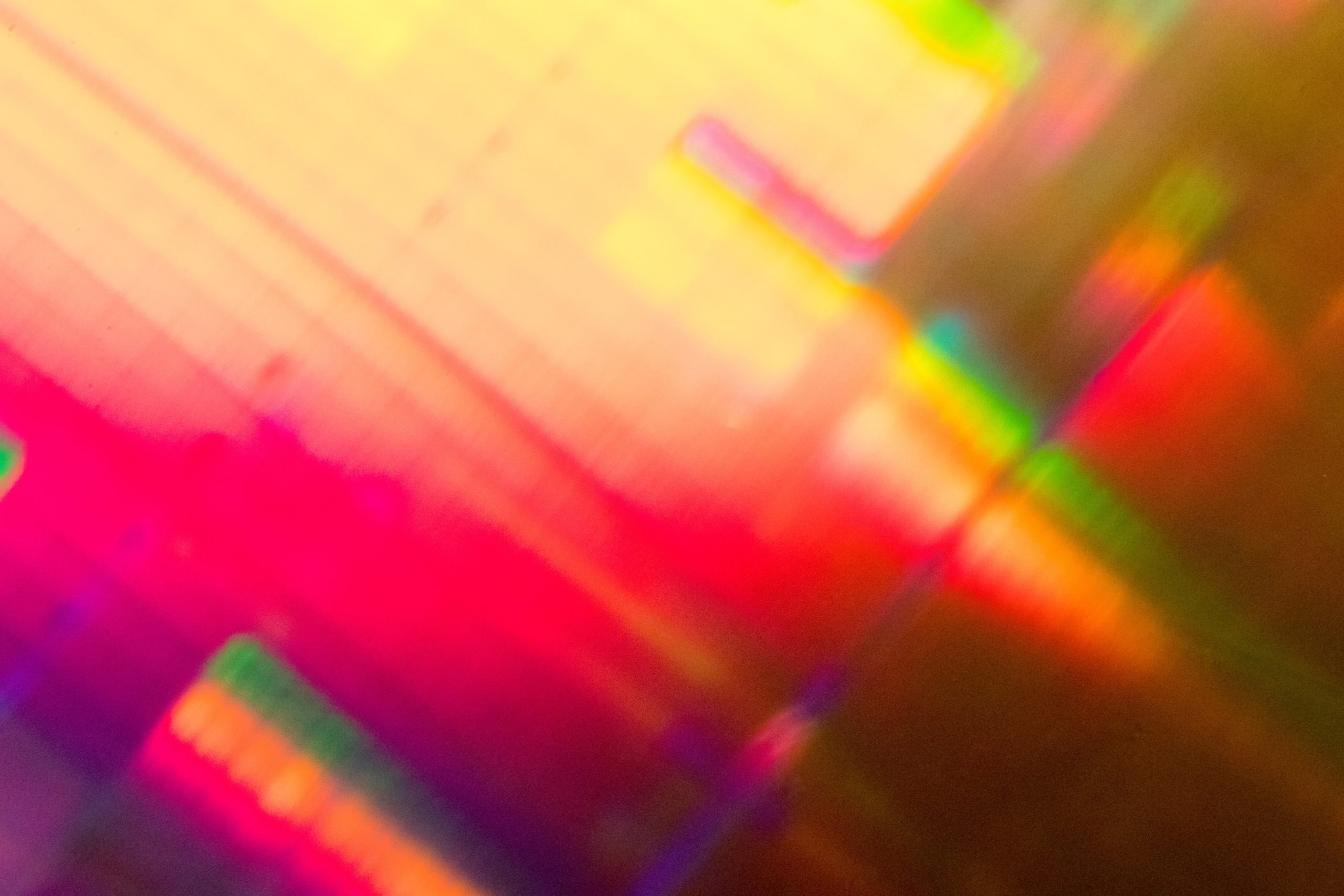
 Popliteratur widmet und insbesondere das Magazin Tempo, seine Leser*innenschaft und seinen Anspruch, eine Generation abzubilden, näher betrachtet. Das entscheidende Attribut lautet dabei postheroisch. Während der Popkultur der 60er/70er Jahre ein heroischer Selbstanspruch im Sinne eines Widerstands attestiert werden kann, zeichneten sich Tempo und die Popliteratur der 90er Jahre durch eine postheroische Haltung aus, die durch einen zunehmenden Bedeutungsverlust von Subkulturen und eine Verbindung von Popkultur und Konsum entstanden war. Dabei kam es zu einer „Lösung des Popdiskurses vom linksalternativen Deutungsmonopol“ und zu einer Ablehnung des linken ebenso wie des konservativen Kulturverständnisses. Daraus entstand ein Generationsgefühl, das nicht mehr durch das gemeinsame Erleben politischer Ereignisse erzeugt wurde, sondern durch kollektive Konsum- und Freizeiterfahrungen. Anhand der Kategorien Generation, Gender, Nation und Konsum zeigt Steenbock auf, wie Tempo durch Stil, Themensetzung und Darstellungsweise vor allem in Bezug zu den vier Bereichen einen Zeitgeist affirmierte und gleichzeitig erzeugte.
Popliteratur widmet und insbesondere das Magazin Tempo, seine Leser*innenschaft und seinen Anspruch, eine Generation abzubilden, näher betrachtet. Das entscheidende Attribut lautet dabei postheroisch. Während der Popkultur der 60er/70er Jahre ein heroischer Selbstanspruch im Sinne eines Widerstands attestiert werden kann, zeichneten sich Tempo und die Popliteratur der 90er Jahre durch eine postheroische Haltung aus, die durch einen zunehmenden Bedeutungsverlust von Subkulturen und eine Verbindung von Popkultur und Konsum entstanden war. Dabei kam es zu einer „Lösung des Popdiskurses vom linksalternativen Deutungsmonopol“ und zu einer Ablehnung des linken ebenso wie des konservativen Kulturverständnisses. Daraus entstand ein Generationsgefühl, das nicht mehr durch das gemeinsame Erleben politischer Ereignisse erzeugt wurde, sondern durch kollektive Konsum- und Freizeiterfahrungen. Anhand der Kategorien Generation, Gender, Nation und Konsum zeigt Steenbock auf, wie Tempo durch Stil, Themensetzung und Darstellungsweise vor allem in Bezug zu den vier Bereichen einen Zeitgeist affirmierte und gleichzeitig erzeugte.