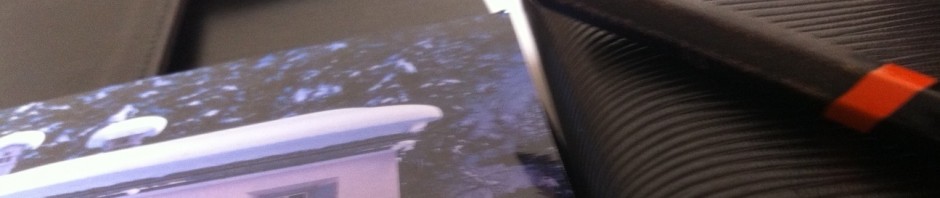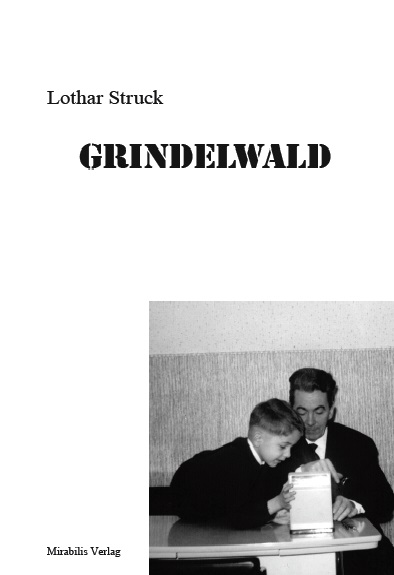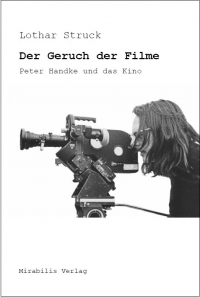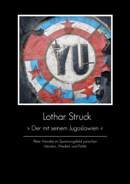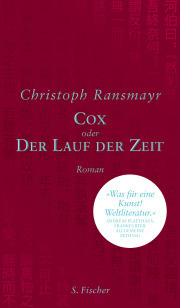Gerade hatte man sich mit den Hoffenheim-Buben arrangiert, da stürmen die Brause-Bullen von Leipzig durch die Fußballligen und erdreisten sich einen bisherigen zweiten Platz in der Bundesliga. Der Fußball droht, so die gängige Meinung unter denen, die sich »Fans« nennen, seine Unschuld zu verlieren. In Dortmund konnte man neulich sehen, wie das Fußballvolk dazu steht: RB Leipzig wird in einer Mischung aus Comedy und Trumpismus für alle Ungemach des Fußballs verantwortlich gemacht. Das ist wirklich lustig, wenn es nicht so ernst gemeint wäre. Ausgerechnet von denen, die offensichtlich vergessen haben, das Borussia Dortmund zuletzt 100 Millionen Euro Transfer Ein- und Ausgaben tätigte und dass es ihr heiliger BVB war, der als erster (und bisher einziger) Verein in Deutschland die Profiabteilung(en) in eine Aktiengesellschaft umwandelte. ich weiß nicht, ob es Dummheit oder einfach nur Naivität ist, die den Span im Auge des anderen sieht, aber den eigenen Balken wahrzunehmen nicht bereit ist.
Der Fußball war und ist auch ohne Hoffenheim und Leipzig längst durchkommerzialisiert bis hin zur Perversion. Die Fußballverbände tun ihr übriges dazu. Damit ist nicht nur der Größenwahnsinn korrupter Organisationen wie UEFA und FIFA gemeint. Der DFB ist selber zur Profitmaschine geworden und ein Ende ist nicht abzusehen. Gerade wird an der Veränderung des DFB-Pokals geschraubt, damit man noch mehr Einnahmen generieren kann und vermeintlich unattraktive Spiele für die »Großen« minimiert werden.
Ich komme aus Mönchengladbach und habe die Hochzeit dieses Fußballvereins erlebt. Mönchengladbach war tiefste Provinz; kein Mensch kannte diesen Ort und es gab auch wenig Veranlassung dazu. Bis es die Borussia schaffte. Das Identifikationspotential war groß; viele Spieler kamen tatsächlich damals aus der Region. Bei der Meisterfeier fuhr der Bus an unserem Haus vorüber. Es waren die Bosse der Borussia und von Bayern München, die dann andere Wege gingen. Mönchengladbach war gezwungen, Spieler zu verkaufen. Aber man kaufte auch ein. Plötzlich kam zum Beispiel ein dänischer Spieler nach Mönchengladbach, den wir bestaunt haben wie ein Wunderwerk. Nach ein paar Toren liebten wir ihn. Weiterlesen