|
Bücher & Themen
Jazz aus der Tube
Bücher, CDs, DVDs & Links
Schiffsmeldungen & Links
Bücher-Charts
l
Verlage A-Z
Medien- & Literatur
l
Museen im Internet
Weitere
Sachgebiete
Tonträger,
SF &
Fantasy,
Autoren
Verlage
Glanz & Elend empfiehlt:
20 Bücher mit Qualitätsgarantie
Klassiker-Archiv
Übersicht
Shakespeare Heute,
Shakespeare Stücke,
Goethes Werther,
Goethes Faust I,
Eckermann,
Schiller,
Schopenhauer,
Kant,
von Knigge,
Büchner,
Marx,
Nietzsche,
Kafka,
Schnitzler,
Kraus,
Mühsam,
Simmel,
Tucholsky,
Samuel Beckett
 Berserker und Verschwender Berserker und Verschwender
Honoré
de Balzac
Balzacs
Vorrede zur Menschlichen Komödie
Die
Neuausgabe seiner
»schönsten
Romane und Erzählungen«,
über eine ungewöhnliche Erregung seines
Verlegers Daniel Keel und die grandiose Balzac-Biographie
von Johannes Willms.
Leben und Werk
Essays und Zeugnisse mit einem Repertorium der wichtigsten
Romanfiguren.
Hugo von
Hofmannsthal über Balzac
»... die größte, substantiellste schöpferische Phantasie, die seit
Shakespeare da war.«
Anzeige
 Edition
Glanz & Elend Edition
Glanz & Elend
Martin Brandes
Herr Wu lacht
Chinesische Geschichten
und der Unsinn des Reisens
Leseprobe
Andere
Seiten
Quality Report
Magazin für
Produktkultur
Elfriede Jelinek
Elfriede Jelinek
Joe Bauers
Flaneursalon
Gregor Keuschnig
Begleitschreiben
Armin Abmeiers
Tolle Hefte
Curt Linzers
Zeitgenössische Malerei
Goedart Palms
Virtuelle Texbaustelle
Reiner Stachs
Franz Kafka
counterpunch
»We've
got all the right enemies.«

|
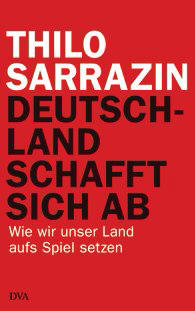 Der
Messias der Mittelschicht Der
Messias der Mittelschicht
Gedanken
zu Thilo Sarrazins Buch "Deutschland schafft sich ab" und die Diskussion
hierüber in 8 Segmenten
Von Gregor Keuschnig
I. Prolog
Auf dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise, als der Steuerzahler (und nur der!) von
der politischen Klasse, die den Staat repräsentiert, zum Bürgen für dessen
selbstgemachte und selbstgeduldete Fehler herangezogen wurde, entwarf der
Philosoph
Peter Sloterdijk in einem sehr kontrovers diskutierten Artikel eine
Gegenwelt: "Die einzige Macht, die der Plünderung der Zukunft Widerstand leisten
könnte, hätte eine sozialpsychologische Neuerfindung der 'Gesellschaft' zur
Voraussetzung. Sie wäre nicht weniger als eine Revolution der gebenden Hand."
Eine Gesellschaft, in der fast ausschließlich der fluchtunfähige
Einkommensteuerzahler den Staat und damit dessen Ausgaben erwirtschaftet,
während die Kaste der Extremverdiener sich mit Hilfe der Politik längst aus der
solidarischen Verantwortung entfernt hat und die Unterschicht zu
Transferempfängern entmündigt werden, beschreibt Sloterdijk mit drastischen
Worten: "So ist aus der selbstischen und direkten Ausbeutung feudaler Zeiten in
der Moderne eine beinahe selbstlose, rechtlich gezügelte Staats-Kleptokratie
geworden. Ein moderner Finanzminister ist ein Robin Hood, der den Eid auf die
Verfassung geleistet hat. Das Nehmen mit gutem Gewissen, das die öffentliche
Hand bezeichnet, rechtfertigt sich, idealtypisch wie pragmatisch, durch seine
unverkennbare Nützlichkeit für den sozialen Frieden - um von den übrigen
Leistungen des nehmend-gebenden Staats nicht zu reden."
Der "soziale Frieden" - Sloterdijk entlarvt dieses vorwiegend an
links-intellektuellen Stammtischen kursierende Letztbegründungsargument. In
Wahrheit ist eine menschenverachtendere Sicht als diese kaum denkbar. Leicht und
locker konzediert, ja fordert man eine Anhebung der Hartz-IV-Sätze, eines
erhöhten Kindergeld oder anderer sozialer Leistungen um damit am Ende
Kratzspuren oder Schlimmeres an den eigenen Luxuskarossen unterbleiben.
Tatsächlich ist der Zorn der jungen Männer in Deutschland anders als beim
Nachbar Frankreich weitgehend ausgeblieben. Den Preis dafür bezahlt man gerne,
falls man ihn denn überhaupt noch bezahlt und dies nicht weitgehend einer
Mittelschicht überlässt, die von Steuerschlupflöchern und
Investitionserleichterungen für Großunternehmen nur aus dem Wirtschaftsteil
ihrer Zeitung erfahren.
Wie soll eine "Revolution der gebenden Hand" überhaupt aussehen? Die gebenden
Hände sind ohne Spielräume in der platonischen Steuerhöhle gefesselt. Wie
romantisch von Sloterdijk, seinerzeit die FDP als Mitregierungspartei zum
Revolutionssprecher zu (v)erklären. In tapsiger Manier und unter Ignoranz aller
Kommunikationstheorien versuchte sich Amateur-Soziologe Westerwelle tatsächlich
im Frühjahr 2010 als Anwalt der Mittelschicht zu gerieren. Die hätte sich lieber
jemand anders gewünscht und entzog der mediokren Schnöseltruppe die Zustimmung.
Dabei ist tatsächlich seit der sogenannten Weltwirtschaftskrise ein wachsendes
Unbehagen an der politischen Kultur festzustellen welches sich - entgegen der
Weltuntergangsprophetien des beginnenden 20. Jahrhunderts - nicht so sehr an
grundsätzlichen gesellschaftlichen Fragen manifestiert, sondern fundamentale
Verteilungsfragen betrifft (freilich nicht im klassischen, sozialdemokratischen
Sinn).
II. Der blinde Fleck und die ehrliche Sorge
Die Vorrede ist notwendig, um das Phänomen der Rezeption von Thilo Sarrazins
Buch "Deutschland schafft sich ab" verstehen zu können. Sarrazin gelingt in dem
Buch das Unbehagen an und - Freud lässt grüßen - in der Kultur die
Mittelstandsängste nicht nur gekonnt zu artikulieren, sondern durch direkte,
klare und jeglicher Elaboriertheit fast akribisch entkleideter Sprache Ausdruck
zu verleihen. Wer beispielsweise die Kommentare unter den entsprechenden
F.A.Z.-Artikeln (und deren Kommentarbewertungen) gelesen hat, muss erkennen:
Hier spricht - bzw. schreibt - der Messias der Mittelschicht. Einer
Mittelschicht, die Sloterdijk nicht verstanden hatte und Westerwelle - zu Recht
- als Anbiederung empfand.
Sarrazin erläutert an einer Stelle im Buch, wie befreit er sich fühlt, endlich
keine Reden mehr in verbrämendem, ausgewogen politisch-korrekten Politslang
schreiben zu müssen. Dennoch will er sich nicht mit dem "einfachen Mann" gemein
machen, attackiert auch die deutsche Unterschicht (wohl wissend, dass diese für
die Sozialdemokraten eh verloren ist) und erklärt sein Buch zum
wissenschaftlichen Werk (rein äußerlich durch Endnoten, Tabellen und
Berechnungen) - inklusive garantiertem Sündenbock.
Tatsächlich finden sich in dem Buch informative Ausführungen zu demographischen
Entwicklungen, dem deutschen Schul- und Bildungssystem, der Problematik, dass
die sogenannten "MINT"-Studiengänge, die den ökonomischen Fortschritt der
deutschen Exportindustrie garantieren, extrem rückläufig sind und einigen
unleugbaren Äußerungen über die falschen Anreize unseres Sozialsystems. Auch die
Einwürfe zur Gerechtigkeitsdiskussion, die zu einem Gleichheits-Mantra führt,
das keinerlei Differenz und Unterschiede mehr zulässt, sind durchaus
interessant. Den "ZEIT"-Chefredakteur zitierend weist Sarrazin darauf hin, dass
der umfangreiche Sozialetat Deutschlands bezahlt werden muss und von wem dies
geschieht. Da bekommt die Mittelschicht einen Schulterklopfer.
Aber dann fällt auch schon der erste blinde Fleck auf. Die Asozialität (Peer
Steinbrück) einer Oberschicht, die sich immer mehr aus der
gesamtgesellschaftlichen Verantwortung beispielsweise durch (zumeist auch noch
legale) Steuertricks entzieht, handelt Sarrazin in nur wenigen Sätzen ab. Kein
Wort gegen Bankmanager, die ihre Institute an den Rand des Abgrunds gefahren
haben und nun vom Steuerzahler aufgefangen werden sollen. Für jemand, der
Deutschland "abgeschafft" sieht, ein erstaunliches Vorgehen. Aber seine Anhänger
verzeihen ihm die Einseitigkeit seiner Wahrnehmungen. Sie hegen ja noch
unterschwellig die Hoffnung, in die Oberschicht aufsteigen zu können, was
natürlich zumeist eine Illusion bleibt. In Wirklichkeit spiegelt sich in der
Vehemenz ihrer Zustimmung ihre amorphe Abstiegsangst. Hier hat Ulrike Herrmann
in ihrem Pamphlet "Hurra, wir dürfen zahlen – Der Selbstbetrug der
Mittelschicht" recht. (Freilich ist ihre Schlussfolgerung, die Mittelschicht
sollte sich mit den Hartz-IV-Empfängern gegen die politische und ökonomische
Elite in Deutschland verbünden, vollkommen unrealistisch).
Tatsächlich räumt Sarrazin mit altlinkem Sozialromantizismus radikal auf. Seine
Thesen über Transferleistungen, die durch ihre nahezu bedingungslose Gewährung
zur Entmündigung und Demotivation des Leistungsempfängers führen, sollten
ernsthaft diskutiert werden. Seine skurril anmutenden Aussagen bezüglich der für
eine vollwertige Ernährung ausreichenden ALG-II-Sätze oder die Anregung, man
solle für Transferempfänger lieber Koch- und Hauswirtschaftskurse statt
Suppenküchen anbieten, sind allerdings schon pure Provokation in einer
Gesellschaft, die in Internetforen darüber diskutiert, ob ein Hartz-IV-Empfänger
auch ein Anrecht auf Blumenerde habe. Geradezu emphatisch plädiert Sarrazin für
ein Aussteigen aus dem in transferabhängiger Passivität halbwegs komfortabel
dahindämmernden Geldempfänger, den er mit dieser Tort auf Dauer
gedemütigt sieht. Dieses hier schlummernde Potential will er wecken, um über
soziale, künstlerische oder wissenschaftliche Tätigkeit oder die Ausübung von
Ehrenämtern Sinn und Struktur in das Leben zu bringen. Die Kritik hieran und
an dem Gedanken, dass dauerhaft gewährte Sozialtransfers gewisse Gegenleistungen
zur Folge haben könnten ist billige Profilierung, um potentielle Wähler nicht
noch mehr in die Arme einer Linkspartei zu treiben, die vor den
Herausforderungen einer globalisierten Gesellschaft mit einer Mischung aus
vormodernen Abschottungsreflexen und philanthropischem Staatsmäzenatentum
antwortet. Vieles spricht dafür, dass die Sorgen, die sich Sarrazin macht,
ehrlich gemeint sind - und nicht so falsch.
III. Rekurs bei Enzensberger
Die hilflosen Zwangsabgabenknechte, die eigentlich das Rückgrat des Steuer-
und Sozialstaates bilden, längst politisch desillusioniert und sich
unrepräsentiert fühlend, haben in Sarrazin einen Diagnostiker ihrer
Politdepression gefunden. Um auf die mangelnde Integrationsfähigkeit der
dauerhaft bildungsfernen deutschen Unterschicht nicht weiter eingehen zu müssen,
fokussiert sich dieser jedoch irgendwann auf die muslimischen Migranten. Ohne
ihn zu erwähnen rekurriert Sarrazin dabei auf Hans Magnus Enzensberger, der sich
2006 in
"Schreckens Männer" nicht nur der Psychologie des islamistischen
Terroristen, des "radikalen Verlierers", sondern der Muslime generell annahm.
Enzensberger psychologisierte "die Araber" als mehr oder weniger frustrierte
Völker, die "in den letzten vierhundert Jahren [...] keine nennenswerte
Erfindung hervorgebracht" hätten. Die politischen und gesellschaftlichen Eliten
in den arabischen Ländern, so Enzensberger damals, hätten selbst Schuld an ihrer
so empfundenen Bedeutungslosigkeit. Eine ähnliche Passage findet sich dann
tatsächlich bei Sarrazin, der von einer narzisstischen Kränkung bei den
islamischen Führungsschichten im Verhältnis zur abendländischen
Moderne spricht. An Einzelbeispielen versuchte Enzensberger eine soziale und
kulturelle Regression des Islam zu diagnostizieren – beispielsweise in dem er
auf die stark unterentwickelte Buchkultur hinwies (nur 0,8% der
Weltbuchproduktion werden in der arabischen Welt gedruckt) oder die mangelhaft
entwickelten Frauenrechte thematisiert (wobei er sehr wohl auf die
Studentinnenquote im Iran hinweist – gleichzeitig aber diese in Saudi-Arabien
unterschlägt). Verblüffenderweise haben Enzensberger seine holzschnittartigen
Vereinfachungen nicht besonders geschadet; man einigte sich wohl hinter den
Kulissen das Buch nach kurzer Diskussion einfach zu "vergessen".
Hier wie dort ist nicht nur ein Ressentiment gegen vereinzelte Protagonisten und
deren fundamentalistische Religionsinterpretation sichtbar, sondern es wird eine
ganze Religionsgruppe vereinheitlicht dargestellt. In anderen europäischen
Ländern sind die Kampfbewegungen gegen "den" Islam schon längst politischer
Alltag. In den Niederlanden lässt sich eine Minderheitsregierung von einer
solchen Partei dulden. Es gibt dezidiert antiislamische Parteien in
skandinavischen Ländern, die an Einfluss gewinnen. In der Schweiz, Österreich
und Frankreich springen rechtsnationale Parteien auf den Zug auf. Daher ist es
erstaunlich, dass die antiislamischen Affekte so lange in Deutschland geruht
hatten. Tatsächlich brodelte (und broderte) es zwar schon länger in der
Bevölkerung - aber gut funktionierende Tabu-Baumeister in den Medien rückten
jede auch nur ansatzweise kritische Äußerung sofort in die Region eines
rechtsradikalen Gedankenguts. So blieb das teilweise militante antiislamische
Bürgertum in der Schmuddelecke eines Internet-Weblogs.
Sarrazins Buch fokussiert sich von Beginn an auf die Gruppe der in Deutschland
lebenden muslimischen Migranten, auch wenn die eigentlichen Kapitel
hierzu erst auf Seite 255 beginnen. Muslimische Migranten sind für Sarrazin
Migranten aus den Herkunftsgebiete[n] Bosnien und Herzegowina, Türkei, Naher
und Mittlerer Osten sowie Afrika. Unterschiede macht er nicht. Die
überproportional guten Bildungsabschlüsse beispielsweise iranischer Migranten
wischt er mit einem Federstrich als eine Art Ausnahme weg. Tatsächlich wäre dies
mit der jüngeren Geschichte des Iran zu erklären: So emigrierten zuletzt Ende
der 70er Jahre aufgrund der iranischen "Revolution" vorwiegend Hochgebildete und
Intellektuelle, die in einem repressiven Gottesstaat nicht leben wollten. Dies
könnte Sarrazin auf die türkischen Migranten in Deutschland gewandt durchaus
verwenden, stammen diese jedoch zumeist aus eher ärmlichen Milieus aus
Anatolien. Ein Faktor, der übrigens in den 60er Jahren von Wirtschaft und
Politik in Deutschland gewollt war: Man wollte eine Zuwanderung nur für niedere
Arbeiten, um das technologische Know-How bei den Deutschen zu lassen. Weil es
nicht in den Kontext seines Thesengebäudes passt, verschweigt Sarrazin so etwas.
Dies würde dann nämlich bedeuten, dass es nicht primär um ein Religions-,
sondern um ein Schichtproblem handeln würde.
In Bezug auf die Türkei ignoriert der Autor noch einen zweiten Aspekt. Für ihn
handelt es sich um einen durchweg religiös beeinflussten, toleranzlosen Staat.
Als Beleg zieht er den aktuellen türkischen Ministerpräsidenten Erdoğan und
dessen sogenannte
Assimilations-Rede heran. Den Spagat, den Erdoğan zwischen seinem
religiös-fundierten Nationalismus im Inneren und der Öffnung der Türkei zur EU
hin erbringt, erwähnt er nicht. Desweiteren suggeriert Sarrazin, dass die Türkei
ein religiöser Staat per se sei wie alle anderen "islamischen Länder" auch. Zwar
wird einmal nebenbei erwähnt, dass die Türkei immerhin das einzig
islamische Land sei, das die politischen Maßstäbe einer westlichen Demokratie
halbwegs erfüllt, aber er verschweigt dem Leser, dass der durch Kemal
Atatürk in den 1930er Jahren eingeführte Laizismus eine Kontrolle der Religion
durch den Staat verfechtet. Damit ist - zumindest formal - die Türkei säkularer
als die Bundesrepublik, auch wenn dies durch die Politik von Erdoğan und seiner
AKP aufgeweicht zu werden droht, was übrigens durchaus Widerstand in der Türkei
hervorruft. Entwicklungen, die Sarrazin ausblendet. Auch die Tatsache, dass die
türkischen Einwanderer, die seit den 1960er Jahren nach Deutschland gekommen
sind, keine strenggläubigen Muslime waren, kommt bei ihm nicht vor. Er macht
sich gar nicht die Mühe, die zweifellos in den letzten Jahrzehnten zunehmende
Religiosität der zweiten und dritten Generation der türkischen Migranten in
Deutschland (aber nicht nur hier) zu untersuchen.
IV. Der verlorene Muslim
Um nicht ins offene Messer des xenophoben Verdachts zu laufen, wendet
Sarrazin zwei Techniken an: Er differenziert da, wo es zu differenzieren seiner
These Nahrung gibt. Und er differenziert da nicht, wo es dem Theoriegebäude
widersprechen würde. Er differenziert, wenn er die Integrationsfortschritte
asiatischer und osteuropäischer Migranten und die hohe Abiturquote bei
Vietnamesen und Koreanern hervorhebt. Diese Einwanderung schätzt er. Er
differenziert nicht mehr, wenn es um die unterschiedlichen Generationen
türkischer Einwanderer geht und wenn er den Begriff des Islam pauschal setzt und
negativ konnotiert (bis auf eine Ausnahme).
Für Sarrazin ist jeder Muslim a priori unrettbar verloren. Daher wendet er auch
nur sehr eingeschränkt soziologische Erkenntnisse an. Hier (und nur hier) weicht
Sarrazin vom sozialdemokratischen Idealbild des sozialen Aufstiegs durch Bildung
ab. Die Verlorenheit des Muslims dokumentiert sich für ihn in einer genetischen
Determination, die er im Buch sukzessive, aber schleichend entwickelt. Seine
Adepten folgen in ihrer Kulturdepression auch dieser These des Autors. Die
Versuchung ist zu groß. Schließlich wird seit vielen Jahren in den (populär)wissenschaftlichen
Diskursen für nahezu jedes Vorkommnis ein "zuständiges" Gen entdeckt, welches
die Verantwortung des Individuums auf behagliche Art minimiert. So gibt es zum
Beispiel ein
Alkohol-Gen, ein
"Schwulen-Gen", natürlich ein
Alters-Gen und ein
Schlaf-Gen. Nichts bleibt vor der genetischen Vereinnahmung durch
halbseidene Dispositionsschwadroneure verschont, die zudem hartnäckig
Korrelation mit Kausalität verwechseln. Das wird ihnen gestattet, solange sie
mit ihrem Vulgär-Biologismus auf dem Niveau der "Apotheken-Rundschau" bleiben.
Sogar der freie Wille gilt inzwischen als Schimäre wie Neurobiologen mit bunten
Bildchen von Probantengehirnen belegen möchten. In einer vollkommen
verwissenschaftlichen Welt wird gerne alles auf mechanisch-medizinische Vorgänge
reduziert. Fast könnte man von einer Reanimation des Schicksalsglaubens
sprechen.
V. Mediale Verwirrung
Da kommt Sarrazins Diktum zur rechten Zeit. Wer ihm pauschal Rassismus
vorwirft übersieht, dass er sein Fremdeln mit biogenetischen Implikationen nur
für die Diagnose des Problems einsetzt - nicht für die Problemlösung selber.
Auch sein Mantra, die Intelligenz sei zu 50-80% genetisch bedingt, ist bei
genauer Sicht etwa so aussagefähig, als beschreibe jemand die Körpergröße eines
mutmaßlichen Diebes mit "zwischen 1,50 und 2,00 m". Die Beteuerungen der
Humangenetiker, man sei in Wirklichkeit viel weiter als diese Aussage
suggerierten, verpuffen allerdings medial im Nebulösen. Da hat man fast den
Verdacht, dass man es so ganz genau dann doch nicht wissen möchte. Oder es nicht
weiss.
Sarrazin konnte lange Zeit die mediale Verwirrung, die er antizipiert hatte,
ausnutzen um stammtischparolenhaft die bereits durch das föderalistische
Bildungssystem ausreichend (und konzise) beschriebene drohende Verdummung des
Volkes durch die fortlaufende Senkung der bildungspolitischen Anforderungen mit
dem "genetischen" Zusatzargument zu bekräftigen. Blieb die deutsche Unterschicht
dumm bzw. wurden die Deutschen immer dümmer, so blieb der muslimische Migrant
sozusagen "doppel-dumm". Sarrazins Regression auf die Eugenik des beginnenden
20. Jahrhunderts fiel dem Gelegenheitsleser kaum auf. Es bedurfte eines
Frank Schirrmacher, der "Deutschland schafft sich ab" sortierte wie ein
Wertstoffsammler den gelben Sack. So ganz kam die Empörung Schirrmachers
(und dann
später auch des SPD-Vorsitzenden und Hobby-Biopolitikers Gabriel) nicht an.
Hat doch Eugenik über diverse Hintereingänge längst Einzug in die Moderne
gefunden: Eltern können aufgrund der Resultate von pränatalen Untersuchungen
bestimmen, ob sie ein eventuell behindertes Kind haben wollen oder nicht. Der
aktuelle Vorstoß der Bundeskanzlerin, dies bei der künstlichen Befruchtung aus
ethischen Gründen zu untersagen (die sogenannte Präimplantationsdiagnostik), ist
arg weltfremd, da damit die Zahl der Abtreibungen steigen wird. Tatsächlich gilt
die (vermeintlich) psychische Belastung der Schwangeren durch ein behindertes
Kind längst als ausreichender Indikationsgrund; übrigens eine heuchlerische
Verbrämung der Wahrheit. Adoptionsverfahren bei kinderlosen Eltern werden nach
Maßstäben durchgeführt, die durchaus eugenische "Dimensionen" besitzen.
Samenbanken in den USA bieten Frauen, hetero- oder homosexuelle Paare an, ihren
Nachwuchs nach ihren Wünschen (Aussehen, Intelligenz, künstlerische Begabungen)
zu "designen". Es gibt also längst Auswahlverfahren für bzw. gegen Menschen, die
gesellschaftlich akzeptiert sind und umgesetzt werden. Freilich sind wir von
umfassenden "Regeln für den Menschenpark" (abermals Sloterdijk), die Grenzen und
Möglichkeiten in einer Art Charta festschreibt, noch weit entfernt, da dies
zwangsläufig zu einstürzenden Weltbildern führen würde. Warum sich Sarrazin auf
das rutschige Terrain der biopolitischen Argumentation begeben hat und
beispielsweise nicht die "Mogelpackung" über Richard Dawkins' Meme gegangen ist,
mag in seiner Provokationslust einerseits und in der Uneinigkeit in diesen
Fragen in der Wissenschaft andererseits zu suchen sein. Vor allem scheint es
jedoch mit fundamentalen Missverständnissen zu tun zu haben.
Die Rezeption des Sarrazin-Buches ist bis auf wenige Ausnahmen kein Ruhmesblatt.
Die fast inquisitorischen Fernsehauftritte bei "Beckmann" und "Hart aber fair"
förderten in ihrer Unkultiviertheit das Interesse an dem Buch. Mit gleicher
Inbrunst, wie sich eine Generation den bösen Einflüssen der Welt durch die
Flucht in den Musikantenstadl entzieht, griff auch das linksintellektuelle
Bürgertum nach der ersten Schockstarre zum ultimativen
Verklärungsinstrumentarium: Man leugnet schlichtweg die dargestellten Probleme,
deklariert sie zu "Einzelfällen" um dann seinerseits mit Einzelfällen das
Gegenteil zur Regel herbeizumogeln. Die Lektüre des inkriminierenden Buches
ersparte man sich weitgehend nonchalant und beließ es bei Zitaten. Das Bad im
Drachenblut der richtigen Gesinnung genügte. Eine Frau, die anläßlich einer
Lesung Sarrazins protestierte und gefragt wurde, warum sie dies mache,
entblödete sich nicht zu sagen, er habe mit dem, was er "über die Juden gesagt"
habe, eine Grenze überschritten. Deutlicher kann man seine Ignoranz dem Buch
gegenüber nicht artikulieren: Sarrazin erläutert darin, dass Juden in den 1920er
Jahren bei Intelligenztests in Deutschland einen IQ von 15 Punkten über dem
Durchschnitt aufwiesen. Auch die eher unglückliche Aussage in einem Interview in
der "Welt" war von Sarrazin eher philosemitisch gemeint; in keinem Fall jedoch
anti-jüdisch. Mit dieser affektgesteuerten Einstellung, von jeglicher Ahnung
befreit, kultiviert man seinen Blumenkasten, der dann einfach zum Garten Eden
erklärt wird. Die zum Teil hysterischen Debattenbeiträge, die Sarrazins
generalisierende Sicht durch Einzelfallbeispiele widerlegen wollten verfingen
zunächst nicht. Die Vorzeige-Muslime und -Muslima tingelten eine Zeit lang durch
alle möglichen Talkshows. Dabei wurde gerne übersehen, dass diese Leute längst
das modern-säkulare Diktum der Trennung zwischen Religion und Kultur
praktizierten. Einem Depressiven hilft der Hinweis darauf, dass die meisten
Menschen glücklich sind, nicht weiter.
Bewies Sarrazin mit seiner Verweigerungshaltung einer differenzierteren
Betrachtungsweise schon beträchtliche Argumentationsresistenz, so lieferten die
Verfechter des "Es-ist-doch-alles-gar-nicht-so-schlimm" ein fast noch
erbärmlicheres Bild. Erst musste die geballte Ladung politisch-korrekter
Schöndarstellung zur besten Radio- bzw. Fernsehzeit abgefeuert werden.
Inzwischen ist der wohlige Effekt der Stigmatisierung der Sarrazin-Leser wieder
konsensuelles Gemeingut des linken Bourgeois, der am liebsten nach einer Lesung
ihrer Reizfigur das entsprechende Sitzmöbel in einem separaten Castor-Behälter
hätte entsorgen lassen. Ernsthaft gibt es schon wieder besonders progressive
Kommentare, die erklären, dass die Beherrschung der Landessprache für Migranten
nicht unbedingt so wichtig sei und stimmen das hohe Lied der
Parallelgesellschaften an.
Nachträglich ist es für das linksintellektuelle Milieu ein Glücksfall, dass
nicht Kirsten Heisigs Buch "Das Ende der Geduld" Gegenstand des Diskurses war.
Sarrazin bot viel mehr Angriffsfläche. Weil er sich in einigen Punkten verrannt
hat, konnte man in einem Schwung sein ganzes Buch als Sondermüll behandeln. Das
wesentlich fundiertere aber in der Sache nicht weniger eindeutige Buch der
Jugendrichterin aus Berlin, die, wie es heißt, aus persönlichen Gründen Hand an
sich gelegt hatte, hätte zu viel interessanteren Diskussionen führen können.
Diese blieben jedoch weitgehend aus. Immerhin stimmten Heisig und Sarrazin im
wesentlichen in der Diagnose der Probleme überein, aber die Hau-druff-Rhetorik
des ehemaligen Berliner Finanzsenators war viel besser geeignet, Realitäten zu
leugnen, die längst nicht mehr zu leugnen sind. Selten versuchte man Sarrazins
sozialpolitisches Theoriegebäude argumentativ zu begegnen. Dies geschah
teilweise aus Unvermögen, teilweise jedoch aufgrund der beschriebenen
Verdrängungsmechanismen. Zumeist begnügte man sich einer großen Portion
rhetorischer Empörung (dabei offenbarte sich zuweilen durchaus ein
erschreckender Meinungsautoritarismus) und versuchte Sarrazins fragile
Statistikgebäude mit reziprok getürkten (!) Werten zu beantworten.
VI. Verirrungen des Bundespräsidenten
Olivier Roy hatte in seiner furiosen religionskritischen Schrift "Heilige
Einfalt" auch die Adepten des Multikulturalismus entlarvt.
Multikulturalismus sei, so Roy "keineswegs die Anerkennung ursprünglicher
Unterschiede, sondern nur Ausdruck dessen, dass sich Kulturen und Religionen an
einem gemeinsamen Paradigma ausrichten, und zwar dem Paradigma des kleinsten
gemeinsamen Nenners". Praktisch entstünde eine Art "Kommunitarismus, reduziert
auf den Zugewinn". Multikulturalismus ist also "eine Illusion, denn er zielt auf
Gemeinschaften, in denen die Ablösung von religiösen und kulturellen Markern
bereits stattgefunden hat: Beim Multikulturalismus wird künstlich etwas als
kulturell definiert, was nicht mehr zur Kultur gehört".
Diese Aussage ist bedeutsam, wenn man sich Bundespräsident Wulffs Diktum vom 3.
Oktober vergegenwärtigt. Wulff sagte, der Islam gehöre zu Deutschland. Abgesehen
davon, dass Wulff und Sarrazin übereinstimmend von "dem" Islam als homogene
Einheit reden, die so gar nicht gibt, gleichen sich die beiden auch noch auf
eine andere Weise: Beide ignorieren die kemalistisch-laizistische Tradition der
Türkei. Der eine malt die (Re-)Islamisierung der in Deutschland lebenden Türken
als eine mögliche Schreckensvision an die Wand - der andere treibt die gleichen
Türken erst in die Arme der Religion. Statt den Satz "Die bei uns lebenden
Türken gehören zu Deutschland" zu sagen, islamisiert Wulff diese und setzt damit
die säkularen Türken ohne Not unter Religionsdruck. Dies entspricht Roys
Darstellung des Multikulturalismus - hier wird etwas "künstlich…als kulturell"
definiert - nämlich der Islam. Wulffs Rede ist ein Beispiel, dass gut gemeint
manchmal das Gegenteil von gut gemacht bedeutet (geradezu anmaßend dann vice
versa in der Türkei das Christentum einzuklagen). Noch gravierender offenbart
sich die politische Inkomptenz bei der Kanzlerin: Einerseits stimmt sie Wulffs
Aussage zu. Andererseits will sie am rechten Rand ihrer verunsicherten
Wählerklientel fischen und erklärt "Multikulti" für gescheitert. Im Licht von
Olivier Roy sind beide Aussagen unvereinbar. Nur gut, dass keiner nachgedacht
hat.
Macht Sarrazin noch (zusammen mit Heinz Buschkowsky) vernünftige (wenn auch
nicht durchgängig neue) Vorschläge was die Bildungs- und Schulpolitik angeht
(besonders interessant: homogene Lerngruppen in der Schule, die nach Neigung und
Leistung zusammengesetzt sind statt starrer Klassenverbände), so muten seine
Ideen zur Integrationspolitik eher bescheiden an. Er möchte, dass die
aufnehmende Gesellschaft eine klare Erwartungshaltung vermittelt.
Angelsächsische Aufnahmemodelle, die nach strengen Kriterien ihre Einwanderer
auswählen, stehen hier Pate. Einlass in die Sozialtransfers (beispielsweise für
sogenannte Importbräute) will er verunmöglichen, in dem eine längere Zeit
nach Einwanderung in die Bundesrepublik keine Leistungen bezahlt werden.
Sarrazin nimmt - diese Sicht vermag überraschen - die Feststellung "Deutschland
ist ein Einwandererland" ernster als diejenigen, die seit Jahren den
ungehinderten und nahezu voraussetzungslosen Familienzuzug goutieren. Seit 1973
hat sich der Zuzug von Migranten weitgehend vom Arbeitsmarkt entkoppelt.
Sarrazin will dies aufheben. Sein zwischendurch immer geäußertes Credo, dass
Einwanderung die demografischen Probleme nicht löst, ist nur ein scheinbarer
Widerspruch: In Wirklichkeit ist er nur an der Zuwanderung ungelernter Kräfte
nicht mehr interessiert.
Die gerne vorgebrachte aktuelle Statistik, wonach es derzeit mehr Auswanderer
als Einwanderer gibt, widerlegt nicht Sarrazins generellen Befund, dass die
Fertilität unter Migranten wesentlich höher ist als in der deutschen Mittel- und
Oberschicht. Die verbale Vehemenz, mit der Sarrazin gegen muslimische
Transferbezieher vorgeht, lässt er bei der Betrachtung der deutschen
Unterschicht vermissen. Dort liegt die sogenannte Nettoreproduktionsrate
vermutlich ähnlich hoch (genaue Statistiken gibt es nicht, weshalb Sarrazin
Ableitungen vornimmt). Wie bereits erwähnt, tangiert sein Negativbefund in Bezug
auf die Zukunft Deutschlands überhaupt nicht die deutsche Oberschicht und deren
Verhalten.
VII. Ein sozialdemokratischer Reflex
Sarrazins Sprach- und Hilflosigkeit dem demographischen Phänomen gegenüber
ist neben der Ausblendung der gesellschaftsschädigenden Verhaltensweisen der
autochthonen Eliten die zweite Enttäuschung des Buches. Nach der Aufzählung
gängiger Vorschläge wie bessere Betreuungsangebote für Kinder, Reform des
Familienlastenausgleichs, der höheren Wertschätzung dauerhafter Partnerschaften,
der Verkürzung von Ausbildungs- und Studienzeiten und der steuerlichen
Höherbelastung von Kinderlosen holt Sarrazin zu einem wuchtigen Schlag aus:
Gebildeten deutschen Frauen soll eine Art Kinderprämie von 50.000 Euro gezahlt
werden. Dieser Vorschlag ist von Gunnar Heinsohn, dem Nestor der deutschen
Biopolitik, geklaut. Dieser wollte sogar 130.000 Euro bezahlen (inzwischen ist
er von diesem Vorschlag abgerückt). Mit diesem Gedanken ist Sarrazin dann
durchaus wieder in einem typisch sozialdemokratischen Reflex aufgesessen: Seit
jeher glauben ja Politiker der fünf sozialdemokratischen Parteien mittels Geld
jeden und alles steuern zu können – und dies im Guten wie im Schlechten. Dieses
Märchen zeigt sich bis in die Umweltgesetzgebung hinein, obwohl man eigentlich
wissen müsste, dass wenigstens die Natur unbestechlich ist: Egal wie hoch der
Preis für das CO2-Zertifikat ist: der Dreck schert sich nicht darum, ob er teuer
war oder nicht - er ist da. Gerade dieser Prämienvorschlag Sarrazins ist
unsinnig. Zum einen ist ja mit einer "deutschen", "gebildeten" Mutter nichts
über den Vater des Kindes ausgesagt (Sarrazin widerspricht sich in seiner
Abstammungstheorie hier selber) und zum anderen lässt der Vermerk im Buch, der
Staat bezahle für ein Kind schätzungsweise 55.000 Euro Kindergeld, den Schluss
zu, dass dieses Kindergeld dann nicht mehr gezahlt werde. Die umworbene
Akademiker-Mutter hätte keinen Gewinn mehr.
Interessanterweise konzediert Sarrazin allerdings sehr wohl, dass Geld nicht
durchgängig der problemlösende Faktor ist. Er weist darauf hin, dass die
deutschen Bundesländer mit den höchsten Prokopfausgaben im Bildungswesen die
schlechtesten Resultate bei PISA-Tests erreichen. Auch hinsichtlich der
demografischen Problematik ist er, was die soziale Versorgung mit
Transferleistungen angeht, skeptisch. So hat Frankreich mit einem ähnlichen
Sozialsystem eine Nettoreproduktionsrate von 0,91 (im Vergleich Deutschland:
0,67). Die USA und England (konsequent wird die Bezeichnung
'Großbritannien' verweigert), Länder mit einer wesentlich restriktiveren
Sozialpolitik, weisen den Faktor 1,01 bzw. 0,75 aus.
In einem anderen Punkt ist Sarrazin wieder der typische Volkswirt. Er fragt
unverhohlen, welchen volkswirtschaftlichen Nutzen die bisherigen Einwanderer der
Bundesrepublik Deutschland erbracht haben. Der Vorwurf, er betreibe damit einen
unzulässigen, ja menschenverachtenden Utilitarismus, ist absurd. Wie bereits
erwähnt, schimmert in solchen Überlegungen der Gedanke an einer konzisen
Einwanderungspolitik durch (beispielsweise wie in Kanada). Er ist aber Realist
genug, um zu erkennen, dass Deutschland für die wirklichen Fachkräfte derzeit
nicht genügend attraktiv ist. Zu Problemlösungen in dieser Hinsicht schweigt er
sich allerdings ebenfalls aus.
VIII. Was bleibt?
Sarrazins Strohfeuer hat einen erschreckenden Blick auf eine hilf-, sprach-
und argumentationslose politische Öffentlichkeit aufgezeigt. Hilflos war man, in
dem man dem Buch eine gewisse Souveränität gegenüber hätte zeigen müssen.
Sprachlos waren vor allem die Politiker, die in ritualisierten
Ablehnungsaffekten verfielen. Die übereilten und repressiven Reaktionen, die
sich gegen den Autor richteten (vorzeitige Pensionierung;
SPD-Ausschlussverfahren) offenbaren erhebliche Defizite in der politischen
Auseinandersetzung auch unangenehmer Problemfelder.
Die Kanzlerin bezeichnete das Buch als "wenig hilfreich" - obwohl sie es nicht
gelesen hatte. Dennoch dürfte sie in dieser Einschätzung auf eine andere Weise
recht behalten: Wenig hilfreich dürfte es sein, weil es zu einer weiteren
Domestizierung des Diskurses um die Themen Sozialpolitik, Demografie,
Integration und Einwanderung führen wird.
Das aktuell
kontrovers diskutierte Interview des türkischen Botschafters in Wien kann
als Gegenstück zu Sarrazins Buch gelesen werden. Ich stimme beiden in vielen
Punkten nicht zu. Aber eine öffentliche Diskussion zwischen den beiden
Protagonisten, zwischen Thilo Sarrazin und Kadri Ecved Tezcan, zwei Stunden zur
besten Sendezeit im Fernsehen, ohne Moderator - das wäre ein Wunsch in den
Zeiten, als das Wünschen schon lange nicht mehr geholfen hat. Gregor
Keuschnig
|
Thilo Sarrazin
Deutschland schafft sich ab
Wie wir unser Land aufs
Spiel setzen
DVA
Gebundenes Buch mit Schutzumschlag
464 Seiten
ISBN: 978-3-421-04430-3
€ 22,99
|
 Berserker und Verschwender
Berserker und Verschwender Edition
Glanz & Elend
Edition
Glanz & Elend
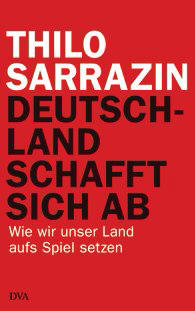 Der
Messias der Mittelschicht
Der
Messias der Mittelschicht