|
Jazz aus der Tube
Bücher, CDs, DVDs
&
der Link des Tages
Schiffsmeldungen
Nachrichten, Gerüchte, Ideen,
Leute & Jobs
aus der Verlagswelt, Fachpresse & Handel
Links
Bücher-Charts
l
Verlage A-Z
Medien- & Literatur
l
Museen im Internet
Rubriken
Belletristik -
50 Rezensionen
Romane, Erzählungen, Novellen & Lyrik
Quellen
Biographien, Briefe & Tagebücher
Geschichte
Epochen, Menschen, Phänomene
Politik
Theorie, Praxis & Debatten
Ideen
Philosophie & Religion
Kunst
Ausstellungen, Bild- & Fotobände
Tonträger
Hörbücher & O-Töne
SF & Fantasy
Elfen, Orcs & fremde Welten
Sprechblasen
Comics mit Niveau
Autoren
Porträts,
Jahrestage & Nachrufe
Verlage
Nachrichten, Geschichten & Klatsch
Film
Neu im Kino
Klassiker-Archiv
Übersicht
Shakespeare Heute,
Shakespeare Stücke,
Goethes Werther,
Goethes Faust I,
Eckermann,
Schiller,
Schopenhauer,
Kant,
von Knigge,
Büchner,
Marx,
Nietzsche,
Kafka,
Schnitzler,
Kraus,
Mühsam,
Simmel,
Tucholsky,
Samuel Beckett
 Honoré
de Balzac Honoré
de Balzac
Berserker und Verschwender
Balzacs
Vorrede zur Menschlichen Komödie
Die
Neuausgabe seiner
»schönsten
Romane und Erzählungen«,
über eine ungewöhnliche Erregung seines
Verlegers Daniel Keel und die grandiose Balzac-Biographie
von Johannes Willms.
Leben und Werk
Essays und Zeugnisse mit einem Repertorium der wichtigsten
Romanfiguren.
Hugo von
Hofmannsthal über Balzac
»... die größte, substantiellste schöpferische Phantasie, die seit
Shakespeare da war.«
Literatur in
Bild & Ton
Literaturhistorische
Videodokumente von Henry Miller,
Jack Kerouac, Charles Bukowski, Dorothy Parker, Ray Bradbury & Alan
Rickman liest Shakespeares Sonett 130
Thomas Bernhard
 Eine
kleine Materialsammlung Eine
kleine Materialsammlung
Man schaut und hört wie gebannt, und weiß doch nie, ob er einen
gerade auf den Arm nimmt, oder es ernst meint mit seinen grandiosen
Monologen über Gott und Welt. Ja, der Bernhard hatte schon einen
Humor, gelt?
Hörprobe
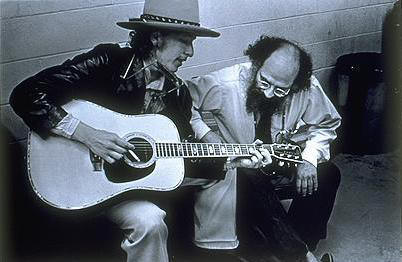
Die Fluchtbewegungen des Bob Dylan
»Oh
my name it is nothin'/ My age it means less/ The country I come from/
Is called the Midwest.«
Ulrich Breth über die
Metamorphosen des großen Rätselhaften
mit 7 Songs aus der Tube
Glanz&Elend -
Die Zeitschrift
Zum 5-jährigen Bestehen
ist
ein großformatiger Broschurband
in limitierter Auflage von 1.000
Exemplaren
mit 176 Seiten, die es in sich haben:
Die menschliche
Komödie
als work in progress
 »Diese mühselige Arbeit an den Zügen des
Menschlichen« »Diese mühselige Arbeit an den Zügen des
Menschlichen«
Zu diesem Thema haben
wir Texte von Honoré de Balzac, Hannah Arendt, Fernando Pessoa, Nicolás
Gómez Dávila, Stephane Mallarmé, Gert Neumann, Wassili Grossman, Dieter
Leisegang, Peter Brook, Uve Schmidt, Erich Mühsam u.a., gesammelt und mit den
besten Essays und Artikeln unserer Internet-Ausgabe ergänzt.
Inhalt als PDF-Datei
Dazu erscheint als
Erstveröffentlichung das interaktive Schauspiel »Dein Wille geschehe«
von Christian Suhr & Herbert Debes
Leseprobe
Anzeige
 Edition
Glanz & Elend Edition
Glanz & Elend
Martin Brandes
Herr Wu lacht
Chinesische Geschichten
und der Unsinn des Reisens
Leseprobe
Neue Stimmen
 Die
Preisträger Die
Preisträger
Die Bandbreite der an die 50 eingegangenen Beiträge
reicht
von der flüchtigen Skizze bis zur Magisterarbeit.
Die prämierten Beiträge
Nachruf
 Wie
das Schachspiel seine Unschuld verlor Wie
das Schachspiel seine Unschuld verlor
Zum Tod des ehemaligen Schachweltmeisters Bobby Fischer
»Ich glaube nicht an Psychologie,
ich glaube an gute Züge.«
Wir empfehlen:
kino-zeit
Das
Online-Magazin für
Kino & Film
Mit Film-Archiv, einem bundesweiten
Kino-Finder u.v.m.
www.kino-zeit.de






br-buecher-blog
Andere
Seiten
Elfriede Jelinek
Elfriede Jelinek
Joe Bauers
Flaneursalon
Gregor Keuschnig
Begleitschreiben
Armin Abmeiers
Tolle Hefte
Curt Linzers
Zeitgenössische Malerei
Goedart Palms
Virtuelle Texbaustelle
Reiner Stachs
Franz Kafka
counterpunch
»We've
got all the right enemies.«
Riesensexmaschine
Nicht, was Sie denken?!
texxxt.de
Community für erotische Geschichten
Wen's interessiert
Rainald Goetz-Blog
Technorati Profile



|
 Phrasen
und sachliche Fehler Phrasen
und sachliche Fehler
Lothar Struck über Albrecht von
Luckes fragwürdige Thesensammlung über
»Die gefährdete Republik«
"Die gefährdete Republik – Von Bonn nach Berlin" – ein
erstaunlicher Titel und wenn man noch dazu die Jahresreihe "1949 – 1989 – 2009"
liest ahnt man, welche Melodie hier angestimmt wird. Das Buch kommt zunächst als
Bestandsaufnahme sowohl der sogenannten "Bonner Republik", die mit dem Mauerfall
1989 sukzessive "abdankte" (aber erst fast ein Jahrzehnt später, 1999 mit der
ersten Plenarsitzung des Bundestages im neuen Reichstags zu Berlin endgültig zu
Ende ging) als auch einer Art Zwischenbilanz der scheinbar noch immer sinn- bzw.
rollensuchenden "Berliner Republik" daher.
Die These des Autors: Die Demokratie der alten Bundesrepublik war stabiler (weil
besser) in der Bevölkerung verankert als im neuen, souveränen Deutschland. Dabei
wird die fast behagliche Situation der "Bonner Republik" aus einer
selbstverordneten (und von anderen erwarteten!) Zurückhaltung heraus zu agieren
(bzw. zu reagieren) und sich in die Bipolarität des Kalten Krieges, die EWG
(später dann EG bzw. EU) und NATO willig einbinden zu lassen als unausweichlich
betrachtet. "Nie wieder Krieg" lautete das Grundbekenntnis (und, die
intellektuelle Variante, "Nie wieder Auschwitz", die allerdings – von Lucke
erwähnt das durchaus – 1999 plötzlich zu einer Art Staatsraison pervertiert
wurde und als Kriegsrechtfertigung diente). Da die Außenpolitik letztlich fast
als Indienstnahme von Auschwitz stattfand, konnte man sich auf das Innere
konzentrieren; zutreffend ist vom Primat der Innenpolitik die Rede.
Wohlstandsversprechen und Kommunikation
Albrecht von Lucke glaubt, dass die Demokratie-Akzeptanz innerhalb der "Bonner
Republik" vor allem durch Erhards Wirtschaftswunder und den danach
parteiübergreifenden Konsens des Ausbaus der sozialen Marktwirtschaft inklusive
der Sozialsicherungssysteme ermöglicht und gefestigt wurde. Das
Wohlstandsversprechen, also der soziale (und ökonomische) Aufstieg durch
Bildung und Arbeit, war nicht nur Möglichkeit, sondern vielfach Realität
geworden. Die Durchlässigkeit innerhalb der sozialen Schichten war erreichbar.
Die intellektuellen Debatten wurden hart aber durchaus in gegenseitigem Respekt
ausgefochten, so die These. Dabei blieb selbst in der entschiedensten
Auseinandersetzung möglich, was die Weimarer Republik nicht vermocht hatte: "die
Transformation von radikaler Systemopposition in kritische Loyalität und
Reformismus". (Das Zitat ist von Paul Nolte.) Die Stärke der
Bundesrepublik - immer wenn von Lucke Bundesrepublik schreibt, meint er die
"Bonner Republik"! – bestand darin, dass in Kommunikation, aber gerade auch
in hartem Konflikt unterscheidbare Alternativen für den Bürger erkennbar und
damit auch wählbar wurden – und im Ernstfall die Verständigung über die
Gegensätze hinweg erfolgte.
Diese Sicht auf die Diskussionskultur ist nicht nur von einigem Sentiment
durchtränkt, sondern arg simplifizierend. Tatsächlich haben immer wieder
Grundsatzfragen des Selbstverständnisses Nachkriegsdeutschlands die
Debattenkultur der Bundesrepublik der ersten dreißig Jahre geprägt. Über die
Verwerfungen quer durch die politische aber auch intellektuelle Elite anlässlich
der Wiederbewaffnungsdebatte Mitte der 50er Jahre gibt es beredte Zeugnisse (u.
a.
Wolfgang Koeppens fiktionale Bearbeitung "Das Treibhaus").
Und wer jemals die teilweise unversöhnlich und aggressiv geführten Diskussionen
in den 70er Jahren hinsichtlich die Ostpolitik der sozial-liberalen Koalition
mitbekam, konnte bei den Gegnern dieser Politik nirgends eine Loyalität zur
Regierung festmachen.
Geschichtsklitternde Idealisierung der "Bonner Republik"
Die Debatten wurden kaum im diskursiven Miteinander, sondern über die damals
jeweils herrschenden Mehrheitsverhältnisse entschieden. Da diese Entscheidungen
Grundsatzcharakter hatten und teilweise völkerrechtliche Verbindlichkeit
bekamen, wurden sie auch bei Regierungswechseln von der jeweils neuen
Administration übernommen (und sogar weitergeführt). Wie fragil allerdings der
Konsens in der Ostpolitik verankert war, konnte man Jahrzehnte danach während
der Verhandlungen über den sogenannten "Zwei-plus-Vier"-Vertrag 1990/91 sehen,
als dort zur Grundbedingung deutscher Souveränität die Oder-Neisse-Grenze mit
Polen als unabänderbar festgelegt wurde (und in diesem Punkt die Ostpolitik der
Regierung Brandt endgültig zementiert wurde) und einige rechts-nationale
Abgeordnete der CDU/CSU Bedenken äußerten (die allerdings keine entscheidende
Rolle mehr spielten). Die vom Autor beschworene "Einbeziehung des Anderen"
(Habermas), jenes Antidot gegen das antiliberale, ausgrenzende
Freund-Feind-Denken Carl Schmitts kann anlässlich der Schärfe und
Radikalität der Debatten insbesondere der 60er und 70er Jahre (mit Ausnahme der
Terrorismusbekämpfung während des "Deutschen Herbstes" 1977) nur als
geschichtsklitternde Idealisierung bezeichnet werden.
Von Lucke konstatiert, dass die "Berliner Republik" nach dem 11. September 2001
zum Freund-Feind-Denken zurückkehrt sei. Der Bürger (und insbesondere der
muslimische Mitbürger) sieht sich immer mehr mit einer Art Generalverdacht
konfrontiert. Die EU-weite Verschärfung des Asylrechts sieht er in diesem
Zusammenhang fast als konsequent. Recht oder Gewalt laute wieder die
Gretchenfrage, so der Autor, der Habermas paraphrasierend, von der
Rückkehr "grosser, gewaltbegründeter Politik" im alten,
vor-bundesrepublikanischen Sinne und von einem neuen Nachtwächter- und
Sicherheitsstaat spricht (von den zahlreichen Geheimdienst- und
Bespitzelungsaffären der "alten" Bundesrepublik erfährt der Leser
sicherheitshalber nichts).
Man weiss nicht, ob von Lucke mit vor-bundesrepublikanisch nun Weimar
meint (die Behauptung "Bonn ist nicht Weimar" strapaziert er am Anfang des
Buches) oder gleich wilhelminisches Politikgebaren unterstellt. In jedem Fall
sieht der Autor mit dem 11. September die Stunde Carl Schmitts gekommen
(das Herbeibeschwören von Carl Schmitt bei Freund und Feind [sic!] ist derzeit
publizistisch en vogue). Einige Schmitt-Adepten dienen ihm dabei als Beleg für
seine These (u. a. Otto Depenheuer und sein Buch
"Selbstbehauptung des Rechtsstates").
Eine dezidierte Beweisführung, dass dieses Denken
entscheidend (und somit auch gesetzgeberisch) in den politischen Diskurs
Deutschlands eingedrungen ist, bleibt aus, auch wenn er äußerst suggestiv zu
Werke geht und emphatisch den "links-rechts"-Gegensatz der "Bonner Republik" als
Ethos der Politik feiert. Da werden dann praktischerweise
die eindeutigen Gegenpositionen des Verfassungsrichters Udo di Fabio
nur in einem Nebensatz und in Bezug auf eine Nuance
erwähnt.
Paranoia um Carl Schmitt
Stattdessen dient ihm Frank Schirrmachers Artikel
"Junge Männer auf Feindfahrt" als Beleg für die auch
unter Intellektuellen verbreitete Stimmung eines (naturgemäß zurecht als
gefährlich eingestuften) Feinddenkens innerhalb des politischen und
soziokulturellen Kontextes. Schirrmachers Text rekurriert auf den brutalen
Überfall zweier jugendlicher Ausländer auf einen Rentner auf dem Münchener
U-Bahn-Gelände. Von Lucke gefällt nicht, wenn Schirrmacher von
Deutschenfeindlichkeit der beiden ausländischen Jugendlichen spricht und
sieht hier (ohne dies zu belegen) eine Art Dammbruch. Dabei geht er einig mit
Schirrmacher, dass es eine wesentliche Errungenschaft der "Bonner Republik"
gewesen sei, den "'inneren Feind' nicht zu postulieren" und führt als Beispiel
die RAF-Terroristen an, die trotz ihrer Verbrechen vom Staat nicht als "Feinde"
betrachtet worden seien. Von Lucke vergisst dabei, dass (1.) Schirrmacher kein
Regierungssprecher ist und (2.) die publizistischen Salven Mitte der 70er Jahre
sehr wohl suggerierten, dass es sich bei den RAF-Terroristen um Feinde des
Rechtsstaats handelte (mitnichten übrigens nur in der "Springer"-Presse, aber
vor allem natürlich dort) und der damalige Bundespräsident
Walter Scheel bei der Trauerveranstaltung für Hanns-Martin Schleyer von den
Terroristen als "Feinde[n] jeglicher Zivilisation" sprach.
Der "Feind" war in Wirklichkeit auch (und gerade) in der
"Bonner Republik" bis in die 80er Jahre hinein als geradezu neurotischer
Antikommunismus präsent, der es Adenauer und Erhard erlaubte, bis weit in die
60er Jahre hinein sogar die
inzwischen gewendete SPD zu stigmatisieren.
Außenpolitisch wurde erst durch die sozial-liberale Entspannungspolitik dieses
Ressentiment offiziell gezähmt.
Aus Angst durch Opposition und Medien als verfassungspolitisches "Leichtgewicht"
verunglimpft zu werden schuf (ja: antizipierte) die sozial-liberale Regierung
1972 den sogenannten
"Radikalenerlass" (offizielle Bezeichnung: "Grundsätze
zur Frage der verfassungsfeindlichen Kräfte im öffentlichen Dienst"
[Hervorhebung G. K.]), der einen virulenten (und traditionellen) Antikommunismus
im Inneren durchaus fortschrieb und als eine Postulierung eines "inneren
Feindes" betrachtet werden muss (man denke auch an den der
Demokratiefeindlichkeit unverdächtigen Karl Popper und dessen Buch
"Die offene Gesellschaft und ihre Feinde"). Und
generell gilt, dass, auch wenn die offizielle Sprachregelung dies seit den 70er
Jahren verbat, die Bundeswehr sehr wohl ihr "Feindbild" aus einer (diffusen,
aber von großen Teilen der Bevölkerung real empfundenen) Bedrohung aus "dem
Osten" bezog (auch wenn die Nennung der Sowjetunion in diesem Zusammenhang nicht
opportun war).
Von Lucke muss hier leider eine (freundlich ausgedrückt) höchst selektive
Auslegung bescheinigt werden. Indem er Schirrmachers Artikel (und auch den
Kommentar von Thomas Schmid aus der "Welt") derart als
Beispiele einer Selbstidiotisierung der Intellektuellen der neuen
"Berliner Republik" darstellt, unterschlägt er den direkten Anlass der
Kommentare: Beide Artikel beziehen sich nämlich direkt auf ein
Video des "Zeit"-Feuilletonchefs Jens Jessen, der
suggerierte, dass der Rentner selber womöglich durch sein typisch-deutsches,
nörgeliges Verhalten diese Eskalation provoziert habe. Jessen stellt den Rentner
als den deutschen Spiesser per se dar und entlastet somit indirekt die beiden
Täter. Von Lucke verschweigt diesen Kontext, weil er offensichtlich seiner These
im Wege steht. Seriös ist so etwas nicht.
Der stille Konsens zwischen Politik und Wahlvolk bröckelt
Der Ruf nach dem Staat, der nicht zuletzt in der derzeit grassierenden
Weltwirtschaftskrise immer stärker um sich greift, sieht der Autor als Ausweis
verminderter Konfliktbereitschaft einer Gesellschaft – auch dies Beleg für seine
These des Rückzugs des Bürgers von der Demokratie bzw. deren Institutionen. Von
Lucke übersieht dabei ausgerechnet seine Eingangsthese, wonach der Ausbau der
Sozialversicherungssysteme (mit dem vorläufigen Höhepunkt der Errichtung der
Pflegeversicherung im Jahre 1995) den Staat immer weiter in die Rolle des
Helfers aus persönlichen Lebenssituationen definiert hatte. Der im Buch so
euphorisch gefeierte Wohlstandsgedanke ging mit einer Absicherungsmentalität
einher: Jeder konnte im Krisenfall (Krankheit, Arbeitslosigkeit, Pflegefall in
der Familie, aber auch beispielsweise bei der Finanzierung von Immobilien oder
bei der Aus- und Weiterbildung) unter bestimmten Voraussetzungen staatliche
Hilfe in Anspruch nehmen, die selbstverständlich (und fast bedingungslos)
gewährt wurde.
Richard von Weizsäcker formulierte 1992 im Interview mit den Journalisten Werner
A. Perger und Gunter Hofmann eine "Art von Vorteilsaufteilung zwischen Politik
und Gesellschaft. In der Gesellschaft steht die Erhaltung materieller Vorteile
im Vordergrund. Im politischen System dominiert die Kunst des Parteienkampfs
untereinander. Es geht…um Wohlstandserhaltung gegen Machterhaltung." Von einem
"stillen Konsens zwischen Öffentlichkeit und Parteien" mochte von Weizsäcker
zwar nicht sprechen. Die Gefahr sei jedoch, so der damalige Bundespräsident,
dass "beide Seiten der ständigen Versuchung [erliegen] auf Kosten der Zukunft zu
leben, um sich die Gegenwart zu erleichtern".
Dies ist, obwohl nach dem Mauerfall formuliert, eindeutig Produkt und Erbe der
"Bonner Republik", denn Systemakzeptanz wurde durch ein (über viele Jahre
eingehaltenes) Wohlstands- und Sicherheitsversprechen sozusagen "erkauft" (die
Eingangsthese von Luckes weitergesponnen). Erst als ab ungefähr Mitte der 70er
Jahre, verstärkt jedoch in den 90er Jahren ein fast selbstverständlich
geglaubter, permanenter ökonomischer Aufschwung für immer grösser werdende Teile
der Bevölkerung nicht mehr garantiert werden konnte (von da an stieg – aus
vielen Gründen – die Arbeitslosigkeit stetig an), bröckelte auch wieder
zunehmend die System-(respektive Demokratie-)Akzeptanz (die durch die Ereignisse
des Mauerfalls 1989/90 noch einmal ein kurzes, aber heftiges Zwischenhoch
erfuhr).
Wenn beklagt wird, dass das gesellschaftliche Ferment, der Unterbau einer am
eigenen Gemeinwesen interessierten Bürgergesellschaft und somit das Ethos
einer republikanischen Öffentlichkeit erodiere und als schleichender Prozess
eine postdemokratische Phase begänne, in der ein Substanzverlust der
Demokratie drohe (die These stammt vom britischen Politikwissenschaftler
Colin Crouch), so ist wird damit ein langwieriger Prozess beschrieben, der mit
den Umwälzungen seit 1989 relativ wenig und mit einer Erwartungshaltung, welches
sich seit den 70er Jahren über die Generationen gebildet hat, relativ viel zu
tun hat (was im übrigen auch nicht auf die Bundesrepublik beschränkt blieb; man
denke nur an die skandinavischen Länder).
Dieser Exkurs zeigt, dass die Dichotomie "Bonner Republik" versus "Berliner
Republik" die zweifellos vorhandenen Veränderungen der politischen und
gesellschaftlichen Kultur der Bundesrepublik Deutschland nur unzureichend
begründen. Zwar betont von Lucke zu Recht die Symbolik, die im
Hauptstadtbeschluss zu Gunsten Berlins lag, aber im wesentlichen sind seine
Feststellungen, die einen verstärkten Nationalismus beispielsweise innerhalb der
Bevölkerung ausmachen, eher dürftig. Und am Ende bezeichnet er selber die
schwarz-rot-goldenen "Demonstrationen" etwa während der Fussball-WM 2006
zutreffend als Placebo-Patriotismus.
"Revitalisierung des Pathetischen?"
Die Argumentation, Deutschland drohe mit einer Revitaliserung des
Pathetischen neue "Helden", die wiederum eine neuartige Herrschafts- und
Kriegsrhetorik zu produzieren, die zunächst aus Verschleierungsgründen als
solche bewusst nicht deklariert werde, ist dagegen nicht ganz von der Hand zu
weisen. Auch wenn von Luckes Behauptung, Kohl sei – in bester deutscher
Kanzlertradition -Pathosverweigerer gewesen,
bei näherer Anschauung in dieser Form nicht aufrecht erhalten werden kann.
Spätestens mit der unter Gerhard Schröder offen
vorgebrachten "Bewerbung" um einen ständigen Sitz im Weltsicherheitsrat ist
allerdings eine Veränderung im Selbstverständnis (der politischen Klasse)
Deutschlands festzustellen.
Als Sündenfall "neu-deutscher" Außenpolitik muss das bis heute unerklärliche
einseitige Vorpreschen der Kohl/Genscher-Regierung 1991 in Bezug auf die
deutsche Anerkennung von Slowenien und Kroatien angesehen werden, ohne
gleichzeitig mindestens ein europäisch abgestimmtes Konzept für die "restliche"
jugoslawische Föderation vorzulegen. Und natürlich stellt der
(völkerrechtswidrige) Kosovo-Krieg 1999, den von Lucke zu Recht als das
definitive Ende der Nachkriegszeit begreift, eine tiefgreifende Zäsur
dar.
Merkwürdigerweise gewichtet der Autor Schröders Ablehnung des Irakkriegs 2003
(und somit auch einer deutschen Beteiligung daran) eher als Ausnahme statt
hierin eine Form von Erneuerung der Werte der alten Bundesrepublik zu erkennen.
Und wenn er Schröder als Nachkriegskind bezeichnet, der, anders als Kohl,
(scheinbar) unbefangener an den
Feierlichkeiten zum D-Day teilnehmen konnte, so stimmt
dies nur teilweise: Schröder hatte seinen Vater niemals kennengelernt; dieser
starb als Soldat im gleichen Jahr, als Gerhard Schröder geboren wurde. So
schnell wird die leichtfüssige Vokabel vom Nachkriegskind zur
missglückten Metapher. (Umso unerklärlicher die Verpflichtungen Schröders sowohl
im Kosovo-Krieg als auch im Fall von Afghanistan; beides zu untersuchen, würde
den Gegenstand dieses Aufsatzes sprengen. Dies jedoch ausschließlich als
Ausdruck einer "neuen deutschen Verantwortung" rein machtpolitisch zu
interpretieren, dürfte zu kurz greifen.)
Ansammlung von Phrasen und sachliche Fehler
Wenn von Lucke das Aufkeimen einer Renaissance der deutschen Nation
feststellt, so muss er sich zunächst fragen lassen, was daran beklagenswert sein
soll. Natürlich bleibt die "Berliner Republik" sowohl in der EU als auch in der
NATO eingebunden. Eine Bismarcksche Bündnispolitik ist weit und breit nicht in
Sicht; nicht einmal die neo-nationale "Linke" plant die so viel gefürchteten
"Alleingänge". Stattdessen wurde das, was der Autor als Residuum der "Bonner
Republik" betrachtet, nämlich die Ablehnung des Irakkriegs der Regierung
Schröder/Fischer, von vielen (amerikafreundlichen) Auguren als Aufkeimen neuer "Achsen"-Politik
(vom neuen "Rapallo" war sogar die Rede) denunziert. Und moniert nicht von Lucke
zu Recht die postsouverän[e] (Scheckbuch-)Rückzugsgemütlichkeit der
"Bonner Republik", die sich auf das Nachkriegsgefühl stützend und mit dem
bei Bedarf stets als eine Art Monstranz hervorgeholten moralischen Anspruch der
außenpolitischen Zurücknahme agiert hat? (Freilich gab es hier die rühmliche
Ausnahme der Ostpolitik Brandt/Bahr/Scheel!)
Zu einfach macht es sich der Autor auch, wenn er ökonomisch-sozialen
Verwerfungen mit Schröders Agenda-Politik erklärt (dabei Ursache und Wirkung
mindestens teilweise verwechselt) und dann die üblichen Floskeln einer
verarmenden Bundesrepublik rekapituliert. Und wenn von der Rückkehr der
Klassengesellschaft gesprochen wird: was ist das für eine fatale
Fehleinschätzung, die impliziert, dass es vorher eine "klassenlose" Gesellschaft
gegeben haben soll.
Könnte es nicht sein, dass die Durchlässigkeit der
sozialen Schichten der "Bonner Republik" multifaktorale Ursachen hatte? Hat sich
nicht die Haltung großer Teile der Gesellschaft zu den Errungenschaften des
Staates geändert, die nun viel selbstverständlicher aufgenommen, ja gefordert
werden? Muss man, bei aller berechtigten Empörung für die zunehmende Staats- und
Politikgleichgültigkeit nicht auch einmal
Kennedys Diktum in Erinnerung bringen (auch auf die
Gefahr, in unerwünschtes Pathos zu verfallen)? Ist es nicht zwingend
erforderlich, dass staatliche Infrastruktur immer auch eines gewissen
Engagements desjenigen bedarf, der diese nutzt? Ein Schul- und Berufsabschluss,
ein besseres Einkommen oder die Möglichkeit, neue Konsumartikel zu erwerben –
all dies kann nicht vom Staat für den einzelnen herbeigeschafft, sondern muss
selber angeeignet werden. Richtigerweise betont von Lucke die eingerissene
Unsitte, dass der Bürger nur noch als Konsument gesehen wird – dieser Rolle
könnte er sich aber auch dezidiert entziehen. Und wenn die "Berliner Republik"
nun dabei ist, die Delegation des privaten Wohlstands an den Staat, der in der
"Bonner Republik" ihren Ursprung hat (und von allen Regierungen entsprechend
auf- und ausgebaut wurde) zu befragen – was ist daran so verwerflich?
Natürlich: Die Kommunikation zwischen der Politik und seinen Bürgern ist
gestört. Es gibt, da liegt der Autor richtig, bedauerlicherweise weder eine
breite gesellschaftliche Debatte über die Rolle, die Möglichkeiten und die
Grenzen des Staates noch eine Diskussion über den Umgang mit Kriegen (stattdessen
werden dürre Durchhalteparolen gedroschen). Da von Lucke jedoch die
Gegenüberstellung von "Bonner" und "Berliner" Republik nicht aufgibt entsteht
fast zwangsläufig der Eindruck, dass eine Art Reanimation dieser "goldenen Zeit"
herbeigeredet werden soll. Dies ist jedoch – der Autor zeigt das selber – aus
vielerlei Gründen weder möglich noch erstrebenswert.
Statt also mutig Projekte für eine Zukunft zu entwerfen und dabei eventuelle
Risiken zu kalkulieren, verfällt von Lucke größtenteils in glorifizierende
Verklärungsrhetorik. Statt der Bundesrepublik Deutschland gäbe es nur noch
Deutschland und es entstehe eine Republik ohne Republikaner. Als sei
das republikanische Element in der "alten" Bundesrepublik Allgemeingut gewesen.
(Und mutierte in den 80er Jahren der Begriff "Republikaner" nicht fast als
Schimpfwort, weil sich eine rechtsradikale Partei plötzlich dieses Namens
bediente und ihn damit praktisch "entehrte"?)
Bedauerlich übrigens, dass das Buch neben den genannten
Schwächen auch noch markante Fehler aufweist. So ist von einer
Regierungserklärung von Willy Brandt von 1968 die Rede, welche den Satz "Wir
stehen nicht am Ende unserer Demokratie, wir fangen erst richtig an" beinhalten
soll. Und Brandts berühmtes Diktum "mehr Demokratie wagen" verortet von Lucke
auf Anfang der siebziger Jahre. Jeder nur halbwegs politisch Gebildete
weiß freilich, dass Brandts Regierungserklärung, aus der beide Zitate stammen,
im Oktober 1969 gehalten wurde. Da ist der Lapsus,
Philipp Jenninger als Martin Jenninger zu bezeichnen, fast noch
entschuldbar. (Und natürlich auch hier die mehrfach falsch verwandte Phrase
"neoliberal" – obwohl von Lucke beim ersten Mal noch darauf hinweist…)
Am Ende gibt es einen eher kleinlauten Vermerk, der auf eine Krise des
gesamten westlichen Gesellschaftsystems hinweist. Vorher wurde kursorisch
auf für die Demokratie teilweise weit bedrohlichere Entwicklungen in Österreich,
der Schweiz oder Italien hingewiesen (insbesondere was den Rechtspopulismus
angeht). Wenn es sich jedoch um eine umfassende Krise des westlichen politischen
(und/oder ökonomischen) Systems handelt (wofür einiges spricht) bleibt die
Frage, warum von Lucke in diesem Buch derart impertinent auf spezifisch
bundesrepublikanische Besonderheiten rekurriert.
Und einen wesentlichen Punkt für die Krise der Demokratie übersieht von Lucke.
Bereits 1992 konstatierte Richard von Weizsäcker: "Wir leben in einer
Demoskopendemokratie. Sie verführt die Parteien dazu, in die Gesellschaft
hineinzuhorchen, dort die erkennbaren Wünsche zu ermitteln, daraus ein Programm
zu machen, dieses dann in die Gesellschaft zurückzufunken und sich dafür durch
das Mandat für die nächste Legislaturperiode belohnen zu lassen…Und es handelt
sich um einen Kreislauf, bei dem die politische Aufgabe der Führung und
Konzeption zu kurz kommt. Es ist ein Zusammenspiel von Schwächen derer, die die
Mandate suchen, und jener, die sie erteilen."
Inzwischen werden in den Massenmedien alle vierzehn Tage
Umfragen zu allen möglichen Themen verbreitet und ausgiebig diskutiert. Die
Gefahr der Ausrichtung der Politik an eine momentan demoskopisch (scheinbar)
mehrheitsfähige Stimmungslage, die dann fälschlich mit Volksnähe verwechselt
wird, unterhöhlt langfristig das Wesen unserer politischen Kultur. Die Parteien
treten nicht mehr mit ihrer Programmatik in den Stimmenwettbewerb, sondern
biedern sich an den potentiellen Wähler an. Aufgabe der kritischen Medien,
denen von Lucke eine (arg pauschal formulierte) aufklärerische Rolle in seiner
Doktrin einer Integration durch Kritik (naturgemäß) zugesteht, müsste mit
einer im Diskurs zu findenden journalistischen Verantwortungsethik definiert
werden. Die Medien sollten weniger sensationsaffin agi(ti)eren und nicht jede
Verwerfung zum ultimativen "Skandal" aufblasen, sondern dem Bürger die
Möglichkeit bieten, aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit zu entkommen.
Leider trägt das vorliegende Buch hierzu nur sehr begrenzt bei.
Lothar Struck
Die kursiv
gedruckten Passagen sind Zitate aus dem besprochenen Buch.
|
Albrecht von
Lucke
Die gefährdete Republik
Von Bonn nach Berlin: 1949 - 1989 - 2009
Wagenbach
Kartoniert. 96 Seiten
EUR 9.90 [D]
18.10 sFr / 10.20 € [A]
Bandnummer 605
ISBN 978-3-8031-2605-4
|
 Honoré
de Balzac
Honoré
de Balzac Eine
kleine Materialsammlung
Eine
kleine Materialsammlung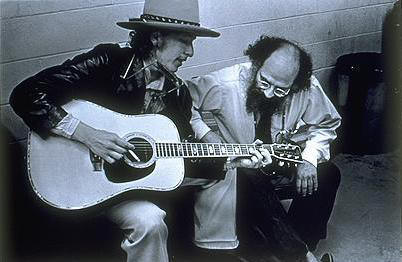
 »Diese mühselige Arbeit an den Zügen des
Menschlichen«
»Diese mühselige Arbeit an den Zügen des
Menschlichen« Edition
Glanz & Elend
Edition
Glanz & Elend Die
Preisträger
Die
Preisträger



 Phrasen
und sachliche Fehler
Phrasen
und sachliche Fehler