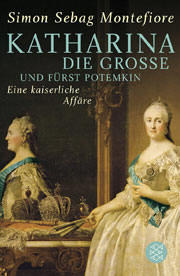|
Andere über uns
|
Impressum |
Mediadaten
|
Anzeige |
|||
|
Home Termine Literatur Blutige Ernte Sachbuch Quellen Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Bilderbuch Comics Filme Preisrätsel Das Beste | ||||
|
Bücher & Themen Jazz aus der Tube Bücher, CDs, DVDs & Links Schiffsmeldungen & Links Bücher-Charts l Verlage A-Z Medien- & Literatur l Museen im Internet Weitere Sachgebiete Tonträger, SF & Fantasy, Autoren Verlage Glanz & Elend empfiehlt: 20 Bücher mit Qualitätsgarantie Klassiker-Archiv Übersicht Shakespeare Heute, Shakespeare Stücke, Goethes Werther, Goethes Faust I, Eckermann, Schiller, Schopenhauer, Kant, von Knigge, Büchner, Marx, Nietzsche, Kafka, Schnitzler, Kraus, Mühsam, Simmel, Tucholsky, Samuel Beckett Berserker und Verschwender  Honoré
de Balzac Honoré
de BalzacBalzacs Vorrede zur Menschlichen Komödie Die Neuausgabe seiner »schönsten Romane und Erzählungen«, über eine ungewöhnliche Erregung seines Verlegers Daniel Keel und die grandiose Balzac-Biographie von Johannes Willms. Leben und Werk Essays und Zeugnisse mit einem Repertorium der wichtigsten Romanfiguren. Hugo von Hofmannsthal über Balzac »... die größte, substantiellste schöpferische Phantasie, die seit Shakespeare da war.« Anzeige  Edition
Glanz & Elend Edition
Glanz & ElendMartin Brandes Herr Wu lacht Chinesische Geschichten und der Unsinn des Reisens Leseprobe Andere Seiten Quality Report Magazin für Produktkultur Elfriede Jelinek Elfriede Jelinek Joe Bauers Flaneursalon Gregor Keuschnig Begleitschreiben Armin Abmeiers Tolle Hefte Curt Linzers Zeitgenössische Malerei Goedart Palms Virtuelle Texbaustelle Reiner Stachs Franz Kafka counterpunch »We've got all the right enemies.« |
Es muss anlässlich jener pompösen Fahrt der Zarin Katharina II. auf dem Dnjepr im Frühjahr 1787 gewesen sein, als erstmals die Rede von den berühmten Potemkinschen Dörfern aufkam. Hatte doch Katharinas Generalbevollmächtigter und zugleich ihr ehemaliger Liebhaber, Grigori Alexandrowitsch Potemkin, mit viel Farbe, Holz und Leinwand alle erdenklichen Kulissen und bukolischen Arrangements entlang des Stromes inszenieren lassen, um die stets von Langeweile bedrohte Petersburger Hofgesellschaft auf ihrer Reise angemessen zu unterhalten. Potemkins tatsächliche „Dörfer“ sind dagegen real, haben inzwischen eine nach Hunderttausenden zählende Einwohnerschaft und heißen Cherson, Sewastopel, Nikolajew oder Odessa. Als Urheber dieser bis heute sprichwörtlichen negativen Fama nennt der durch seine beiden famosen Stalinbiografien bekannte britische Autor Simon Sebag Montefiore den österreichischen Diplomaten Charles de Ligne. Dieser habe seinem Kaiser [Joesph II.] von leeren Hausfassaden berichtete, die er bei Fahrten über Land bemerkt hatte. Das publizistische Fundament einer erstaunlich langlebigen Diffamierung legte jedoch erst der sächsische Gesandte am Petersburger Hof, Georg von Helbig, der, obwohl selbst nicht Augenzeuge, die gefälschten Ortschaften nicht nur in seiner Korrespondenz regelmäßig erwähnte, sondern auch in seiner später auszugsweise veröffentlichten Biographie über Potemkin.
Hat man dies einmal akzeptiert, darf sich jedoch wer will, auf eine opulente und gleichsam romanhafte Lebensbeschreibung eines außergewöhnlichen Aristokraten freuen, der trotz seiner Extravaganzen und libidinösen Ausschweifungen zu den bedeutendsten Persönlichkeiten des 18. Jahrhunderts gezählt werden muss. Dies gilt nicht zuletzt auch deshalb, weil Potemkins Wirken in den ehemals tartarisch-türkischen Gebieten des nördlichen Schwarzen Meeres noch heute, mehr als 200 Jahre später, deutliche Spuren aufweist. Selbst nach den Umbrüchen der 1990-iger Jahre und dem Ende der Sowjetunion zählen die Gebiete auf der Krim, im Kuban und im nördlichen Kaukasus immer noch zu Russland. Auch der dort ehemals bedeutsame Islam spielt zumindest auf der Krim und im angrenzenden Moldawien kaum noch eine Rolle, nachdem Stalin die letzten Krimtataren während des Zweiten Weltkriegs gewaltsam umsiedeln ließ. Potemkin hingegen hatten ihnen, noch ganz im Stile des aufgeklärten Absolutismus, großzügig Religionsfreiheit gewährt und sogar Gelder aus seiner Privatschatulle für den Erhalt ihrer Moscheen gestiftet. Dass Potemkin die Unterwerfung der auch zu seiner Zeit noch gefürchteten Nachfahren der Goldenen Horde fast ohne militärische Gewalt zustande brachte, ist allerdings für seine Epoche und besonders für die Geschichte Russlands eine durchaus ungewöhnliche Leistung. Montefiore stützt sich in seiner voluminösen Arbeit nicht nur auf archivalisches Material, sondern zieht auch umfangreiche Briefwechsel und eine ungewöhnlich reiche Memoirenliteratur heran. Gerade letztere verleitet ihn allerdings immer wieder dazu, allzu ausführlich auf Intrigen und amouröse Verhältnisse im Umfeld seines Helden einzugehen. Zu oft kommen dabei Geschichten aus einem prallen Hofleben ins Spiel, die man als das übliche „on dit“ besser hätte weglassen sollen. Im Leben des Fürsten Potemkin spielte all das gewiss eine Rolle, aber aufs Ganze überfordert der Autor mit seiner von pikanten Details überfrachteten Darstellung den Leser, zumal sich vieles wiederholt. Montefiores Lebensbeschreibung ist eindeutig keine politische Biografie. So ist die Geschichte Russlands und auch der europäischen Staatenwelt zugunsten der Darstellung persönlicher Verhältnisse, darunter auch vielfach Anekdotisches, auf ein Minimum beschränkt. Auch wenn dies noch in der Absicht des Verfassers gelegen haben mag, bei der nur dürftigen und klischeehaften Schilderung militärischer Abläufe zeigen sich ganz klar seine historiographischen Grenzen. Gerade das Militärwesen des 18. Jahrhunderts und die von Potemkin geleiteten Operationen gegen Türken und Kaukasier erörtert Montefiore nur sehr oberflächlich und offenbar ohne tiefere Sachkenntnis von Struktur und Taktiken spätabsolutistischer Armeen. Dies wäre jedoch nur ein akzidenteller Makel der Arbeit, wenn es der Verfasser zugleich vermieden hätte, allzu ausführlich auf die persönlichen Selbstdarstellungen und Turtellaien zwischen der Zarin und ihrem um zehn Jahre jüngeren Günstling einzugehen. Es gelingt ihm somit nicht, eine ausreichende Distanz zu seinem schwierigen und zwiespältigen Protagonisten aufzubauen, die es ihm vielleicht ermöglicht hätte, plausibel zu erklären, weshalb der neben Zar Peter I. erfolgreichste Russe des 18. Jahrhunderts selbst in der Geschichtsschreibung immer noch als ausschweifender Scharlatan und Blender erscheint, der seine Besucher provokativ im offenen Morgenrock zu empfangen pflegte.
War es tatsächlich so, wie
Montefiore es glauben machen will, dass Peter als Zar den ungeschmälerten Ruhm
für seine Eroberung der Ostsee einstreichen konnte, während Potemkin, den er
eigenartigerweise und fast liebvoll als „Serenissimus“ bezeichnet, als bloßer
Günstling einer sexuell scheinbar unersättlichen Monarchin für seine analogen
Erfolge an den Küsten des Schwarzen Meeres nur Neid und Missgunst ernten
konnte? Die kontinuierlich schlechte Presse des Tauriers schon zu seinen
Lebzeiten irritiert angesichts seiner Leistungen und nach gut 720 Seiten hat man
als Leser das Gefühl, zwar vieles aus dem Leben Potemkins und seiner
unermüdlichen Förderin Katharina erfahren zu haben, aber vielleicht nicht das
Wesentliche. |
Simon Sebag Montefiore |
||
|
|
||||