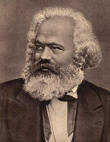|
Andere über uns
|
Impressum |
Mediadaten
|
Anzeige |
|||
|
Home Termine Literatur Blutige Ernte Sachbuch Quellen Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Bilderbuch Comics Filme Preisrätsel Das Beste | ||||
|
Jazz aus der Tube Bücher, CDs, DVDs & Links Schiffsmeldungen & Links Bücher-Charts l Verlage A-Z Medien- & Literatur l Museen im Internet Weitere Sachgebiete Tonträger, SF & Fantasy, Autoren Verlage Glanz & Elend empfiehlt: 20 Bücher mit Qualitätsgarantie Klassiker-Archiv Übersicht Shakespeare Heute, Shakespeare Stücke, Goethes Werther, Goethes Faust I, Eckermann, Schiller, Schopenhauer, Kant, von Knigge, Büchner, Marx, Nietzsche, Kafka, Schnitzler, Kraus, Mühsam, Simmel, Tucholsky, Samuel Beckett  Berserker und Verschwender Berserker und VerschwenderHonoré de Balzac Balzacs Vorrede zur Menschlichen Komödie Die Neuausgabe seiner »schönsten Romane und Erzählungen«, über eine ungewöhnliche Erregung seines Verlegers Daniel Keel und die grandiose Balzac-Biographie von Johannes Willms. Leben und Werk Essays und Zeugnisse mit einem Repertorium der wichtigsten Romanfiguren. Hugo von Hofmannsthal über Balzac »... die größte, substantiellste schöpferische Phantasie, die seit Shakespeare da war.« Anzeige  Edition
Glanz & Elend Edition
Glanz & ElendMartin Brandes Herr Wu lacht Chinesische Geschichten und der Unsinn des Reisens Leseprobe Andere Seiten Quality Report Magazin für Produktkultur Elfriede Jelinek Elfriede Jelinek Joe Bauers Flaneursalon Gregor Keuschnig Begleitschreiben Armin Abmeiers Tolle Hefte Curt Linzers Zeitgenössische Malerei Goedart Palms Virtuelle Texbaustelle Reiner Stachs Franz Kafka counterpunch »We've got all the right enemies.« |
Es war ein revolutionäres Zeitalter, in das der Trierer Karl Marx im Jahre 1818 geboren wurde. Die radikale Phase der französische Revolution lag gerade ein Vierteljahrhundert zurück und innerhalb von nur 60 Jahren sollte das benachbarte Frankreich, an dessen erst kurz zuvor beendete Besatzungszeit sich damals noch die rheinländischen Juden mit nostalgischen Gefühlen erinnerten, insgesamt sechsmal seine Regierungsform ändern. Für die an Hegel geschulte „Generation Revolution“ war klar: Die Welt musste vernünftig sein, auch wenn sie in sich widersprüchlich erschien. Keinesfalls aber war die Vernunft für den jungen Marx, der erst fünf Jahre nach Hegels Tod in der großen Choleraepidemie von 1831 nach Berlin gelangte, in der reinen Idee angelegt. Zeit seines Lebens suchte das eloquente Mitglied des argwöhnisch beobachteten Berliner Doktorenclubs die Bedingungen einer Entfaltung von Vernünftigkeit in den realen politischen Verhältnissen auszumachen. Die wahre Theorie müsse, so Marx 1842 in einem Brief an seinen Kölner Herausgeber Dagobert Oppenheim, innerhalb konkreter Zustände und an bestehenden Verhältnissen klar gemacht werden. Gleichwohl aber übernahm er von der Titanengestalt der spekulativen Philosophie nicht nur die zentrale Denkfigur der Entäußerung und ihrer dialektischen Aufhebung durch die Negation, sondern auch den eschatologischen Glauben an einen vernünftigen Endzustand der Menschheitsgeschichte, in dem alle historischen Antagonismen für immer aufgehoben seien. In seiner knappen aber konzisen Biografie des umstrittenen Begründers des historischen Materialismus lässt der Berliner Autor Rolf Hosfeld keinerlei Zweifel daran, dass gerade diese teleologische Wahnidee von der vollkommenen Umgestaltung aller Verhältnisse Marx’ beeindruckende Leistung als kritischer Philosoph und empirischer Erforscher der kapitalistischen Ökonomie nachhaltig beeinträchtigt hat. Trotz aller niederschmetternden Erfahrungen, wie etwa die des blutigen Scheiterns der Revolutionen von 1848/49 und der Pariser Kommune von 1871, verlor der Londoner Exilant nie den Glauben an den siegreichen Ausgang der Weltrevolution. Enttäuscht von dem Verrat des Bürgertums, das sich 1848 in seinem Erschrecken von dem Gespenst des Kommunismus lieber mit der schon taumelnden Reaktion verbündet hatte, wandte er sich seit 1850 verstärkt dem Studium der politischen Ökonomie zu. Gemäß Hosfeld hatte Marx stets ein ambivalentes Verhältnis zum Kapitalismus, der gerade in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts seine beeindruckenden Kräfte entwickelte. Fraglos stellte diese dynamische Wirtschaftsform in jeder Beziehung die ökonomischen Leistungen vergangener Epochen tief in den Schatten und ließ sie, so Marx in einer elegischen Passage seines kommunistischen Manifestes von 1848, geradezu als dumpfe Bärenhäuterei erscheinen. Der Kapitalismus hatte die gewaltigsten Produktivkräfte der Menschheitsgeschichte geschaffen, aber er zerriss auch alle sozialen Bindungen und vereinzelte die Masse der Menschen, die als Anbieter ihrer Arbeitskraft hilflos den Zufällen eines entfesselten Marktes ausgesetzt waren. Doch nicht nur das enteignete Proletariat, auch der Kapitalist war ein Opfer dieses höchst produktiven, aber zugleich auch zerstörerischen Systems, das ihn um den Preis seiner Rolle als Unternehmer dazu zwang, sein Kapital kontinuierlich zu akkumulieren und ständig nach höheren Renditen zu suchen. Es sei, so Hosfeld, Marx’ genuine Leistung, dieses System ohne jeden moralischen Unterton in seiner Struktur und in seinen inneren Verwerfungen analysiert zu haben. Nicht äußere Faktoren, wie noch seine Vorgänger Adam Smith oder David Ricardo geglaubt hatten, würden zum Untergang der kapitalistischen Produktionsweise beitragen, sondern allein sein immanentes Bewegungsgesetz. Schon die weltweiten Krisen von 1857 und 1873 hatten angedeutet, dass Überproduktion und tendenziell fallende Profitraten die wahren Totengräber des Kapitalismus sein würden. Doch zu Marx grenzenloser Überraschung erholte sich der Kapitalismus immer wieder und trat nach seinen Krisen sogar noch stärker in Erscheinung. Seine Hoffnung, dass sich das scheinbar von allen humanen Lebensbedingungen entfremdete industrielle Proletariat als revolutionärer Protagonist einer neuen kommunistischen Gesellschaft entpuppen würde, hat sich bis heute nicht erfüllt. Gerade in dieser utopischen Ausfaserung liege auch, so Hosfeld, trotz aller bedeutenden Einsichten die zentrale Schwäche seiner politischen Ökonomie. Den revolutionären Übergang zur klassenlosen Gesellschaft konnte Marx, bei aller sonstigen Klarheit seiner Gedanken, stets nur in luftigen Formeln beschreiben. So kann es auch nicht weiter erstaunen, dass Marx gegen Ende seines Lebens alle seine revolutionären Hoffnungen auf das ultrareaktionäre Russland setzte, gegen das er einst einen Weltkrieg hatte entfesseln wollen. Hegte dort doch eine besonders agile Gruppe von Revolutionären, anders als die in Marx’ Augen längst verweichlichte deutsche Sozialdemokratie, radikale Umsturzpläne, waren dort doch, wo schon 1872 eine Übersetzung seines im Westen verschmähten „Kapitals“ erschienen war, auch Bürgertum und Ancien Regime gleichermaßen schwach, das eine noch nicht entwickelt und das andere längst desavouiert. Wie sich herausstellen sollte, war beides tatsächlich eine unschätzbare Voraussetzung für das Gelingen der bolschewistischen Revolution im Jahre 1917. Was aber könnte von Marx’ Lehren 125 Jahre nach seinem Tod im Londoner Exil heute nach aktuell sein? Nach Hosfeld, der hierzu den amerikanischen Philosophen Richard Rorty zitiert, wäre es vor allem die Einsicht, dass demokratische Institutionen und die formale Garantie der Grundrechte offenbar nicht ausreichen, um Zusammenhalt und Fairness unter den Menschen zu sichern. Marx würde uneingeschränkt zu den größten Denkern der Geschichte zählen, wenn er sich, gänzlich befreit von seiner hegelschen Eschatologie, der Suche nach einer realistischen Lösung dieses Problems gewidmet hätte, so wie es schließlich die deutsche Sozialdemokratie mit beträchtlichem Erfolg getan hatte. Dagegen führte die spätere strikte Weigerung der Bolschewisten, mit anderen politischen Kräften zusammen zu arbeiten geradewegs in den Gulag und in den Genozid. Der Gedanke, eine notorisch indifferente Bevölkerung notfalls mit Gewalt in eine neue Menschenklasse zu verwandeln, war im Marxismus mit seinem säkularisierten Chiliasmus immer schon angelegt. Marx war indes nicht der Urheber dieser mörderischen Konsequenz, denn das Massensterben für eine angeblich bessere Welt hatte schon ein Vierteljahrhundert vor ihm auf dem Pariser Place de la Concorde und in den Flüssen der Vendée eingesetzt. So wäre also Hosfelds ausweichende Ambivalenz in der Beantwortung der Frage, welche Verantwortung Marx für die millionenfachen Untaten im Namen seiner Lehre zu tragen hätte, durchaus nachvollziehbar. Mit gleicher Ambivalenz dürfte Hosfeld der auf dem Buchrücken werbewirksam angebrachten Frage: Kommt der große Alte wieder? begegnet sein, war es doch im Gegenteil sein Anliegen, Marx als Produkt der geistigen und materiellen Umwälzungen des 19. Jahrhunderts darzustellen. Allein für diese Zeit trafen seine Analysen und vielleicht auch einige seiner Lösungen zu. Wer aber in Marx den überzeitlichen Propheten einer jetzt endlich herannahenden kapitalistischen Götterdämmerung sehen will, dessen Lösungen angesichts der aktuellen Verwerfungen des Weltfinanzsystems wieder eine unerwartete Konjunktur haben könnten, hat eindeutig den Boden wissenschaftlicher Seriosität verlassen.
Auf Hosfelds konsequent
ideengeschichtlich gestaltete Biographie trifft diese Invektive jedoch nicht zu.
So erwähnt er nur die notwendigsten Lebensschritte des Trierers und verzichtet
auch auf eine breitere Darstellung seiner familiären oder finanziellen
Verhältnisse. Allerdings hätte man sich als Leser von Hosfeld eine klare
Positionierung seiner Studie innerhalb der aktuellen Forschungsdiskussion
gewünscht. Das bleibt ein Makel des Buches, allerdings auch der einzige.
|
Rolf Hosfeld
|
||
|
|
||||

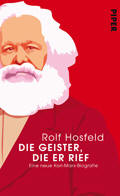 Karl
Marx - Der große Alte
Karl
Marx - Der große Alte