Am Tag danach
«Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau herausfindet, wozu das Universum da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch noch etwas Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. – Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist.» – Douglas Adams. Er wäre am 11. März sechzig Jahre alt geworden.
Populistische Neinsager
Gut, dass es endlich vorbei ist. Zwar gab es auch Lichtblicke in der breit geführten Diskussion um die besondere Schutzwürdigkeit der Buchbranche: In einer «Brennpunkte»-Sendung von Radio DRS zum Beispiel Hans-Jürg Fehr, der mit der Erfahrung der Verlegerperspektive gesellschaftlich argumentierte und die ökonomischen Hintergründe der kulturellen Vielfalt verteidigte. Oder Ruth Schweikert mit ihrem geistvollen und witzigen Text über illusorische Ersparnisse und den anderen Reichtum, den Bücher geben.
Aber zu oft fühlte man sich in den vergangenen Wochen wie in einem unfreiwillig komisch vor sich hineiernden Dorftheater, wenn man den Argumenten der Gegner einer Buchpreisbindung zuhörte. Mal durfte ein lokaler Platzhirsch, der Buchhandlung und Druckerei geerbt hat, von sich geben, dass ihm als Unternehmer die Preisbindung «ein grosses Stück Handlungsfreiheit» nehmen würde. Mal versuchte der SVP-Nationalrat Reimann seinen Zuhörern weiszumachen, es seien ausländische Verlage, die mit überhöhten Preisen Schweizer Buchkäufer abzocken wollten. Erkennbar waren die populistischen Neinsager an ihren Worthülsen, die vor allem eins ahnen ließen: ihre eigene Ferne zu Büchern und nachdenklichem Lesen.
Geiz als Motivation des Politischen
Zu den Formen, mit denen die Niederlage am Tag nach derAbstimmung verarbeitet wurde, gehörte ein Facebook-Link. Marianne Sax, Buchhändlerin in Frauenfeld und durch ihre Arbeit für den SBVV ohnehin eine Befürworterin der Preisbindung, verwies neben ihrem Foto mit dem roten Ja-Button auf ein Tagi-Interview mit der Überschrift «Viele Deutsche sehen in Schweizern eine Art verschärfte Schwaben». Der Korrespondent der «Süddeutschen Zeitung» erläuterte darin, wie anders er die Schweizer zu sehen gelernt hat, differenzierter als es das Schwaben-Etikett seiner Landsleute meint; zugleich bereitete er mit subtilen Komplimenten die Werbekampagne für sein neues Buch über die Schweiz vor.
Dem Artikel fehlt aber eine erläuternde Fußnote: denn der aus Hessen stammende Journalist versteht unter «Schwaben» vermutlich noch etwas anderes als Schweizer Zeitungsleser. Schwaben sind für ihn jene süddeutsche Mentalitätsgruppe rund um die baden-württembergische Landeshauptstadt Stuttgart, die sich neben ausgeprägtem Ordnungssinn immer wieder durch besonders individualisierten Geiz und ein nerviges Gelddenken auszeichnet. Verschärftes Erkennungszeichen: Jener Mietshaustyp im Schwäbischen mit einem individuellen Lichtschalter in jeder Wohnung für die Beleuchtung des gemeinsamen Kellergangs; der sorgt dafür, dass keiner die (mikroskopischen) Kosten einer 60-Watt-Funzel mittragen muss, die ein anderer Mieter aus Versehen mal nicht ausknipst.
Gestern hat in der Schweiz, um es knapp zu sagen, das kurzatmige Gelddenken einer Minderheit für eine weitere Schwächung eines differenzierten Angebots von Büchern vor Ort votiert. Ein Viertel aller Stimmbürger gab, zusammen mit jener schweigenden Mehrheit, die seit langem demokratische Abstimmungen am liebsten rechts liegen lässt, den Ausschlag.
Reguliertes Glücksspiel – deregulierter Buchmarkt
Es bleibt eine kuriose Koinzidenz: Am Tag, als das Stimmvolk mit überdeutlicher Mehrheit eine Deregulierung des bisherigen Glücksspiel-Systems ablehnte – dort darf alles übersichtlich weitergehen, wie es war – am selben Tag stimmte es auch mit deutlichem Mehr dafür, dass die Organisation eines Kulturguts namens Buch ohne den geregelten Schutz bleibt, den es gebraucht hätte. Notwendig gebraucht, um den schwierigen Übergang in der Darreichungsform, dem Wechsel vom Papier zum Display, in einem geordneten Rückzug zu verkraften. Dass die Neinsager sich vorstellen können, welche Marktmechanismen sie in weitere Bewegung setzten, kann bezweifelt werden.
Der Zufall wollte es, dass an eben diesem Abstimmungs-Sonntag im Branchen-Magazin «BuchMarkt» einer der erfolgreichsten Buchhändler, Hermann-Arndt Riethmüller vom süddeutschen Filialisten Osiander, bei einer Frage nach der «digitalen Revolution» zu Protokoll gab: „Das ist richtig. Wir haben aber auch (im Gegensatz zum übrigen Einzelhandel) das Privileg der Preisbindung, und wir sollten die Chance nutzen, die unserer Branche dadurch gegeben wird, dass sich der Wettbewerb im Dienstleistungsbereich, nicht im Preisbereich, abspielt.“
Der Sinn des "Tiefen Lesens"
Osiander, mit einer der größten Filialen in Konstanz nur wenige hundert Meter hinter der Grenze, kann dem ohnehin starken Einkaufstourismus Schweizer Buchliebhaber nach dieser gezielten Schwächung des Schweizer Buchhandels durch ein Viertel der Stimmberechtigten noch gelassener entgegen sehen. Man vertut weder in Deutschland noch in Österreich oder Frankreich als Buchhändler seine Zeit mit dem Revidieren von Preisschildern. Schnäppchen für die Jäger gibt es nebenbei genug. Dass eine militante Geiz-ist-geil-Gruppe ein gewachsenes Qualitätssystem der Buchbesorgung aufs Spiel setzen könnte – diese Option hatten deutsche Wähler glücklicherweise bisher nicht. Dort sichert eine vom Parlament beschlossene Preisbindung einen Rahmen, in dem vorerst die Qualität der Dienstleistung für Kunden finanziert werden kann. In einem Buchhandel, der seit Jahren mit Umsatzschwund zu kämpfen hat, muss neben qualifizierter Beratung ein Ambiente entwickelt werden, das auf gesteigerten Bedürfnis der Käufer nach Lustgewinn rund um den Kauf der Ware Buch reagiert.
Denn es gibt immer noch beträchtliche Zielgruppen der Buchkäufer («Hedonisten», «Performer», «Liberal-Intellektuelle», wie sie in neuen Sinus-Studien unterschieden werden). Sie kommen aus einkommensstarken Milieus, die «Tiefes Lesen» weiterhin zur Lebensqualität rechnen. Wer die Thesen der amerikanischen Neurowissenschaftlerin Maryanne Wolf ernst nimmt, sorgt dafür, dass Kinder in einem Haus mit Büchern aufwachsen, deren Inhalt auf Papier gedruckt ist und die Freude einer tieferen Leseerfahrung ermöglichen.
Wind of Change
In der Schweiz wird man zuschauen können, wie das lukrative Segment des Buchgeschäfts, die ständig wechselnden Bestseller, bald von anderen Verteilern angegangen wird. Die Prognose steht, dass sich spezialisierte Discounter die saisonalen Seller greifen werden. Profitmaximierung über das problemlose Geschäft mit den schnellen Drehern. Dieser Teil der Ware Buch wird abwandern in andere Läden des Einzelhandels und den bestehenden Buchhandlungen einen Umsatzanteil wegbrechen, den für die risikoreichere Arbeit mit langsamer gängigen Titeln gebraucht haben.
Es gehört zu den atrocities, dass man nun noch die rostigen Worthülsen um einen der markanten Aberglauben der westlichen Neuzeit lesen muss, die fatalistische Mär vom sich selbst regulierenden Markt, wie sie am Abstimmungsabend die NZZ auftischte («Jetzt hat das Stimmvolk diesem regulatorischen Übereifer einen Riegel geschoben. Genauer: Die Deutschschweizer Stimmberechtigten haben verfügt, dass nicht Verleger und Buchhändler die Preise ihrer gedruckten Produkte bestimmen sollen, sondern der Markt.»)
«Markt» meint in diesem Fall den langsamen Niedergang von Buchhandlungen in ruinösen Preiskämpfen, die den Online-Händlern nützt mit Steuersitz in Anderswo. Und was nützt es, möchte man fragen, einen Riegel zu schieben, wenn durch die Wucht dann Steine in einer Mauer gelockert werden, durch die ohnehin der Wind of Change pfeift.

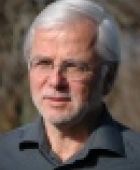


@ Johannes. Ihrem Kommentar kann ich mehrheitlich zustimmen. Mit einigen Quererinnerungen freilich: Während meiner Jahrzehnte als Buchhändler in Konstanz hatte ich oft Unstimmigkeiten mit Kunden, die den - im Vergleich zum englischen Pfund-Preis – viel höheren Import-Preis der Penguin-Bücher monierten. Dass man da einen Zwischenhändler bezahlen musste, weil man vor der Zeit des Online-Banking sonst bei einer Einzelüberweisung an einen englischen Verlag mehr Spesen verloren hätte, als das Buch kostete: das war ein Denkschritt, den die Kunden erst nachvollziehen musste. Oder einem Kunden klarzumachen, dass zur Besorgung eines Titels aus einem Schweizer Verlag ungewöhnlich hohe Portokosten und Zollgebühren hinzukommen, war schwer zu vermitteln. Irgendwann habe ich dann lachend gesagt: Fahren Sie doch nach Sizilien, dort kosten die Zitronen auch viel weniger als in einem Laden bei uns... Bei einigen hat es dann Klick gemacht.
Dass importierte deutsche Bücher in der Schweiz teurer sein müssen, versteht sich nicht nur von den – je nach Stadt – saftigeren Forderungen der Ladenvermieter. Es versteht sich vor allem aus den höheren Löhnen; all die Geiz-ist-Geil-Abstimmer in der Schweiz haben zugleich für Lohndumping gestimmt. Und sie müssen sich fragen lassen, ob sie – wie dies nicht wenige Buchhändlerinnen in Deutschland tun – für weniger als 10 Euro in der Stunde arbeiten würden. In die Schweiz sind deutsche Buchhändlerinnen gern ausgewichen, weil hier maßvoll besser bezahlt wurde. Das wird bald zu Ende sein.
Zu den historischen Versäumnissen des Schweizer Verbands und der Schweizer Auslieferungen, die die Tabelle mit den Umrechnungskursen den deutschen Verlagen vorlegten und durchsetzten, gehört allerdings: dass sie den in den letzten Jahren steil ansteigenden Frankenkurs ihren Kunden viel zu spät weiterzugeben begannen. Und dass sie die Transparenz unterschätzten, die das Internet dem mündigen Kunden auf einmal ermöglichte. Das Ressentiment, oft eine Art kleinlicher Rachsucht, war bei vielen Äusserungen der Gegner dieser Vorlage zu merken. Ob sie jemals sich selbst beobachtet hatten, wie leicht sie bei jeder Pizza in Zürich das Drei- und Vierfache bezahlten vom Preis jenseits der Grenze? Und wie ohne mit der Wimper zu zucken sie ihr Glace in Basel viel teurer bezahlten als das Eis im nahen Lörrach? Ja, wie kam es, dass die Deutschschweizer ausgerechnet bei den Büchern aufs Preisschild zu starren begannen? Sozialpsychologen sollten jetzt noch ganz rasch eine Untersuchung beginnen, um die sehr unterschiedlichen Motivationen des Nein aufzufächern. Es wäre für Generationen, die Bücher auf Papier so behutsam anblicken werden wie Musik auf Schellack-Platten oder CDs, ein interessantes Bild derzeitiger Mentalitäten.
@gast: Das hätten Sie nun aber einfacher haben können, ohne Google: Ich verberge ja meine Berufserfahrung nicht, im vorhergehenden Blog-Beitrag auf Journal 21 war das zu lesen, dass ich Jahrzehnte als Buchhändler gearbeitet habe und immer noch Verleger bin. Man sollte schreiben, wovon man etwas versteht, bei mir ist es diese Buchbranche aus drei Blickwinkeln: Leser (Buchliebhaber), Buchhändler, Verleger. Die Google-Gläubigkeit hat noch andere Schattenseiten. Google findet nur, was im Netz sichtbar ist. Einen wichtigen, aber nur geringen Teil der Wirklichkeit. Meine enragierte Stellungnahme zum Abstimmungsergebnis hat als Hintergrund: Von 1994 bis 2010 hat ein unabhängiges Branchenmagazin („BuchMarkt“) monatlich auf zwei Seiten meine kritische Sicht auf neue Entwicklungen der Buchbranche veröffentlicht; Buchpreisbindung war ein Thema seit den 90er-Jahren. Dass da seit Jahren der Übergang ins Digitale ein Thema war, ist selbstverständlich. Steht nicht im Netz, aber ist in gut bestückten Universitätsbibliotheken zu lesen...
Schön, dass der Artikel kontrovers gelesen wird. Die Schreibart war so angelegt, dass ich die Retourkutschen als durchaus gerecht empfinde. Das wird meinen Widerspruch aber nicht mindern. Um für heute mit "Buchpirat" ganz unten zu beginnen, der diesen Kommentar vor Tagen schon bei http://www.tgkulturagenda.ch/index.php?article_id=1616&rubrik=&clang= gebracht hat, also identisch ist mit dem Schreiber oder Pseudonym Erich Zann:
Zwangsherrschaft ist in der Schweiz schon länger abgeschafft. Glücklicherweise. Herrschaftsformen, mit denen die einen die andern hin und wieder überwältigen gibt es aber noch genug. Bei dieser Abstimmung über die Preisbindung hat das deutschschweizer Stimmvolk wie schon bei manchen Abstimmungen die welschen Kantone überwältigt. Diesmal aber hatten die Welschen die grössere Erfahrung in der Sachfrage: Sie haben bereits 9 Jahre ohne Preisbindung hinter sich und wissen, wie ungut oder auch verheerend das für sie wurde. Sie unterlagen mit ihrem Votum für gesicherte Verhältnisse, weil in der Deutschschweiz das Ressentiment stärker war als die Einsicht, dass man eine ohnehin gefährdete Infrastruktur nicht mutwillig beschiessen sollte.
Am Tag nach der Abstimmung hatte ich mit zwei deutschen Buchhändlern im Bodenseeraum Kontakt. Sie freuen sich über das Ergebnis. Sie wissen, dass der Niedergang der Schweizer Buchhandlungen ihnen mehr Kunden bringen wird.
Was die Geiz-ist-geil-Mentalität der vorherigen Kommentatoren betrifft, so ist ihnen offenbar wurscht, was die Arbeitenden verdienen. Hauptsache, sie haben das Gefühl!!! Das Gefühl ist wichtig, sie könnten etwas profitieren. Von Nachhaltigkeit und gerechten Lohnverhältnissen haben sie keine Ahnung, weil sie selber nicht in den Verhältnissen arbeiten müssen! Sie würden wohl auch "Begleitmassnahmen" für solche "Freizügigkeiten" in der Entlöhnung für ihre Profitchen ablehnen...
Jeder Mensch hat ein Anrecht darauf, da wo er lebt eine auskömmlich bezahlte Arbeit zu bekommen, statt europaweit auf Wanderschaft gehen zu müssen. Von den sicheren Familienverhältnissen ganz zu schweigen...
Erst denken und dann bestellen. Aber denken bedeutet, auch das Kleingedruckte zu lesen!
Ich bin seit 40 Jahren Buchhändler mit Lehre im Verlag und habe seit 35 Jahren einen kleinen Spezialbuchladen.
Ich bin froh um den endgültigen Wegfall der Buchpreisbindung!
Das Buch kann mit anderen Mitteln besser gefördert werden, als mit einem Zwangsverkaufspreis, der vom Verlag festgelegt wird, welcher keine Ahnung von den Verhältnissen in Buchhandlungen hat.
Seit 200 Jahren beträgt der Rabatt 30 % vom Verkaufspreis. Sie könnten sich mal vorstellen was das für die Fixkosten bedeutet. Es ist unsinnig, gerade vom kleinen Buchhändler zu verlangen, dass er den schmalen brutto!! Rabatt mit vermehrtem Umsatz ausgleichen soll!
Erinnern Sie sich nicht mehr an die unseligen Diskussionen um Umrechnungstabellen für andere Währungen? Kennen Sie die Rabatte an Endverbraucher nicht, die schon immer über das Erlaubte hinaus gewährt worden sind?
Es ist völlig natürlich, dass Erdbeeren, Bohnen und Bananen verschieden hohe Preise haben. Das ist bei Büchern genauso! Und daran sollen sich Kunden gewöhnen! Wie bei anderen Markenartikeln!
Nicht zu vergessen der finanzielle Anteil deutscher Verlage an den Grossvertrieben und dieser wiederum an den schweizer Verteilzentren. Da wird nicht nur der Endpreis vorbestimmt, sondern auch dazwischen...
Wieso kommt eigentlich niemand auf den Büchertarif der Post zurück, den die Bürgerlichen abgeschafft haben? Grosse Verteiler profitieren von individuellen Abmachungen mit Transporteuren für Billigbeförderungen zu ihren Kunden...
Ich hatte kürzlich ein Buch in Österreich zu bestellen, weil Thalie das für den Kunden nicht machen wollte. Offiz. VP 26 Euro. Versand 6 Euro. Rabatt 30 %. Wie soll ich im vorgeschriebenen Rabatt noch etwas verdienen?? Weil es relativ lange dauerte, reklamierte ich und bekam dann noch ein Zweites Buch zugeschickt, welches ich wiederum für CHF 13.- zurückschicken musste...
Sie können es drehen und wenden wie Sie wollen, arbeiten Sie doch einfach mal in einem Buchladen!
Also anscheinend muss auch die Buchbranche erstmal die ”4 Stadien der Trauer” durchlaufen, im Moment befinden sich deren Exponenten wohl immer noch in der ersten Phase, Nicht-Wahrhaben-Wollen dass das Volk nunmal ihre Zwangsherrschaft nicht mehr haben wollte und sie durch ihr eigene Borniertheit und Unausstehlichkeit ihrer Vertreter kolossal an der Urne gescheitert sind. :D
Und zwischen den Zeilen gelesen merkt man halt schon dass die selbsternannten Gralswächter der Literatur in ihrem Elfenbeinturm der Arroganz sehr bedauern, dass das Preisdiktat nicht einfach nach Gutsherrenart von oben herab dem Volk aufgestülpt werden konnte so wie in Deutschland sondern das von ihnen so sehr verachtete gemeine Volk das letzte Wort behielt.
Aber egal, nach der Ablehnung kann diese verkrustete Buchbranche nun endgültig aufs Abstellgleis geschoben werden, wo sie weiter vor sich hin verrotten können bis auch der letzte Dinosaurier endlich ausgestorben ist... :))
Im 21. Jahrhundert gibt es nunmal kein Platz mehr für so verbohrte Ewiggestrige die nur kramphaft an an alterhergebrachten Konzepte aus Vergangenheit festklammern können statt innovativ auf die neuen Bedürfnisse einzugehen und den Aufbruch ins digitale Zeitalter als Chance wahrzunehmen die Kundschaft nicht mit noch mehr Repression zu begegnen, sondern mit Nutzerfreundlichkeit.
"Ja, siehst du wohl! Ich dacht'es gleich!" (Wilhelm Busch): Was ich als Leser vermutete, bestätigte sich innert Sekunden (dank Google): der Verfasser des stellenweise eher unsachlichen, ja gehässigen Artikels ist Verleger und Buchautor, also an der Aufrechterhaltung der Buchpreisbindung direkt interessiert! Eine Offenlegung dieses Interesses wäre ehrlich gewesen und hätte dem heute vielbeschworenen Gebot der Transparenz entsprochen.
Der Schreibende liebt es, in Buchhandlungen zu stöbern und einzukaufen; er gehört zu den vom Artikelautor beschworenen Freunden des "tiefen Lesens", und er hat auch dafür gesorgt (mit Erfolg), dass sein Sohn "in einem Haus mit Büchern" aufwuchs. Trotzdem hat er sich vehement für eine Verwerfung des Buchpreisbindungsgesetzes (BuPG) eingesetzt, und zwar - weil er überzeugt ist, dass sich der Strukturwandel, der auch die Buchhandels- und Verlagsbranche erfasst hat, nicht rückgängig machen lässt; - weil die betroffenen Buchhändler und Verleger, die sich allzu lange an ihr Preisbindungsprivileg geklammert haben, den Realitäten des Internetzeitalters endlich ins Auge blicken sollten.
Der SBVV hat seine Sache denkbar schlecht vertreten: - Er hat während Jahren für eine juristische Auseinandersetzung durch alle Instanzen viel Geld ausgegeben, das er besser rechtzeitig in ein modernes verbandsweites Bestellsystem investiert hätte. - Er hat nach dem vollständigen Scheitern seiner Beschwerden das Kunststück fertiggebracht, das Parlament zum Erlass eines Spezialgesetzes zu veranlassen, dessen Verfassungswidrigkeit offen zu Tage lag, aber im Falle eines Scheiterns des Referendums bedeutungslos gewesen wäre, weil die Bundesverfassung die Überprüfung von Bundesgesetzen (noch) verbietet. - Er hat nicht rechtzeitig gemerkt, wie schlecht das BuPG formuliert war, so dass mitten im Abstimmungskampf u.a. Streit darüber entstand, ob das Gesetz auf Direktbestellungen schweizerischer Kunden im Ausland anwendbar sein werde oder nicht. - Er hat noch im Abstimmungskampf mit den gleichen "rostigen Worthülsen" um sich geworfen, welche von den Wettbewerbsbehörden, vom Bundesgericht und vom Bundesrat eingehend geprüft und verworfen worden waren: * es gehe darum, das "Kulturgut Buch" zu schützen, das keine Ware sei; * nur die Preisbindung könne den Autorinnen und Autoren ein Auskommen sichern (die Autorenförderung war aber im BuPG mit keinem Wort erwähnt!) ; * ohne Preisbindung werde den Buchhändlern das lukrative Geschäft mit Bestsellern entrissen und dadurch die Quersubventionierung weniger populärer Titel verunmöglicht etc. etc. - Er hat schliesslich nicht fertig gebracht, dass seine Präsidentin und die weiteren Befürworter der Preisbindung gut vorbereitet in die "Arena" stiegen, welche dem BuPG gewidmet war.
Welche Auswirkungen die endgültige Abschaffung der Buchpreisbindung haben wird, kann niemand genau voraussagen. Die gebetsmühlenartig vorgetragenen Hymnen auf das "Kulturgut Buch" können aber nichts an der Tatsache ändern, dass das Buch nicht nur ein Kulturgut, sondern - auch - eine Ware ist, und zwar dank Gutenberg eine Massenware; warum das Buch anders behandelt werden sollte als andere Kulturgüter (wie z.B. die Tonträger, deren Branche den Strukturwandel schon durchgestanden hat), ist nicht einzusehen.
Die - nicht wenigen - SBVV-Mitglieder, welche das Gesetz ablehnten, werden nun weiterhin energisch darauf hinarbeiten, sich an die neuen Gegebenheiten (insbesondere an die Veränderung des Kaufgewohnheiten) anzupassen. Ein Gleiches zu tun, sei den anderen Mitgliedern sowie den Autorinnen und Autoren empfohlen.
Ich habe mir einige Male Bücher aus Deutschland kommen lassen, weil sie in schweizerischen Buchhandlungen nicht erhältlich waren oder weil ich ihren Preis als übersetzt empfand. Es ist zwar anzunehmen, dass deutsche Buchhändler über einen grösseren Kundenstamm als schweizerische verfügen und darum in der Preiskalkulation etwas beweglicher sein können. Wenn es aber vorkommt, dass die Preisunterschiede gewisse Grenzen überschreiten, so wird es ungemütlich. Niemand bestreitet, dass Bücher zum Kulturgut gehören und dass man deswegen etwas anders kalkuliert, als wenn es nur um Bratwürste und dergleichen ginge. Es gibt aber meines Erachtens Grenzen dessen, was man als «kaufmännischen Anstand» betrachtet, und da wurde ich bisher den Eindruck nicht los, dass dieser im Buchhandel nicht gleich gewogen wurde wie in anderen Branchen. Ich glaube im übrigen nicht, dass wegen der Aufhebung der Buchpreisbindung die Welt des schweizerischen Buchhandels unergehen wird.
Ich stelle fest: wer gegen die Preisbindung war, kann nur bedingt zur denkenden, verantwortungsbewussten Menschheit gezählt werden. Von nah besehen: eigentlich überhaupt nicht, jedenfalls ist das aus dem Beitrag zu schliessen. Allerdings übersieht Faunde, dass Leser (und vor allem die helvetischen Schwaben) auch rechnen können. Und hin und wieder die aufgedruckten Euro- und Frankenpreise vergleichen und dann bass erstaunt sind. Und es sind möglicherweise nicht nur neoliberale Nationalkonservative, die zum Schluss gekommen sind: so geht das nicht. Und noch etwas: die Verunglimpfung Andersdenkender macht auch vor dem erlauchten Kreis der Buchliebhaber offenbar nicht halt.
Ihr von der Schweizer Buchbranche habt uns lange genug jahrzehntelang mit willkürlich diktierte Buchpreise abgezockt - nur zu gut sind die Zeiten noch in Erinnerung geblieben, als Bücher in der Schweiz im Vergleich zu Deutschland stets um mind. 30% teurer, wenn nicht gar mehr angeboten wurden und man dem margengierigen Buchpreisfilz alternativlos ausgeliefert war, in jenen Zeiten als es noch keine Ausweichmöglichkeit auf Amazon gab.
So braucht ihr euch nicht zu wundern, dass ihr für eure dummdreiste Profitgier, elitäre Nutzniesserpolitik und Protektionismus nach Gutsherrenart nun endgültig abgestraft und für alle Zeiten entmachtet worden seid!
Ich persönlich jedenfalls werde als Folge dieser unsäglichen Vorlage, welche uns Bürger ein unannehmbares Bevormundungsregime und erhebliche Einschränkungen unserer Freiheiten bedeutet hätte - auch und vor allem im Internet - jedenfalls konsequent mit keiner Buchhandlung mehr geschäftlich verkehren - und dies auch alle meinen Freunden und Bekannten zu empfehlen gedenke - welche zusammen mit dem Buchverband uns ein solch repressives Kartellpreisdiktat aufnötigen wollte!