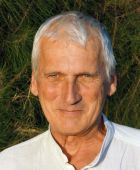Böser Hacker, digitaler Robin Hood oder Hoffnungsträger?
Ein bubenhaftes Gesicht, struppiges Haar – Rui Pinto wirkt auf den ersten Blick keinesfalls böse. In Portugal wird er jedoch des Datenraubes und der versuchten Erpressung beschuldigt. Aus diesem Grunde liess die Justiz den jetzt 31jährigen früheren Studenten der Geschichte aus Vila Nova de Gaia nahe Porto per europäischem Haftbefehl suchen. Er wurde im Januar 2019 in Budapest gefasst und im letzten März an Portugal ausgeliefert. Seitdem sitzt er in einer Zelle der portugiesischen Kripo in H-Haft.
Bis zuletzt hatte er sich gegen seine Auslieferung gestemmt. Er sah darin eine Frage von Leben oder Tod. Er erwarte in Portugal keinen fairen Prozess, sagte er Anfang 2019 dem «Spiegel», denn er hatte sich mit der «Mafia» Fussballs angelegt. Er liess bei einer Gelegenheit wissen, dass er mit der französischen Justiz über die Einbeziehung in ein Programm für den Schutz von Zeugen in Kontakt gestanden habe. Nur habe sein eigenes Land, Portugal, diese Pläne durchkreuzt.
Autodidakt mit Raffinesse
Schon als Kind mochte Rui Pinto eigentlich den Fussball. Er interessierte sich bald aber auch für dessen dunkle Seiten, nach denen er eifrig grub. Als Autodidakt legte er sich technische Kenntnisse und Ausrüstungen zu, um fremde E-Mail-Konten und Server auszuspähen, so die in Portugal erhobene und vor einigen Wochen modifizierte Anklage, die ihm 90 Delikte vorwirft – oder besser: bisher vorwarf. Niemand weiss nämlich, in welche Computer er noch eingedrungen ist und was er noch entdeckt hat.
Rui Pinto gründete 2015 die Enthüllungsplattform «Football Leaks». Unter dem Decknamen «John» belieferte er den «Spiegel». Er sammelte mehr als 70 Millionen Dokumente von Clubs, von Spielern und vom Fonds Doyen Sports. Mehr als 300mal soll er gar die EDV der Generalstaatsanwaltschaft in Lissabon «angezapft» haben. Ihm wird jedoch auch vorgeworfen, vom Fonds Doyen zwischen 500'000 und 1 Million Euro verlangt zu haben, um von der Veröffentlichung gewisser Dokumente abzusehen. Und so geht er nicht mehr so leicht als ein von rein idealistischen Interessen geleiteter Whistleblower durch.
Vom Fussball zu den «Luanda Leaks»
Wie kürzlich bekannt wurde, betreffen seine Enthüllungen derweil nicht nur den Fussball. Am 26. Januar bestätigten Rui Pintos Anwälte, dass der junge Hacker geholfen habe, die dubiosen Geschäfte der als «Prinzessin» von Angola apostrophierten Isabel dos Santos – der 46jährigen Tochter des langjährigen Staatspräsidenten José Eduardo dos Santos ‑ zu enthüllen. Er habe die durch «Luanda Leaks» bekannt gewordenen Dokumente über ihre Geschäfte der französischen Plattform PPLAAF (Plateforme de Protection des Lanceurs d’Alerte en Afrique) zugespielt.
Das war im Dezember 2018, also nur kurz vor seiner Festnahme und vor der Beschlagnahme aller Computer, Festplatten und sonstiger Datenträger aus seinem Besitz. Von 2015 bis zu seiner Festnahme soll er insgesamt 26 Terabyte an Daten angehäuft, aber nur 3,4 Terabyte öffentlich zugänglich gemacht haben. Einen Grossteil dieser Daten hatte er verschlüsselt, und noch ist der Kripo die Entschlüsselung nicht gelungen.
Während er auf die Entscheidung über seine Auslieferung aus Ungarn wartete, durften dort immerhin Beamte der französischen Justiz die bei ihm sichergestellten Daten kopieren – und zwar ohne Kenntnis der Behörden in Portugal. Die Franzosen sollen befürchtet haben, dass die Daten in Portugal verschwinden könnten.
«Es gibt noch viele Sachen, die die Portugiesen erfahren sollten», liess er vor einigen Tagen im Kurznachrichtendienst Twitter wissen. Er bezog sich etwa auf die Erteilung von «goldenen Visa», mit denen Portugal betuchte Bürger aus Nicht-EU-Staaten für den Kauf von teuren Immobilien belohnt – und ihnen dafür die freie Fahrt im Schengener Raum ermöglicht. Weitere wissenswerte Details beträfen die einst mächtige und auch international vernetzte portugiesischen Finanzgruppe Espírito Santo, die im Sommer 2014 kollabierte.
Ein «politischer Gefangener»?
Schon vorher hatte er Hoffnungen auf brisanten Enthüllungen geweckt. Als «politischen Gefangenen» sah ihn der bekannte TV-Kommentator Miguel Sousa Tavares. Nach seiner Ansicht hätte es Rui Pinto verdient, an einem 10. Juni, dem portugiesischen Nationalfeiertag, einen Orden zu bekommen, und er sollte Ermittlungen leiten, anstatt in U-Haft zu schmachten. So wird Rui Pinto zu einem Mann, der womöglich zu viel weiss, hochstilisiert.
Noch stand sein Name nur für Enthüllungen aus der Welt des Fussballs, da bekam er im April 2019 von der Linken im EU-Parlament einen Preis für Whistleblower zuerkannt. Er teilte sich diesen unter anderem mit Julian Assange, dem Gründer der Plattform Wikileaks. Überreicht bekam er den Preis durch die damalige portugiesische EU-Parlamentarierin Ana Gomes vom derzeit regierenden Partido Socialista. Sie prangert schon seit Jahren unermüdlich die Korruption ebenso an wie alle Versuche, diese unter den Teppich zu kehren. Für sie ist es unverständlich, dass Pinto in Haft sitze, während Kriminelle auf freiem Fuss seien. Eine Kommentatorin sah in ihm einen «digitalen Robin Hood».
Die Empörung erscheint verständlich, und die U-Haft von Pinto mutet unverhältnismässig an. Unter juristischen Aspekten wäre es aber nicht leicht, ihm die Strafverfolgung ganz zu ersparen, auch nicht im Lichte der Regeln für den Schutz von Whistleblowern, die das EU-Parlament noch im letzten Jahr gebilligt hatte. Sie gelten insbesondere für Personen, die im beruflichen Kontext an gewisse Informationen gelangt sind und diese im öffentlichen Interesse ans Licht bringen. Rui Pinto aber hat als Hacker agiert und sogar staatliche Stellen ausgespäht, anstatt seine Entdeckungen mit den zuständigen Behörden zu teilen und ihnen die Ermittlungen zu überlassen. Noch im Januar lehnte es eine Richterin ab, Rui Pinto gegen Kaution freizulassen.
Wenn es Rui Pinto darum ging, die strafrechtliche Ahndung gewisser Machenschaften zu erleichtern, so dürfte er sich der eigenen Sache wenigstens in Portugal zudem keinen guten Dienst erwiesen haben. Er mag das wirtschaftliche Imperium von Isabel dos Santos erschüttert und viele Personen in Erklärungsnot gebracht haben. Auf illegale Art – also etwa durch einen Hacker - beschaffte Dokumente haben vor portugiesischen Gerichten aber keine Beweiskraft. Es bleibt den Behörden unbenommen, auf zulässige Art nach den gleichen Beweisen zu suchen – wobei fraglich wäre, ob sie wirklich fündig werden wollen.