Wie die AHV-Zeitbombe entschärfen?

Nach dem Scheitern der Altersvorsorge-Vorlage in der Volksabstimmung vom 24. September 2017 hat der Bundesrat Ende Juni 2018 vorgeschlagen, das ordentliche Rentenalter der Frauen von 64 auf 65 Altersjahre und den Normalsatz der Mehrwertsteuer um 1,5 Prozentpunkte zu erhöhen.
Die eidgenössischen Räte haben Ende September 2018 ein Paket verabschiedet, das
Dr. rer. pol. Armin Jans war 2002 bis 2014 Professor für Volkswirtschaftslehre an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Winterthur und 1999 bis 2011 Mitglied des Bankrats der Schweizerischen Nationalbank. Er ist Mitherausgeber des Buchs «Krisenfeste Schweizer Banken?» (NZZ-Libro 2018).
Kontakt: armin.jans@datazug.ch
neben einer Neuauflage der Unternehmenssteuerreform ab 2020 zusätzliche Einnahmen für die AHV von jährlich mindestens 2 Milliarden Franken vorsieht. Die Volksabstimmung wird voraussichtlich im Mai 2019 stattfinden.
Alle diese Massnahmen würden die AHV primär mit zusätzlichen Einnahmen stabilisieren, und das nur bis zum Jahr 2030. Hier werde ich aufgezeigen, welchen Beitrag eine Anhebung des Referenzalters auf 66 und auf 67 Jahre für die Sicherung der AHV leisten kann. Schliesslich mache ich einen Vorschlag, der die AHV bis 2034 finanziell stabilisiert und dazu noch konsensfähig sein dürfte.
Wie es um die AHV bestellt ist
Gegenwärtig ist die AHV der wichtigste Pfeiler der Altersvorsorge. 2016 richtete sie Altersrenten von 42,3 Mrd. Franken aus, die Pensionskassen solche von rund 25 Mrd. Franken sowie 6,8 Mrd. Franken in Form von Kapitalleistungen bei der Pensionierung. (1*) Ohne neue Massnahmen sieht die zukünftige finanzielle Entwicklung der AHV düster aus. 2021-2030 übersteigen die Ausgaben die laufenden Einnahmen um 43 Mrd. Franken, so dass der AHV-Fonds bis Ende 2030 von 45 auf 3,5 Mrd. Franken absinkt (siehe Tabelle 1). Gemäss AHV-Gesetz muss er jedoch einen Stand aufweisen, der einer Jahresausgabe entspricht. Aus diesem Grunde sind bis 2030 nicht nur 43, sondern 53 Mrd. Franken zur Deckung der Finanzlücke erforderlich.
Die finanziellen Prognosen für die AHV basieren auf einer Reihe von Annahmen über die Entwicklung der Bevölkerung, der Wirtschaftslage und der Kapitalrenditen. In der Vergangenheit erwiesen sich diese als zu pessimistisch; vor allem die Einwanderung und damit die Einnahmen wurden unterschätzt. Selbst für den Fall, dass die aktuellen Prognosen wiederum zu pessimistisch wären, darf angesichts des Umfangs der sich abzeichnenden Defizite nicht davon ausgegangen werden, dass sich die Finanzlücke ohne Gegenmassnahmen quasi von selbst schliessen wird.

(Tabellen und Grafiken können vergrössert angezeigt werden. Klicken Sie auf das Titelbild des Beitrags. Es öffnet sich eine Bildergalerie, in der sich auch die Tabellen und Grafiken befinden.)
Sanierungsoptionen
Wie einleitend bemerkt, hat der Bundesrat Ende Juni 2018 die Vernehmlassung für eine Revision der AHV eröffnet. Im Wesentlichen schlägt er vor, das ordentliche Rentenalter (= Referenzalter) der Frauen von 64 auf 65 Altersjahre zu erhöhen, den Bezug der AHV-Rente zwischen 62 und 70 Altersjahren nach versicherungstechnischen Grundsätzen zeitlich zu flexibilisieren und den Normalsatz der Mehrwertsteuer um 1,5 Prozentpunkte zu erhöhen. Dazu kommen zwei Varianten von Ausgleichsmassnahmen für die betroffenen Frauen (siehe Szenarien B und C in Tabelle 2).
Die von den eidgenössischen Räten Ende September 2018 verabschiedete Neuauflage der Unternehmenssteuerreform beinhaltet auch zusätzliche Einnahmen für die AHV von jährlich mindestens 2 Milliarden Franken ab 2020. Bis 2030 resultieren Mehreinnahmen von rund 30 Mrd. Franken. (2*) Sollte die Vorlage vom Volk angenommen werden, will dies der Bundesrat bei seinen Szenarien B und C dadurch kompensieren, dass er den Mehrwertsteuersatz um 0,7 statt um 1,5 Prozentpunkte erhöht. (3*)
Im Folgenden soll aufgezeigt werden, wie sich die finanzielle Lage der AHV in den kommenden Jahrzehnten entwickeln dürfte. Dabei werden die oben skizzierten Vorschläge dem Status quo gegenübergestellt. Zusätzlich wird in Szenario D aufgezeigt, wie sich eine generelle Erhöhung des Referenzalters auf 66 Jahre auswirken würde. In einem weiteren Szenario E wird Szenario D gekoppelt mit der Steuervorlage 17 (STAF). In Szenario F wird schliesslich untersucht, wie sich ein Referenzalter von 67 Jahren auswirken würde.
Die sechs erwähnten Szenarien sind in Tabelle 2 näher umschrieben. In Szenario D erfolgt 2022-2025 eine Erhöhung des Rentenalters für beide Geschlechter um ein Jahr. Danach wird das Referenzalter der Frauen an das der Männer angeglichen, falls die unerklärte Lohndifferenz zwischen Männer- und Frauenlöhnen unter eine Grenze fällt, die letztlich politisch festzulegen ist. Gemäss einer Analyse der Lohnstrukturerhebung 2014 betrug diese Lohndifferenz damals 7,4%. (4*) Darin wird zwar das Dienstalter in der Unternehmung, in der 2014 gearbeitet wurde, berücksichtigt, nicht aber die gesamte Dauer der Erwerbstätigkeit. Die so berechnete unerklärte Lohndifferenz darf deshalb nicht als reine Lohndiskriminierung aufgefasst werden. Wenn letztere 2014 5% betragen hätte und halbiert würde, würde die unerklärte Lohndifferenz auf 4,9% sinken. In Szenario D wird die Annahme getroffen, dass das Referenzalter der Frauen auf 66 Jahre steigt, falls die unerklärte Lohndifferenz unter 4% liegt, und dass dies bis 2030 der Fall sein wird.
Szenario D besitzt Parallelen zum Vorschlag, den die Industrie- und Handelskammer Thurgau 2017 gemacht hat. Danach soll das Referenzalter für Männer und Frauen schrittweise von 2021 bis 2032 auf 66 Altersjahre angehoben werden, bei den Männern um einen Monat, bei den Frauen um zwei Monate pro Jahr. (5*) Im Unterschied zu Szenario D erfolgt die Anpassung des Referenzalters der Frauen an das der Männer automatisch, ist also nicht an die unerklärte Lohndifferenz gekoppelt.
Szenario E kombiniert Szenario D mit der Steuervorlage 17, die Mehreinnahmen für die AHV von über 2 Mrd. Franken jährlich beinhaltet. 2021–2030 würden so rund 30 Mrd. Franken zusätzlich in die AHV fliessen. Szenario F stellt eine Erweiterung von Szenario D dar, das Referenzalter wird bis 2030 um ein weiteres Jahr angehoben. Es wird wiederum davon ausgegangen, dass die unerklärte Differenz zwischen den Frauen- und den Männerlöhnen 2030 unter 4% liegen wird, so dass das Referenzalter der Frauen 2031–2034 stufenweise auf 67 Jahre steigt und ab 2034 gleich hoch ist wie das der Männer.

Für die Szenarien D, E und F wurden eigene Berechnungen für die Jahre 2021–2045 aufgrund der in Tabelle 2 dargelegten Annahmen durchgeführt. Sie sind als grobe Schätzungen zu betrachten. Sie weichen jedoch wenig ab von internen Berechnungen des Bundesamts für Sozialversicherungen und dürften die Grössenordnungen korrekt ausdrücken.
Ergebnisse
Die finanziellen Konsequenzen der Szenarien A, B und C sind im Vernehmlassungsbericht des Bundesrats von Ende Juni 2018 für die Jahre 2017–2045 dargestellt. Sie werden im Folgenden unverändert in den Grafiken 1 und 2 wiedergegeben. Aus Grafik 1 ist ersichtlich, dass beim Status Quo ein kumuliertes Umlagedefizit (= Ausgaben - Einnahmen, ohne Kapitalerträge des AHV-Fonds) 2021–2030 von rund 43 Mrd. Franken entsteht, weitere zehn Mrd. Franken sind erforderlich, um den AHV-Fonds Ende 2030 auf den gesetzlich vorgeschriebenen Stand einer Jahresausgabe von rund 60 Mrd. Franken zu bringen. Wie Grafik 2 zeigt, gibt es bei den Szenarien B, C und E keine solche Lücke im Jahr 2030, wohl aber in den Szenarien D und F.
Die Fortschreibung der Szenarien nach 2030 zeigt, dass der AHV-Fonds auch in den Szenarien B, C und E spätestens ab 2034 unter eine Jahresausgabe sinkt. Bis zum Jahr 2045 entstehen somit neue und sehr grosse finanzielle Lücken. Am kleinsten ist sie in Szenario E, in welchem sie eine Jahresausgabe von rund 80 Mrd. Franken annähernd erreicht. In allen anderen Szenarien übersteigt sie eine Jahresausgabe deutlich, so in Szenario B um 36%, in Szenario C um 44%. Nach 2030 sind deshalb in jedem Fall weitere Massnahmen erforderlich, um die AHV finanziell zu stabilisieren.


Ein neuer Vorschlag
Grundsätzlich kann der zukünftige Finanzierungsbedarf mit zusätzlichen Einnahmen oder mit geringeren Ausgaben (durch eine Erhöhung des Referenzalters oder einer Senkung der laufenden Renten) gedeckt werden. Die Kürzung von laufenden Renten wird hier nicht betrachtet; sie gilt als politisches Tabu. Falls die AHV ausschliesslich oder vorwiegend mit zusätzlichen Einnahmen saniert würde, müsste dies von den Erwerbstätigen (höhere Lohnbeiträge) oder der gesamten Bevölkerung (Erhöhung der Mehrwertsteuer um 1,5 Punkte bis 2030 und um weitere rund 10 Punkte bis 2045) getragen werden. Dies ist sehr kostspielig und politisch schwierig durchzusetzen.
Wollte man die AHV bis 2030 einzig über eine Erhöhung des Referenzalters sichern, so würde weder eine Anhebung auf 66 Altersjahre (Szenario D) noch eine Erhöhung auf 67 Jahre (Szenario F) ausreichen, um ein ausgeglichenes Umlage-Ergebnis zu erzielen. Der AHV-Fonds würde 2030 auf rund 60 (Szenario D) respektive 69% (Szenario F) der Jahresausgaben absinken.
Deshalb wird hier vorgeschlagen, die AHV-Reform auf den Zeithorizont 2030 auszurichten und als Kombination von Mehreinnahmen und einer Erhöhung des Referenzalters in folgenden drei Schritten vorzugehen:
- Annahme der Steuervorlage 17, wodurch der AHV Mehreinnahmen von rund 30 Mrd. Franken bis 2030 und gegen 50 Mrd. Franken 2031–2045 zukommen.
- Schrittweise Erhöhung des Referenzalters für alle um ein Jahr in den Jahren 2022–2025. Eine Flexibilisierung des Referenzalters auf 62–70 Altersjahre nach versicherungstechnischen Grundsätzen (wie im Vorschlag des Bundesrats) kann problemlos darin einbezogen werden und würde an den oben dargelegten finanziellen Auswirkungen nichts verändern.
- Anpassung des Referenzalters der Frauen an das der Männer, d. h. Referenzalter 66 für alle, sobald die unerklärte Differenz zwischen Männer- und Frauenlöhnen unter 4% (oder eine andere, politisch festgelegte Grenze) sinkt. Sofern dies 2030 der Fall ist, entspricht der Vorschlag exakt Szenario E.
Das Argument, dass das Referenzalter der Frauen aufgrund der Lohndiskriminierung nicht an das der Männer angeglichen werden darf, wird damit hinfällig. Ein Vorteil verbleibt den Frauen: im Jahr 2013 betrug ihre Lebenserwartung bei Geburt 84,8, bei den Männern lediglich 80,5 Jahre. Das wird sich auch in absehbarer Zukunft nicht verändern, die Lebenserwartung von 65-jährigen Frauen steigt 2015–2045 voraussichtlich von 22,4 auf 25,9 Jahre, die Differenz zu gleichaltrigen Männern sinkt von 2,8 auf immer noch 2,4 Jahre. (6*)
Dazu kommt, dass das Schweizer Referenzalter im internationalen Vergleich tief ist. So hatten 2016 von den 35 Mitgliedländern der OECD acht ein höheres und 13 ein tieferes ordentliches Referenzalter als die Schweiz. Für die heute 20-Jährigen zeigt sich indes ein anderes Bild: 15 OECD-Länder kennen ein höheres und nur sechs ein tieferes Referenzalter als die Schweiz. (7*)
SKOS-Vorschlag für ältere Arbeitslose
Der Bundesrat wendet sich mit folgendem Argument gegen eine Erhöhung des Referenzalters über 65 Jahre: «Tatsächlich haben ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oft Schwierigkeiten, auf dem Arbeitsmarkt zu verbleiben oder bei Arbeitslosigkeit einen Arbeitsplatz zu finden.» (8*) Er befürchtet deshalb eine Kostenverlagerung von der AHV zur Arbeitslosenversicherung oder anderen Sozialwerken.
Dem ist entgegenzuhalten, dass ab 2020 doppelt so viele Arbeitskräfte pensioniert werden, wie junge nachrücken. Dies (und die zu erwartenden Einschränkungen bei der Einwanderung) wird die Arbeitgeber in ihrem eigenen Interesse zu einem anderen Verhalten gegenüber älteren Arbeitnehmenden bewegen. Andernfalls sind gesetzliche Schutzmassnahmen für ältere Arbeitnehmende einzuführen.
Kürzlich hat die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) einen interessanten Vorschlag dazu gemacht. Demnach sollen Arbeitslose, die über 55 Jahre alt und ausgesteuert sind, bei der Stellensuche weiterhin durch die Regionale Arbeitsvermittlung (RAV) betreut werden. Kann keine neue Stelle gefunden werden, sollen diese Personen spezielle Ergänzungsleistungen statt Sozialhilfe erhalten. Die Mehrkosten für 4000 Arbeitslose zwischen 57 und 62 Altersjahren betragen gemäss SKOS lediglich 25 Mio. Franken pro Jahr. (9*)
Chance für politische Akzeptanz
Eine Kombination von Mehreinnahmen mit einer Erhöhung des Referenzalters verteilt nicht nur die Lasten der AHV-Finanzierung adäquater und entlastet gleichzeitig die Pensionskassen, sie dürfte auch deshalb auf mehr politisch Akzeptanz stossen. Der Vorschlag des Bundesrats geht zwar in diese Richtung, er ist jedoch beim Referenzalter viel zu zaghaft und bezüglich der Nachteile zu pessimistisch.
Der oben skizzierte Vorschlag ist konsequenter und sichert zudem eine gesetzeskonforme Finanzierung der AHV bis 2034, rund drei Jahre länger als die Vorschläge des Bundesrats. Und nur mit ihm würde der AHV-Fonds 2045 noch ein leichtes Plus aufweisen; bei allen anderen Szenarien resultiert dagegen ein mehr oder weniger hohes Minus (siehe Grafiken 1 und 2). Trotzdem: Spätestens Mitte der dreissiger Jahre werden in jedem Fall zusätzliche Massnahmen erforderlich. Hierfür wird man die wirtschaftliche Lage und die finanzielle Situation der AHV vor dem Jahr 2030 grundlegend neu beurteilen müssen.
Anmerkungen:
(1*) Bundesamt für Statistik, www.bfs.admin.ch (09.10.2018).
(2*) Eidgenössisches Departement des Innern, Stabilisierung der AHV (AHV 21) Erläuternder Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens vom 27.06.2018, S. 14.
(3*) Ebenda.
(4*) Büro Bass, Analyse der Löhne von Frauen und Männern anhand der Lohnstrukturerhebung 2014, Schlussbericht. Im Auftrag von: Bundesamt für Statistik BFS, Abteilung Wirtschaft Sektion Löhne und Arbeitsbedingungen, Silvia Strub und Livia Bannwart, Bern, 2. März 2017, S. II.
(5*) https://www.ihk-thurgau.ch/wirtschaft-politik/rentenreform/index.html (09.10.2018)
(6*) Bundesamt für Statistik, Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung der Schweiz 2015 –2045, Neuchâtel 2015, S. 20–21.
(7*) OECD, Pensions at a Glance, Paris 2017, S. 92–95, https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/pension_glance-2017-en.pdf?expires=1539432518&id=id&accname=guest&checksum=034B59EF38F757E0E9E98C269A92B577 (13.10.2018)
(8*) Eidgenössisches Departement des Innern, Stabilisierung der AHV (AHV 21) Erläuternder Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens vom 27.06.2018, S. 34
(9*) Medienmitteilung SKOS vom 05.11.2018, https://www.skos.ch/medien/medienkonferenzen/ (30.11.2018).

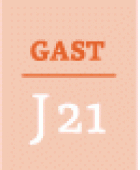


Nach aufwendiger Lektüre und Studium finde ich diese Darstellungen gut und nachvollziehbar. - Allerdings vermisse ich in diesen Scenarien ein Faktum, welches aber sehr schwer zu prognostizieren ist. Nämlich die Effekte der Industrie 4.0 ! Es werden in diesem Zeitraum drastische Veränderungen in der Beschäftigung, vorallem im unteren Lohnbereich, stattfinden. Mit einer Wucht, die uns alle überraschen wird. Dabei wird die Produktivität weiterhin massiv ansteigen. Also Stichwort "Produktivität" müsste als Mitfinanzierungsquelle in Betracht gezogen werden. Klar ist, dass die "Robotersteuer" zu wenig greift, respektive sehr kompliziert zu erheben wäre. - Aber in dieser Richtung muss was geschehen, auch wenn noch kein Lösungsansatz sichtbar ist. Die Verlagerund von menschlicher Arbeit zu Automaten MUSS berücksichtigt werden. Die soziale Spaltung in der Gesellschaft muss "abgefedert" werden, sonst stehen wir vor Zerreissproben die wir nicht mehr kennen.
zu Herrn Rettenmund:
Klar, dieses Problem ist riesengross. Die Preisfrage ist, wie schnell wird die Digitalisierung fortschreiten, welche Branchen und Tätigkeiten wird sie schwergewichtig umgestalten? Ich gehe davon aus, dass für eine volle Entfaltung etwa zehn Jahre benötigt werden, dann ist mein Vorschlag praktikabel. In der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre muss eh Bilanz gezogen und alles im Lichte der Erfahrungen und der dannzumal absehbaren Entwicklungen neu beurteilt werden.
In den Ländern, wo das Renteneitrittsalter auf 67 angehoben wurde, dient diese Reform überwiegend als ein Vorwand zu Rentenkürzung. In vielen körperlich anstrengenden Berufen kann kaum einer bis 67 arbeiten. Fast keine Firma will ein volles Gehalt an so alte Arbeitnehmer bezahlen, die schlecht hören, schlecht sehen, Rückenschmerzen haben, Knieschmerzen haben, zu oft beim Arzt und im Krankenhaus sind. Einige deutsche Politiker reden sogar über Rente ab 70. Dann muß rechtzeitig bei jedem Arbeitsplatz ein Abstellplatz für einer Rollator geschaffen werden. Auch betriebseigene Friedhöfe sind denkbar. Die volljährigen Flüchtlinge, die sich bei der Altersangabe jünger gemacht haben, Minderjährig gemacht haben, werden deswegen später noch länger arbeiten müssen.
Zu Herrn Wölfle:
Mein Vorschlag will Rentenkürzungen vermeiden. Er beinhaltet auch die Flexibilisierung des Rentenalters (siehe Punkt 2). Damit kann der individuellen gesundheitlichen Sitaution Rechnung getragen werden. Für Bauarbeiter gilt bereits das Pensionsalter 60, daran würde sich nichts ändern.
Altersvorsorge: Erhöhung des Renteneintrittsalters ist kontraproduktiv!
Die langfristige Sicherstellung der AHV-Finanzierung kann nicht über die Anpassung des normalen Renteneintrittsalters an die veränderte Lebenserwartung erfolgen. Aufgrund der Arbeitsbelastung und den Anforderungen des modernen Arbeitsmarktes wäre eine generelle Erhöhung des Renteneintrittsalters kontraproduktiv. Gute Alternativen sind: Flexibilisierung des Renteneintrittsalters; Beitragserhöhungen, ev. auf Kosten von Lohnerhöhungen; neue Finanzierungsquellen (Mehrwertsteuererhöhung, Finanztransaktionssteuer, Kapitalgewinnsteuer, Umlagerung des Bundesbudgets zugunsten der AHV).
Mein Vorschlag enthält die Flexibilisierung des Pensionsalkters (siehe Punkt 2). Eine Sanierung der AHV rein über neue Einnahmen erachte ich als wenig zielführend und politisch als kaum mehrheitsfähig. Eine Erhöhung des Rentenalters auf 66 würde zudem den Pensionskassen helfen, was bei Mehreinnahmen für dei AHV nicht der Fall ist.
zu Herrn Schneider:
Mein Vorschlag beinhaltet neben der generellen Erhöhung des Rentenalters auf 66 Jahre auch die Flexibilisierung (siehe Punkt 2). Eine starke Ehöhung der Lohnbeiträge würde die Produktionskosten erhöhen und unserer internationalen Konkurrenzfähigkeit schaden. Bei der Mehrwertsteuer gibt es dieses Problem nicht. Mehreinnahmen lösen aber die Probleme der Pensionskassen nicht, die Erhöhung des Rentenalters leistet dagegen einen Beitrag dafür.
Hr. Schneider,
Anhebung des Referenzalters muss im Zentrum stehen. Neben der Immigration kann nur die Ref.Alter-Anhebung das schiefe Verhältnis von Erwerbstätigen zu Rentnern entschärfen. Praktisch jede Art von Geldzufuhr, zum heutigen Zeitpunkt, entspricht einer Umverteilung von Jung zu Alt.
Eine generationengerechte Sicherstellung der AHV ist heute eigentlich nicht mehr möglich. Diesen Zeitpunkt haben wir verschlafen. Keine andere Versicherung ist der Demografie derart stark ausgeliefert wie die AHV. Die Ignorierung dieser Demografie hat sie nun in diese Sackgasse geführt. Eigentlich müssten heute die Leistungen den Einnahmen angepasst werden.
“Aufgrund der Arbeitsbelastung und den Anforderungen des modernen Arbeitsmarktes wäre eine generelle Erhöhung des Renteneintrittsalters kontraproduktiv.”
Ihre Argumente sind nicht völlig unberechtigt. Allerdings darf diese Problematik nicht auf Kosten der AHV gelöst werden. Diese Lösung hat in den letzten 15 Jahren, durch die Nichtanhebung des Referenzalters, massive Lasten zu den heute Jungen verschoben.
Diese Kosten müssen heute, mit anderen Lösungen, zeitgerecht erfolgen.
Sämtliche ihrer alten wie neuen Finanzierungsvorschläge entsprechen, zum heutigen Zeitpunkt, in hohem Masse einer Umverteilung von Jung zu Alt.
Das stimmt doch nicht! Finanztransaktionssteuer, Kapitalgewinnsteuer, Umlagerung des Bundesbudgets zugunsten der AHV treffen doch vor allem die reicheren älteren Bevölkerungsschichten.
Hr. Schneider….
Die nun anfallenden Umlageverluste der AHV sind der Nichtreaktion auf die Demografie geschuldet. Der Ausgleichsfonds hätte in der Vergangenheit massiv geäuffnet werden, die Referenzalter längst angehoben werden müssen. Die Finanzierung der AHV war nie durchdacht. Dem absehbaren Manko, welches nun entstanden ist, hat man nie versucht flankierend zu begegnen. Die Schwächen der Umlagefinanzierung, bezüglich kommendem demografischem Ungleichgewicht, hatte man nicht zur Kenntnis genommen.
Die nun anfallenden Umlageverluste müssen als eine Altlast bezeichnet werden.
Praktisch sämtliche, zum heutigen Zeitpunkt, erhobenen Steuern, um diese Altlast zu beseitigen, entsprechen in hohem Masse einer Umverteilung von Jung zu Alt.
Finanztransaktionssteuer, Kapitalgewinnsteuer, Bundesbeiträge würden heute von Jung und Alt erhoben. Alle, wenn auch deutlich mehr reiche (Kapitalhalter), würden für die Altlast mitbezahlen. Die Einbeziehung der Jungen (ob reich oder arm) in diese Sanierung ist nicht fair.
Natürlich müssen Geldflüsse erfolgen. Natürlich werden Reiche, wie immer bei der AHV, mehr zur Kasse gebeten. Aber zuerst müssen längst fällige Strukturanpassungen erfolgen.
Die Anhebung der Referenzalter muss klar ins Zentrum gestellt werden.
PS: Bin kein Gegner der Kapitalgewinnsteuer. Diese sollte, meiner Ansicht nach, zusammen mit der Abschaffung der Emissionsabgabe auf Eigenkapital eingeführt werden.
zu Herrn Vetterli:
Bin mit allem einverstanen bis auf die letzten drei Zeilen. Eien Erhöhung der Mehrwertsteuer trifft Junge und Renter/innen. Es gibt hier keine erkennbare Umverteilung von Jung zu Alt.
erst heute (26.12.2018) gesehen….
Hr. Jans...
Der heutige Mix der Finanzierung der AHV führt zu einem jährlichen Umlageverlust von 1Mrd.
Dieser Verlust ist, auch wegen der zu tiefen Finanzierung in der Vergangenheit, nicht tragbar. Diese heute nun nicht tragbaren, anfallenden Verluste, bei einem Verhältnis der Erwerbstätigen zu Rentner von 3,4, ist der unzureichenden Finanzierung der Vergangenheit, welche zur Anhebung des AHV-Fonds geführt hätte, u/o der verpassten Anhebung des Ref.Alters, geschuldet. Ein Ergebnis der Nichtreaktion auf die Demografie. Man kann sagen, dass die heute nun anfallenden Verluste einer Altlast entsprechen.
Natürlich würden heute alle an der Finanzierung/Sanierung der AHV via MWSt beitragen. Aber der Einbezug der Jungen zur Finanzierung der Altlast AHV ist nicht fair. Die Einbeziehung der Jungen, um die transferierte Altlast mitzutragen, entspricht einer Umverteilung von Jung zu Alt.
Eine generationengerechte Umsetzung der AHV müsste eigentlich durch die Anpassung der Leistungen an die Einnahmen bewerkstelligt werden.
Praktisch jede Anhebung der Einnahmen (Beiträge, Steuern), zum heutigen Zeitpunkt, entsprechen einer Umverteilung von Jung zu Alt in hohem Masse.
Als erstes müssen die Referenzalter angehoben werden. Die Immigration in den Arbeitsmarkt darf nicht behindert werden.
An einer gewissen (ungerechten) Umverteilung zwischen den Generationen kommen wir aber wohl nicht mehr herum.
Wünsche ein erfolgreiches Neues Jahr….
'Prognosen zu stellen, ist immer schwierig, besonders, wenn sie die Zukunft betreffen'.
Die erwähnten Vorschläge verdienen es, vertieft analysiert und diskutiert zu werden. Ein grosser Mangel ist aber weiterhin die sehr einseitige Betrachtungsweise, nämlich der Fokus lediglich auf die finanzielle Lage der AHV gerichtet.
Der Bundesrat selbst bemängelt, dass die Auswirkungen einer Erhöhung des Rentenalters auf die anderen Sozialkosten, wie Arbeitslosenversicherung, Sozialhilfe, Unfallversicherung und eine wahrscheinlichen Zunahme von psychisch bedingten Krankheitskosten (infolge noch mehr Langzeit-Arbeitslosen) viel zu wenig konkret berechnet wird.
Zudem haben die Arbeitgeber bisher noch nie den Beweis erbracht, dass sie ältere Arbeitnehmer einstellen würden. (Ausnahmen bestätigen die Regel). Mehr als fromme Lippenbekenntnisse waren noch nie festzustellen.
Es braucht also eine ganzheitliche Betrachtung der Auswirkungen auf die verschiedenen Sozialsysteme - und nicht nur der einseitige Blick auf die AHV.
Bin weitgehend einverstanden. Nur: In den nächsten zehn Jahren kommen auf 100 neu Pensionierte nur rund 50 Junge, die ins Erwerbsleben eintreten. Das wird die Arbeitskräfte verknappen ujnd die Haltung der Arbeitgeber nachhaltig verändern. Bezüglich Arbeitslosigkeit älterer Arbeitnehmender: Was meinen Sie zum Vorschlag der SKOS bezüglich Ergänzungsleistungen für Arbeitslose ab 55?
zu Herrn Schwab:
Einverstanden, eine ganzheitliche Betrachtung ist nötig.
Das Gros der Arbeitgeber hat bisher nicht den Beweis erbracht, dass sie ältere Arbetinehemr einstellen. Zukünftig werden aber für 100 Arbeitnehmende, die pensioniert weden, nur 50 nachrücken. Jene Arbeitgeber, die dem nicht Rechnung tragen, werden auf die Welt kommen. Schliesslich: Was meinen Sie zum Vorschlag der SKOS für die arbeitlosen über 55 Jährigen?
Hr. Schwab
Wie hoch die Kosten für die ALV, Sozialhilfe, UVG etc. ausfallen würde ist zweitrangig.
Wichtig ist, dass die Kosten, welche heute durch die Nichtanhebung des Referenzalters entstehen, nicht weiter auf die AHV fallen. Die Umverteilung von Kosten dieser Sozialversicherungen an die AHV ist alles andere als transparent. Zumindest bis anhin hat dieser Kostentransfer die AHV, oder genauer den Ausgleichsfonds, schwer belastet und hat zu einem Transfer dieser, bezüglich Altersvorsorge, eigentlich fremden Kosten in die Zukunft zu den heute Jungen verschoben.
Leistungsanhebungen bei ALV etc. führen zu höheren Beiträgen u/o Steuern. Diese Kosten werden somit nicht nur richtig ausgewiesen, sie fallen vor allem auch periodengerecht an und werden nicht mehr via AHV (betrifft vor allem die Vergangenheit) in die Zukunft verschoben.
Rentenalter muss dringendst angehoben werden. Kein weiterer Kostentransfer durch ALV etc. an die AHV.
Nachträglicher Geldfluss durch ALV u. sonstigen Sozialwerken, für die in den letzten Jahren durch Kostentransfer in der Summe zu hoch geleisteten AHV-Renten, würde allerdings zu heutigem (verspätetem) Zeitpunkt natürlich auch nicht zu Kosten führen welche zeitgerecht anfallen. Trotzdem scheint mit eine Nachzahlung an die AHV angebracht.
Keine weiteren Subventionierungen der ALV und weiterer Sozialwerke durch Nichtanhebung des Referenzalters. Die Verzerrungen, des zu tiefen Referenzalters, müssen beendet werden. Für vertiefte Transparenz unserer Sozialversicherungen und weiterer Sozialleistungserbringer. Für raschmögliche Anhebung des Referenzalter.
In der Zwischenzeit könnte ein jährlicher (pauschaler) Geldfluss durch ALV etc. an die AHV für mehr Kostentransparenz sorgen.
“Zudem haben die Arbeitgeber bisher noch nie den Beweis erbracht, dass sie ältere Arbeitnehmer einstellen würden.”
Ja, dieser Beweis muss erbracht werden. Sollten diese Beweise unzureichend ausfallen, darf dies nicht zu Leistungen der Altersvorsorge führen sondern muss mit ALV oder Leistungen weiterer Sozialwerke getragen werden.
“Es braucht also eine ganzheitliche Betrachtung der Auswirkungen auf die verschiedenen Sozialsysteme - und nicht nur der einseitige Blick auf die AHV.”
Ja… schaffen wir Transparenz… entlasten wir die AHV von fremden Kosten welche bis anhin der nächsten Generation aufgebürdet werden konnte.
Die Vorschläge von Armin Jans sind interessant und vermutlich politisch auch verdaubar. Verdaubar deshalb, weil nicht grundlegende Aenderungen angestrebt werden.
Ich bin allerdings überzeugt, dass das ganze System neu überdacht werden muss, weil sich die grundlegenden Variablen des Systems komplett verändert haben. Die Beziehung Mensch=Wertschöpfung hat sich seit der Digitalisierung der Arbeitswelt massiv verschoben. Als Beispiel sei hier nur Google zitiert, wo die Wertschöpfung einer Mitarbeiterin verglichen mit einer Fabrikmitarbeiterin um ein Vielfaches grösser ist.
Wenn es uns nicht gelingt die modernen Elemente der Wertschöpfung (Computer und Roboter) in die Finanzierung der Altersvorsorge miteinzubeziehen, werden wir das Problem nicht lösen können.
Natürlich wird ein Teil des Produktivitätsgewinns immer auch via Löhne verteilt. Aber letztlich sind die Löhne erster Linie ein Produkt von Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt und er in zweiter Linie beeinflusst durch die Produktivität des Betriebs.
Das bedeutet nichts anderes, als dass ein grosser Teil der Produktionsgewinne direkt an die Investoren fliesst (zum Beispiel in Form von Aktiengewinnen) und sich damit nicht positiv auf die AHV auswirkt. Das heisst aber nichts anderes, als dass die AHV unterproportional vom Wirtschaftswachstum profitiert, was letztlich unbegründet ist.
Das heisst nicht, dass nicht auch das Rentenalter und andere aktuell diskutierte Variablen den realen Verhältnissen angepasst werden sollten. Dass aber die produktivsten Kräfte unseres Wirtschaftssystems, die eine immer wichtigere Rolle spielen, nicht auch einen Beitrag zur Finanzierung der AHV leisten sollen, ist nicht einzusehen.
Der Vorschläge sind viele. allein, warum das Rad neu erfinden?
Schweden machts uns vor: keine fixen Versprechungen, nachvollziehbare Korrekturen im Millimeterbereich, gebunden an die wichtigen Parameter.
Ohne den Artikel gelesen zu haben, würde ich zuerst vorschlagen, das fehlende Geld bei den Milliardären und 10'00 Reichsten und Top Umsatz Firmen der Schweiz den, Glencores, Nestlés, Novartis und UBS zu holen, die letztes Jahr durchschnittlich 17% reicher wurden. Dann könnte man noch Harry F. Heutschi fragen, wie die Bosse der AHV die fehlenden Gelder mit ihren Bankster Freunden verzocken und verpassen und die Bücher dazu fälschen, und mich, warum bei dem überquellenden Reichtum der Erde gar niemand AHV-IV-Versicherungsprämien und Steuern und Abgaben zu entrichten hätte und 4 % der Weltbevölkerung genügen würden, alle nötigen Arbeiten zu erledigen.
Die Szenarien sind sehr interessant...
Das Problem der umlagefinanzierten AHV besteht in der, bei gegenwärtigen Parametern, unglücklichen Aufteilung der Altersgruppen. Dies hat nun zu einem Verhältnis von 3,4 Erwerbstätigen auf einen Rentner geführt. Dieses Verhältnis ergibt einen jährlichen Umlageverlust von rd. 1 Mrd.
Bei altersmässig ausgeglichener Bevölkerungsstruktur (alle Altersgruppen ab Alter 20 - 65 gleich gross), Referenzalter 65 sowie durchschn. Lebenserwartung von 85 Jahren müssten rund 2,3 Aktive einen Rentner finanzieren können.
Um das Verhältnis der Aktiven zu Rentnern in einigermassen vernünftige Grössenordnungen zu führen, muss neben der Immigration vor allem die Anhebung des Referenzalters angegangen werden. Natürlich kann die Anhebung des Referenzalters heute nur noch zu einer Milderung der Defizite führen. Trotzdem sollte, vor zusätzlichem Geldfluss in die AHV, das unglückliche Verhältnis der Altersgruppen (Aktive zu Rentner) erst angegangen werden.
Geldfluss entspricht letztlich primär einer Symptom- nicht einer Ursachenbekämpfung und darf nicht an erster Stelle stehen.
Zu erwähnen ist, dass praktisch jeder Geldfluss, zum heutigen Zeitpunkt, in hohem Masse einer Umverteilung von Jung zu Alt entspricht.
Zur Immigration:
Sämtliche hier wiedergegebenen 5 Szenarien basieren, bezüglich Bevölkerungsentwicklung, auf dem Szenario A-00-2015 des BfS. Dieses Szenario sieht bis 2030 eine Nettoeinwanderung von 60000 Personen vor. Ab 2031- 2045 soll sich diese auf 30000 zurückbilden.
Zu Kostenverlagerungen:
“Er befürchtet deshalb eine Kostenverlagerung von der AHV zur Arbeitslosenversicherung oder anderen Sozialwerken.”
Kostenverlagerungen ab der AHV zu ALV oder sonstigen Leistungserbringern sind sinnvoll und entsprechen einem korrekten Ausweis. Vor allem in der Vergangenheit hätten diese “Fehlbuchungen” nicht zu einer Lastenverschiebung in die Zukunft (via AHV) geführt. Die zusätzlichen Kosten hätten zu höheren Prämien/Steuern geführt und wären somit zeitgerecht erfolgt.
Auch die heute weiterhin bestehenden Kostenverschiebungen zur AHV, aufgrund des zu tiefen Ref.Alters, ergeben keine Transparenz. Die Anhebung des Referenzalters hinauszuzögern um die ALV und weitere Leistungserbringer zu schonen ist wenig vernünftig.
Raschmöglichste Anhebung des Referenzalters (z.B. 66/67 F/M) sollte angegangen werden. Kein Geldfluss vor Beschluss zu deutlichen Strukturanpassungen.
Die Vorschläge von Armin Jans sind interessant und vermutlich politisch auch verdaubar. Verdaubar deshalb, weil nicht grundlegende Aenderungen angestrebt werden.
Ich bin allerdings überzeugt, dass das ganze System neu überdacht werden muss, weil sich die grundlegenden Variablen des Systems komplett verändert haben. Die Beziehung Mensch=Wertschöpfung hat sich seit der Digitalisierung der Arbeitswelt massiv verschoben. Als Beispiel sei hier nur Google zitiert, wo die Wertschöpfung einer Mitarbeiterin verglichen mit einer Fabrikmitarbeiterin um ein Vielfaches grösser ist.
Wenn es uns nicht gelingt die modernen Elemente der Wertschöpfung (Computer und Roboter) in die Finanzierung der Altersvorsorge miteinzubeziehen, werden wir das Problem nicht lösen können.
Natürlich wird ein Teil des Produktivitätsgewinns immer auch via Löhne verteilt. Aber letztlich sind die Löhne erster Linie ein Produkt von Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt und er in zweiter Linie beeinflusst durch die Produktivität des Betriebs.
Das bedeutet nichts anderes, als dass ein grosser Teil der Produktionsgewinne direkt an die Investoren fliesst (zum Beispiel in Form von Aktiengewinnen) und sich damit nicht positiv auf die AHV auswirkt. Das heisst aber nichts anderes, als dass die AHV unterproportional vom Wirtschaftswachstum profitiert, was letztlich unbegründet ist.
Das heisst nicht, dass nicht auch das Rentenalter und andere aktuell diskutierte Variablen den realen Verhältnissen angepasst werden sollten. Dass aber die produktivsten Kräfte unseres Wirtschaftssystems, die eine immer wichtigere Rolle spielen, nicht auch einen Beitrag zur Finanzierung der AHV leisten sollen, ist nicht einzusehen.
Grüezi Hr. Schärli
Ihre Vorschläge sind interessant und können künftig vielleicht in die AHV Finanzierung einfliessen. Wenn Gewinne von Unternehmen z.T. AHV-pflichtig werden sind dies ja auch Lohn-Nebenkosten. Sie würden einfach in Prozent vom Firmengewinn erhoben. Eine Gewinnbeteiligung des AN welcher nicht zu seinen Gunsten in Form von Cash beglichen wird. Diese Gewinnbeteiligung entspricht einer Steuer und verteuert letztlich die Produktionskosten. Für die Eigentümer wird weniger Gewinn resultieren. Eine Beitragserhöhung, welche sich nicht nach der Anzahl Mitarbeiter oder deren Salärhöhe richtet. Eine Reaktion auf die Automatisierung. Wettbewerbsfähigkeit muss natürlich beibehalten bleiben. Auch die Maschinensteuer kann für Zukunftsszenarien herbeigezogen werden.
Heute müssen wir uns allerdings mit dem Ist-Zustand beschäftigen. Dieser Ist-Zustand ist das (Zwischen)-Resultat einer Altlast. Die AHV war und ist nie/nicht nachhaltig finanziert.
Gem.UBS-Studie hat bis heute noch kein lebender Altersjahrgang seine eigenen gesetzlich versprochenen Leistungen mittels Beiträgen und Steuern jeweils einbezahlt oder wird einbringen können.
Mit Stand heute finanzieren 3,4 Aktive einen Rentner, dies führt zu einem Umlageverlust von 1 Mrd.
Um den jährlichen Umlageverlust zu stabilisieren, müssen erstens die jährlich ausscheidenden Erwerbstätigen zu 100% mit Neuzugängen ersetzt werden. Zweitens müssen die Neurentner, welche zu einem Anstieg des Rentnerbestands führen, mit 3,5 Erwerbstätigen ersetzt werden, damit der jährliche Umlageverlust nicht weiter ansteigt.
Das heutige Problem der AHV liegt in der Demografie. Diese wurde nie gebührend berücksichtigt.
Die Buchhaltung der AHV basiert auf einer Milchbüchlein-Rechnung. Abgrenzungen, bezüglich nicht umlagegerechter Demografie, wurden nie für nötig befunden. Der tatsächliche Zustand wurde nie ermittelt. Der Cash-Bestand “stimmte”. Viel weiter hat man nicht gedacht.
Heute ist das Umlageverfahren an ihr Ende gelangt. Nur noch durch exorbitanten Lastenübertrag an die Jungen kann sie überleben.
Die heutige demografische Schieflage (Missverhältnis von Aktiven zu Rentnern) kann nur durch Immigration und Anhebung Referenzalter gemildert werden.
Dass 80% der Schweizer sich einer Anhebung auf Ref.Alter 67 verweigern muss wohl mit fehlender Aufklärarbeit erklärt werden. Die AHV als “soziale Errungenschaft” der Linken muss doch auch durch diese Linke stabilisiert werden. Immerhin hat diese Linke die Problematik bezüglich Demografie in der Vergangenheit häufig in geradezu absurder Weise ignoriert. Nur schon der Versuch, die AHV generationengerecht langfristig zu sichern, hat sie nie erwogen.
Bis vor etwas mehr als einem Jahr wollten, nicht nur diese Kreise, gar Leistungsanhebungen erwirken. Ein Vorgehen, dass heute undenkbar ist. Obwohl die Nichtanhebung des Ref-Alters doch auch einer Leistungsanhebung entspricht.
Durch die ev. Abnahme der Beschäftigten in der Zukunft müssen für diese Zukunft wahrscheinlich neue Finanzierungsquellen erschlossen werden. Ihre Ideen sind interessant. Für die anstehende Altlastenbereinigung würden sie in hohem Masse (wie Beitragserhöhungen) einer Umverteilung von Jung zu Alt bedeuten und sind für die Sanierung nur sehr bedingt tauglich.
PS. Anpassungen zu meinem Kommentar von gestern:
- nicht Altersgruppen ab Alter 20 - 65 sondern Altersjahrgänge ab Alter 20 - 65,
- Nettoeinwanderungen gem. Szenario A-00-2015 sind pro Jahr gemeint,
- Bezeichnung “sonstige Leistungserbringer” ist nicht glücklich. Besser wohl “weitere Sozialwerke”.
Wie die AHV Zeitbombe entschärfen?
Ist do klar! Mit dem UN-Migrationspakt.
Eine Million kräftiger Afrikaner und die AHV
schreibt schwarze Zahlen. Bedingung, alle
Geschirrspülmaschinen müssen in der
Schweiz verschrottet und verboten werden.