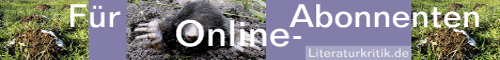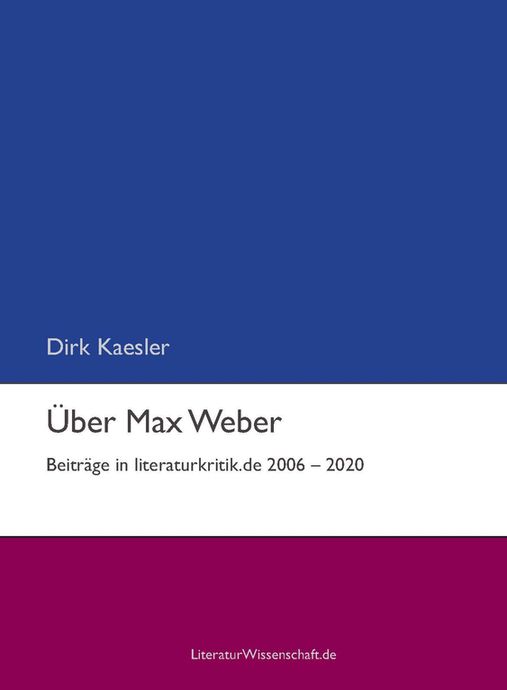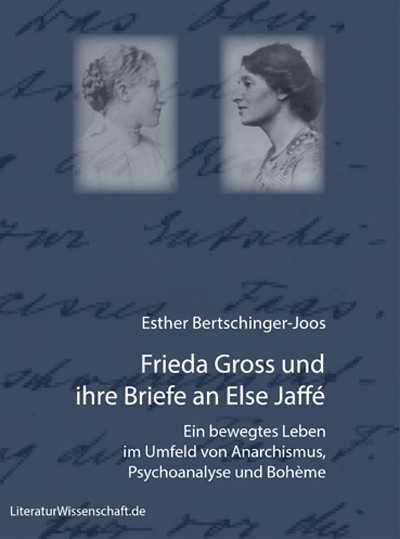Leander Scholz schrieb uns am 03.11.2004
Thema: Claudia Schmölders: Gesichtsliteratur
Kurzer Kommentar des Herausgebers:
Dass der physiognomische Diskurs einer Kontextualisierung bedarf, trifft offensichtlich in erhöhtem Maß auf die Rezension von Claudia Schmölders zu. Denn soweit ich sehen kann, versuchen alle drei besprochenen Bücher, die Frage nach dem Facialen aus der anthropologischen Perspektive zu lösen und in eine mediengeschichtliche einzuordnen. Wenn Frau Schmölders meint, in diesem Zusammenhang an Plessners Idee der "exzentrischen Position" erinnern zu müssen, dann ist sie einer humanistischen und anthropozentrischen Tradition der Erkenntnistheorie verhaftet und verfehlt auf diese Weise den Ansatz der besprochenen Bücher. Das spiegelt sich auch in der Weise der Zitation wider. Wenn sie meint, ich hätte in meinem Beitrag vorgeschlagen, zwischen einem "Urgesicht" und einem "Ungesicht" zu unterscheiden, dann kann ich daraus nur schließen, daß sie ihn nicht gelesen hat. Vielemehr geht der Beitrag der Frage nach, wie die Fiktion eines "Urgesichts" und eines "Ungesichts" in der abendländischen Anthropologie zusammenhängen und welche Politik dieser Zusammenhang begründet. Darüber hinaus scheint Frau Schmölders ein Ressentiment gegenüber Gilles Deleuze zu hegen, der sich mit eben dieser Politik des menschlichen Gesichts intensiv auseinandergesetzt hat. Dieses Ressentiment kann ich mir allerdings nur so erklären, daß Frau Schmölders Deleuze schlichtweg nicht verstanden hat.
Mit freundlichen Grüßen,
Leander Scholz
|
claudia schmölders schrieb uns am 09.11.2004
Thema: Claudia Schmölders: Gesichtsliteratur
Antwort auf Leander Scholz Leserbrief vom 3.11.2004
Sehr geehrter Herr Scholz,
Keineswegs war meine kleine Polemik als Rezension der genannten Bücher gemeint; das habe ich der Redaktion eindeutig mitgeteilt. Es geht mir um die Frage: kann man die neuere Gesichtsliteratur, die zur Jahrhundertwende von Simmel sehr konzis angestoßen wurde, wirklich ohne Rekurs auf die physiognomische Tradition lesen, wenn man Wissenschaftsgeschichte betreibt? Physiognomik ist seit Aristoteteles eine „Gesichtslesekunst“; genaugenommen die älteste Wahrnehmungslehre, die wir haben, und sie hatte seit 1800 enorm Konjunktur Sieht man einmal ab von der falschen Assoziation, Physiognomik sei per se Rassismus: kann sie deshalb in Medienphilosophie (Deleuze) oder Ästhetik (Simmel) verschwinden? Béla Balász hat ja mit seiner Filmphysiognomik die Brücke geschlagen. Deleuze habe ich übrigens schon in mein erstes Buch von 1995 aufgenommen. Sie haben aber recht: er bedeutet für mich nicht das letzte Wort in physiognomischer Hinsicht. Ich möchte tatsächlich an der Einstellung meines Lehrers Helmuth Plessner festhalten, die Sie beschrieben haben: humanistisch und anthropologisch. Darüber habe ich ja auch geschrieben, cf. www.claudiaschmoelders.de
|
Leander Scholz schrieb uns am 10.11.2004
Thema: Claudia Schmölders: Gesichtsliteratur
Sehr geehrte Frau Schmölders,
sollte mein Kommentar zur Ihrer Rezension, die eigentlich eine Polemik sein sollte, zu polemisch ausgefallen sein, dann entschuldige ich mich selbstverständlich. Allerdings ist dieser Unterschied nicht immer leicht zu erkennen. Ihre inhaltlichen Bedenken gegen die Versuche, auf die physiognomische Tradition eine mediengeschichtliche Perspektive zu entwickeln und sie dadadurch in die Wissenschaftsgeschichte einzuordnen, kann ich nicht nachvollziehen. Denn dabei geht es doch gerade darum, mit der Frage nach den medialen Bedingtheiten der Lesbarkeit des menschlichen Gesichts die Frage nach der Produktion von Wissen zu stellen. Gesichter sind ja nicht per se lesbar (etwa im Sinne einer anthropologischen Konstante), sondern müssen erst als solche lesbar gemacht werden, und das heißt, daß sie bestimmten medialen Transkriptionen unterworfen sind (was sich schon bei Lavater durch das Text-Bild-Problem seiner Lektüren ausdrückt). Um genau diese historisch unterschiedlichen Verfahren zur Produktion der Lesbarkeit geht es in unserem Band, der im übrigen auch einen Beitrag zur Auseinandersetzung zwischen Hegel und Lavater enthält und selbstverständlich auch das 18. Jahrhundert berücksichtigt, in dem die Anthropologie erfunden wurde. Wie man auch immer im Einzelnen zur Anthropologie Plessners stehen mag, so denke ich, kann man heute nicht mehr ohne weiteres die Selbstverständlichkeiten voraussetzen, die seine philosophische Anthropologie impliziert. Aber vielleicht bekommen wir irgendwann einmal die Gelegenheit, das genauer zu diskutieren. Jedenfalls würde ich mich nach unserem kleinen Briefwechsel freuen, wenn Sie vielleicht doch noch eine Rezension schreiben würden.
Mit freundlichen Grüßen,
Leander Scholz
|