Editorial ¦ Zoom ¦ Zeitblende ¦ Weitwinkel
Literatur im Lichthof (10/2017) - Zoom
- Hugo J. Bonatti: Von Vulkanen und Narren
- Franz Tumler: In einer alten Sehnsucht. Hg. von Ferruccio Delle Cave
- Peter Giacomuzzi: asyl asyl
- Erich Hackl (Hrsg.): So weit uns Spaniens Hoffnung trug. Erzählungen und Berichte aus dem Spanischen Bürgerkrieg
- Gerhard Jäger: Der Schnee, das Feuer, die Schuld und der Tod
- Martin Kolozs: Sommer ohne Sonne
- Felix Mitterer: Märzengrund
- Anne Marie Pircher: Über Erde
- Raoul Schrott: Erste Erde Epos
- Bernd Schuchter: Jacques Callot und die Erfindung des Individuums
- Judith W. Taschler: bleiben
- Vera Vieider: Leichtfüßig sein
Hugo J. Bonatti: Von Vulkanen und Narren. Novellen und Gedichte.
Innsbruck: Turmbund 2016
 Stoff für ein Spielfilm-Drehbuch: Im Vatikan tobt ein Machtkampf. Johannes Paul II. tritt zurück; nach einem kurzen Interregnum und nach rasch vorübergehenden Amtsperioden der Päpste Judas I. und Judas II. wird schließlich Anonymus I. zum Bischof von Rom gewählt. Die Konservativen haben verloren. Radikale Reformen sind zu erwarten. Ein Konzil wird einberufen.
Stoff für ein Spielfilm-Drehbuch: Im Vatikan tobt ein Machtkampf. Johannes Paul II. tritt zurück; nach einem kurzen Interregnum und nach rasch vorübergehenden Amtsperioden der Päpste Judas I. und Judas II. wird schließlich Anonymus I. zum Bischof von Rom gewählt. Die Konservativen haben verloren. Radikale Reformen sind zu erwarten. Ein Konzil wird einberufen.
Das Konzil. Der Prosatext, den Hugo Bonatti (geb. 1933 in Innsbruck, er lebt seit 1956 in Kitzbühel) schon 1991 geschrieben aber bisher noch nie publiziert hat, führt von allem Anfang an in eine Ausgangssituation, die auch einen Roman eröffnen könnte. Aber die Erzählung bricht rasch ab, und unversehens wechselt der Erzähler auf ein Reflexionsterrain, das ihm erlaubt zu kommentieren, was sich unterm Stichwort Humanisierung und Demokratisierung in der katholischen Kirche zuträgt, was unter der Oberfläche derartiger (abstrakter) Begriffe im Reden darüber durchbricht. – Unmittelbar darauf kippt die Erzählung schon in ein surreales Schlusstableau: Der Pavillon auf St. Helena, der Schauplatz des Konzils, stürzt in sich zusammen und macht einen Augenblick lang Platz für die Vision einer lichtdurchfluteten Kathedrale, ehe er sich endgültig in ein Trümmerfeld verwandelt.
Derartige „surreale Züge“ begegnen (das stellt schon Mario Andreotti im Vorwort zu diesem Band fest) in nahezu allen Texten, die Bonatti hier versammelt hat. – Der Schriftsteller, der einen Roman schreiben will: Er sitzt am Schreibtisch... und gleichzeitig im Krater eines Vulkans, (wieder) auf St. Helena, in dem Text Die Vulkane. Er kämpft und kämpft und bringt doch keinen Roman zustande; was er zutage fördert, das sind nur „Brocken“, Reflexionen über Figuren, die in seinen Roman eintreten könnten. Er hält (nach dem Muster Pirandellos) Sprechstunden ab für seine „Phantasiegaukelgestalten“, wohl wissend, dass sein Roman sich nur entfalten kann, wenn die Marionetten zu Personen sich verwandeln können, „mit Freiheit ausgestattet, mit eigenem Gewissen“. Unter allen denkbaren Protagonisten ist ihm der Narr am nächsten, die einzige Figur, die „auf Logik verzichten darf“; doch vor der Vorstellung, sein Ich in fremde Kleider zu stecken, vor dieser zwar erfolgversprechenden, aber konventionellen Strategie schrickt er zurück, und die „Story vom Nichtfinden der Story“ ersetzt am Ende (konsequent) den so schon im Ansatz steckengebliebenen Roman.
Auch diese Erzählung Die Vulkane oder Er wollte einen Roman schreiben hat Bonatti im vorliegenden Band zum ersten Mal veröffentlicht. Zwei weitere Prosatexte, Requiem für einen Verkehrstoten und Der Pianist, sind schon früher erschienen, aber inzwischen wesentlich erweitert worden (anders als die drei Gedichte, die zwischen diesen Prosatexten stehen und unverändert aus älteren Publikationen übernommen worden sind: Hebung, Rabenlitanei, Porträt). – In allen diesen Texten wird nicht in herkömmlicher Manier erzählt oder gar eine Geschichte nacherzählt, sondern das Erzählen mehr oder weniger bald ersetzt durch ein Reflektieren über das Erzählen, das wiederum einmündet in ein Reflektieren über den Fortschritt, den Fortschritt im Gang der fiktiven Handlung wie auch den Fortschritt im Gang der Weltgeschichte. Manches wird dabei ausdrücklich beklagt; der Prozess der Entmythisierung zum Beispiel, der mittlerweile auch Bereiche erfasst hat, die darunter leiden, oder auch der Umstand, dass das Bewusstsein über den Unterschied zwischen profan und sakral weithin verschwunden ist. Aber in der Regel hat Bonatti (wie sein auktorialer Erzähler) nicht viel übrig für einen (leisen) larmoyanten Ton, ihn zieht es weit eher hin zu (unmissverständlichen) satirischen und sarkastischen Passagen.
So, wenn er im Requiem für einen Verkehrstoten sich über den Titelhelden seine Gedanken macht – oder auch über dessen Beerdigung. „Letztlich richtet sich alles nach dem Vermögen oder Unvermögen der Hinterbliebenen; und des Toten.“ Während sich der Erzähler von den Mutmaßungen der Menschen distanziert, die im Leichenzug sich eingefunden haben und weniger mit Gedanken an den Toten als vielmehr mit sich selbst beschäftigt sind, stellt er seine eigenen Mutmaßungen an, aber er stellt sie gleichzeitig in Frage. Wie er am Ende auch den Schriftsteller in Frage stellt, der dem Kondukt folgt und dabei darüber nachgrübeln sollte, welchen Spruch er dem Toten zueignen könnte; er denkt an alles Mögliche, kommt vom Hundertsten ins Tausendste, und hat am Ende doch nur einen einzigen Satz zu bieten, den er dem Verkehrstoten widmen kann: Requiescat in pace! – Bonattis Interesse an der Musik ist in nahezu allen seinen Texten deutlich spürbar (nicht zuletzt in seiner Neigung zu Variationen), am stärksten aber zeigt es sich in der Erzählung Der Pianist (Krilowsky), die vor allem um den Themenkomplex Virtuosität und Zauber kreist und versucht, möglichst direkt in Sprache umzusetzen, was sich im Kopf des Künstlers K. (Krilowsky) abspielt (eine „ungeheure Verdichtung“ nämlich), und gleichwohl nüchtern darzustellen, was zu seinem Absturz führt: „Ängste, Befürchtungen, Obsessionen [...] tobten und tobten [...] rasten, tobten, rasten-tobten, während er Schumanns C-Dur-Phantasie op. 17 interpretiert, unübertrefflich; sie fuhren blindfingrig tobend im Kreis (fuhrentobten blindfingrig, tobten-fuhrentobtenfuhrentobten).“ – Dieser Text, wohl ebenfalls „durchaus fantastisch und leidenschaftlich vorzutragen“ wie der erste Satz der zitierten Schumannschen Komposition, ist im übrigen schon 1986 entstanden und in einer ersten Fassung im Jahr 1997 erschienen; es ist indessen ganz bestimmt kein Zufall, dass Bonatti ihn immer wieder sich zur weiteren Bearbeitung vorgenommen hat.
Was der erste Sonderband der Reihe Texttürme dokumentiert, ist, kurz zusammengefasst: eine unverwechselbare, ganz eigene Stimme, die sich unbedacht weder an alten Mustern noch an neuen Moden orientiert, weil sie allen vor-formulierten Sätzen grundsätzlich misstraut.
Franz Tumler: In einer alten Sehnsucht. Ein Südtirol-Lesebuch. Hg. von Ferruccio Delle Cave.
Innsbruck, Wien: Haymon 2016
Erst als er gekommen war
sah er, daß er wirklich
zurückgekommen war: (S. 126)
 Der Haymon-Verlag bringt seit 2012 die Studienausgabe Franz Tumler heraus, bei der Johann Holzner federführend ist. Nach den Bänden Nachprüfung eines Abschieds, Aufschreibung aus Trient, Der Schritt hinüber und dem Sammelband Hier in Berlin, wo ich wohne sucht Ferruccio Delle Cave Tumlers Erinnerungs- und Sehnsuchtsort Südtirol auf. Der gebürtige Südtiroler pflegt immer wieder in seine Vaterheimat zurückzukehren, auch wenn er sich oft nur auf der Durchreise befindet, nicht bleiben kann, weiterfahren muss. Der nun vorgelegte Sammelband In einer alten Sehnsucht zum Thema Südtirol gliedert sich in drei Kapitel: Jahrgang 1912, Ortsbestimmung und Welche Sprache ich lernte.
Der Haymon-Verlag bringt seit 2012 die Studienausgabe Franz Tumler heraus, bei der Johann Holzner federführend ist. Nach den Bänden Nachprüfung eines Abschieds, Aufschreibung aus Trient, Der Schritt hinüber und dem Sammelband Hier in Berlin, wo ich wohne sucht Ferruccio Delle Cave Tumlers Erinnerungs- und Sehnsuchtsort Südtirol auf. Der gebürtige Südtiroler pflegt immer wieder in seine Vaterheimat zurückzukehren, auch wenn er sich oft nur auf der Durchreise befindet, nicht bleiben kann, weiterfahren muss. Der nun vorgelegte Sammelband In einer alten Sehnsucht zum Thema Südtirol gliedert sich in drei Kapitel: Jahrgang 1912, Ortsbestimmung und Welche Sprache ich lernte.
Das erste Kapitel Jahrgang 1912 spannt einen Bogen zwischen dem literarischen Anfang und dem Ende des Schreibens Franz Tumlers. Es versammelt Prosa, publizistisches Schreiben und Lyrik. Deutlich wird eine Sehnsucht und gleichzeitig eine Distanz zu Südtirol; an dieser Dialektik müht sich Tumler Zeit seines Lebens ab. Der namensgebende Text Jahrgang 1912 erscheint in Jahr und Jahrgang 1967 das erste Mal. Das Buch vereint Texte von Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die alle 1912 geboren wurden. Es gibt einen Einblick, wie sich dieser Jahrgang in das Netz des Nationalsozialismus verstricken lässt und diese Verstrickung im Nachhinein beurteilt. Neben Tumler findet sich z.B. auch Gertrud Fussenegger. Das Spannungsfeld zwischen Nationalsozialismus und der Hinwendung zu anderen Schreibweisen hätte man mit einer etwas anderen Textauswahl deutlicher unterstreichen können.
Die zeitliche Bestandsaufnahme von 1912 bis 1998 wird im zweiten Kapitel einer örtlichen gegenübergesetzt. Spielen im ersten Teil Tumlers Lebenslandschaften Oberösterreich und Berlin durchaus eine Rolle, so konzentriert sich der Band in Ortsbestimmung auf Südtirol, genauer auf das Vinschgau, auf Meran, Plasnego/Blasenegg, Göflan, Schlanders und immer wieder Laas. Eine der schönsten Erzählungen Lagàr darf in der Sammlung natürlich nicht fehlen. Am Sonnenberg über Laas spürt Tumler einer Ruine, einem abgebrannten Haus nach. Er versucht Linien auf der Landkarte in der Landschaft festzumachen und setzt alles daran, eine Ordnung zu erkennen. Für Tumler wird das Ordnen von Beobachtungen, das Einordnen in Strukturen ein wesentlicher Haltepunkt in seinem Schreiben und Leben. Der Doppelpunkt kündigt die Einordnung an.
„Als wir unten sind und es Abend wird – ich denke, wie es abends jetzt oben ist. Als ich zwei Tage später unten auf der Straße fahre und hinaufsehe, kann ich es auch im Fahren sehen: als erstes den grauen Strich, dann darüber die Felskuppel, darunter den Fächer Wiese, dazwischen ist die Trennlinie und ein Stück davon der graue Strich: die Trennlinie – der Weg, der graue Strich – das Haus.“ (S. 146)
Mit dem Verweis auf das Ordnen gelangen die Leserin und der Leser im letzten Kapitel Welche Sprache ich lernte zur Frage, wie das Ordnen denn nun in Sprechen oder Schreiben umzusetzen sei. Tumler beschäftigt sich bereits in jungen Jahren mit dem Ladinischen, prüft Ortsnamen auf ihre Herkunft und beschäftigt sich mit Dichtern und Denkern aus Südtirol, namentlich mit Oswald von Wolkenstein und mit Jakob Philipp Fallmerayer. Er wiegt die Worte, überlegt lange, bevor er sich für ein Wort entscheidet. Ob der raumgreifende Abdruck des Werkstattgesprächs mit Peter Demetz – es ist sicher eines der wichtigsten Zeugnisse, was Tumlers Aussagen zu seinem eigenen Werk betrifft – an dieser Stelle glücklich gewählt ist, kann man diskutieren. Gut fügt sich hingegen das 1989 entstandene Gedicht Vergangenheit ein, in dem Tumler von der Spannung zwischen Sprache und Sprachlosigkeit, von Aufzählung und Verwechslung spricht.
Das nachprüfende Nachwort Delle Caves nähert sich in vielen Punkten einfühlsam dem Schreiben, wenn er erklärt, wie es zu Wortwahl – manchmal sogar Wortneuschöpfungen – Tumlers kommt. Der Herausgeber beschäftigt sich mit der Entstehung von Wendungen wie „Aufschreibung“ und „Nachprüfung“. Manchmal ist das prosaische Nachwort zu glatt, wenn es vom „Anschluss“ Österreichs ans Deutsche Reich spricht und darüber, welche „Verwerfungen und Veränderungen“ die Geschichte mit sich gebracht habe. (S. 230) Norbert Florineth und auch Jörg Hofer, die sich beide um Tumler und dessen Werk verdient gemacht haben, erzählen die Geschichten von Laas und vom Autor noch heute. Mit seiner abschließenden Erinnerung hat Delle Cave den Erzählungen Florineths zu Recht ein Andenken bewahrt.
Barbara Hoiß
Peter Giacomuzzi: asyl asyl.
Zirl: edition baes 2016
 Peter Giacomuzzi hat mit seinem Gedichtband „asyl asyl“ eine Art Logbuch rund um die so genannte „Flüchtlingsfrage“ verfasst, das ein Jahr lang, von Februar 2015 bis Februar 2016, mit Datumsangaben versehen, das Material der Sprache und die Fakten, die in diesem zum Ausdruck kommen, besieht, wendet, umdreht, gegen den Strom und gegen die vorherrschende Richtung. Bei den poetischen Verfahrensweisen waren ihm wohl die Dadaisten, sicherlich aber Ernst Jandl große Meister, wie zwei Gedichten entnommen werden kann, in dem Giacomuzzi sich direkt auf diesen bezieht: war not love, S.17, aber auch S. 84: ldnaj). Eine ganz eigene Montage- und Dekonstruktionstechnik verleiht den Texten einen unvergleichlichen Sound, der zugleich unbarmherzig ist (mit jenen, die austeilen) und empathisch sich annähernd (an jene, die einstecken müssen). Versatzstücke aus der Alltagssprache, die an Kriegssprache erinnern, werden aufgedröselt, durchdekliniert und in ihrer an Befehlen geschulten Gewalt dargestellt. Ein „Untergrund“, der ständig mitgedacht und als in der Sprache präsent dargestellt wird, ist dabei die in unseren Breitengraden vorherrschende Religion mit ihren Geboten und Verboten. So werden Verse aus Gebeten abklopft, ihre Formen wie zum Beispiel die Litanei verwendet, aber in völlig fremde Kontexte gestellt, nämlich in den Kontext von Fremdenfeindlichkeit, von sich Verschließen und den Anderen Ausschließen. Die biblische Saga von der Herbergssuche aber auch Vers 35/25 des Matthäus-Evangeliums aus dem „Weltgericht“: „Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben; ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben; ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen“ - beides moralische Imperative für Christinnen und Christen – werden mit den politischen Ereignissen rund um den Asylstopp kombiniert (im Juni 2015 von Innenministerin Johanna Mikl-Leitner angeordnet). Giacomuzzi spricht diese bzw. weitere Politiker und Politikerinnen direkt in seinen Gedichten an, zeigt dadurch auch die persönliche Verantwortung jeder bzw. jedes Einzelnen in dem, was er tut bzw. nicht tut, auf (S. 37). Auch auf die Grenzschließungen am Balkan und am Brenner bezieht sich Giacomuzzi ganz konkret. So findet sich im Band folgendes Gedicht, das sich explizit an diese uns so nahe und „vertraute“ Grenze bezieht:
Peter Giacomuzzi hat mit seinem Gedichtband „asyl asyl“ eine Art Logbuch rund um die so genannte „Flüchtlingsfrage“ verfasst, das ein Jahr lang, von Februar 2015 bis Februar 2016, mit Datumsangaben versehen, das Material der Sprache und die Fakten, die in diesem zum Ausdruck kommen, besieht, wendet, umdreht, gegen den Strom und gegen die vorherrschende Richtung. Bei den poetischen Verfahrensweisen waren ihm wohl die Dadaisten, sicherlich aber Ernst Jandl große Meister, wie zwei Gedichten entnommen werden kann, in dem Giacomuzzi sich direkt auf diesen bezieht: war not love, S.17, aber auch S. 84: ldnaj). Eine ganz eigene Montage- und Dekonstruktionstechnik verleiht den Texten einen unvergleichlichen Sound, der zugleich unbarmherzig ist (mit jenen, die austeilen) und empathisch sich annähernd (an jene, die einstecken müssen). Versatzstücke aus der Alltagssprache, die an Kriegssprache erinnern, werden aufgedröselt, durchdekliniert und in ihrer an Befehlen geschulten Gewalt dargestellt. Ein „Untergrund“, der ständig mitgedacht und als in der Sprache präsent dargestellt wird, ist dabei die in unseren Breitengraden vorherrschende Religion mit ihren Geboten und Verboten. So werden Verse aus Gebeten abklopft, ihre Formen wie zum Beispiel die Litanei verwendet, aber in völlig fremde Kontexte gestellt, nämlich in den Kontext von Fremdenfeindlichkeit, von sich Verschließen und den Anderen Ausschließen. Die biblische Saga von der Herbergssuche aber auch Vers 35/25 des Matthäus-Evangeliums aus dem „Weltgericht“: „Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben; ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben; ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen“ - beides moralische Imperative für Christinnen und Christen – werden mit den politischen Ereignissen rund um den Asylstopp kombiniert (im Juni 2015 von Innenministerin Johanna Mikl-Leitner angeordnet). Giacomuzzi spricht diese bzw. weitere Politiker und Politikerinnen direkt in seinen Gedichten an, zeigt dadurch auch die persönliche Verantwortung jeder bzw. jedes Einzelnen in dem, was er tut bzw. nicht tut, auf (S. 37). Auch auf die Grenzschließungen am Balkan und am Brenner bezieht sich Giacomuzzi ganz konkret. So findet sich im Band folgendes Gedicht, das sich explizit an diese uns so nahe und „vertraute“ Grenze bezieht:
Prenero prena
auf auf
erhebet euch und dann errichtet
es gilt das uns zu schützen
auf auf
ein zaun verbindet nicht
er nichtet
wir müssen uns entscheiden
wo wir sitzen
der mensch soll nicht verbinden
wo göttin hat getrennt ganz fein
die eine hälfte sein for blinden
de anare for swain
In den letzten beiden Versen des Gedichts, das insgesamt einen „hohen Ton“, der an Nationalhymnen erinnert, anschlägt bzw. vortäuscht, wird dieser massiv zum Einsturz gebracht bzw. konterkariert, indem eine Art Kunstdialekt angewandt wird, den Giacomuzzi auch in anderen Gedichten verwendet: „Kunst“ deshalb, weil er Versatzstücke aus einem vertrauten Dialekt mit Fantasiewörtern, die teilweise klanglich ans Englische erinnern bzw. „richtige“ englische Wörter sind, miteinander vermischt. Derart verfremdet und ent-fremdet Giacomuzzi Gewohntes und Nahes und führt nicht nur eine Ebene der Distanz, sondern vielmehr eine klar zu erkennende politische Haltung ein.
Doch nicht nur verfremdete „vertraute“ Sprache, sondern auch fremde Sprache, „ein leben ohne wörter“ (S.51) ist Thema und literarische Herangehensweise zugleich. Der Autor unterrichtet Deutsch als Fremdsprache und erläutert in einer kurzen, sehr persönlichen Einführung zum Gedichtband, warum er es unerträglich findet, Menschen, die größtmögliche Gefahren auf sich genommen haben, um in Sicherheit zu kommen, nun einige wenige Brocken Deutsch beizubringen. Als einen Akt weiterer Gewalt scheint er zu empfinden, den Menschen ihre Herkunft und damit ihre Wurzeln zu nehmen, indem man sie in eine fremde Sprache zu pressen versucht. Integration, die sehr nahe an Assimilation kommt. Am eindrucksvollsten kommt dies in folgendem Gedicht konzentriert zum Ausdruck:
ein zaun für mich
ein zaun für dich
ein zaun für ihn
ein zaun für sie
ein zaun für es
ein zaun für uns
ein zaun für euch
ein zaun für sie
ein zaun für Sie
und jetzt den akkusativ
031115
Und demzufolge ist die Frage nach Identität, nach Identitäten eine wesentliche Achse in den Texten, wobei der Autor durchdekliniert und -konjugiert und sich selbst, seine Suche nach seiner eigenen Identität nicht ausspart, zum Beispiel im Gedicht giacomuzzi (S.98). Der Unterschied dabei ist, dass er seine eigene als „eingekastelt“ in viele Bezeichnungen findet, wohingegen jene, die als Asylwerbende nach Österreich kommen, jegliche Identität, jegliche Geschichte quasi an der Grenze zurücklassen müssen und ausschließlich auf dieses eine (für sie selbst vielleicht unwichtigste) Merkmal reduziert werden: geflohen zu sein und jetzt in einem anderen Land, das sie nicht unbedingt haben will, gelandet. Oder, um es im Giacomuzzi’schen Sound zu sagen: identitäten idinti titten ädänntä täten ödöntö töten (S. 43). Identitäten töten. Und „Flüchtlinge“: Ein Wort, das so viel nicht sagt. Dabei ist es selten ein „Ich“, das in den Texten spricht, sondern oft ein „Wir“; ein „Wir“ jedoch, welches das „schreibende Ich“ als ein Kollektiv darstellt, das sich erst dadurch als Wir empfinden kann, als es die „Anderen“, die „Flüchtlinge“, die „flüchtlingsströme“ (Gedicht S. 79) abfängt, abschiebt, abtötet. Und von dem das schreibende Ich sich abgrenzt, indem es diesen Mechanismus an der Bearbeitung des Sprachmaterials bloßlegt.
Einige der stärksten Texte des seitenmäßig schmalen, aber inhaltlich und formal dichten und intensiven Bands, der den einzelnen Gedichten keinen Titel voransetzt, sondern einen einzelnen Vers im Gedicht fett hervorhebt, sind meines Erachtens jene, in denen einige jener mittlerweile schleichend in den Alltagsgebrauch übergegangene Wörter und Redewendungen, die das Abschotten und Zurückdrängen von Menschen auf der Flucht betreffen, sprachlich abgeklopft werden und so ihre Brutalität zum Vorschein kommt (z.B. ein bisschen spaß, S. 25, oder zumacher dichtmacher dichter, S. 65). Alltägliche Rituale und Zeitvertreibe wie das allseits bekannte schiffl versenken (S. 22f.) erhalten durch die Gegenwart, aus der heraus und in die Giacomuzzi hinein schrei(b)t, einen fast unerträglichen Beigeschmack. Und wenn kinderspiele in der Deklination von Wörtern wie „eingreifen abfangen abschieben“ bestehen (S. 78), so wird in der Kombination von scheinbar „Inkompatiblem“ das Grausame in der Sprache und in den Herzen zugleich bloßgestellt.
So weit uns Spaniens Hoffnung trug. Erzählungen und Berichte aus dem Spanischen Bürgerkrieg. Hg. von Erich Hackl.
Zürich: Rotpunktverlag 2016
(Mit Texten von: Erich Arendt, Theodor Balk, Franz Borkenau, Willi Bredel, Eduard Claudius, Carl Einstein, Walter Fischer, Lisa Gavrić, Valentin Gelber, Edwin Gmür, Willy Hirzel, Hans Hutter, Fritz Jensen, Hanns-Erich Kaminski, Alfred Kantorowicz, Hermann Kesten, Egon Erwin Kisch, Arthur Koestler, Rudolf Leonhard, Erika Mann, Peter Merin, Rudolf (Michel) Michaelis, Joaquim Morera i Falcó, Maria Osten, Karl Otten, Gustav Regler, Ludwig Renn, Ruth Rewald, Joseph Roth, Anna Seghers, Anna Siemsen, Augustin Souchy, Kurt Stern, Gusti Stridsberg, Ruth Tassoni, Clara Thalmann, Paul Thalmann, Albert Vigoleis Thelen, Ernst Toller, Bodo Uhse, Erich Weinert, F. C. Weiskopf)
„Der Widerstand, eine Brücke ohne Ufer“[i]
 Die „unter dem Eindruck des Geschehens entstandene Literatur […] gibt, genauer als ein Geschichtswerk, Auskunft über das, was die Menschen damals erhofft, was sie gewonnen und verloren haben, was möglich gewesen wäre“ (S. 9), schreibt Erich Hackl in seinem Vorwort zum 2016 erschienen Band So weit uns Spaniens Hoffnung trug, der zeitgenössische Erzählungen und Berichte aus dem Spanischen Bürgerkrieg in sich versammelt. Was zunächst fast vermessen anmutet („genauer als ein Geschichtswerk“) und sogleich an die Skepsis vieler Historikerinnen und Historiker gegenüber literarischen Quellen denken lässt, erweist sich – so viel kann schon vorweg genommen werden – als zutreffend.
Die „unter dem Eindruck des Geschehens entstandene Literatur […] gibt, genauer als ein Geschichtswerk, Auskunft über das, was die Menschen damals erhofft, was sie gewonnen und verloren haben, was möglich gewesen wäre“ (S. 9), schreibt Erich Hackl in seinem Vorwort zum 2016 erschienen Band So weit uns Spaniens Hoffnung trug, der zeitgenössische Erzählungen und Berichte aus dem Spanischen Bürgerkrieg in sich versammelt. Was zunächst fast vermessen anmutet („genauer als ein Geschichtswerk“) und sogleich an die Skepsis vieler Historikerinnen und Historiker gegenüber literarischen Quellen denken lässt, erweist sich – so viel kann schon vorweg genommen werden – als zutreffend.
Belege dafür liefern nicht nur die von Erich Hackl herausgegebenen Textsammlungen, sondern auch seine eigenen literarischen Werke (wenngleich sie nicht unter dem Eindruck des Geschehens, sondern retrospektiv entstanden sind), von Auroras Anlaß (1987) über Abschied von Sidonie (1989) bis hin zum Entwurf einer Liebe auf den ersten Blick (1999), einer Erzählung, die auch vor dem Hintergrund des Spanischen Bürgerkrieges spielt. Hackl, für den „genaue Recherche als Voraussetzung literarischer Gestaltung“[ii] gilt, rekonstruiert in seinen Texten, die schon als „Fallstudien“ und als „poetische Historiographie“ bezeichnet wurden, fernab aller Moden des historischen Romans Vergangenheit und kompensiert mit ihnen, was die Geschichtsschreibung nicht leisten kann: Leserinnen und Leser zu erschüttern, „ihre Gleichgültigkeit in Mitleid, ihr Mitleid in Solidarität, ihre Solidarität in Aktion“ (S. 10) zu verwandeln, kurz: den Menschen Phantasie und Einfühlungsvermögen zurückzugeben, mit der bzw. mit dem sie die „Trägheit des Herzens“[iii] zu überwinden im Stande sind.
Demselben Ziel folgen die Anthologien, als deren Herausgeber – oder besser: Arrangeur – Hackl fungiert: Sie widmen sich den politischen Umbrüchen des 20. Jahrhunderts, Schicksalsmomenten, die – hätten sie anders geendet – dem Verlauf der Geschichte eine andere Richtung gegeben hätten. Nachdem er 2014 gemeinsam mit der Literaturwissenschaftlerin Evelyne Polt-Heinzl eine Anthologie von Texten über den österreichischen Arbeiteraufstand im Februar 1934 herausgab, widmete sich Hackl, der übrigens auch Hispanistik studiert hat und als Übersetzer aus dem Spanischen tätig ist, nun dem Spanischen Bürgerkrieg.[iv] Die Parallelität der Zeitabstände, 1934 – 2014, 1936(-1939) – 2016 ist kein Zufall. 80 Jahre, solange dauert „nach Ansicht von Erinnerungstheoretikern das kommunikative Gedächtnis [an]. Das also, was innerhalb einer Familie oder Sippe mündlich weitergegeben wird, bis es mit dem Tod der ältesten Generation erlischt. Von da, von nun an sind wir auf historische und literarische Quellen angewiesen, um uns die Ereignisse vorzustellen“[v], so heißt es im Vorwort zur Anthologie Im Kältefieber.
Die Auswahl der 46 abgedruckten Texte in So weit uns Spaniens Hoffnung trug erfolgte nach äußeren Kriterien (es wurden nur in deutscher Sprache verfasste Texte von Zeitgenossinnen und Zeitgenossen aufgenommen), inhaltlich deckt der Band die gesamte Breite der politischen Positionen und Gruppierungen auf Seiten der Republik ab, denn Hackl lässt Kommunisten gleichermaßen zu Wort kommen wie Anarchisten, Sozialisten ebenso wie parteilose Antifaschisten. Ein knappes Viertel der Beiträge stammt von Frauen. Die Anordnung der Texte (besser spricht man von Komposition) folgt der Chronologie der Ereignisse und setzt zudem – hier knüpft Hackl an das mit Polt-Heinzl bereits erfolgreich für Im Kältefieber umgesetzte Konzept an – topographische Schwerpunkte. Was für die „Februargeschichten 1934“ vergleichsweise einfach war, weil sie auf eine weitaus weniger verworrene historische Situation rekurrierten, muss bei der Simultaneität der Ereignisse im Spanischen Bürgerkrieg eine viel größere Herausforderung gewesen sein. Geschichte verläuft nicht linear und die Anordnung der Texte will das auch nicht vorgaukeln. Dennoch erweist sich die Dramaturgie, die sich aus ihr ergibt, als Hilfestellung, die der Leserin, dem Leser die komplexen Geschehnisse näher bringt, ohne dass diese(r) sich überfordert fühlt.
Da trifft man zunächst den Schriftsteller und früheren Offizier Ludwig Renn im Schweizer Exil und erfährt mit ihm von den Ereignissen in Spanien. Man reist mit dem Schlosser und (späteren) Interbrigadisten Hans Hutter im Zug nach Barcelona und kommt schließlich mit dem Geschichtsphilosophen Franz Borkenau dort an. Hanns-Erich Kaminski nimmt die Leserin, den Leser mit in eine Kaserne, man erfährt von den Hoffnungen und von den Beweggründen der Soldaten für Spanien zu kämpfen, die sehr unterschiedlich sind und sich doch auf einen gemeinsamen Nenner bringen lassen: „Im Grunde wollen alle nichts anderes, als an der Revolution teilnehmen und den Proletariern der ganzen Welt ein Beispiel geben.“ (S. 57)
Noch sind sie fröhlich und sorglos, doch ich zittere, wenn ich daran denke, was der Krieg aus ihnen machen wird. Werden sie abstumpfen? Und werden sie nicht zu heimatlosen Soldaten werden, besessen von Frauen und Alkohol? Oder werden sie bald von allem angeekelt sein und sich nur noch nach einer ruhigen Ecke sehnen, in der sie nichts hören von Revolution und Bürgerkrieg? […] Wir können nur hoffen, daß der Krieg die Revolution nicht verschlingen wird und daß diese Milizsoldaten bleiben werden, was sie sind: Männer, die sich mit Leib und Seele für ihr Ideal einsetzen. (S. 59)
Tun sie dies anfangs noch hoffnungsvoll und mit Elan, liest man doch von Seite zu Seite stärker die zunehmende Ausweglosigkeit aus den Zeilen heraus, spürt man, dass der „Widerstand eine Brücke ohne Ufer“[vi] ist. Man erfährt von der Allgegenwart des Todes im Krieg, vom Morden, vom Hunger, vom Elend. „Wenn wir von Madrid erzählen“, so Maria Osten, „dann müßte die Feder gleichzeitig filmen, in Farben malen, fotografieren und zu dem einzelnen so sprechen, daß er alles wie am eigenen Leibe verspürt, daß er es miterlebt […]“ (S. 106). Ihrem Text gelingt das genauso wie einigen anderen im Band und es drängt sich an mehr als einer Stelle der Gedanke auf: „[D]as, wovon er [der Schreibende] gerade spricht, ist nicht alt, sondern nur eben vorbei, es hat sich in einer neuen, vielleicht noch grausigeren Variation wiederholt.“ (ebd.)
Es erfordert vielleicht den Schriftsteller, um aus einer Textsammlung einen vielstimmigen, dokumentarischen Roman zu machen. So weit uns Spaniens Hoffnung trug ist gleichermaßen ein Geschichtsbuch, das die äußeren Handlungen nachzeichnet und verständlich macht und ein Geschichtenbuch, das spürbar werden lässt, was in den Menschen vorging, warum sie gestorben sind und wofür. Auch 80 Jahre später ist es schmerzhaft, das schlussendliche Aufeinandertreffen von Vision und Wirklichkeit.
--------------------
[i] Erich Hackl: Abschied von Sidonie. Erzählung. Zürich: Diogenes, 1991, S. 61.
[ii] Erich Hackl: Literatur und Gewissen. Innsbruck: iup, 2016 (Innsbrucker Poetik-Vorlesungen, 1), S. 34.
[iii] Ernst Toller verwendet die Formulierung, die auf ‚Acedia‘, eine der sieben Hauptsünden, hindeutet, u. a. in seiner Autobiographie Eine Jugend in Deutschland: „Ich glaube nicht an die ‚böse‘ Natur des Menschen, ich glaube, daß er das Schrecklichste tut aus Mangel an Phantasie, aus Trägheit des Herzens.“ (zit. nach: Ernst Toller: Sämtliche Werke. Bd. 3: Autobiographisches und Justizkritik. Hrsg. von Stefan Neuhaus und Rolf Selbmann. Göttingen: Wallstein, 2015, S. 258.)
[iv] 1989 erschien die zusammen mit Manuel Lara García herausgegebene Anthologie Spanien im Schatten der Sonne. Eine literarische Reise in 26 Etappen bei Luchterhand.
[v] Erich Hackl, Evelyne Polt-Heinzl (Hg.): Im Kältefieber. Februargeschichten 1934. Mit einem Vorwort von Erich Hackl. Wien: Picus, 2014, S. 9.
[vi] Siehe Anm. 1.
Gerhard Jäger: Der Schnee, das Feuer, die Schuld und der Tod.
München: Karl Blessing 2016
Weißer Tod in schneearmen Zeiten
 Die größte Lawinenkatastrophe in der Geschichte der Alpen oder auch gleich der Welt trug sich laut einem Doku-Film von Sabine Zink und Gerhard Jelinek im Groß Walsertaler Blons zu: Im Jänner 1954 vernichten insgesamt 13 Lawinen das Bergdorf, mehr als 100 Menschen werden verschüttet, an die 50 sterben unter den Schneemassen. Einen ganzen Tag bleiben die Überlebenden abgeschnitten, die Straßen unpassierbar, die Telefonleitungen tot. Mit bloßen Händen graben die Menschen nach ihren Angehörigen. Als die Behörden endlich von der Katastrophe erfahren, bahnen sich Hilfsorganisationen, Feuerwehren und Hunderte Freiwillige aus dem In- und Ausland den Weg ins tief verschneite Walsertal.
Die größte Lawinenkatastrophe in der Geschichte der Alpen oder auch gleich der Welt trug sich laut einem Doku-Film von Sabine Zink und Gerhard Jelinek im Groß Walsertaler Blons zu: Im Jänner 1954 vernichten insgesamt 13 Lawinen das Bergdorf, mehr als 100 Menschen werden verschüttet, an die 50 sterben unter den Schneemassen. Einen ganzen Tag bleiben die Überlebenden abgeschnitten, die Straßen unpassierbar, die Telefonleitungen tot. Mit bloßen Händen graben die Menschen nach ihren Angehörigen. Als die Behörden endlich von der Katastrophe erfahren, bahnen sich Hilfsorganisationen, Feuerwehren und Hunderte Freiwillige aus dem In- und Ausland den Weg ins tief verschneite Walsertal.
Der Vorarlberger Austro-Popper Reinhold Bilgeri hat daraus 2010 den Roman Der Atem des Himmels gemacht, die “Geschichte einer Liebe”. Große Literatur war das nicht, aber gut verkäufliche und verfilmbare. Der Schnee, das Feuer, die Schuld und der Tod, der erste Roman des in Imst lebenden Vorarlberger Autors Gerhard Jäger literarisiert nun die zweitgrößte Lawinenkatastrophe in der Geschichte der Alpen: den Lawinenwinter 1951. “Der zahlreichen Menschenopfer wegen”, wusste der Spiegel dereinst zu berichten, “ hatte der Tiroler Landeshauptmann eine viertägige Landestrauer angeordnet. Nur die Kufsteiner Gastwirte widersetzten sich. Sie wollten zwei angesetzte Tanzvergnügen nicht ausfallen lassen.” Außerdem hatte die in den ersten Zügen des Wiederaufbaus erblühende Tourismuswirtschaft des Landes, abgesehen von allen materiellen Einbußen, einen Imageschaden erlitten. Die Naturgewalten hatten sich von ihrer wenig idyllischen Seite gezeigt und die Medien beschworen sogar noch eine angebliche Seuchengefahr herauf.
In Jägers Literarisierung geht es naturgemäß nicht bloß darum, die Katastrophe in Szene zu setzen, wiewohl sich die Schneemassen auf diesen 400 Seiten gegen Ende hin immer bedrohlicher auftürmen. Die schließlich abgehende Lawine wird dramaturgisch unheilschwanger - nachgerade wie in Fontanes John-Maynard-Ballade das rettende Ufer von Buffalo - angekündigt: “Und oben auf den Bergen sammelt sich der Schnee, auf den Graten hängen die Schneewechten … Und oben auf den Bergen ist die große Welt, die andere Welt, die eisige Welt … Und oben auf den Bergen wütet der Wind, reißt und zerrt an allem … Und oben auf den Bergen ein Beben und Zittern …” Der Gewaltakt der Natur wird insofern noch gesteigert, als er das Treiben zweier Liebender im Heustadel unterbricht. “Dann ist es still, ohrenbetäubend still”, schildert der Erzähler Ehrfurcht gebietend; als beide ausgegraben sind, setzt es freilich Schläge von einem Dritten. “Dann Stille, Stille, eine ohrenbetäubende Stille.”
Im Mittelpunkt steht das rätselhafte Schicksal eines jungen Historikers, der aus Wien in ein Tiroler Bergdorf reist, um die Geschichte der dort als Hexe verschrienen Katharina Schwarzmann zu erforschen, die am 5. Jänner 1856 auf ihrem Hof verbrannte. Max Schreiber, so heißt der Studierte, hat hier damit keinen leichten Stand. Er verliebt sich zudem in “die Stumme” und am Höhepunkt der Dreiecksgeschichte - ein ortsansässiger Bauernsohn hat sich längst in diese Nachfahrin der anno dazumal Verbrannten verschaut - passiert, was eben geschildert wurde. Wer im Übrigen das alles zu erzählen weiß, ist nicht ersichtlich. Jäger hätte aus Schreibers Aufzeichnungen, die sich im Tiroler Landesarchiv erhalten haben, zitieren können, aber er tut dies nicht (oder nur kurz und wenig überzeugend), sondern nimmt eine allwissende Erzählperspektive ein. Ausgehoben werden diese Unterlagen von einem im Jahr 2006 aus Übersee angereisten John Miller (dem zweiten Erzähler), der sich - achtzigjährig - “auf diesem Weg zu einem Geheimnis, das ich alter Narr lösen will”, aufgemacht hat.
Es geht - soweit kündigt dieses Geheimnis bereits der Titel des Romans an - auch um Tod und Schuld. Es wäre unfair, die Katze aus dem Sack zu lassen, aber es verhält sich ohnedies so, wie sich Innsbruck in dem mit meteorologischen Stimmungsbildern überinstrumentierten Schmöker darbietet: “Alles ist grau in grau. Nichts klärt sich auf, und es scheint, als ob das Wetter mir zu verstehen geben will, dass es kein Durchkommen, keine Klarheit geben wird.” Archaische Atmosphäre satt, dort droben in den Bergen, aber kein erzählerischer Gipfelsieg.
Bernhard Sandbichler
Martin Kolozs: Sommer ohne Sonne. Roman.
Hohenems, Wien, Vaduz: Bucher 2016
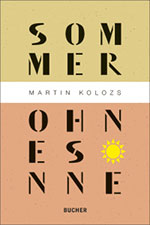 „Hast du auch nichts vergessen?“ – So harmlos Martin Kolozs seinen jüngsten Roman auch eröffnet, so schnell kann man erahnen: Etwas viel Schwereres, als der Anfang vermuten lässt, ist liegengeblieben und harrt in dem beschaulichen norwegischen Ferienhaus der Erinnerung. Der renommierte Theaterkritiker Martin Sauerwein verbringt dort den Sommer – in diesem Jahr jedoch nicht allein, sondern im Beisein einer jungen Biographin, nach deren Abreise seine Gedankenwelt aus den Fugen gerät: Nie verarbeitete Erlebnisse, die er der Autorin seiner Memoiren verheimlicht hat, tauchen als Geister der Vergangenheit auf; er, der jahrelang geschwiegen hat, „als fürchte er mit nur einem Wort zu viel, einen Dämon oder anderen Höllenhund zu entfesseln und nicht wieder einfangen zu können“, muss nun einsehen, dass er dem Verdrängten nicht länger entkommen kann. Mit der Erinnerung aber kommen die Zweifel, brennende Fragen nach der Richtigkeit und dem Sinn des eigenen Tuns: So wird aus der bescheidenen Geschichte eines reifenden Mannes mehr und mehr ein Roman über das Schicksal, der Suche nach einem erfüllten Leben und das Recht darauf, dieses selbst zu beenden.
„Hast du auch nichts vergessen?“ – So harmlos Martin Kolozs seinen jüngsten Roman auch eröffnet, so schnell kann man erahnen: Etwas viel Schwereres, als der Anfang vermuten lässt, ist liegengeblieben und harrt in dem beschaulichen norwegischen Ferienhaus der Erinnerung. Der renommierte Theaterkritiker Martin Sauerwein verbringt dort den Sommer – in diesem Jahr jedoch nicht allein, sondern im Beisein einer jungen Biographin, nach deren Abreise seine Gedankenwelt aus den Fugen gerät: Nie verarbeitete Erlebnisse, die er der Autorin seiner Memoiren verheimlicht hat, tauchen als Geister der Vergangenheit auf; er, der jahrelang geschwiegen hat, „als fürchte er mit nur einem Wort zu viel, einen Dämon oder anderen Höllenhund zu entfesseln und nicht wieder einfangen zu können“, muss nun einsehen, dass er dem Verdrängten nicht länger entkommen kann. Mit der Erinnerung aber kommen die Zweifel, brennende Fragen nach der Richtigkeit und dem Sinn des eigenen Tuns: So wird aus der bescheidenen Geschichte eines reifenden Mannes mehr und mehr ein Roman über das Schicksal, der Suche nach einem erfüllten Leben und das Recht darauf, dieses selbst zu beenden.
Tiefes Verständnis für diese großen Themen zeigt nur die in Sauerweins Gedächtnis lebendig werdende Freundin, die alte, fast stereotypenhaft weise Cäcilia – ihr stehen die Figuren der Gegenwart gegenüber, aus denen sich ein konfliktgeladenes Beziehungsgeflecht ergibt: verletzliche Frauen, die den angesehenen Theaterkritiker Klischee-gemäß wild begehren, ein eifersüchtiger Ehemann, der zwielichtige (in seiner Authentizität wohl am besten gelungene) Handlanger Arne, und vor allem der unnahbare Sauerwein selbst, der sich, aus Angst vor dem eigenen Versagen, in schwierige Liebschaften flüchtet. Die eigentliche Handlung aber besteht aus bruchstückhaften Erinnerungen, die auch die Struktur des Textes prägen: Erst allmählich erfährt der Leser von Sauerweins einschneidenden Begegnungen – das Verfahren, das Geschehen nur langsam und unter Missachtung der Chronologie zu entrollen, trägt ebenso wie die eingeflochtene Kriminalgeschichte dazu bei, die Spannung aufrechtzuerhalten. Vieles ist dabei zu knapp und zu vage erzählt, um in einen größeren Sinnzusammenhang eingeordnet zu werden – dennoch ist man dankbar für die Aussparungen, wenn mit dem Verzicht auf Erklärungen und Wertungen vermieden wird, dass moralisch-belehrende Töne überhandnehmen.
Szenische, mit norwegischen Einsprengseln versehene Dialoge, vor allem aber die genauen Beschreibungen von Mimik, Gestik und Sprechweise der Figuren verdeutlichen die Komplexität der zwischenmenschlichen Beziehungen, in denen Wichtiges unausgesprochen bleibt und nur in subtilen Andeutungen erkennbar wird – Kolozs Bemühen, Inquit-Formeln zu variieren („blaffte“, „lächelte beinahe angewidert“, „schnitt ihm das Wort im Mund ab“, „prustete […] spöttisch“) lässt den Text aber ebenso wie die vielen Vergleiche („lakonisch im Brustton eines südamerikanischen Großgrundbesitzers“, „rollte dabei mit den Augen, wie ein Orakel, das in die Zukunft blickt“, „grinste […] zufrieden wie ein dicker Kater“, „[n]eugierig wie eine Eule“, „glitt aus dem Bett, wie über eine Notrutsche“) oft umständlich gezwungen wirken. Sprachlich besser gelingen dem Autor die Naturbeschreibungen, mit denen er die raue nordische Landschaft mit ihren Fjorden und Küsten nachzeichnet. Regen und Sturm werden zum Symbol für die inneren Zustände der Hauptfigur, wobei eine schlichte, klare Sprache, mit der Kolozs Naturphänomene einfängt, zumindest ab und zu verhindern kann, dass der Text in Sentimentalität abgleitet: Von dem Geruch des Fallobstes, den Weißwangengänsen und dümpelnden Eiderenten, den gegen die Häuser schlagenden Böen und den klappernden Wellblechdächern der Schiffshütten möchte man sehr gerne mehr lesen.
Felix Mitterer: Märzengrund.
Innsbruck: Haymon 2016
 Felix Mitterers jüngstes Stück Märzengrund entstand als Auftragswerk für das Zillertaler Kulturfestival Stummer Schrei, in dessen Rahmen es am 16. Juni 2016 unter der Regie von Konrad Hochgruber und mit Heinz Tipotsch in der Hauptrolle mit großem Erfolg uraufgeführt wurde. Nach über 20 ausverkauften Vorstellungen in diesem Sommer ist eine Wiederaufnahme für 2017 geplant. Daneben ist der Stücktext in Buchform beim Haymon-Verlag erschienen.[i] In 31 Bildern erzählt Mitterer darin die Geschichte von Elias, einem Bauernsohn, der krank von der Zivilisation in die Natur des Märzengrundes flieht. Dort verbringt er die nächsten 40 Jahre seines Lebens in Abgeschiedenheit, bevor er schließlich ins Tal zurückkehren muss.
Felix Mitterers jüngstes Stück Märzengrund entstand als Auftragswerk für das Zillertaler Kulturfestival Stummer Schrei, in dessen Rahmen es am 16. Juni 2016 unter der Regie von Konrad Hochgruber und mit Heinz Tipotsch in der Hauptrolle mit großem Erfolg uraufgeführt wurde. Nach über 20 ausverkauften Vorstellungen in diesem Sommer ist eine Wiederaufnahme für 2017 geplant. Daneben ist der Stücktext in Buchform beim Haymon-Verlag erschienen.[i] In 31 Bildern erzählt Mitterer darin die Geschichte von Elias, einem Bauernsohn, der krank von der Zivilisation in die Natur des Märzengrundes flieht. Dort verbringt er die nächsten 40 Jahre seines Lebens in Abgeschiedenheit, bevor er schließlich ins Tal zurückkehren muss.
Wie bereits in einigen seiner Werke zuvor hat Mitterer in Märzengrund eine wahre Geschichte aufgegriffen und dramatisiert. Seiner Recherche stand in diesem Fall aber die Tatsache im Weg, dass der Mensch, auf dem Elias basiert, Einsiedler war. Erzählungen und Augenzeugenberichte konnten nur einen Bruchteil dessen darstellen, was in 40 Jahren Einsamkeit passiert ist und was den Mann aus dem Märzengrund wirklich ausmachte. Um diese Lücken zu füllen und dem Gefühl eines ‚furchtbaren Mangels‘ bei der Figur des Elias beizukommen, ‚lieh‘ sich Mitterer, wie er im Nachwort zur Haymon-Ausgabe schreibt, einige Beobachtungen aus Henry David Thoreaus Buch Walden – eine Strategie, die offensichtlich wunderbar aufgegangen ist. Er zeichnet den RezipientInnen ein klares Bild von Elias, seiner Lebensweise und seinem Bezug zur Natur, die ihn umgibt.
Es ist eine beeindruckende Geschichte, vor allem auch wegen der Art, durch die sie im Stück vermittelt wird. In fließenden Übergängen treten Figuren aus den Szenen heraus und richten das Wort direkt ans Publikum. Im Dialekt erzählen sie von Elias, erzählen davon, wie er als Junge war, davon, wie es ihm immer schwerer fiel, im Tal zu leben, davon, wie er schließlich die Entscheidung traf, in den Märzengrund zu gehen, und von allem, was danach geschah. Auf diese Weise ergibt sich eine detaillierte Figurenzeichnung aus mehreren Perspektiven in einer Mischung aus szenischer Darstellung und Erzählung. Zudem werden dadurch auch die Schicksale derer beleuchtet, die Elias in seinem Eremitenleben zurückgelassen hat. Ergänzt wird das Ganze an einigen Stellen durch Musik und Videoprojektionen, die in den Regieanweisungen erwähnt werden und natürlich dem Stück in inszenierter Form vorbehalten sind.
Nun drängt sich bei der Auseinandersetzung mit Märzengrund quasi zwangsläufig die Frage nach der Zivilisationskritik auf, nach der man wegen der Art des Stoffes ganz intuitiv zu suchen beginnt. Schließlich grenzt sich Elias mit seinem Lebensentwurf, dessen Ansprüchen oft auch die Natur selbst nicht gerecht werden kann, in radikaler Weise vom Leben der übrigen Menschen im Tal ab, welches durch Modernisierung, Technisierung und ständigen Fortschritt charakterisiert ist. Ein Mittelweg wird im Rahmen des Stückes nicht angeboten und auch die wenigen Besuche von Familie und Freunden, die Elias während seiner 40 Jahre auf der Alm bekommt, bestätigen nur die absolute Trennung dieser beiden Welten. Aber was soll man nun damit anfangen? Welche Lehre kann man aus dem Stück ziehen? Gibt es überhaupt eine? Die Antwort lautet zum größten Teil: Nein. Nur in einigen wenigen Momenten sickert eindeutige Kritik an der modernen Zivilisation durch und tatsächlich zählen diese zu den schwächeren im Stück. Als Beispiel seien die sich bekämpfenden Ameisen in Bild 21 genannt – eine Metapher auf den Krieg, die stark und lebhaft beginnt, aber lediglich mit dem schlichten Resümee endet, dass Krieg sinnlos sei.
So wird deutlich, dass es hier um eine eingehende Kritik an unserer Zeit nicht gehen kann. Vielmehr bringt Mitterer selbst im bereits zitierten Nachwort Sinn und Zweck des Stückes auf den Punkt, wenn er schreibt, dass er damit dem Bauernsohn aus dem Zillertal, auf dem es basiert, ein Denkmal gesetzt hat. Unterm Strich lässt sich also sagen: Märzengrund ist ein wunderbares Denkmal für einen faszinierenden Aussteiger, dessen Geschichte nun auf der Bühne weiterleben wird.
Max Mayr
--------------------
[i] Diese Rezension bezieht sich auf die Publikation im Haymon-Verlag, nicht auf die Zillertaler Inszenierung.
Anne Marie Pircher: Über Erde. Gedichte.
Innsbruck: edition laurin 2016
 Die Südtiroler Autorin Anne Marie Pircher debütierte 2000 mit dem Lyrikband „bloßfüßig. Texte und Illustrationen“ (Berenkamp, Innsbruck). In der Folge wandte sie sich dem Erzählen zu und veröffentlichte drei Erzählbände. „Kopfüber an einem Baum“, „Rosenquarz“ (Skarabaeus, Innsbruck) und „Zu den Linien“ (Edition Laurin). Nun erschien ihr zweiter Lyrikband „Über Erde“.
Die Südtiroler Autorin Anne Marie Pircher debütierte 2000 mit dem Lyrikband „bloßfüßig. Texte und Illustrationen“ (Berenkamp, Innsbruck). In der Folge wandte sie sich dem Erzählen zu und veröffentlichte drei Erzählbände. „Kopfüber an einem Baum“, „Rosenquarz“ (Skarabaeus, Innsbruck) und „Zu den Linien“ (Edition Laurin). Nun erschien ihr zweiter Lyrikband „Über Erde“.
Zwischen Lyrik und Prosa fließen die Texte Anne Marie Pirchers, und mithin ist es ein charakteristischer Zug ihres Schreibens, dass sie die Elemente der lyrischen Verdichtung mit jenen der erzählerischen Bewegung zu verbinden versteht. So finden sich in ihrem neuen Gedichtband vor allem erzählende Gedichte, die gleichermaßen auf verdichtete situative Momentaufnahmen hin fokussiert sind. Die Texte führen szenische Bilder vor Augen, in die der punktuelle Bezugspunkt eines lyrischen ICH, dessen Erleben, Erinnern und Empfinden wie Intarsien eingearbeitet sind. Die visuellen Elemente der Gedichte enthalten zumeist fotografisch festgehaltene Miniaturen. Dass Anne Marie Pircher eine nahe Beziehung zur Fotografie pflegt, zeigte sich bereits in ihrem ersten Gedichtband „bloßfüßig“. Darin begleiten die Texte ihre eigenen Schwarz-Weiß-Fotografien. Sehen und über das Gesehene hinaus Zusammenhänge herzustellen und auszugestalten – darin darf ein Grundzug ihrer Texte ausgemacht werden, auch in ihrem neuen Gedichtband „Über Erde“. Darin heißt es beispielsweise im Gedicht „Fuge in Rot“: „Auch in dieser Stadt suche ich die Bilder / den Klang der Farben abseits vom Wort“.
Der neue Gedichtband ist in drei Teile gegliedert.
Der erste Teil trägt als Motto die Verszeile „so weit reicht der Atem“. In den Gedichten lassen sich die Spuren einer Art Reisebewegung nachziehen: „Wohin zu gehen ist“, fragt das erste Gedicht, und es ist Ausgangspunkt für ein Gehen an andere Orte, es eröffnet Horizonte von Reiseerfahrungen: in Andalusien, Kalabrien, im Osten, in Danzig, Mostar u.a., oder einfach nur in einem Garten und in der nahen Umgebung.
Den Gedichten zugrunde liegen – wie Anne Marie Pircher in einem Interview erklärt – Inspirationen, die auf ihre eigenen Reisen, auf die Begegnung mit fremden Landschaften und Lebensräumen zurückgehen. Auf diesen Reisen sind Notizen, Fragmente und Fotografien entstanden, die sie nun in ihren Gedichten literarisch ausgeformt hat.
Sinnlich und bildreich breiten die Texte kleine Panoramen des Lebens wie der Welterfahrung aus – Panoramen, aus denen Stimmungen herausklingen und die in ‚Gestimmtheiten‘ führen. Die Gedichte führen aber eigentlich zu poetischen Orten der Fremdheitserfahrung – der schmerzlichen, der heiter gelassenen, der zärtlich empfundenen oder der geduldig nachgespürten – ,immer aber der aufmerksam gehörten und wahrgenommenen Erfahrungen des Lebens.
Anne Marie Pircher sagt: „Mich interessiert, was Landschaften aus Menschen machen. Du fährst irgendwo anders hin und plötzlich kannst du jemand anderes sein.“ („Was treibt die Menschen an?“ Die Schriftstellerin Anne Marie Pircher im Gespräch mit Christine Kofler, VISSIDARTE 2015).
Dieses Hineingehen in andere Wirklichkeiten, das ‚in-Beziehung-treten‘, sich fremden Erfahrungsräumen aussetzen ist ein Grundmotiv ihres Schreibens.
Auch im zweiten Teil ihrer Gedichte ist das Grundmotiv die Erfahrung des Unbekannten, des Neuen vielleicht, dann – so der Titel dieses Teils – „wächst eine lila Blume in den Raum“ - und es öffnet sich der Raum für das Unerwartete.
Die Gedichte dieses Teils ziehen hinein in eine vibrierende Atmosphäre der Lebendigkeit, der Bewegung – vor allem auch der Bewegung im Tanz. Dies ist eines der wiederkehrenden Motive, in dem sich eine Atmosphäre der Bewegtheit und der Erotik entfaltet. „Ohne Gewähr“ heißt beispielsweise ein Gedicht: „der Blick im Spiegel findet neue Wege“ (...) „hier gehört uns nichts, hinter Türen halten wir uns zitternd die Waage Wange an Wange.“
Der dritte Teil trägt den Titel „Gras, das sich einer unsichtbaren Hand beugt“. Es ist gleichzeitig die Zeile des ersten Gedichts „Liebesspiele“, das die Verbundenheit der Dinge zueinander in einem wunderbaren Naturgedicht vor Augen führt. In diesem Teil sind Texte versammelt, in denen ein lyrisches ICH ein schreibendes ICH erkundet und dabei Topografien der Existenz – seiner eigenen Existenz – erinnernd verortet.
Den drei Teilen des Bandes ist das Gedicht „slow motion“ vorangestellt, in dem sich eine Art Leitbild des Schreibens von Anne Marie Pircher zu erkennen gibt, erzählt es doch von der Schildkröte, die alljährlich „in Zeitlupe aus dem Winterloch“ kriecht und die Winterstarre in der Frühlingssonne allmählich wieder verliert. Anne Marie Pircher sieht darin ein Sinnbild für ihre Kreativität und dies darf auch als Sinnbild gesehen werden für den notwendigen Wechsel der Tag-Nachtrhythmen des Lebens.
Raoul Schrott: Erste Erde Epos.
München: Hanser 2016
 Kraftstrotzend, aufbegehrend, verwegen - so sieht man es seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bis heute gut und gern: das Originalgenie. Wie es die Götter dumm dastehen lässt! Wie es aus dem Vollen schöpft! Aus allen Töpfen, wo doch die Meisterköche über diesen und jenen Topf die Nase rümpfen und Rezepturen lehren, die stauben, so trocken und abgeklärt wie sie sind. Hier dagegen schmeckt alles kräftig und duftet, und süffig ist es außerdem! Raoul Schrott ist so einer wie Prometheus: Mit Erste Erde Epos serviert er wieder seine Leibspeise - “ein völlig unmögliches Unterfangen” nämlich. So beschrieb er sein Ansinnen beiläufig einem Redakteur des Hessischen Rundfunks mit dem treffenden Namen Hess: “Die Idee eines modernen Epos, in dem sich die Welt vom Urknall bis zum Menschen erzählt.”
Kraftstrotzend, aufbegehrend, verwegen - so sieht man es seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bis heute gut und gern: das Originalgenie. Wie es die Götter dumm dastehen lässt! Wie es aus dem Vollen schöpft! Aus allen Töpfen, wo doch die Meisterköche über diesen und jenen Topf die Nase rümpfen und Rezepturen lehren, die stauben, so trocken und abgeklärt wie sie sind. Hier dagegen schmeckt alles kräftig und duftet, und süffig ist es außerdem! Raoul Schrott ist so einer wie Prometheus: Mit Erste Erde Epos serviert er wieder seine Leibspeise - “ein völlig unmögliches Unterfangen” nämlich. So beschrieb er sein Ansinnen beiläufig einem Redakteur des Hessischen Rundfunks mit dem treffenden Namen Hess: “Die Idee eines modernen Epos, in dem sich die Welt vom Urknall bis zum Menschen erzählt.”
Eine Art Genesis also. “In sieben biblischen Tagen lässt sich diese abstrakte und vielgestaltige Architektur nicht mehr begreifen”, schreibt Schrott im Vorwort, das dieses Ansinnen post festum sehr plausibel erläutert, wohl ebenso plausibel wie damals die beiläufige Erwähnung gegenüber dem Redakteur. Der verwies ihn jedenfalls auf die Kulturstiftung des Bundes, wo man nicht lange fackelte und Geld vorschoss - “und so nahm das Abenteuer seinen Lauf.” Wieso “Abenteuer”? Nun: Wer an den hinter der biblischen Genesis stehenden Gott nicht glaubt, dem “bleibt seit Newton nur der Weg vorwärts zu den Wissenschaften und zugleich zurück hinter die Theologie.” “Lauf“ und “Weg” - das sind für Schrott dann keine bloßen Metaphern. Die Wissenschaften haben ihr Wissen durch konkrete Objekte erschlossen, die freilich zu wissenschaftlichen Diskursen und musealen Schaustücken geronnen sind. Meteoritenbrocken, Stromatolithen, das Skelett eines Schwamms, eine Schieferplatte mit den fossilen Resten einer ediacarischen Lebensform, ein Trilobit: Wie über sie geschrieben wird, wie sie betrachtet werden, das macht sie abstrakt. Schrott braucht es konkret: das Objekt in seinem Kontext, und das bedeutet: an seiner Fundstelle.
Diese kann schon mal vor der Tür liegen, was etwa die vor 66 Jahrmillionen ausgestorbenen Megalodonten betrifft. Handflächengroße Schalen dieser Riesenmuscheln sind als runde Klammern im Tiroler Fels zu sehen, wo man sie vormals freilich nicht als Fossilien bestaunte, sondern als Spuren einer wilden Jagd, die sich im Schneegestöber der Rauhnächte abspielt, bemunkelte und als “Kuhtritte” bezeichnete. Gebirge? Dieses “hochgeschobene zu brechern versteinerte meer” sieht man hierorts viel eher als “ein zum himmel gehobenes meer: mahnmal dafür dass nichts ist wies scheint.” Und die Orte? Anstatt sie namenlos zu belassen, heißen sie St. Johann und St. Jodok, St. Kathrein und St. Leonhard. Kurz: “man führt gott allerorten im mund”. Kein Wunder, dass sich der den Wissenschaften zugewandte und hinter Gott abgewandte Autor mit dem Begriff “Heimat” schwertut.
Aber die heimatlichen Gefilde decken ohnedies bei Weitem nicht alles ab. In der Regel freilich muss, um an den Anfang zu gelangen und also 13,82 Jahrmilliarden zurückzugehen, weit gereist werden. Etwa in die Waitomo-Höhlen nach Neuseeland. Erstes Licht, letzte mündlich entstandene Kosmogonie: “i noho a Io roto · i te aha o te ao”. “da war ein rund im karst klaffender abgrund in den wir uns abseilen mussten um in die flusshöhle zu gelangen”. Mythen und Logbuch wie dort - das sind Schrotts ureigenste Terrains. Aber es gibt in diesem vielseitigen Werk auch anderes: einen Dialog in Mails und Telefonaten über die Natur des Menschen - angeregt durch den Besuch des Affengeheges im Leipziger Zoo (eine ebenso spannende Materie wie in Ulrike Draesners Sieben Sprünge vom Rand der Welt); den Bericht eines thüringischen Archäologen über sein Dunkelheits-Experiment in einer Gletscherhöhle; die Schilderung von Vergewaltigung, Dunkelhaft und Folterung nach dem Scheitern des Warschauer Aufstands, der mit wissenschaftlichen Ausführungen darüber, “was an uns - vom Raubtiergebiss an von den Reptilien abstammt und was die aus ihnen hervorgegangenen Säugetiere ausbildeten” (nämlich Warmblütigkeit und Milchdrüsen!), gegengeschnitten wird; das Protokoll, packend poetisch, einer brenzligen Kanufahrt in den kanadischen Northwestern Territories; und, und, und.
Schrott geht es nicht darum, selbst zum Wissenschaftler oder Sammler zu werden. Zunächst geht es ihm bei “Lauf” und “Weg” nur darum, den von Wissenschaftlern gemachten Funden das eigene Erleben einzuhauchen: “Je näher ich ihnen kam, desto mehr Realität erlangten sie.” Das Ziel in den kanadischen Northwestern Territories war es, das älteste erhaltene, mit der Hand greifbare Gestein, datiert auf 4,01 Milliarden Jahre vor heute, mit der eigenen Hand zu greifen. Um darüber “wissenschaftlich” zu schreiben, war das nicht vonnöten. Diesen Teil leistet ein an die 150 Seiten langer Anhang - “ein umfassender Querschnitt jener Erkenntnisse, die ein neugieriger Mensch sich zu erwerben vermag.” Nein, Schrott geht es vielmehr darum, die bereisten Funde “beim Schreiben begreifbar” werden zu lassen, “nicht in hehrem Anspruch, sondern als Poesie, die Welt enthält” - so definiert er das moderne Epos.
Klugerweise bleibt Schrott nicht mit sich allein und versteckt sich hinter Fakten, sondern baut für dieses Epos spannende Fiktionen in einer bewundernswerten dichterischen Bandbreite ein. Die Welt begreifbar zu machen erhellt auch unser Innerstes, meint er. Das ist sicher kein Gedanke, den er allein denkt. “Die Geschichte des Universums ist die Geschichte jedes einzelnen von uns”, so sieht das etwa auch der kanadische Populär-Astrophysiker Hubert Reeves. Den Schrott nicht konsultiert hat. Es gab aber genug andere Fachwissenschaftler, den er ein Loch in den Bauch gefragt hat, was vom Bayerischen Rundfunk und vom Hörbuch-Verlag, München, dokumentiert wurde. Schrott hat für all das sieben Jahre aufgewendet. Sieben Bücher sind so entstanden. Das Werk eines aufmüpfigen Titanen? Keineswegs! Es ist vielmehr ein bisschen wie beim alten Meister Rubens, der in seinem Antwerpener Atelier zahlreiche spezialisierte Mitarbeiter beschäftigte und selbst als erfolgreicher Unternehmer fungierte. Wie viele “Mitarbeiter” hier beteiligt waren, zeigt die zweiseitige Danksagung am Schluss des wunderbar gestalteten Folianten, die mit einem schönen Satz endet: “Das Schreiben bleibt all dem gegenüber aber weiterhin eines: ein Anfang, immer von neuem.”
Bernhard Sandbichler
Bernd Schuchter: Jacques Callot und die Erfindung des Individuums.
Wien: Braumüller 2016
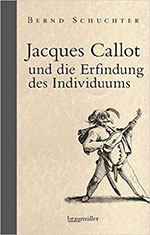 Bernd Schuchters wunderbares Buch macht einen einzigartigen Blick in eine Epoche möglich, die man „Barock“ nennt. Ein souveräner Erzähler, kein Historiker führt in einem märchenhaft anmutenden Tonfall die Geschichte des Dreißigjährigen Krieges vor Augen. Dieser Krieg, vordergründig eine Auseinandersetzung zwischen Katholiken und Protestanten, war eine lukrative ökonomische Angelegenheit, macht Schuchter klar, der eindeutig Position für die kleinen Leute bezieht, gegen Kriegsgewinnler wie Wallenstein. Dabei formt er lebendige Geschichten in humanistischem Geist und stattet sie mit Bezügen zu anderen Epochen, nicht zuletzt der gegenwärtigen, aus. Als Ausgangspunkt seiner Überlegungen wählt er die Lebensgeschichte eines beinahe vergessenen Künstlers namens Jacques Callot (1592-1635), der bereits im Alter von zwölf Jahren – angeregt von Erzählungen über sein Sehnsuchtsland Italien – ausbüxt, zurückgebracht wird, sich erfolglos ein zweites Mal auf den Weg macht, um schlussendlich mit Sechzehn offiziell eine Italienreise antreten zu dürfen, die sich in einen mehrjährigen Aufenthalt in Rom, dann in Florenz entwickeln wird. Dort perfektioniert er sein Grafikhandwerk, bringt es zum allseits geachteten Meister, der, zurückgekehrt in seine lothringische Heimat, Bilder schaffen wird, die bis dahin nicht vorgestellt werden konnten; Bilder, die aufgrund ihrer eigenwilligen Technik wie auch ihrer Sujets eine Welt zum Ausdruck bringen, wie sie zuvor nicht auf Papier gebannt worden ist. „Callot schaffte in seinen Stichen so etwas wie den Versuch einer Mentalitätsgeschichte, die sich auf das Leiden des Individuums fokussiert.“
Bernd Schuchters wunderbares Buch macht einen einzigartigen Blick in eine Epoche möglich, die man „Barock“ nennt. Ein souveräner Erzähler, kein Historiker führt in einem märchenhaft anmutenden Tonfall die Geschichte des Dreißigjährigen Krieges vor Augen. Dieser Krieg, vordergründig eine Auseinandersetzung zwischen Katholiken und Protestanten, war eine lukrative ökonomische Angelegenheit, macht Schuchter klar, der eindeutig Position für die kleinen Leute bezieht, gegen Kriegsgewinnler wie Wallenstein. Dabei formt er lebendige Geschichten in humanistischem Geist und stattet sie mit Bezügen zu anderen Epochen, nicht zuletzt der gegenwärtigen, aus. Als Ausgangspunkt seiner Überlegungen wählt er die Lebensgeschichte eines beinahe vergessenen Künstlers namens Jacques Callot (1592-1635), der bereits im Alter von zwölf Jahren – angeregt von Erzählungen über sein Sehnsuchtsland Italien – ausbüxt, zurückgebracht wird, sich erfolglos ein zweites Mal auf den Weg macht, um schlussendlich mit Sechzehn offiziell eine Italienreise antreten zu dürfen, die sich in einen mehrjährigen Aufenthalt in Rom, dann in Florenz entwickeln wird. Dort perfektioniert er sein Grafikhandwerk, bringt es zum allseits geachteten Meister, der, zurückgekehrt in seine lothringische Heimat, Bilder schaffen wird, die bis dahin nicht vorgestellt werden konnten; Bilder, die aufgrund ihrer eigenwilligen Technik wie auch ihrer Sujets eine Welt zum Ausdruck bringen, wie sie zuvor nicht auf Papier gebannt worden ist. „Callot schaffte in seinen Stichen so etwas wie den Versuch einer Mentalitätsgeschichte, die sich auf das Leiden des Individuums fokussiert.“
Der einfühlsame Essay über Leben und Werk Callots ist in zehn Kapiteln ausgeführt und beginnt mit einer Reiseschilderung. Der gereifte Callot ist unterwegs zur Stadt Breda, heute an der belgisch-holländischen Grenze, die zu Beginn des 16. Jahrhunderts als Zentrum der niederländischen Unabhängigkeitsbewegung von Spanien galt. Nach neunmonatiger Belagerung musste die Stadt aufgegeben und den Spaniern übergeben werden. Ein berühmtes Gemälde von Diego Velasquez gibt davon Zeugnis. Infantin Isabella lässt Callot nach Breda senden, um die Belagerung in einer Radierung zu dokumentieren. Dieses Werk stellt für Schuchter einen Höhe- und Wendepunkt im Schaffen des Künstlers dar. Es ist eine Reise in kalter Jahreszeit durch tiefgefrorene Landschaften, die die mediterrane Wärme seiner italienischen Lehrjahre kontrastiert. Auch die dem Aufenthalt in Italien gewidmeten Passagen des Buches zeigen einen tief religiösen, an allem interessierten Menschen, der ständig bestrebt ist, seine künstlerischen Fertigkeiten zu vervollkommnen. Von den Medici gefördert, bezieht Callot ein Atelier in den Uffizien und lernt die maßgebenden Künstler und Wissenschaftler seiner Zeit kennen, so befreundet er sich etwa mit Galileo Galilei.
Schuchter setzt Callots „Frieren“ als Leitmotiv ein, um dessen humane Reaktion auf die Gräuel des Krieges, die sich in seinen Radierungen und Kupferstichen wiederfinden wird, darzustellen. „Dieser Ort war nicht der Zeuge eines Triumphes, sondern die Hölle auf Erden. Der Teufel war auf die Erde zurückgekehrt, dachte Callot, und bekreuzigte sich drei Mal. Er fühlte sich unwohl, und fror.“ Krieg heißt die Erinnerung an die Würde des Menschen auslöschen, das Rohe und Barbarische hervorkehren, das Zivilisatorische und Kulturelle als eine Oberfläche durchschauen, die rasch durchbrochen wird, um Kräfte zu mobilisieren, die auf Untergang und Tod setzen. Callot gelang es, dies darzustellen. „Von bleibender Dauer sind seine beiden Radierzyklen Die kleinen Schrecken des Krieges und Die großen Schrecken des Krieges; sie sind das bleibende Vermächtnis von Jacques Callot.“ Darüber hinaus wird der Künstler „ganze Serien von Bettlern, Buckligen und anderen Existenzen am Rande der Gesellschaft radieren, er wird zum Meister des Grotesken, Fantastischen, Abseitigen. Es sind Porträts voller Innigkeit.“
Bernd Schuchter ist ein Autor, der seine Gelehrtheit subtil einsetzt, um auf Themen hinzuweisen, die ihn beschäftigen: Menschheitsthemen, wesentliche Fragen nach der Existenz. Dabei verbindet er einen historischen, relativierenden Zugang zur Kunst, zum Leben Jacques Callots geschickt mit Fragen nach dem „Wesen“ der Kunst, des Menschen, seinen Sinn in der Welt, nach Gott – aber immer mit dem Auge eines Menschen, der diese Fragen aus der Gegenwart heraus stellt. In diesem Sinne erlaubt er sich auch kritische Zwischenrufe, welche die niemals versiegende Aktualität einer humanistischen Gesinnung, wie sie sich in der Kunst von Callot äußert, betont. „Der Terrorismus von Boko Haram oder des IS ist schwer zu erklären, vor allem aber ist er fortschrittsfeindlich – wenn man damit die Technikhörigkeit des Westens meint – und bildungsfeindlich. Wer aber nur glaubt, kann nicht wirklich wissen, darin unterscheiden sich die Verfechter des Glaubens nicht von den Menschen des 17. Jahrhunderts.“
Florian Braitenthaller
Judith W. Taschler: bleiben. Roman.
München: Droemer 2016
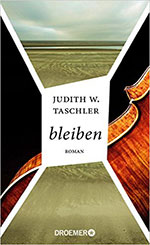 Judith W. Taschler macht das, was sie am besten kann: Sie lässt ihre Figuren erzählen. Wie bereits in ihrem Debütroman dürfen auch in bleiben alle Protagonisten kapitelweise ihre Sicht der Dinge schildern, bis die Erlebnisse, von denen sie abwechselnd berichten, zu einer einzigen Geschichte verschmelzen.
Judith W. Taschler macht das, was sie am besten kann: Sie lässt ihre Figuren erzählen. Wie bereits in ihrem Debütroman dürfen auch in bleiben alle Protagonisten kapitelweise ihre Sicht der Dinge schildern, bis die Erlebnisse, von denen sie abwechselnd berichten, zu einer einzigen Geschichte verschmelzen.
Diese Geschichte beginnt in einem Nachtzug nach Rom, in dem vier junge Menschen, die sich vorher noch nie begegnet sind, näherkommen – nichtsahnend, das von nun an ihr Leben auf fast magische Weise verwoben bleibt: Max und Felix werden beste Freunde, Juliane die Gattin von Paul, die Geliebte von Felix; dieser wiederum mietet eine Wohnung, die Paul, wissend, dass sie mit schädlichem Teerkork isoliert ist, unrechtmäßig verkauft hat. Ein Zusammentreffen aller gibt es erst viele Jahre später – am Sterbebett des lebensfrohen Felix, der aufgrund der Kontamination seiner Wohnstätte unheilbar an Lungenkrebs erkrankt ist.
So besonders ihre schicksalhafte Begegnung ist, so durchschnittlich sind die Figuren selbst: Außerordentliches findet sich allenfalls in ihren Lebensgeschichten – der Anwaltssohn Paul ist von einer katastrophalen Ehe traumatisiert, Juliane, weil sie als Jugendliche unabsichtlich ihren Bruder getötet hat, Max, das Heimkind, weil er von der Familie seines ehemals besten Freundes verstoßen wurde. Ansonsten aber bleiben die Figuren alltäglichen Gedanken verhaftet: Es geht um Eitelkeiten und Schuldgefühle, den Wunsch, begehrt und gleichzeitig beschützt zu sein, das Bedürfnis nach Sicherheit, die Gier nach Abenteuer, die Angst vor Bindungen und dem Neuanfang – darauf, dass der großen Frage nach dem rechten Lebensweg mit herausragenden Ideen begegnet wird, wartet man vergeblich. Judith W. Taschler zieht es viel eher vor, ihre Charaktere so authentisch und somit auch so gewöhnlich wie möglich zu gestalten, wobei sie tiefe Einblicke in ihre Seelen gestattet. Weder menschliche Abgründe noch die Qualen, die ein Sterbender und seine Begleiter erleiden müssen, bleiben ausgespart, sodass das Ganze zu einem schonungslosen Bericht über persönliche Krisen und Tragödien wird. Der Roman gewinnt dabei vor allem durch seine Multiperspektivität, durch die ein zu einseitiger Blick auf komplexe zwischenmenschliche Beziehungen vermieden wird.
Vor Klischees ist man dennoch nicht ganz gefeit: Der biedere Anwalt schwört auf geordnete Bahnen, der Südtiroler fühlt sich am stärksten mit seiner Heimat verbunden, der berühmte Maler flirtet mit Kunststudentinnen, die wild danach sind, für ihn Modell zu stehen. Auch die Bilder, die im Roman entworfen werden, wirken mitunter altbekannt – bei der Fotografie einer schönen jungen Frau, die bäuchlings im hohen Gras liegt und an einem Halm kaut, den fleißigen Arbeitern am Bergbauernhof, der Ehefrau, die durch das Fenster beobachtet, wie ihr Mann im Café seine Exfrau an den Händen hält, verschwimmen Szenen aus Alltag, Liebesroman und Fernsehdrama. Sprachliche Stereotype sind an diesen Stellen nicht selten, was Taschler ihre Erzählerin sogar selbst eingestehen lässt: „Das klingt jetzt kitschig, ich weiß, aber es hatte irgendwie etwas Kinomäßiges an sich“ [206].
Im Allgemeinen aber bleibt die Sprache schlicht und schnörkellos, was der Erzählsituation – die Figuren berichten ihren jeweiligen Gesprächspartnern von ihren Erfahrungen – entspricht. Unterschiede zwischen den einzelnen Rednern gibt es kaum: Sie alle sprechen im selben Ton und mit derselben Offenheit über ihre Gedanken – sie sind ihre eigenen Geschichtenerzähler und -analytiker, Psychologen und Traumdeuter in einem. Für den Leser bleibt dabei ebenso wenig zu tun wie für die stummen Zuhörer: Leerstellen werden nach und nach geschlossen, Fragen beantwortet, selbst über historische Hintergründe wie die Geschichte Südtirols wird ausführlich referiert. Unschwer zu erkennen ist schließlich auch der Leitgedanken des Buchs, das ein vorangestelltes Zitat von Sándor Márai vorwegnimmt und dann von Felix, der nur wenige Monate zu leben hat, mehrmals wiederholt wird: „Der Sinn des Lebens besteht darin, dass man erkennt, wie schön es ist. Aber darauf kommt niemand“ [S. 173].
Wer fertige Urteilssprüche erwartet, wird dennoch enttäuscht: Taschler begegnet ihren Figuren mit Verständnis statt mit Wertungen, was den Roman trotz allem zu einem sympathischen Buch macht: eines, das ohne edle Helden, aber auch ohne Bösewichte auskommt. „Ich finde nicht, dass ein Talent mehr wert ist als das andere“ [S. 142], erklärt der Maler Max, und verrät damit indirekt einen der einnehmendsten Gedanken der Geschichte: nämlich dass ein Leben, egal, welchem Entwurf es folgt, gleich viel wert ist wie jedes andere.
Vera Vieider: Leichtfüßig sein.
Innsbruck: edition laurin 2016
 Vera Vieiders neue Gedichte erinnern an die Qualität, die bereits ihren ersten ebenfalls bei Laurin erschienen Gedichtband „Am Hafen“ auszeichnet, mehr noch: Sie hat diese weiter erfeinert, beispielsweise das Formprinzip der Reihung, die strenge Struktur, den klaren Rhythmus. Die Südtiroler Lyrikerin Vera Vieider ist studierte Pharmazeutin, sie lebt und arbeitet als Apothekerin in München. Das Feld der literarischen Öffentlichkeit betrat sie erstmals im engeren Umfeld Merans, als sie mit ihren Gedichten gleich zwei Förderungspreise erhielt. Seither zeigt sie sich kontinuierlich im Literaturbetrieb, im April letzten Jahres beispielsweise beim 2. Babelsprech in Bern -, einem Internationalen Forum für junge deutschsprachige Lyrik, bei dem sich junge AutorInnen aus vier Nationen trafen und sich über Positionen und Entwicklungen aktueller Lyrik austauschten.
Vera Vieiders neue Gedichte erinnern an die Qualität, die bereits ihren ersten ebenfalls bei Laurin erschienen Gedichtband „Am Hafen“ auszeichnet, mehr noch: Sie hat diese weiter erfeinert, beispielsweise das Formprinzip der Reihung, die strenge Struktur, den klaren Rhythmus. Die Südtiroler Lyrikerin Vera Vieider ist studierte Pharmazeutin, sie lebt und arbeitet als Apothekerin in München. Das Feld der literarischen Öffentlichkeit betrat sie erstmals im engeren Umfeld Merans, als sie mit ihren Gedichten gleich zwei Förderungspreise erhielt. Seither zeigt sie sich kontinuierlich im Literaturbetrieb, im April letzten Jahres beispielsweise beim 2. Babelsprech in Bern -, einem Internationalen Forum für junge deutschsprachige Lyrik, bei dem sich junge AutorInnen aus vier Nationen trafen und sich über Positionen und Entwicklungen aktueller Lyrik austauschten.
2013 veröffentlichte Siegfried Höllrigl in der Lyrikreihe seiner Offizin S. das bibliophile Bändchen, das den Zyklus “Gebettete Landschaft” enthält, der nun im dritten Teil des Bandes „Leichtfüßig sein“ wieder zu finden ist. Der Gedichtband besteht aus drei Teilen: „Oxidation“, „In Fristen“, „Gebettete Landschaft“. Alle drei Teile handeln von Daseinserfahrungen, von Begegnungen eines lyrischen Ichs mit der Welt, mit den Elementen der Natur, von den Wandlungen, die durch die bewirkt werden. Die Texte handeln auch von den Begegnungen mit einem Du, sind manchmal in der Form von subtiler Mitteilungen verfasst, die oft auch ein WIR miteinschließen.
Vera Vieiders Gedichte entfalten Sehnsuchtsorte und sie ziehen Linien und Suchspuren in das Amorphe des Lebens.
Lyrik ermöglicht eine besondere Weise des Erkennens, eine, die nicht „fest-stellt“, feststellt dass dieses und jenes so sei. Gedichte haben vielmehr die Fähigkeit, durch exaktes Kombinieren und Komponieren der Worte in den Bedeutungen ein Moment der Leerheit und der Fremdheit, ein irritierendes Moment des Unsicheren aufzuzeigen und es offen zu halten.
In Besprechungen zu Vera Vieiders Gedicht wurde besonders auf das Geheimnisvolle und Rätselhafte hingewiesen. Rätselhaftigkeit in diesem Sinne meint nicht mehr als eben diesen Augenblick der Uneindeutigkeit, der den Raum öffnet für die von Paul Celan so genannte „Schwebesituation“ zwischen der Benennbarkeit der Erfahrung und der eigentlichen Nichtfassbarkeit der Existenz. Das Gedicht erzeugt einen Raum der Präsenz, des Gegenwärtigseins, in dem ein steter Dialog beginnen kann, der sich nicht erschöpft, weil nie das letzte Wort gesagt sein kann zu einem Gedicht. „Die Suche nach dem richtigen Wort“, sagt Vera Vieider, „Gedichte schreiben ist für mich wie ein Puzzle-Spiel“. Die richtigen Worte sollen zueinander finden wie in einem Puzzlespiel, wie, „in einer Wörterlandschaft, in der sich das Bemühen um Genauigkeit und die Sehnsucht nach Überraschungsmomenten treffen“, so heißt es in einer Besprechung von Edith Ulla Gasser. Ich meine, Vera Vieider ist von ihrem Studium her auch in den Naturwissenschaften beheimatet: Ein Gespür für die Zusammensetzung von Elementen dürfte ihr ganz selbstverständlich sein – wie auch ein Sinn für Strukturen, ein Gespür für das Ineinandergreifen der richtigen Worte in einem konzentrierten Sprachbild. So sind ihre Gedichte kristalline Gebilde, in denen sich die Worte - wie die Moleküle von Elementen - auf eine genaue Weise verbunden haben. Das Kleine, das Unspektakuläre entfaltet sich, es oxidiert („Oxidation“ lautet nicht zufällig auch der Titel des ersten Teils der Gedichte). Es entstehen – wie unter dem Mikroskop betrachtet – sublime Wahrnehmungsbilder, und man möchte Vera Vieiders Lyrik gern ein wenig in der Nähe von Alchemie empfinden. „(...) als Randnotiz rutscht in die handwarme Stille der Tag“, eine Verszeile wie diese ist eines der vielen kunstvollen Amalgame, die die Qualität ihrer Lyrik ausmachen.