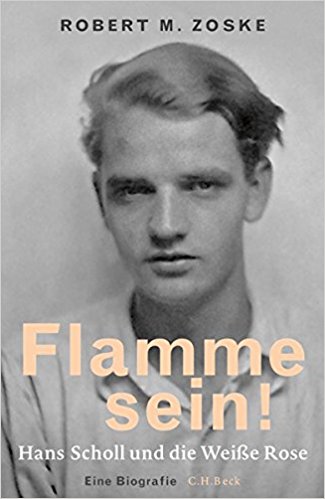18.2.2017 – Jerusalem
Auf halbem Weg nach oben habe ich gesehen, wie sich weiße Flecken im Gebüsch bewegten. Rehe? Der Hund ist weit hinter mir, da soll er bleiben, ich gehe weiter und wirklich: drei Rehe springen in großen Bögen von der Lichtung in den Wald.
Mein Vertrauen in meinen Text wächst wie bei einem Menschen, den man allmählich kennen und lieben lernt und den interessiert, wie man denkt. Er hat mich bisher noch nie enttäuscht, im Gegenteil: überrascht mit seinen Nachfragen, die mir dann weiter auf die Sprünge helfen und mich neugierig machen auf das, was kommt. Gibt mit das Gefühl von Reichtum verteilt in kleinen Schätzen, die ich heben darf.
Es ist nicht gut zu sterben, bevor man seine Geschichte zu Ende erzählt hat.
So Henning Mankell in seinem Aids-Roman. Große Worte. Zu groß für die Kranke, die das sagt, sie schafft es nicht.
Das Überinformiertsein rottet Mitgefühl aus.
Am Anfang erwischt mich der Schock. Um damit fertig zu werden, wehre ich mich mit bescheidenen Hilfsaktionen, was nicht hilft.
Man lebt weiter und schämt sich. Und dann schämt man sich dafür, dass man sich nur schämen kann. Und das ist dann auch noch irgendwann abgestorben.
Trump und Netanjahu wo es mit Arafat und Rabin und Clinton einmal Hoffnung gab. Grauenhaft. Ich denke an Jerusalem.
Israel 1992Jerusalem – tot oder lebendigJerusalem ist ein Ort des Friedens – wenn man das hebräische Jeruschalajim wörtlich nimmt. Für die Araber ist es die Heilige: Al-Kuds.
Jerusalem.
Diese Stadt und ihre Steine tun weh. Als ich sie zum ersten Mal wieder verließ, war es ein Abschied voll Traurigkeit, Bitterkeit und Zorn. Schmerz darüber, was mit Gott alles zu rechtfertigen ist. 3000 Jahre Geschichte gegen eine Gegenwart.
Das ist schon lange her. Es war der Herbst 1991, ein paar Monate nach dem ersten Golfkrieg. Wie die meisten Besucher, von denen es damals nur wenige gab, war ich durch Jerusalems Weststadt durch das Jaffator gekommen. Das Hotel gegenüber der Zitadelle am Eingang zur David Street, die mitten durch die Altstadt führt, hatte genügend leere Zimmer.
Die Meldungen von den Angriffen auf Israel hatten mich ins Reisebüro getrieben. Angstträume, Schuldgefühle und die Unmöglichkeit, die Gasmasken wieder zu vergessen. Es gab keine Nachricht, die sie nicht zeigte oder erwähnte. Da konnte ich nicht länger zuhause bleiben, in Deutschland.
Ich war am Tag vor dem Unabhängigkeitsfest gelandet. Das erfuhr ich bei der Fahrt vom Flughafen in Tel Aviv nach Jerusalem, als ich danach fragte, was die mit der israelischen Fahne geschmückten ausgebrannten, verrosteten Panzer und Geschütze zu bedeuten hätten, die rechts und links von der Straße zwischen blühenden Bäumen zu sehen waren.
Für den Taxifahrer war Jerusalem am Jaffator zu Ende. Dort setzte er mich ab. Er wollte nicht weiter.
Die paar Schritte zur Altstadt ging ich zu Fuß.
Am hellen Nachmittag fand ich die Straßen leer, alles war still, die Rollläden der Geschäfte heruntergelassen. Das sollte ein Bazar sein? Auf den Stufen vor einem geschlossenen Café gegenüber saßen drei Soldaten in kugelsicheren Westen, jeder hatte ein Gewehr halb auf seinem Schoß, halb unter dem Arm in Bereitschaft, einer trug sogar zwei. Als ich auf den Balkon trat, riefen sie – in Ermangelung einer anderen Abwechslung, denn sonst bewegte sich hier nichts – zu mir herauf:
- Hello! Israel is beautiful, isn’t it? – Natürlich.
- Where do you come from? – Germany.
- Your name? – Heide.
- Hello Heide, Jerusalem is beautiful!
Yes. Jerusalem is beautiful.© H. TarnowskiDie Altstadt sei heute ruhig, sagten sie, als ich herunterkam, keine Vorfälle. Nur die schnarrenden Stimmen der Soldaten aus dem Walky-Talky mit dem sie sich laufend gegenseitig verständigten, hingen in der Luft. Sie waren überall: drei Soldaten mit vier Gewehren, eines davon für das Gas.
Ich nahm den Weg durch die Davidstreet in Richtung jüdisches Viertel und dann nach links ins muslimische Viertel. Die Händler standen wie überflüssig vor ihren Läden herum, redeten miteinander oder spielten Karten. Oft schlüpften sie auch unter den Rollläden zueinander, um drinnen weiterzureden. Ich fragte, was los sei: am Montagvormittag alles verriegelt. Sie zuckten mit den Schultern und lachten: Streik!
Warum?
- Wir wissen es nicht.
Ob sie morgen wieder aufmachen werden?
- Wenn keine Flugblätter kommen – ja.
Nur die Händler mit den beweglichen Tischen oder solche, die ihre Dinge auf einem Tuch am Boden ausbreiten, waren immer da. Mädchen und Jungen in Schuluniformen schlenderten in kleinen Gruppen umher, übrig geblieben mit geschenkter Zeit. Man hat sie wieder nach Hause geschickt. Das kam oft vor, die Palästinenser antworteten mit Streik auf die Ausgangssperre der Juden. Botschaften in den Farben rot, grün, schwarz und weiß, zogen sich an den Wänden der Gassen entlang.
Ich hörte eingesperrte Katzen schreien, das verzweifelte Maunzen der Jungen, die von ihrer Mutter getrennt wurden. Die rannte aufgeregt schreiend vor der Wand hin und her, bis der Streik vorbei war und der Rollladen wieder hochgezogen wurde.
Warnungen zur Vorsicht erhielt ich von denen, die ihre Läden nur zur Hälfte herunter gelassen hatten, so daß man darunter hineinschlüpfen konnte: nicht hierhin oder dorthin sollte ich gehen, nicht am Freitag, nicht allein und schon gar nicht am Abend.
An einer Stelle kam ich nicht weiter, keiner wurde durchgelassen, was war los?
Die Juden vermuteten in dem Abfall eine Bombe. Das Spezialkommando war schon verständigt, Soldaten sperrten die Gasse. Vorschriftsmäßig umsichtig bereiteten sie eine Entschärfung vor.
Ein palästinensischer Vater scheuchte seinen Jungen zurück. Ein orthodoxer Jude mit Pelzhut und Schläfenlocken, den schwarzen Mantel mit der baumelnden Kordel gebunden, kam mit kleinen, eiligen Schritten des Weges. Es war der Vater von drei Jungen, ebenso in schwarzen Mänteln und mit schwarzen Samtkäppchen. Als sie an der Absperrung nicht weitergehen durften, bildete der Vater mit den Jungen sofort eine Kreis, um mit ihnen zu tanzen. Dazu sang er vor sich hin, sah sich nicht um, von Zeit zu Zeit machte er einen kleinen Satz in die Höhe. Die Jungen drehten ihre Köpfe, hätten gerne gesehen, was da vor sich ging, aber der Vater zog sie weiter, immer weiter im Kreis. Der Messias duldet keinen Müßiggang.
Bis ein Knall zu hören war. Dann ging das Leben weiter. Es war keine Bombe, sondern Abfall. Ein Abfallhaufen wurde gesprengt. Lachen griff um sich. Die Kinder, die Frauen, die Alten, die Jungen – einer sagte es dem anderen, bis jeder lachte.
Was erzählten die Väter ihren Kindern? Wie erklärten sie ihnen diese Welt? Zweierlei Geschichten aus zwei Welten, die ihre einzige ist. Das Gemeinsame war die Angst.Es wäre besser, die Juden zu töten als die Araber, wie?!
Diese Gegenfrage eines Juden war die Antwort auf meine Frage: Warum macht ihr es so? Es ist doch auch für euch sehr gefährlich –
Seine Frage kam hart und aggressiv und schloß jede Antwort aus. Jung war er, keine zwanzig, das Gewehr immer dabei. 16-, 17-Jährige, Jungen und Mädchen, trugen Gewehre über die Schulter gehängt. Mit ihren 16, 17 Jahren sind diese Kinder der jüdischen Siedler Herren über Leben und Tod – der Araber. Auf einen der ihren dürfen sie nicht schießen, selbst wenn er dabei ist zu morden. Das ist ein Gesetz.Da bin ich schutzsuchend den Palästinensern in die Arme gelaufen. „They do what is done to them“, sagten sie zu mir. Und daß Opfer immer neue Opfer brauchen, um keine Opfer mehr zu sein.
Noch immer unsere Schuld? Der Palästinenser erriet meinen Gedanken und lachte mich aus:
„Yes! You are to blame! Because of the Jews and now because of us!“ Er lachte aus vollem Hals. Das war eine Absolution – bis er wieder verstummte.
Sie lachten sehr viel. Sie lachten und lachten und lachten. Über ihre Besatzer und was denen alles einfiel. „Es scheint in der menschlichen Natur zu liegen, daß der Unterdrückte fröhlicher ist als der Unterdrücker. Wir hassen sie nicht, wir hassen das, was sie tun. Aber sie kennen keine Vergebung.“ Das sagte der Biologie-Professor in Bethlehem, den sie ein halbes Jahr eingesperrt hatten, weil er Samen und Setzlinge für die Höfe in den Flüchtlingslagern verteilte. Immer lachten sie, wenn sie ihre Geschichten erzählten. Warum?
- Sollen wir weinen? Wir haben nichts mehr zu verlieren!
Ihre Häuser wurden geschleift. Manchmal bekamen sie stattdessen ein Zelt. Oder einen Wohnwagen, wie der Alte bei Bethlehem, der letzten Monat gestorben ist. In die Gesichter der Alten hat das Lachen tiefe Falten gegraben. Wie viel muß einer lachen, bis die Falten so tief sind? Wieder klein geworden hatten ihre Gesichter die ungeschützte Offenheit von Kindern, als hätten sie von diesem Leben nichts gelernt.
Ihre Kinder aber gehen und werfen Steine und werden vor den aufgestapelten, mit Beton gefüllten Tonnen, die die Straßen sperren, gefangen. Sie werden nicht mehr lachen.© H. TarnowskiIch streifte weiter durch die Gassen. Am Ende einer besonders dunklen sah ich ein kleines Tor, durch das Licht herein fiel. Dort ging es hinaus zum Tempelberg und dem Felsendom mit seiner goldenen Kuppel, dem Wahrzeichen Jerusalems. Die heilige Mitte der islamischen Welt. Nur wenige Schritte trennen sie vom heiligen Ort des Judentums, der Klagemauer. Da herrscht ununterbrochen ein eiliges Kommen und Gehen der Gläubigen. Die Mauer empfängt in ihren Ritzen die auf kleine Zettel geschriebenen Wünsche und Gebete.
Ich ging hinüber zur Al-Aqsa-Moschee, um die Stille zu fühlen, die von jeder Moschee ausgeht und die soviel Ruhe und Kraft auch denen schenkt, die keine Muslime sind. Die Männer, meist ältere, lagerten im Gras, als gehörten sie dazu wie die Bäume. Ich wählte eine Pinie, um mich in ihrem Schatten niederzulassen. Zwei Mädchen setzten sich zu mir: Raida und Afifi. Raida mochte sechs Jahre alt sein, Afifi vielleicht neun. Es folgten die üblichen Versuche der Verständigung und die Hilflosigkeit mit Achselzucken und Bedauern, wenn sie misslang. Da begann Raida zuerst ihren kleinen Schuh nach mir zu werfen, dann griff sie nach dem größeren Schuh, um mit ihm auf meinen Rücken zu schlagen. Als ich aufstand und ging, kamen mir die beiden nach. Erst war es ein Pinienzapfen, dann ein Stein, den Raida nach mir warf. Der Hass in ihrem Gesicht, den ich nicht hatte wahrhaben wollen, war nun nicht mehr zu übersehen. Sie muß mich für eine Jüdin gehalten haben.Im Bus nach Nablus setzte sich der alte Herr, der mir bei der Verständigung mit dem Fahrer behilflich gewesen war, neben mich, nachdem er mich mit einer kleinen Verbeugung gefragt hatte, ob es mir recht sei. Er sprach gerne Deutsch, das er in einer Schule in Jerusalem gelernt hatte, noch bevor dem Volk ohne Land das „Land ohne Volk“ gegeben wurde. Sorgfältig gefaltet lagen seine Hände in seinem Schoß. Sein Lächeln verschwand nie. Als wir an einem Flüchtlingslager mit den üblichen Beobachtungsstellen vorbeifuhren, erklärte er mir: „Wir nennen es das Gestapo-Hauptquartier.“ Dabei schmunzelte er, zog den Kopf ein bißchen zwischen die Schultern und neigte ihn zur Seite. Dann lachte er auch.
Mir riet er sehr ernst davon ab, in Nablus zu bleiben.
- Vielleicht machen sie eine Ausgangssperre, wie kommen Sie dann heraus?
Beim Aussteigen kaufte ich eine Dose Coca-Cola. Der Verkäufer reichte sie mir mit besorgtem Gesicht und der Mahnung:
- Take care for you!Jeder konnte sehen, daß ich keine Palästinenserin war, Touristen gab es hier nicht, so würde man mich für eine Jüdin halten. Was wollte die hier? Man konnte nie wissen, was passieren würde. Er zeigte mir die Richtung zu dem Platz der Sammeltaxis, und als er sah, daß ich zögerte, brachte er mich kurz entschlossen selbst dorthin. Vorbei an den geschlossenen Läden, kaum ein Mensch auf der Straße, Streik auch heute. Gespenstisch. Die Sonne schien. Das Leben hätte auf der Straße stattfinden können.
Nein, hier sollte ich nicht bleiben. Was verstand ich schon davon.
Jerusalem! rief mein Begleiter. Das war ein Befehl für den Fahrer, der nickte, und schon saß ich in seinem Wagen. Aus dem kam ich hier nicht mehr heraus. Ein kleines Mädchen winkte mir lachend zu und streckte die rechte Hand hoch, deren Zeige- und Mittelfinger ein V bildeten. Ich tat das Gleiche.Zweimal hat mich ein Auto mitgenommen, als ich im Regen von der Grenze zum Libanon nach Jerusalem zurückfahren wollte. Das erste Mal war es wieder ein Zwanzigjähriger, er trat barfuß auf die Pedale. Als ich mich dankend auf den Beifahrersitz setzte, sah ich ein Gewehr zwischen seinen Füßen. Das zweite Mal war es eine Frau, die erzählte, daß in Bethlehem eine französische Touristin umgebracht worden sei. Dazu machte sie die Geste von Halsabschneiden und gab mir den Rat, vorsichtig zu sein. Sie wünschte mir alles Gute.
Beides fand innerhalb einer Stunde statt. Übermorgen wollte ich nach Bethlehem. Ich weiß nicht, ob es für meine Angst einen Unterschied macht zu wissen, daß der Mörder – wie mir ein deutscher Priester später erzählte – von den Juden gekauft war.Zurück in Jerusalems Altstadt wusste ich inzwischen, wo ich anklopfen konnte und mir aufgemacht würde, und bin unter den heruntergelassenen Läden durchgeschlüpft, die zu diesem Zweck kurz hochgezogen, danach sofort wieder geschlossen wurden. In dieser kühlen Höhle saßen wir stundenlang bei Kaffee mit Kardamon. Allein der Schmuck, der wie nebenbei angefertigt und zu einem immer größeren Vorrat wurde, deutete auf eine Zukunft hin. Jetzt interessierte sich kaum einer dafür. Es gab keine Touristen. Ich bekam die alten Ansichtskarten von Palästina zu sehen, wie es war vor dieser Zeit.
Die Männer rauchten viel. Seit dem Krieg, erzählte der eine, habe er wieder damit angefangen, davor hatte er jahrelang nicht mehr geraucht. Und ein anderer erzählte, er rauchte nur in diesem Land. Wenn er es verließ, rührte er keine Zigarette mehr an.
Ein einmaliger, ein einzigartiger Krieg, hätten die UNO-Soldaten gesagt, ein Krieg, wie sie ihn noch nie erlebt hatten. Unglaublich, wie viel die Soldaten gesoffen hätten, am meisten die Norweger, unglaublich.
Manchmal waren Worte von draußen zu hören, die warnten, daß Soldaten vorbeikamen. Inzwischen an das Bild gewöhnt, konnte ich sie mir vorstellen, wie sie durch die Gassen gingen: In der linken Hand ruht der Gewehrlauf, die rechte liegt locker und selbstverständlich auf dem Abzug, einer trägt ein zweites Gewehr für das plastic, das Gas. Dann mussten wir besonders leise sein.
Später erzählten sie weiter ihre trostlosesten, unfassbaren Geschichten, die sie so zusammenfassten: „Hitler, wenn es ihn noch gäbe, er könnte von ihnen lernen.“
Die Raketen, die auf Israel kamen, waren mit Jubel empfangen worden. Die Gasmasken, die die Palästinenser erhalten hatten, seien zum Teil unbrauchbar gewesen. Auch manche Juden hätten solche Gasmasken bekommen, so sagte man jetzt.
Viele sind krank geworden. Aber nicht vom Gas.Unter meinem Balkon hatten es die Kinder wieder einmal geschafft, den Soldaten Angst zu machen. Jetzt wurden sie von ihnen mit festem Griff um ihre dünnen Arme gepackt und angeschrieen. Nach leisen, schnellen Antworten ließ man sie wieder laufen, die Davidstreet hinunter und dem amerikanischen Außenminister voraus. Sie würden ihm nichts tun. Mit ihren kleinen Händen.
Ein deutsches Ehepaar aus Rosenheim ist mit einem Mietwagen von Elat durchs Westjordanland nach Jerusalem gefahren. Am Jaffator fiel der Auspuff auf die Straße. Als sie sich anschickten, zu Fuß weiterzugehen, erzählten sie – froh darüber, deutsch sprechen zu können – von ihrer Fahrt: „Zweimal haben’s Steine nach uns gschmissn,“ sagte die Frau und fügte rasch beschwichtigend hinzu: „Aber das waren ja Kinder, kleine Kinder, höchstens zehn, elf!“ Und der Mann, nachdem er das unbrauchbare Auto abgestellt hatte: “Da fahr i nimmer her!“ Darauf sie: „Aber geh’, red’ doch net so!“Was man am meisten fürchtet, wird man mit Sicherheit treffen. Es ist kein Land zum Glücklichsein. Wie viel müsste einer vergessen können, um hier glücklich zu sein. Wo sind die Vergesslichen?
Im Oktober 1993 bin ich wiedergekommen. Wie gewohnt habe ich Minen erwartet, was ich aber fand, waren Baustellen. Eine neue Zeit war angebrochen. Eine Woche zuvor hatten Israelis und Palästinenser das Friedensabkommen unterzeichnet.
Die Altstadt war eine Baustelle geworden. Dort wo jeden Nachmittag die Rollläden heruntergezogen waren und jeden zweiten Tag ein Streik stattgefunden hatte, wurde jetzt verputzt, gestrichen, wurden Fliesen verlegt und hier ein neues Fenster, dort eine neue Tür eingesetzt. Immer wieder musste ich zur Seite gehen, um einen Wagen mit den leisen Gummireifen vorbeizulassen, beladen mit Brot oder Gemüse oder der wieder gefragten Ware für die Läden. Jeden Tag, von morgens bis abends. Dazu die Traktoren mit ihren Anhängern, beladen mit Sand, Zement und überhaupt mit allem erdenklichen Baumaterial. Man begann, die Graffiti des Kampfes mit frischer Farbe zu übermalen. Auch abends liefen noch Menschen durch die Gassen. Es ging also wieder. Die Symbole vermischten sich: Kreuze und siebenarmige Leuchter waren bei muslimischen Händlern zu finden. An der Klagemauer betete ein Tourist mit einem Palästinensertuch um den Hals.
Die Soldaten saßen, wie immer zu dritt, gemütlich in den Läden. Zwei von ihnen dürfen gleichzeitig essen. Einer isst immer. Dabei hatten sie die Gasse unauffällig im Auge und die Kinder in den neuen T-Shirts mit dem immer lachenden Arafat auf der Brust.Aber nicht nur Arafat lachte. Freude und Fröhlichkeit waren allgegenwärtig. Zuversicht und Hoffnung auf einen Frieden, der wieder Leben erlaubte. Sträuße von frischen palästinensischen Fahnen waren offen aufgestellt und für jeden zu haben.
Ich nahm den Weg zum Damaskustor, wo es zum arabischen Ostjerusalem hinausgeht und wo die Frauen in ihren Trachten aus den Dörfern der Westbank ihre duftenden Kräuter, ihr Gemüse und ihre Früchte anbieten. Granatäpfel und Feigen waren reif. Auch die köstliche Mandelmilch war wieder zu haben, und laut wurden die frischen Süßigkeiten angepriesen. Die Hitze brachte auch dem Wasserverkäufer wieder das gewünschte Geschäft. Es war ein Drängen und Schieben und Schreien, als hätte es hier nie diese toten Tage gegeben.
Ich wich dem Gedränge aus, bog in eine Seitengasse, dort machte ich noch einmal Halt, setzte mich hin und lehnte mich dabei mit dem Rücken an die Stadtmauer. Ich schaute nachdenklich zurück. Ob es jetzt wohl besser werden konnte mit dieser Stadt, ob sie einen Weg finden würden, miteinander zu leben ohne Bomben und Steine?
Auf dem Platz vor mir spielten Jungen Fußball, voller Kraft traten sie in den Ball, die Mauer gab ihn zurück, so ging es hin und her, bis die Jungen zum Essen gerufen wurden. Einer der Kleineren sprang leicht die Stufen neben mir hinauf, oben angekommen zögerte er und schaute zurück, hüpfte wieder herunter und hielt mir einen Bonbon hin. Überrascht nahm ich ihn an und dankte ihm, und schon war er lachend wieder die Stufen hinauf und verschwunden.Beim letzten Mal kam ich über Jericho nach Jerusalem.
Am Damaskustor stieg ich aus und ging Geld wechseln. Ich traf den Blinden wieder mit seinen Bürsten und grob geflochtenen Handschuhen, die man im Hammam benutzt, um sich gegenseitig die Haut abzurubbeln. Mich kannte keiner mehr. Erst als ich die Menschen in den Läden, wo ich so oft Tee bei heruntergelassenen Läden getrunken habe, ansprach und zu erinnern versuchte, schien ein leichtes Wiedererkennen aufzutauchen. „Your face seems familiar“ meinte der Doc, ein Wissenschaftler, der lange in USA gelebt hatte und noch immer das Hotel am Jaffator führte. Aber es konnte auch nur die Höflichkeit sein.Die Menschen schienen vorsichtig, misstrauisch, nach außen nicht sehr freundlich. Überall war Unsicherheit zu spüren.
Ich stand an der Straße, um einem Taxi zu winken, das mich fortbringen sollte. Winkte ich den grünen oder den gelben Nummernschildern? Meine Überlegungen nützten mir nichts. Als ich mich für die grünen, die arabischen Sammeltaxis aus dem Westjordanland entschieden hatte, hielt keines an. Das hatte es bisher nicht gegeben. Trauten sie mir nicht? Sah ich doch immer wieder freie Plätze in den vielen großen Autos, die an mir vorbeifuhren.
Zweierlei Taxis. Zweierlei Traurigkeit. Und mich wollte hier keiner haben.
Ich bin langsam zur Bushaltestelle gegangen, der Bus würde halten und mich mitnehmen müssen. Der konnte mich nicht stehen lassen.
Um mich herum saßen wieder einmal Männer. Sie fuhren nach Hause in ihr Dorf. Mein Nachbar begann ein Gespräch, fragte mich, was schöner sei: Jerusalem oder Germany. Die Antwort wurde mir abgenommen: „For the Beduins the desert ist he most beautiful!“ – kam es barsch über eine Schulter von vorne. Und auf die Frage nach der Stimmung, dem Lebensgefühl im Land, das ich wieder so bedrückend empfand: „The people? – Nobody knows what will happen –“
So sei es immer. Jeder hier – er zeigte auf alle – habe einen Bruder oder einen Sohn im Gefängnis. Dazu nickte er. Er warte auf seine Söhne. Sei dreieinhalb Jahren. Jede Familie warte auf jemanden.
Was sollte ich sagen. Ich nickte. Wusste ich doch soviel wie die ganze Welt. Es hatte anders werden sollen.
Wir sind – einmal mehr – nach einer Hoffnung. Sie hatte ein so kurzes Leben.Ich habe Jerusalem wieder verlassen. Es war kühl geworden. Am Abend hat es gedonnert. Regentropfen sind mit lautem Knall auf den Plastiktüten auf meinem Balkon explodiert. Sie kamen als viele kleine Bomben in meinen Schlaf.
Ich habe die Altstadt wieder tot gesehen. Die heruntergelassenen Läden nach jedem Attentat, Leere ums Damaskustor, vereinzelt huschende Gestalten in den Gassen.Der Bus hält an der Einfahrt in das Gelände des Ben Gurion Flughafens. Drei Soldaten stehen davor, um zur Kontrolle einzusteigen. Einer von ihnen tritt ganz nah an die Windschutzscheibe heran und nimmt mit der rechten Hand – über der linken Schulter hängt das Gewehr – ein winziges Vögelchen aus dem Scheibenwischer, das sich dort verfangen hat. Zart und vorsichtig löst seine Hand das kleine Tier aus seinem Gefängnis, dann steigt der Soldat wie die beiden anderen in den Bus und setzt das Vögelchen weich in die Schale für das Kleingeld neben der Kasse des Fahrers, um seinen Kontrollgang zu machen. Davon zurückgekehrt hebt er das Tier ebenso vorsichtig, wie er es hineingesetzt hat, wieder aus der Schale und verläßt mit einem Gruß den Bus.
Es gab eine Hoffnung in Jerusalem.© H. Tarnowski
Aus Heide Tarnowski: überallundnirgends. 2017 mit 74 – Ein Tagebuchroman. Sonderausgabe von literaturkritik.de im Verlag LiteraturWissenschaft.de