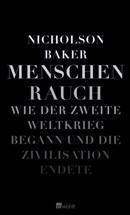|
Jazz aus der Tube
Bücher, CDs, DVDs
&
der Link des Tages
Schiffsmeldungen
Nachrichten, Gerüchte, Ideen,
Leute & Jobs
aus der Verlagswelt, Fachpresse & Handel
Links
Bücher-Charts
l
Verlage A-Z
Medien- & Literatur
l
Museen im Internet
Rubriken
Belletristik -
50 Rezensionen
Romane, Erzählungen, Novellen & Lyrik
Quellen
Biographien, Briefe & Tagebücher
Geschichte
Epochen, Menschen, Phänomene
Politik
Theorie, Praxis & Debatten
Ideen
Philosophie & Religion
Kunst
Ausstellungen, Bild- & Fotobände
Tonträger
Hörbücher & O-Töne
SF & Fantasy
Elfen, Orcs & fremde Welten
Sprechblasen
Comics mit Niveau
Autoren
Porträts,
Jahrestage & Nachrufe
Verlage
Nachrichten, Geschichten & Klatsch
Film
Neu im Kino
Klassiker-Archiv
Übersicht
Shakespeare Heute,
Shakespeare Stücke,
Goethes Werther,
Goethes Faust I,
Eckermann,
Schiller,
Schopenhauer,
Kant,
von Knigge,
Büchner,
Marx,
Nietzsche,
Kafka,
Schnitzler,
Kraus,
Mühsam,
Simmel,
Tucholsky,
Samuel Beckett
 Honoré
de Balzac Honoré
de Balzac
Berserker und Verschwender
Balzacs
Vorrede zur Menschlichen Komödie
Die
Neuausgabe seiner
»schönsten
Romane und Erzählungen«,
über eine ungewöhnliche Erregung seines
Verlegers Daniel Keel und die grandiose Balzac-Biographie
von Johannes Willms.
Leben und Werk
Essays und Zeugnisse mit einem Repertorium der wichtigsten
Romanfiguren.
Hugo von
Hofmannsthal über Balzac
»... die größte, substantiellste schöpferische Phantasie, die seit
Shakespeare da war.«
Literatur in
Bild & Ton
Literaturhistorische
Videodokumente von Henry Miller,
Jack Kerouac, Charles Bukowski, Dorothy Parker, Ray Bradbury & Alan
Rickman liest Shakespeares Sonett 130
Thomas Bernhard
 Eine
kleine Materialsammlung Eine
kleine Materialsammlung
Man schaut und hört wie gebannt, und weiß doch nie, ob er einen
gerade auf den Arm nimmt, oder es ernst meint mit seinen grandiosen
Monologen über Gott und Welt. Ja, der Bernhard hatte schon einen
Humor, gelt?
Hörprobe
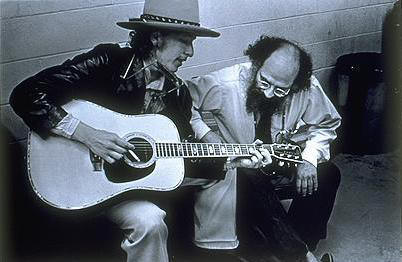
Die Fluchtbewegungen des Bob Dylan
»Oh
my name it is nothin'/ My age it means less/ The country I come from/
Is called the Midwest.«
Ulrich Breth über die
Metamorphosen des großen Rätselhaften
mit 7 Songs aus der Tube
Anzeige
 Edition
Glanz & Elend Edition
Glanz & Elend
Martin Brandes
Herr Wu lacht
Chinesische Geschichten
und der Unsinn des Reisens
Leseprobe
Neue Stimmen
 Die
Preisträger Die
Preisträger
Die Bandbreite der an die 50 eingegangenen Beiträge
reicht
von der flüchtigen Skizze bis zur Magisterarbeit.
Die prämierten Beiträge
Nachruf
 Wie
das Schachspiel seine Unschuld verlor Wie
das Schachspiel seine Unschuld verlor
Zum Tod des ehemaligen Schachweltmeisters Bobby Fischer
»Ich glaube nicht an Psychologie,
ich glaube an gute Züge.«
Wir empfehlen:




Andere
Seiten
Quality Report
Magazin für
Produktkultur
Elfriede Jelinek
Elfriede Jelinek
Joe Bauers
Flaneursalon
Gregor Keuschnig
Begleitschreiben
Armin Abmeiers
Tolle Hefte
Curt Linzers
Zeitgenössische Malerei
Goedart Palms
Virtuelle Texbaustelle
Reiner Stachs
Franz Kafka
counterpunch
»We've
got all the right enemies.«

|
Nicholson Baker, 12.2007
 »War
es ein guter Krieg?« »War
es ein guter Krieg?«
»Menschenrauch«
von Nicholson Baker ist ein kühnes, ein waghalsiges, ein fürchterliches, ein
aufrüttelndes, ein geschichtsklitterisches - und ein erhellendes Buch. Es ist
der Versuch, die Zeit zwischen 1919 und Ende 1941 aus einer anderen Sicht zu
sehen. Wo inzwischen die Vokabel des Paradigmenwechsels ein wenig verbraucht
erscheint – hier ist sie angebracht.
Von Gregor Keuschnig
Tagebuchähnlich
collagiert, zitiert und montiert Baker aus Briefen, Artikeln, Aufzeichnungen,
Büchern und Verlautbarungen von Politikern, Schriftstellern, Journalisten oder
auch nur "einfachen" Bürgern (vorwiegend aus dem angelsächsischen Bereich; aus
Deutschland gibt es vor allem Auszüge aus den Tagebüchern von Goebbels, Victor
Klemperer und
Ulrich von Hassel).
Der Erste Weltkrieg wird nur auf ganz wenigen Seiten am Anfang gestreift, die
Jahre 1920-1933 auf rund 30 Seiten. Der Zweite Weltkrieg beginnt auf Seite 152,
das Jahr 1940 auf Seite 182 und 1941 auf Seite 306. Das Buch endet am 31.12.1941
(Seite 518; danach gibt es ein sehr kurzes Nachwort und umfangreiche
Quellennachweise), also als die meisten Menschen, die im Zweiten Weltkrieg
starben…noch am Leben [waren] wie Baker schreibt.
Der Gedanke, es handele sich um etwas analog zu Kempowskis "Echolot"-Projekt
erweist sich sehr bald als falsch. Bakers Zitate sind fast immer bearbeitet -
und er wertet, wenn auch manchmal nur unterschwellig. Nur selten wird das
"reine" Dokument zitiert. Manchmal werden auch nur die jeweiligen Zitate gegen-
oder aufeinander bezogen. Dieser Stil ist suggestiv bis ins kleinste Detail. So
erfolgt beispielsweise keine Datumszeile, sondern es wird narrativ mit einem
bedeutungsvollen "Es war der …" im Text agiert. Peinlich genau achtet Baker
darauf, dass alles belegt ist; er benutzte ausschließlich öffentliche Quellen
bzw. Archive. Etliches ist auch im Netz nachschlagbar. Neues bietet Baker
demzufolge nicht (die Geschichte muss auch nicht neu geschrieben werden, aber
dazu später); er verschiebt nur die Blickrichtung.
"War es ein guter Krieg?"
Baker dürfte sein Buch wohl nicht als Experiment sehen; im Nachwort wird
deutlich, worin seine Intention liegt: War es ein "guter Krieg"? Hat er
irgendeinem Menschen geholfen, der Hilfe brauchte? Die Fragen kommen dem
Leser bekannt vor: Sie sind als Imperative formuliert die propagandistischen
Begründungsmetaphern mit denen kriegsmüden Mitteleuropäern regelmäßig die
"Interventionen" der "Völkergemeinschaft" kruden Diktatoren gegenüber (die man
vorher jahrzehntelang als Handelspartner schätzte und politisch gewähren ließ)
schmackhaft gemacht werden sollen. Nahezu alle Kriege seit den 1950er Jahren
wurden mit den Versprechen, Menschen zu helfen, geführt.
Nach dem Ende der Bipolarität 1990 hat die Bereitschaft des "Westens", den
"guten Krieg" zu führen, massiv zugenommen: Kuwait 1990/91; Jugoslawien/Kosovo
1999, Afghanistan 2001, Irak (bzw. gleich der ganzen Welt) 2003. Meistens muss
eine "humanitäre Katastrophe" verhindert werden (die man nonchalant in Afrika
"übersieht", als dort wirklich Hunderttausende ermordet werden). Daher wird ein
Krieg geführt, der als im wörtlichen Sinne blutleeres Videospiel inszeniert und
zelebriert wird und Journalisten wie Touristen zu den Schlachtfeldern führt.
Jegliche kritische Berichterstattung wird somit unmöglich gemacht; die Kontrolle
ist perfekt. Im Vorfeld wird die Alternativlosigkeit dieses Vorgehens
herausgestellt; die Zustimmungsraten sind durch entsprechende mediale Einsätze
kurz vor dem Gewaltausbruch auch entsprechend (Ausnahme vielleicht nur 2003).
Die hartnäckigen Kriegsgegner werden noch flugs als Sympathisanten des Dämons
denunziert, damit man sich nicht mehr länger mit ihren Argumenten
auseinandersetzen muss.
"Menschenrauch" lässt nun die Kriegsgegner und Pazifisten der 1930er/40er Jahre
nicht nur zu Wort kommen, sondern ergreift dezidiert Partei für sie. In dem
nicht per se die Aktionen der Alliierten einem scheinbar übergeordneten Zweck
untergeordnet werden, deren Kriegsführung befragt und die Provokations- und
Eskalationstechniken eines Winston Churchill und Franklin Roosevelt aufgezeigt
werden, begeht Baker einen Tabubruch. Er verstößt gegen den unausgesprochenen
und allseits akzeptierten Konsens, welcher dem Sieger des Krieges die
Glorifizierung der eigenen Taten nicht nur gestattet sondern diese im
(historischen) Diskurs kanonisieren darf.
Deutschland kennt die Diskussion: Luftkrieg und Literatur
Es ist noch nicht lange her, als W. G. Sebald 1997 im Rahmen einer
Poetikvorlesung über "Luftkrieg und Literatur" von der Tabuisierung des
Bombenkriegs in der deutschen Literatur (und somit auch generell im historischen
Diskurs) sprach. "Der wahre Zustand der materiellen und moralischen Vernichtung
in welchem das ganze Land sich befand", so Sebald 1997, "durfte aufgrund einer
stillschweigend eingegangenen und für alle gleichermaßen gültigen Vereinbarung
nicht beschrieben werden. Die finsteren Aspekte des von der weitaus
überwiegenden Mehrheit der deutschen Bevölkerung miterlebten Schlußakts der
Zerstörung blieben so ein schandbares, mit einer Art Tabu behaftetes
Familiengeheimnis."
Zwar gab es durchaus literarische Versuche, sich diesem Thema zu nähern
(beispielsweise Hans Erich Nossack; Gert Ledig, insbesondere in seinem
Meisterwerk "Vergeltung"; Alexander Kluge; in Grenzen auch Dieter Forte) – aber
sie drangen bis weit in die 1990er Jahre nicht zu einem größeren Publikum durch,
weil es nicht opportun war, Deutsche im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg
auch als Leidende darzustellen. Zu schnell haftete dem Autor das Etikett des
Revanchismus an. Erst als der in dieser Hinsicht völlig unverdächtige Günter
Grass im Jahr 2002 mit seiner Novelle "Im Krebsgang" die Versenkung des Schiffes
"Wilhelm Gustloff" (durch ein sowjetisches U-Boot) und damit den Tod von rund
9.000 Zivilisten thematisierte, veränderte sich die abweisende Haltung teilweise
und die Kritiker "entdeckten" plötzlich jahrzehntealte Bücher, die sie aus
opportunistischen Gründen in den Giftschrank eingesperrt hatten.
So kamen mit einiger Verspätung großartige literarische Werke endlich in den
Fokus der Öffentlichkeit. Grundvoraussetzung dabei war allerdings, dass die
Auseinandersetzung beispielsweise mit dem Bombenkrieg auf eine rein
literarisch-ästhetische Weise stattfand (die natürlich frei von jedem
Opferheroismus zu sein hatte). Vom Vorwurf des Geschichtsrevisionismus wurde man
nur befreit, wenn sich in der Literatur keinerlei Hinweis auf einen auch nur
angedeuteten historischen Rekurs des Ereignisses befand. An der Tatsache der
ursprünglichen "Schuld" für die Szenarien durfte kein Zweifel artikuliert
werden. Das Dilemma steigerte sich noch, als die rechtsextreme NPD im
sächsischen Landtag 2005 in Bezug auf den 60. Jahrestag der Bombardierung
Dresdens vom "Bombenholocaust" schwadronierte und das Thema versuchte für ihre
neonazistische Propaganda zu vereinnahmen. Jede Befragung der Notwendigkeit des
Bombenkrieges durch die Alliierten (bzw. der Effizienz von Bombenangriffen
generell) hat heute noch einen negativen Hautgout und gilt als reaktionär. (Bei
Militärs ist dies natürlich nicht der Fall. Sie sehen Luftbombardements schon
lange ambivalent.)
 "Ablage.
Nicht bearbeiten FDR" "Ablage.
Nicht bearbeiten FDR"
Mit diesem Hintergrund ist die heftige Ablehnung von Nicholson Bakers Buch in
Deutschland fast vorprogrammiert. Zwar lässt Baker in ausgewählten Passagen von
Zeitzeugen keinen Zweifel an Hitlers Wahnsinn. Daneben gibt es zwei Stellen die
über die Anfänge von Auschwitz berichten. Auch der Titel des Buches
("Menschenrauch") ist nicht beliebig gewählt (wie Baker im Nachwort erwähnt).
Ausgiebig zeigt er, wie die Appelle jüdischer Emigranten und Organisationen
insbesondere an Roosevelt, mehr Flüchtlinge aufzunehmen und die Visaanträge
zügiger zu bearbeiten, ignoriert wurden und stattdessen abstruse neue
"Aufenthaltsorte" für jüdische Emigranten diskutiert wurden (Madagaskar,
Tanganjika, Dominikanische Republik). Zu lange wollte man den ungeheuerlichen
Zivilisationsbruch, der sich früh abzeichnete, nicht wahrhaben. Auf eine Anfrage
zum Gesetzesentwurf zur Aufnahme von Flüchtlingskindern im Juni 1939 vermerkte
Roosevelt "Ablage. Nicht bearbeiten FDR".
Ob dies nun einer noch in den 1920/30er-Jahren auch im angelsächsischen Raum
verbreiteten antisemitischen bzw. antizionistischen Stimmung geschuldet war
(Baker hat eine entsprechende Äußerung von Eleanor Roosevelt entdeckt und auch
Franklin Roosevelt störte sich 1932 am relativ hohen Anteil jüdischer
Erstsemesterstudenten an amerikanischen Universitäten von mehr als 30% und
wollte diese Quote mittelfristig auf 15% senken) oder schlichtweg einer fatale
Fehleinschätzung der tatsächlichen Lage entsprang – Baker zeigt diese
"unterlassene Hilfeleistung", die man wohl als Schande bezeichnen muss.
Deutlich wird aber auch: Hitler galt bis weit in die 1930er Jahre hinein für
viele amerikanische und britische Politiker als das geringere der beiden Übel;
man gestand Nazi-Deutschland die Rolle des Bollwerks gegen den als wesentlich
bedrohlicher empfundenen Kommunismus zu und verharmloste die Exzesse, die sich
beispielsweise in der Reichspogromnacht zeigten.
Baker reißt aber noch mehr Wunden auf: Er thematisiert die britische
Kolonialpolitik und deren Exzesse. Parallel dazu besetzte Roosevelt eine
pazifische Insel nach der anderen und errichtete somit ein Drohszenario gegen
Japan (dem der Kuba-Krise von 1962 ähnlich). Es wird im weiteren Verlauf des
Buches suggeriert, der japanische Angriff auf Pearl Harbor wäre nicht nur
willkommener Anlass für den Kriegseintritt der USA gewesen (Roosevelt hatte den
Wahlkampf mit dem Versprechen der Neutralität der USA bestritten), sondern
geradezu provoziert worden (und natürlich greift Baker die Quellen auf, die
behaupten, man habe hiervon rechtzeitig gewusst).
Churchills Militarismus und Gandhis Opferrhetorik
Baker zeigt, wie die USA China gegen Japan bereits in den 20er Jahren
unterstützten und aufrüsteten und dokumentiert, dass große Teile des "New
Deal"-Programms Roosevelts ein gewaltiges Aufrüstungsprogramm darstellte. Er
illustriert die Doppelzüngigkeit der Abrüstungsreden Roosevelts, der weltweite
Abrüstung bei eigener Aufrüstung als Friedenssicherung begreift. In den USA
wurde die allgemeine Wehrpflicht eingeführt und Pazifisten, die sich
verweigerten, für mindestens ein Jahr ins Gefängnis gesteckt.
Dazwischen gibt es immer wieder Redeprotokolle, Briefe und Artikel von Mahatma
Gandhi, der der Gewaltspirale mit Gewaltlosigkeit begegnete und dabei in eine
heute merkwürdig anmutende Opferrhetorik verfiel: "Ich weiß, dass es
notwendig sein kann, Hunderte wenn nicht gar Tausende zu opfern, um den Hunger
von Diktaturen zu stillen." Die Praxis der Gewaltlosigkeit – ashimsa – sei am
wirksamsten angesichts schrecklicher Gewalt, schrieb Gandhi, "auch wenn die
Opfer nicht mehr erleben, wofür sie gelitten haben.". Und auch im Oktober
1941 – Japan hatte Pearl Harbor angegriffen und das nationalsozialistische
Deutschland einige Monate vorher die Sowjetunion überfallen – meinte Gandhi
das Prinzip der Gewaltlosigkeit, selbst wenn es mit der Gefahr verbunden sei,
eingekerkert, dem Verhungern preisgegeben oder getötet zu werden sei die
einzig richtige Antwort. Und dann die Sätze, die konstituierend für
Bakers "Menschenrauch"-Buch sind, aus dem Mund von Gandhi: "Hitlerismus und
Churchillismus sind im Grunde dasselbe; sie unterscheiden sich nur graduell."
Der eigentliche Schwerpunkt dieses Buches liegt in der Abarbeitung Bakers am
Politiker und Kriegsherren, ja an der Person von Winston Churchill. Hier zeigt
sich eine Obsession: Er will den Nimbus Churchills, den des "guten"
Kriegsherren, der gegen das "böse" Nazideutschland reüssierte entmythologisieren
und dekonstruieren. War doch gängiger Konsens, dass gegen den massenmörderischen
NS-Staat fast alle Mittel Recht waren. Genau das bestreitet Baker. Dabei geht er
bewusst das Risiko der Einseitigkeit, der Überzeichnung und – leider – an
einigen Stellen auch der Manipulation ein.
 Gezeigt
wird ein hoch intelligenter und wortgewandter, extrem bellizistischer, ja
brutaler Winston Churchill, ein Militarist der extremen Schule, der eine
Blockadepolitik als gerechtfertigt hinstellte, selbst wenn dabei auch Frauen und
Kinder verhungerten, sofern sie zu einer früheren siegreichen Beendigung des
Krieges beitragen (Herbert Hoover, August 1940). Er initiiert
Strafaktionen (d. h. Bombardierungen aus der Luft) in den 1920er Jahren im
Irak, der Stadt Peshawar oder einem Dorf im Jemen und wettert gegen den
Gandhiismus, der unnachsichtig bekämpft und letztendlich niedergeschmettert
gehört (ausser Repressionen findet er keine Mittel). Baker zitiert aus einem
heute antisemitisch erscheinenden Artikel Churchills von 1920 ("Zionism-versus-Bolschewism
(pdf, 97 KB)"), der vom "finsteren Bündnis" des internationalen Judentums
faselt, vor einer jüdischen Verschwörung warnt und Judentum und Bolschewismus
als synonyme Feindbilder sieht (ohne
"entlastendes Material" für Churchill
einzuflechten), erwähnt ein frühes Lob auf Mussolini und zitiert aus Churchills
Buch "Große Zeitgenossen" ("Great Contemporaries") aus dem Jahr 1937, in dem er
Hitler als hochkompetenten, kühlen, gutinformierten Funktionär mit
angenehmen Umgangsformen beschreibt ("Those who have met Herr Hitler face to
face have found a highly competent, cool, well informed functionary with an
agreeable manner, a disarming smiles, and few have been unaffected by a subtle
personal magnetism"). Gezeigt
wird ein hoch intelligenter und wortgewandter, extrem bellizistischer, ja
brutaler Winston Churchill, ein Militarist der extremen Schule, der eine
Blockadepolitik als gerechtfertigt hinstellte, selbst wenn dabei auch Frauen und
Kinder verhungerten, sofern sie zu einer früheren siegreichen Beendigung des
Krieges beitragen (Herbert Hoover, August 1940). Er initiiert
Strafaktionen (d. h. Bombardierungen aus der Luft) in den 1920er Jahren im
Irak, der Stadt Peshawar oder einem Dorf im Jemen und wettert gegen den
Gandhiismus, der unnachsichtig bekämpft und letztendlich niedergeschmettert
gehört (ausser Repressionen findet er keine Mittel). Baker zitiert aus einem
heute antisemitisch erscheinenden Artikel Churchills von 1920 ("Zionism-versus-Bolschewism
(pdf, 97 KB)"), der vom "finsteren Bündnis" des internationalen Judentums
faselt, vor einer jüdischen Verschwörung warnt und Judentum und Bolschewismus
als synonyme Feindbilder sieht (ohne
"entlastendes Material" für Churchill
einzuflechten), erwähnt ein frühes Lob auf Mussolini und zitiert aus Churchills
Buch "Große Zeitgenossen" ("Great Contemporaries") aus dem Jahr 1937, in dem er
Hitler als hochkompetenten, kühlen, gutinformierten Funktionär mit
angenehmen Umgangsformen beschreibt ("Those who have met Herr Hitler face to
face have found a highly competent, cool, well informed functionary with an
agreeable manner, a disarming smiles, and few have been unaffected by a subtle
personal magnetism").
Baker wirft Churchill hier vor, dass er Hitler nicht dämonisiert. Dabei
übersieht er, dass die Hitler zugeschriebenen Eigenschaften in der geschilderten
Situation sehr wohl stimmen konnten, ohne dass damit über die Moral des
Politikers (und Menschen) Hitler auch nur ein einziges Wort gesagt ist. Und wenn
dann aus einer Rundfunkansprache Churchills im September 1940 zitiert wird, in
der er Hitler einen "niederträchtige[n] Mann" und "monströs"
nennt, scheint das auch nicht recht zu sein.
Jungbrunnen Krieg
Baker berichtet immer wieder von Churchills Begeisterung für chemische
Kampfstoffe, die wohl sehr ausgeprägt gewesen sein muss (Mussolinis Einsatz von
Senfgas in Äthiopien inspiriert ihn geradezu). Er legt sogar einen Vorrat mit
Milzbrand-verseuchten Keksen an, die nach Bedarf abgeworfen werden könnten (zum
Einsatz sind sie nie gekommen). Der Krieg schien ein wahrer Jungbrunnen für den
Briten zu sein; ständig entwickelt er neue Ideen für Waffen, so beispielsweise
"Visitenkartenbomben", spielkartengroße mit einem Loch versehene
Zelluloidkarten, von denen jeweils zwei mit einem Stück Gaze zusammengeklebt
wurden. Das ganze wurde mit feuchtem weißen Phosphor bestrichen. Die Karten
wurden feucht abgeworfen. Wenn sie in der Sonne trockneten, wurde das Zelluloid
rissig. Dann entzündeten sich die Plättchen. Churchill ließ diese
Brandbomben unter anderem über den Schwarzwald und dem Harz abwerfen.
Aber er beging auch grobe taktische und strategische Fehler mit fatalen Folgen.
Beispielsweise die Vorgänge um Norwegen 1940 noch unter dem Premierminister
Chamberlain und der
offene Brief an den Oberbefehlshaber der
jugoslawischen Luftwaffe, General Dusan Simowitsch,
in dem er Simowitsch ermunterte, lieber als Erster zu schiessen statt von
den Deutschen angegriffen zu werden und Albanien zu überfallen und sich dort
die "massenhaft" vorhandenen Waffen zu sichern. Baker insinuiert, dass erst
durch Churchills Aktivitäten um Norwegen, Jugoslawien (und auch Griechenland)
Hitler "gezwungen" wurde einzugreifen und ohne Churchill die Länder von der
Okkupation durch die Deutschen hätten verschont werden können.
Baker widmet sich Churchills Rhetorik (die Deutschen hießen jetzt pauschal
Hunnen) und kritisiert die Gleichförmigkeit auch der Presse, die sich allzu
bereitwillig fügte (daran hat sich bei ähnlichen Situationen offensichtlich bis
heute nichts geändert). In Großbritannien werden feindliche Ausländer
(insbesondere Deutsche – unter ihnen viele Flüchtlinge) ohne gerichtliches
Verfahren interniert. Stellenweise scheint Churchill geradezu missionarisch den
Krieg alleine für die "freie Welt" führen zu wollen und ordert ohne Unterlass
die neuesten Flugzeuge und Munition von Roosevelt.
Auf schwieriges Terrain begibt sich Baker mit seinem Buch an zwei Punkten: Er
suggeriert durch ausgesuchte Texte, dass Hitlers Friedensangebote im
Herbst/Winter 1939 (und sogar teilweise noch später) zu schnell abgelehnt worden
seien und kreidet der britischen Politik damit mangelndes Interesse an einem
Frieden an. Und in einem sehr speziellen Punkt stimmt Baker durch seine
Textauswahl der These zu, dass nicht Hitler den Bombenkrieg mit Großbritannien
begonnen habe, sondern die Royal Air Force mit einem Bombardement auf
Mönchengladbach am 11. Mai 1940, einen Tag nach dem er von Chamberlain (den er
nicht sehr schätzte) das Amt des Premierministers übernahm. Baker erweckt den
Eindruck, dass Churchill bewusst die Flächenbombardements deutscher Bomber auf
englische Städte in Kauf genommen habe um nun seinerseits ohne jegliche
Rücksichten deutsche Ziele bombardieren zu können und gleichzeitig die USA in
den Krieg zu ziehen. (Wie "nebenbei" wird aus Quellen zitiert, die anzeigen,
dass die britische Abwehr die Evakuierung Coventrys am 14. November 1940 nicht
vorgenommen habe, obwohl man mehrere Stunden vorher vom deutschen Angriff und
dessen Ziel wusste.)
Die Illusion der "Friedensangebote"
Beide Thesen stehen auf wackligem Fundament und zeigen die Grenzen des
Verfahrens, welches Nicholson Baker hier anwendet. Tatsächlich muss der Leser,
der die genauen historischen Abläufe nicht genau kennt glauben, dass auch nach
Hitlers Überfall auf Polen noch eine Chance auf eine Einigung mit dem
nationalsozialistischen Deutschland möglich gewesen wäre. Aber wie hätte man mit
einem derart größenwahnsinnigen Diktator wie Hitler einen dauerhaften Frieden
schließen können? Was Baker auslässt sind die vorher bereits durch Hitler
begangenen zahlreichen Vertragsbrüche, angefangen vom Einmarsch in das
entmilitarisierte Rheinland 1936 (ohne durchgreifende Reaktion der Versailler
Siegermächte), dem "Anschluss" Österreichs 1938 (es gab nur diplomatische
Protestnoten) und die widerrechtliche Besetzung der "Rest-Tschechei" im Jahr
1939.
All diese Ereignisse finden in Bakers Textsammlung keinen Niederschlag; die
Verhandlungen um die Sudetenkrise 1938 (mit dem "Münchener Abkommen" als
Ergebnis) werden nur in einem Eintrag kurz erwähnt. Kennt Baker diese
Vorgeschichte nicht? An einigen wenigen Punkten glaubt man zu bemerken, dass er
was den deutschen Nationalsozialismus angeht, nicht ganz auf der Höhe ist (etwa,
wenn unwidersprochen die Fama wiedergegeben wird, dass Hitler Rudolf Heß in
Landsberg "Mein Kampf" diktiert habe). Dennoch kaum zu glauben, dass Baker diese
essentiellen Verstöße gegen den Versailler Vertrag, die allesamt unsanktioniert
blieben, nicht kennt.
Es wird für möglich erachtet, dass Hitler auch noch 1940 "zu bändigen" gewesen
sei, wenn man nur von britischer (und amerikanischer) Seite gewollt hätte. Das
ist in Anbetracht der langfristigen "Strategie" des Nationalsozialismus
schlichtweg dumm. Dabei ist den im Buch zu Wort kommenden Pazifisten der 30er
und 40er Jahre weniger ein Vorwurf zu machen als dem Collageur des 21.
Jahrhunderts, der in grandioser Verkennung der bereits damals vorliegenden
Tatsachen glaubt, der Nationalsozialismus hätte sich irgendwie in eine
europäische Gebietsaufteilung einbinden lassen. Baker vernachlässigt die
tatsächliche Intention Hitlers für diese sogenannten Friedensaktivitäten: Er
wollte an der Westflanke Ruhe haben, um sich vollständig auf den Eroberungs- und
Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion zu konzentrieren.
Wer das ignoriert und stattdessen suggeriert, Hitler hätte mit weiterem
Appeasement aufgehalten werden können und Churchill (und in Grenzen auch
Roosevelt) hätten diese Möglichkeit verstreichen lassen – der betreibt nichts
anderes als Geschichtsklitterung. Freilich bleibt dann das ausführlich
beschriebene inkonsequente Verhalten der Alliierten was die (nicht nur
jüdischen) Flüchtlinge aus Deutschland und später aus ganz Europa angeht.
Wer hat angefangen?
Auch in der Frage, wer denn den Luftkrieg zwischen Großbritannien und dem
"Deutschen Reich" angefangen habe, begibt sich Baker auf vermintem Terrain.
Nicht wenige sehen die Luftangriffe auf
Mönchengladbach vom 11./12. Mai 1940 als eine
Art Antwort auf die sogenannte
"Westoffensive" Deutschlands ("Fall Gelb")
einen Tag vorher. Baker suggeriert, Churchill
habe provozieren wollen, nach dem eine Blockade gegen Deutschland (und später
gegen die besetzten Gebiete) nicht zum "Erstschlag" Hitlers geführt hatte. Fest
steht – Baker erwähnt dies -, daß Flächenbombardements von beiden Seiten in
anderen Konflikten als kriegsführendes Mittel eingesetzt wurden. Fest steht auch
(das wird im Buch gut belegt): Die Absicht, nur militärische oder wichtige
strategische Ziele des Feindes zu treffen, war mit der damaligen Technik
unmöglich. Somit waren zivile Tote nicht nur billigend in Kauf genommen worden,
sondern spielten mehr und mehr eine entscheidende Rolle, weil man damit die
Moral und Regierungstreue der Bevölkerung unterminieren wollte. Früh zeigt sich
auch für jemanden wie Churchill, dass dies mindestens nicht kurzfristig
funktionierte. Dies führte jedoch nicht zur Eindämmung, sondern, im Gegenteil,
zur Ausweitung der Angriffe – auch hier auf beiden Seiten und mit wachsender
Brutalität.
Könnte man zweifelsfrei nachweisen, dass Churchill den Luftkrieg begonnen hätte,
wäre die Argumentation Pazifisten gegenüber nur in Notwehr gehandelt zu haben
nicht mehr haltbar. Das moralische Kalkül würde dann nicht mehr
funktionieren: "Wenn sie von Pazifismus reden", so Gandhi 1938, "dann
mit dem Hintergedanken, dass man Waffen anwenden darf, falls der Pazifismus
scheitert". Ein wahrer Pazifist sei jedoch nie berechnend. "Irgendjemand muss in
England aus ehrlicher Überzeugung aufstehen und fordern, dass England unter gar
keinen Umständen zu den Waffen greift."
Wer die von Baker zusammengetragenen Äußerungen Gandhis zu, über und sogar an
Hitler liest, kann unmöglich nicht bewegt sein. Im Januar 1939 sagt Gandhi:
Selbst das härteste Herz müsse vor der Hitze der Gewaltlosigkeit schmelzen.
"Herr Hitler ist nur ein Mensch, der nur eine durchschnittliche Lebensspanne zu
erwarten hat". Am 3. Juli 1940 schreibt er in einem offenen Brief ("To-Every-Briton
(pdf, 16 KB)") an das englische Volk: "Eure Soldaten richten
ebensolche Zerstörung an wie die Deutschen. Ich wünschte, Ihr würdet den
Nationalsozialismus ohne Waffen bekämpfen". Und an Adolf Hitler schreibt er
am 24.12.1940: "Wir zweifeln nicht an Ihrer Tapferkeit und Hingabe an Ihr
Vaterland, noch halten wir Sie für das Ungeheuer, als das Ihre Gegner Sie
beschreiben." Seine Taten seien allerdings ungeheuerlich. Die Tschechoslowakei,
Dänemark, "die Vergewaltigung Polens" – mit diesen Eroberungen habe er die
Menschenwürde verletzt. Gandhi erklärte Hitler den Weg der Gewaltlosigkeit
und riet Hitler bringen Sie Ihren Disput vor ein internationales Tribunal.
Warum dieses Buch dennoch lesenswert ist
Unweigerlich kommt einem bei der Lektüre Heiner Geißlers Diktum von 1983 in den
Sinn: "Der Pazifismus der 30er Jahre, der sich in seiner gesinnungsethischen
Begründung nur wenig von dem unterscheidet, was wir in der Begründung des
heutigen Pazifismus zur Kenntnis zu nehmen haben, dieser Pazifismus der 30er
Jahre hat Auschwitz erst möglich gemacht." Später stellte Geißler klar: Er
meinte mit Pazifismus Chamberlains Appeasement-Politik, die vor einer
Konfrontation mit Hitler zurückschreckte und 1938 den Verbündeten
Tschechoslowakei praktisch verriet, um einen drohenden Krieg zu verhindern.
Aber ist das alles wirklich so einfach? Legt man das Buch nach der Lektüre
einfach so weg und hakt den Autor als unbelehrbaren Pazifisten oder sogar naiven
Dummkopf ab? Oder, anders gefragt: Was macht denn das Buch trotz der teilweise
aberwitzigen suggerierten historischen Deutungen so lesenswert? Ist es nur die
gewollt andere Sicht, der Gegenstrom des so scheinbar Überdeutlichen?
Nein. Denn Nicholson Baker zeigt, dass ein Krieg, mag er auch noch so moralisch
gerechtfertigt oder gar politisch unabwendbar sein, immer beide Seiten
verändert und niemals nur die klare Dichotomie des Guten auf der einen und
des Bösen auf der anderen Seite kennt. Jeder Krieg korrumpiert auch die Werte
des moralisch scheinbar Überlegenen.
Im weiteren Verlauf werden sich die vermeintlichen Gegner immer ähnlicher (wie
Baker an einem Beispiel aufzuzeigen versucht, als im März 1941 in den USA ein
Buch mit dem Titel "Germany
must perish" erscheint, in dem allen Ernstes
die Massensterilisation aller Deutschen vorgeschlagen wird und gleichzeitig die
SS Pläne entwickelt, wie Keimdrüsen und Eierstöcke von Juden beim Warten an
Formularschaltern sterilisiert werden könnten).
Bakers Buch endet mit dem Jahr 1941, als das fürchterlichste
Menschheitsverbrechen, die Shoah, erst begann. Dies verführt den Leser zu der
Frage: Wie würde dieser Krieg in der Retrospektive bewertet, hätte es den
Massenmord an den europäischen Juden nicht gegeben? Welche Dolchstosslegende(n)
hätte es in Deutschland gegeben? Aber diese Frage ist unhistorisch, weil Bakers
Textsammlung zu einem Fehlschluss verleitet: Nationalsozialismus ist ohne die
Shoah gar nicht denkbar. Der wahnsinnige Gedanke der Vernichtung der
europäischen Juden ist immanent im "Denken" des Nationalsozialismus eingebettet.
Hitler ist kein monströserer Mussolini, der mit regionalen
Territorialzugeständnissen irgendwann milde zu stimmen war.
Und hier ist das Buch – fast unfreiwillig – erhellend: Diese Komponente hatten
die Alliierten wenn überhaupt, nur am Rande im Blick. Den Krieg, der wir
nachträglich den Zweiten Weltkrieg nennen, wurde von ihnen als ein fast reiner
macht- bzw. geostrategischer Krieg begriffen. Hier ein größenwahnsinniger
Diktator, dessen wahre Absichten ignoriert bzw. heruntergespielt wurden und dort
die angelsächsische "Empire"-Achse, die bis 1944 wartete, ehe sie den verhassten
Diktator Stalin vorübergehend in ihre Gesellschaft aufnahm (da sonst ein Sieg
fraglich geworden oder zeitlich sehr viel länger gedauert hätte).
Wer dieses Buch "gefährlich" nennt und behauptet, eine solch
journalistisch-literarisches Thesenwerk liefere unverbesserlichen Pazifisten
oder rechtsradikalen Dummköpfen nur billiges Material, verkennt nicht nur die
heutzutage gängigen Informationsmöglichkeiten sondern zeigt auch sehr schön
seine paternalistischen Beschützerarroganz. "Menschenrauch" verlangt nicht nur
den mündigen Leser, es erzeugt ihn geradezu. Das ist bei all den genannten
Mängeln kein geringes Verdienst.
Auch ein Leser, der Bakers pazifistische Gedanken und historische Einschätzungen
nicht teilt, kann dieses Buch mit Gewinn lesen.
Alle Photos:
Public domain
|
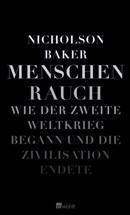 Nicholson
Baker Nicholson
Baker
Menschenrauch
Deutsch von Sabine Hedinger und Christiane Bergfeld
Rowohlt
Hardcover, 640 Seiten
06.03.2009
24,90 €
978-3-498-00661-7
Leseempfehlung:
Enzyklopädie der Melancholie
Ein Essay von René
Steininger
Man wird
in der deutschen Literatur nach 1945 nicht leicht ein Werk finden, das so
hartnäckig um die Themen der Zerstörung und Trauer kreist, wie jenes des 1944 in
Wertach im Allgäu geborenen und 2001 bei einem Autounfall in seiner englischen
Wahlheimat Norwich ums Leben gekommenen Literaturwissenschaftlers und
Schriftstellers W. G. Sebald.
|
 Honoré
de Balzac
Honoré
de Balzac Eine
kleine Materialsammlung
Eine
kleine Materialsammlung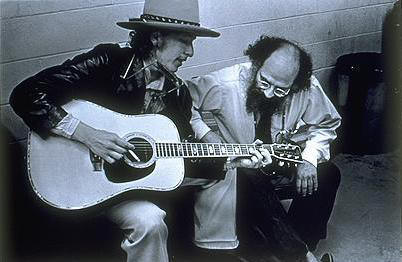
 Edition
Glanz & Elend
Edition
Glanz & Elend Die
Preisträger
Die
Preisträger