|
Jazz aus der Tube
Bücher, CDs, DVDs
&
der Link des Tages
Schiffsmeldungen
Nachrichten, Gerüchte, Ideen,
Leute & Jobs
aus der Verlagswelt, Fachpresse & Handel
Links
Bücher-Charts
l
Verlage A-Z
Medien- & Literatur
l
Museen im Internet
Rubriken
Belletristik -
50 Rezensionen
Romane, Erzählungen, Novellen & Lyrik
Quellen
Biographien, Briefe & Tagebücher
Geschichte
Epochen, Menschen, Phänomene
Politik
Theorie, Praxis & Debatten
Ideen
Philosophie & Religion
Kunst
Ausstellungen, Bild- & Fotobände
Tonträger
Hörbücher & O-Töne
SF & Fantasy
Elfen, Orcs & fremde Welten
Sprechblasen
Comics mit Niveau
Autoren
Porträts,
Jahrestage & Nachrufe
Verlage
Nachrichten, Geschichten & Klatsch
Film
Neu im Kino
Klassiker-Archiv
Übersicht
Shakespeare Heute,
Shakespeare Stücke,
Goethes Werther,
Goethes Faust I,
Eckermann,
Schiller,
Schopenhauer,
Kant,
von Knigge,
Büchner,
Marx,
Nietzsche,
Kafka,
Schnitzler,
Kraus,
Mühsam,
Simmel,
Tucholsky,
Samuel Beckett
 Honoré
de Balzac Honoré
de Balzac
Berserker und Verschwender
Balzacs
Vorrede zur Menschlichen Komödie
Die
Neuausgabe seiner
»schönsten
Romane und Erzählungen«,
über eine ungewöhnliche Erregung seines
Verlegers Daniel Keel und die grandiose Balzac-Biographie
von Johannes Willms.
Leben und Werk
Essays und Zeugnisse mit einem Repertorium der wichtigsten
Romanfiguren.
Hugo von
Hofmannsthal über Balzac
»... die größte, substantiellste schöpferische Phantasie, die seit
Shakespeare da war.«
Literatur in
Bild & Ton
Literaturhistorische
Videodokumente von Henry Miller,
Jack Kerouac, Charles Bukowski, Dorothy Parker, Ray Bradbury & Alan
Rickman liest Shakespeares Sonett 130
Thomas Bernhard
 Eine
kleine Materialsammlung Eine
kleine Materialsammlung
Man schaut und hört wie gebannt, und weiß doch nie, ob er einen
gerade auf den Arm nimmt, oder es ernst meint mit seinen grandiosen
Monologen über Gott und Welt. Ja, der Bernhard hatte schon einen
Humor, gelt?
Hörprobe
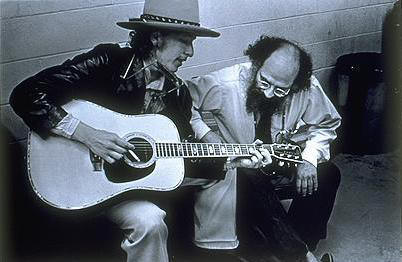
Die Fluchtbewegungen des Bob Dylan
»Oh
my name it is nothin'/ My age it means less/ The country I come from/
Is called the Midwest.«
Ulrich Breth über die
Metamorphosen des großen Rätselhaften
mit 7 Songs aus der Tube
Glanz&Elend -
Die Zeitschrift
Zum 5-jährigen Bestehen
ist
ein großformatiger Broschurband
in limitierter Auflage von 1.000
Exemplaren
mit 176 Seiten, die es in sich haben:
Die menschliche
Komödie
als work in progress
 »Diese mühselige Arbeit an den Zügen des
Menschlichen« »Diese mühselige Arbeit an den Zügen des
Menschlichen«
Zu diesem Thema haben
wir Texte von Honoré de Balzac, Hannah Arendt, Fernando Pessoa, Nicolás
Gómez Dávila, Stephane Mallarmé, Gert Neumann, Wassili Grossman, Dieter
Leisegang, Peter Brook, Uve Schmidt, Erich Mühsam u.a., gesammelt und mit den
besten Essays und Artikeln unserer Internet-Ausgabe ergänzt.
Inhalt als PDF-Datei
Dazu erscheint als
Erstveröffentlichung das interaktive Schauspiel »Dein Wille geschehe«
von Christian Suhr & Herbert Debes
Leseprobe
Anzeige
 Edition
Glanz & Elend Edition
Glanz & Elend
Martin Brandes
Herr Wu lacht
Chinesische Geschichten
und der Unsinn des Reisens
Leseprobe
Neue Stimmen
 Die
Preisträger Die
Preisträger
Die Bandbreite der an die 50 eingegangenen Beiträge
reicht
von der flüchtigen Skizze bis zur Magisterarbeit.
Die prämierten Beiträge
Nachruf
 Wie
das Schachspiel seine Unschuld verlor Wie
das Schachspiel seine Unschuld verlor
Zum Tod des ehemaligen Schachweltmeisters Bobby Fischer
»Ich glaube nicht an Psychologie,
ich glaube an gute Züge.«
Wir empfehlen:
kino-zeit
Das
Online-Magazin für
Kino & Film
Mit Film-Archiv, einem bundesweiten
Kino-Finder u.v.m.
www.kino-zeit.de






br-buecher-blog
Andere
Seiten
Elfriede Jelinek
Elfriede Jelinek
Joe Bauers
Flaneursalon
Gregor Keuschnig
Begleitschreiben
Armin Abmeiers
Tolle Hefte
Curt Linzers
Zeitgenössische Malerei
Goedart Palms
Virtuelle Texbaustelle
Reiner Stachs
Franz Kafka
counterpunch
»We've
got all the right enemies.«
Riesensexmaschine
Nicht, was Sie denken?!
texxxt.de
Community für erotische Geschichten
Wen's interessiert
Rainald Goetz-Blog
Technorati Profile



|
Die Kunst der Verästelung
globaler Hauptereignisse
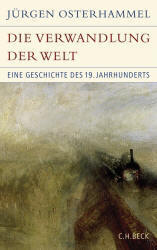 Peter
V. Brinkemper über
Jürgen Osterhammels
grandiose Geschichte des 19. Jahrhunderts Peter
V. Brinkemper über
Jürgen Osterhammels
grandiose Geschichte des 19. Jahrhunderts
»Die Verwandlung der Welt«
Das Problem, in die jede Art der globalen Betrachtungsweise verwickelt
wird: Ist ihre Perspektive umfassend UND trotzdem nah genug, um die Totalität
der Prozesse zu überblicken und doch ihren detaillierten Zusammenhang nicht aus
den Augen zu verlieren? Historische, wissenschaftliche und literarische Werke
sind ebenso wie mediale Re-/Konstruktionen im- oder explizite Raum-Transporter
und Zeitmaschinen, raumzeitliche Gedankenetze, die mit linearen einheitlichen
oder vielfältigen Diskursen: Positionen und Linien, Übergänge und
Entwicklungspfade wie Bastionen und Autobahnen behaupten oder als poröse
Sandburgen und smarte Korallenriffe in generativen Schritten und Spuren
nachvollziehend erschließen. Man kann sich hier, im Nah- und Fern-Bereich
verschiedene Arten von Diskursmodi zwischen großer mythologisierender
Mega-Erzählung und wissenschaftlich ausgenüchterter basisnaher Erklärung und
Sammlung von Faktoren vorstellen. Irgendwann wird das globale
Datengewitter zwischen Spam und Information auch noch die lauterste und
methodisch abgeklärteste Arbeit in eine fatale Textform verwandeln, die momentan
in dem Wikipediatisierten Universum herumgeistert: Das leere Aufsagen alter
historischer und literarischer Erzählformen, »erst.., und dann ...., und
dann..«, die längst wissenschafts-, publikations- und kinostrategisch
ausgeblutet sind und darunter die wütend-verzweifelte Aufzählung, die in jeden
narrativen Einzelschritt eine virtuell unendliche Serie von Faktoren und
Mikroereignissen hineinpumpt:
»F1,
F2, und so weiter bis Fn«.
So dass die Erzählung auf der Oberfläche ihrer Hauptereignisse durch die
Unendlichkeits-Verästelung unter der Haut nicht mehr fortschreitet, sondern
implodiert oder zu einem eisigen Modell in einer steuerungslos gewordenen
Wissensgesellschaft gefriert.
Vorsicht und
Interdisziplinarität
Jürgen Osterhammel hat mit
»Die
Verwandlung der Welt -
Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts«
ein wissenschaftliches Standardwerk geschrieben, in dem der Spagat zwischen
Überblick und Detail so weit wie möglich ausbalanciert werden soll. Sein Buch
ist aus mehrfachen Gründen nicht historistisch sondern aktuell und
zukunftsweisend akzentuiert, weil es mit historiographischer Vorsichtigkeit die
Beschreibung und Erklärung von globaler Entwicklung betreibt und dabei die
Methode der interdisziplinären, multifaktoriellen und interkontinentalen
Betrachtung anwendet. In dieser Herangehensweise operiert Osterhammel mit dem
heute möglichen umgreifenden Verständnis, was die Bedeutsamkeit der sich
abzeichnenden Geschichte von Vorgestern für uns auf einem immer noch zerteilten
Planeten betrifft. Osterhammel holt diese Historie in vielen Storyaspekten aus
ihrer wissensmäßigen und nationalen Vereinzelung und isolierten Erstarrung
heraus, vermeidet dabei aber auch die Beliebigkeit eines bloßen Nebeneinanders
oder den Dogmatismus vorschneller großer Erzählungen und Erklärungen. Manches
mag da zwar wie argumentatives Püree und diskursiver Schaum klingen, aber der
Eindruck der kreativ-lebendigen Ordnung, eines wohlgeratenen Omelettes
herrscht vor. Osterhammel setzt bewusst Bescheidenheit vor
»Allwissenheit«,
er betont, dass er viel Wissen aus anderen Bereichen und von anderen Experten
übertragen muss, um zur richtigen Proportionierung und Gewichtung von Prozessen
in der Nach- und Gleichzeitigkeit zu gelangen, um dann zu einer wirklich
substantiellen Vorbereitung von Knotenpunkten und Erklärungen vorzustoßen und
nicht nur in gefälligen Beschreibungen oder Nacherzählungen, schiefen Analogien
und sturen Erfassungen zu enden, damit Kontinuität, Stagnation, Verfall und
Evolution, Ausweitung und Verengung in Raum und Zeit realgeschichtlich
begreifbar werden.
Eine nützliche
Leseanweisung
Osterhammel betont in seiner Einleitung, dass er
»Migration,
Ökonomie, Umwelt, internationale Politik und Wissenschaft«
breiter als andere Faktoren behandelt. Dabei könne er einen bestimmten
transnationalen Eurozentrismus mit transatlantischer Verbundenheit zu der
Geschichte der USA nicht verleugnen. Das Buch sei aber vor allem
»an
den chronologischen Rändern noch offener gehalten«
als Christopher Baylys
»The
Birth of the Modern World«
(2004) mit seiner Betonung von Industrialisierung, Staatsbildung und religiösen
Revivals. Mit ihm teilt er den Verzicht auf die regionale Gliederung nach
Nationen, Zivilisationen und kontinentalen Großräumen. Aber Osterhammel sieht in
dieser lateralen, raumbetonten Sichtweise Baylys und den stärker zeitbetonten
Perspektiven der weiteren Vorgänger John M. Roberts und Eric J. Hobsbawm
Unschärfen und Spaltungen zwischen narrativer und struktureller Darstellung, die
es durch weitere kategoriale Entscheidungen und dichte Beschreibungen zu füllen
gilt. Im Sinne von Fernand Braudel beansprucht er eine differenziertere,
perspektivisch relativierende Anwendung von verschiedenen
»Meistererzählungen«,
die jeweils in ihrer fachlichen Logik eines Teilgebietes weitergetrieben werden,
um sodann einen Beschreibungs- und Erklärungswert abzuwerfen, für die
Darstellung von allgemeinen und regionalen Entwicklungen nach bestimmten
temporalen Mustern. Man muss Osterhammel beipflichten, wenn er betont:
Eurozentrismus und andere Einseitigkeiten in der Darstellung lassen sich nicht
durch die »illusionäre
'Neutralität' eines allwissenden Erzählers oder die Einnahme einer
vermeintlich 'globalen' Beobachterposition«
tilgen, »sondern
durch ein bewusstes Spiel mit der Relativität von Sichtweisen«
relativieren. Diese methodische Vorbemerkung ist auch eine nützliche
Leseanweisung für den Rezipienten, der sich anhand einzelner Kapitel zum
gleichen Thema auch mit anderen Quellen synoptisch beschäftigen will.
Osterhammel reflektiert gekonnt die Abwesenheit von Zeit- und
Standortneutralität seiner Darstellung und kann insofern einen
relativistisch-interdisplinären Navigations-Antrieb für seine Darstellung
gewinnen, die regionalen Verfälschungen und Übertreibungen wie auch
historistischen und imperialen Zerrbildern von Damals, von Heute und sozusagen
von Morgen den Spiegel vorhält.
Ein Exempel: Let my People go!
Man kann sich an der
Qualität des Osterhammelschen Wissensmanagements von kontrollierter
bereichsbezogener interdisziplinärer Beschreibung und dabei möglichst vorsichtig
und doch relativ präzise ausdestillierter Erklärung in den verschiedenen
Kapiteln des 1568 kleinstgedruckten Seiten starken Buches überzeugen. Wenn
Barack Obama am Tag seiner Vereidigung symbolisch auf die Original-Bibel Abraham
Lincolns den Präsidenteneid ablegte, so ist bei Osterhammel über die
»Sklavenemanzipation
und 'Weiße Vorherrschaft'«
nachzulesen: »Das
Zurückdrängen von Sklavenhandel und Sklaverei geschah als eine transatlantische
Kettenreaktion, bei der jede lokale Handlung durch einen größeren Zusammenhang
zusätzlichen Sinn erhielt«.
Nun gut. Das klingt noch nach einer klaren Kausalkette. Aber im Kern der
Argumentation erreichen die Dominosteine eine Spiralform mit einem drohenden
Patt der aufeinander klickenden Fronten. Weiter: Die britische Öffentlichkeit
mit ihrem Antislavery-Programm und ihrer weltweiten Intervention führte 1807/8,
also mitten im Abwehrkampf gegen Napoleon, zu einem weltweiten Verbot von
Sklavenhandel auf Schiffen unter britischer Flagge. Damit war dieser Art von
globalem Geschäft offiziell ein empfindlicher Schlag versetzt worden. Dies könne
aus wirtschaftlichen Prämissen allein nicht erklärt werden, da die
Plantagenwirtschaft zu dieser Zeit noch erhebliche Gewinne abwarf. Adam Smiths
ökonomische These,
»freie Arbeit sei
produktiver als erzwungene«,
habe damals noch keine Mehrheit in der Fachwelt errungen. Hier wäre natürlich
Feinarbeit über die sozioökonomische Meinungsbildung im unmittelbar
präindustriellen Großbritannien wünschenswert. Aber die steht in einem anderen
Kapitel. Interessant ist die Ausführung, dass die sozialpolitische Bewegung des
z. T. radikalen Abolitionismus eine emanzipatorische Ventilfunktion für eine
noch nicht völlig gleichberechtigte Öffentlichkeit in Großbritannien hatte: Die
Rhetorik der Abolitionisten wird von Osterhammel als
»kalkuliert«
bezeichnet und setzte eine Identifikation mit den Opfern an. Britische Frauen,
die erst später, 1919 erheblich eingeschränkt, 1928 uneingeschränktes Wahlrecht
bekamen, sahen auch hier ein wichtiges, von der offiziellen Politik zunächst
nicht hinreichend beachtetes Betätigungsfeld. Hier sieht Osterhammel eine Line
mit den »sentimental
novels«
des 18. Jahrhunderts. »In
der publizistischen Strategie der maßgebenden Abolitionisten vermischten sich
humanitär-moralische Appelle mit Argumenten, welche die militärischen und
imperialen Interessen der Nation zu Geltung brachten«.
Die Royal Navy nahm sich das Recht, Schiffe dritter Staaten nach Sklaven zu
durchsuchen und freizusetzen. Auf diese Weise wurde auch die Handelslücke
geschlossen, die mit dem britischen Verzicht auf Sklavenhandel faktisch geöffnet
worden war. Ebenfalls 1807 verbot der US-Kongress die Teilnahme von US-Bürgern
am afrikanischen Sklavenmarkt und die legale Einfuhr weiterer Sklaven. Von hier
aus lässt sich auch die Linie zum späteren abolitionistischen Roman Harriet
Beecher Stowes »Uncle
Tom’s Cabin«
(1852) ziehen, zu der auch ihre Schwägerin sie mit den politischen Worten
motivierte: »Harriet,
if I could use a pen as you can, I would write something that would make this
whole nation feel what an accursed thing slavery is.«
Beecher Stowe wurde später mit offenen Armen in Großbritannien empfangen. Der
literarische Massen-Erfolg ihres sentimentalen Romans im Sinne der umgreifenden
Politisierung von Mitleid mit Unterdrückten kann man sich als Teil einer
literarischen Emanzipationsbewegung vor allem im angelsächsischen Raum
vorstellen. Frankreich und Spanien reetablierten ihre Ausbeutungssysteme in den
Kolonien, auch auf Kuba während der europäischen Restauration in abgeschwächter
Form. Erst die französische Julimonarchie beendete den unterschwelligen
Sklavenhandel in die Kolonien. Zu den Intellektuellen des französischen
Abolitionismus gehörten Tocqueville, Larmartine und Hugo. Erst 1863 wurde das
Ende des niederländischen Sklavenhandels eingeleitet. Die US-Südstaaten
stabilisierten ihre Sklavenhaltergesellschaft erfolgreich durch die zahlreichen
schwarzen Nachkommen ihrer Arbeiter, die den Einfuhrstopp ausglichen, wenn nicht
doch weiter eingeschmuggelt wurde. Von 1840 bis zum Vorabend des Bürgerkrieges
seien die Schwarzen mit den Status von Sklaven von 2,5 auf 4 Mio. gewachsen. Der
Abolitionismus erhielt nur im Norden der USA eine schmale Plattform, während
sich der Süden ideologisch gegen den Wandel verbarrikadierte, obwohl das Ideal
des reichen weißen Plantagenbesitzers lediglich von einer Minderheit der weißen
Bevölkerung im Süden gelebt wurde. Der Southern Comfort war also eine Ideologie
und nicht nur ein Getränk. Durch die ökonomische und politische Verflechtung von
Norden und Süden in den USA war die Protestbewegung zunächst auch im Norden im
Vergleich zum britischen Movement relativ schmal. In dieser Zwangslage
tendierten manche US-Abolitionisten zu einem ersatzpolitischen religiösen
Extremismus, der sich dann oft weniger um die soziale und ökonomische Ausbeutung
der Schwarzen und ihre gesellschaftliche Integration, sondern auf die
strafwürdige Sünde des weißen Mannes und die spätere Ausschiffung der befreiten
Sklaven nach Afrika, in ein gelobtes Land, wie man es aus vielen (späteren?)
Gospels heraushört, bezog.
»When
Israel was in Egypt's Land,
Let my people go,
Opressed so hard they could not stand,
Let my people go.
Chorus
Go down, Moses,
Way down in Egypt's Land.
Tell ol' Pharoah,
Let my people go.«
Nach der Missouri Krise von
1819-1821 wurde das Thema in der offiziellen Politik tabuisiert, zwischen
1836-1844 wurde das Thema im Kongress grundsätzlich abgewürgt; durch
»gag
rules«,
Maulkorberlasse zur Tagesordnung (siehe G. W. Bush) in Bezug auf
Gesetzesinitiativen und Themen wurden Anti-Sklaverei-Petitionen abgeschmettert.
Feste und lose Texturen
Aufgrund dieser Sachverhalte macht Osterhammel deutlich, dass der
Abolitionismus, die Aufhebung der Sklaverei und der Bürgerkrieg nicht in einem
einfachen kausalen Zusammenhang stehen. Und, möchte man aktuell ergänzen, so
muss auch Obamas Lincoln-Bibel-Connection komplexer interpretiert werden.
Osterhammel: »Der
Kampf weißer und schwarzer Abolitionisten gegen die Sklaverei hätte allein den
Bürgerkrieg nicht herbeigeführt, und ohne den Bürgerkrieg hätte sich die
peculiar institution noch eine Weile gehalten.«
Aber was wird damit nun strukturell für die Analyse der Geschichte zwischen
idealtypischer Durchleuchtung und möglicher Begründung und faktischer
Beschreibung ausgesagt? Das ist ein Einwand, der jeden Global- und
Normal-Historiker betrifft, nicht nur Osterhammel. Immerhin standen viele
Präsidenten in der Tradition sklavenhaltender Plantagenbesitzer wie George
Washington, verbunden mit aberwitzigen Wahlstimmen-Anrechnungen durch die
besessenen Sklaven, obwohl diese kein Wahlrecht hatten, geschweige denn hätten
frei ausüben können. Die uralte römische Logik des Stimmviehs? Und es ist kein
Zufall, wenn die Säulen des Weißen Hauses an das Herrenhaus Tara in
»Vom
Winde verweht«
erinnern. Der Aufstieg und die Präsidentschaft Abraham Lincolns, aus seiner
Familientradition ein religiös motivierter Sklaverei-Gegner, aber erst seit 1854
öffentlich in gemäßigter Form in diese Richtung auftretend, ist selbst mit der
Krisenphase einer USA verbunden, deren weitere dramatische Landgewinne im Krieg
gegen Mexiko die kontinentale Spannweite des Unionsterritoriums bald abschlossen
und die Debatte um die Konformität oder Eigenständigkeit der alten und neuen
Bundestaaten und damit die Frage nach der wahren Einheit des Riesenlandes gegen
Ende der New Frontier verstärkte. 1861 wurde Kansas nach blutigen Kämpfen nur
knapp als sklavenhaltender Staat Mitglied. Die Frage der Sklaverei blieb
virulent, im Vordergrund stand die wirtschaftliche Erstarkung des Nordens durch
die zunehmende Industrialisierung gegenüber der südstaatlichen
Plantagenwirtschaft, die allein in der territorialen Expansion ihre Zukunft sah.
Entsprechend eskalierte die Auseinandersetzung um die Integration neuer
Bundesstaaten als Freier oder als
»Sklaven«-Staaten.
Lincolns politischer Kampf auf dem neuen, noch unbegriffenen Großmachttanker USA
war zwischen intelligenter Zurückhaltung und nachhaltiger Innovation angelegt,
er führte ihn über die Reorganisation der zerstrittenen Republikaner unter neuen
Prämissen und zum Aufstieg in die Präsidentschaftskandidatur aufgrund seiner
brillanten rhetorischen Fähigkeiten. Lincoln übte strenge methodisch-skeptische
Differenzierung in seinen berühmten Reden, die Einheit des Repräsentantenhauses
und den Zusammenhalt der Union über den Streit um die Sklaverei zu stellen; der
Aufhebung der Sklaverei, wenn der Union dienlich, aber auch Priorität zu
verleihen. Dies verdeutlicht, dass es nun vor allem um flexible Überlegungen und
Entscheidungen zu aktuellen politischen Macht- aber auch
wegweisenden Gestaltungsfragen auf der Ebene der Nation ging. Provokationen
zwischen dem Süden und Norden, wie der Entsendung von Kopfjägern nach in den
Norden entflohenen Sklaven, die später auch in schwarzen Bataillonen gegen den
Süden kämpften, machten nach Osterhammel deutlich,
»dass
die normative Einheit der Union, ein emotional gepflegter Mythos der
Gründerzeit, zerbrochen war.«
Und hierin sieht der Autor den eigentlichen Einsatz des Bürgerkriegs: im erst
drohenden, dann schon faktisch vollzogenen Staatsverfall, der auch durch die
Härte des folgenden Kriegs mit seinen wechselnden Ausgängen beglaubigt wurde.
Und in diesem Moment war es aus transatlantischer Perspektive keineswegs
erstaunlich, dass sich der US-Norden nun ausgerechnet dem alten verfeindeten
Mutterland Großbritannien in gewisser Weise annäherte, während der US-Süden mit
den Sklavenhaltern in Brasilien und Cuba sympathisierte. Ob hier ein altes Motiv
für den menschenrechtsfeindlichen Guantanamo-Deal zwischen der Bush-Regierung
und Castro zu suchen ist, der erst durch Obama beendet werden soll? Und so ist
ebenso keineswegs unplausibel, dass nach der
»dramatisch«
zu nennenden offiziell eröffneten Emanzipation aller Schwarzen in den USA nach
Kriegsende doch die Gegenbewegung einer fortwährenden Rassendiskrimierung
spätestens seit 1870, nicht nur in den Südstaaten, um sich griff.
Hier
wie an anderen Stellen wird deutlich: Osterhammels Werk ist kein dogmatischer
Versuch Weltgeschichte allzuständig, personen- und ereignis-, territorial- und
strukturgeschichtlich zu Ende zu schreiben, sondern ein eindrucksvoller
Webstuhl, dessen Texturen und Kategorien mal fester und mal loser geknüpft sind.
Was aber allemal dem eigenständigen Leser nur entgegen kommen kann, weil wir
selbst erstens in einer Geschichte im Fluss leben, selbst dort, wo sie erstarrt
zu sein scheint, und zweitens in einer Geschichte der Kontinuitäten, obwohl
derzeit überall die Medienhysterie den rasanten Dauer-Wandel ausposaunt.
|
Jürgen
Osterhammel
Die Verwandlung der Welt
Eine
Geschichte des 19. Jahrhunderts
Historische Bibliothek der Gerda Henkel Stiftung.
C. H. Beck München 2009
1568 Seiten
Euro
49.90 (D), 51.30 (A)
Leseprobe
Hörprobe
|
 Honoré
de Balzac
Honoré
de Balzac Eine
kleine Materialsammlung
Eine
kleine Materialsammlung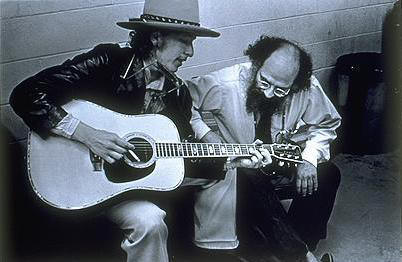
 »Diese mühselige Arbeit an den Zügen des
Menschlichen«
»Diese mühselige Arbeit an den Zügen des
Menschlichen« Edition
Glanz & Elend
Edition
Glanz & Elend Die
Preisträger
Die
Preisträger



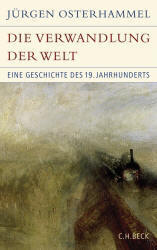 Peter
V. Brinkemper über
Peter
V. Brinkemper über