|
Andere über uns
|
Impressum |
Mediadaten
|
Anzeige |
|||
|
Home Termine Literatur Blutige Ernte Sachbuch Quellen Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Bilderbuch Comics Filme Preisrätsel Das Beste | ||||
|
Bücher & Themen Links Bücher-Charts l Verlage A-Z Medien- & Literatur l Museen im Internet Glanz & Elend empfiehlt: 20 Bücher mit Qualitätsgarantie Weitere Sachgebiete Kunst Ausstellungen, Bild- & Fotobände Tonträger Hörbücher & O-Töne SF & Fantasy Elfen, Orcs & fremde Welten Autoren Porträts, Jahrestage & Nachrufe Verlage Nachrichten, Geschichten & Klatsch Klassiker-Archiv Übersicht Shakespeare Heute, Shakespeare Stücke, Goethes Werther, Goethes Faust I, Eckermann, Schiller, Schopenhauer, Kant, von Knigge, Büchner, Marx, Nietzsche, Kafka, Schnitzler, Kraus, Mühsam, Simmel, Tucholsky, Samuel Beckett Berserker und Verschwender  Honoré
de Balzac Honoré
de BalzacBalzacs Vorrede zur Menschlichen Komödie Die Neuausgabe seiner »schönsten Romane und Erzählungen», über eine ungewöhnliche Erregung seines Verlegers Daniel Keel und die grandiose Balzac-Biographie von Johannes Willms. Leben und Werk Essays und Zeugnisse mit einem Repertorium der wichtigsten Romanfiguren. Hugo von Hofmannsthal über Balzac »... die größte, substantiellste schöpferische Phantasie, die seit Shakespeare da war.» Anzeige  Edition
Glanz & Elend Edition
Glanz & ElendMartin Brandes Herr Wu lacht Chinesische Geschichten und der Unsinn des Reisens Leseprobe Andere Seiten Quality Report Magazin für Produktkultur Elfriede Jelinek Elfriede Jelinek Joe Bauers Flaneursalon Gregor Keuschnig Begleitschreiben Armin Abmeiers Tolle Hefte Curt Linzers Zeitgenössische Malerei Goedart Palms Virtuelle Texbaustelle Reiner Stachs Franz Kafka counterpunch »We've got all the right enemies.» |
Ein Buch, das eine ganze Islamkonferenz ersetzen könnte: Aatish Taseer nimmt seine Leser mit auf eine zeitgemäße »islamische Pilgerreise», auf der er im Wesentlichen das Gebiet der islamischen Expansion im siebten und achten Jahrhundert besucht. Der Titel »Terra islamica« der deutschen Ausgabe vermittelt dies besser als das englische Original: »Stranger to History«. Auch der Untertitel »Auf der Suche nach der Welt meines Vaters« (engl. »A Son’s Journey through Islamic Lands«) ist gut gewählt. Denn Aatish Taseer möchte herausfinden, wie sein nur brieflich bekannter Vater und pakistanischer Politiker sich als Moslem begreifen kann, wiewohl er nach eigenem Bekunden nicht an die Grundsätze des Islam glaubt, Schweinefleisch isst, jeden Abend Scotch trinkt und während eines Gefängnisaufenthalts den Koran las, worauf er sagte, er könne nichts damit anfangen. Zweitwichtigster Grund für die Reise ist Taseers seit den Tagen seiner indischen Kindheit präsente Gefühl, irgendwie ein Moslem zu sein, aber nicht genau zu wissen inwiefern. Mit dem Sikh-Armband seiner Mutter am Handgelenk, entdeckt der Autor schon auf der ersten Hauptstation seiner Reise, in Istanbul, eine für ihn selbst unerwartete Tiefenebene des Moslemseins. Sie ist grundlegender als moslemische Religiosität und Glaubenspraxis und geht in dem in leicht bedrohlicher Situation im kernmoslemischen Viertel Istanbuls über ihn, Aatish Taseer, geäußerten Satz auf: »Er stammt aus Pakistan und ist Moslem.« Zauberformeln wie diese, findet Taseer heraus, funktionieren in allen moslemischen Ländern. Obwohl ohne Glauben aufgewachsen und sichtlich kein religiöser Mensch, wird er als Moslem angesehen und behandelt, solange er sagt, sein Vater sei Moslem. Mit dem Taurus-Express geht es von Istanbul nach Damaskus, Syrien. Schon vor der Reise hatte Taseer erstmals in Manchester von einem halbfanatischen Moslem erfahren, Syrien sei eine Anlaufstelle des internationalen Islam geworden. An der Universität Damaskus stößt er auf ein internationales Volk aus Studenten, darunter einen Norweger, die nach dem 11. September 2001 beschlossen hatten, Arabisch zu lernen. Wir erfahren von der Anwesenheit von mehr als 12000 Studenten aus 55 Ländern an der Universität, von drei neuen Islamschulen und zwei Schariah-Instituten und speziell für Ausländer bestimmten Räumlichkeiten und Übersetzerdiensten. Wie andeutungsweise schon in Istanbul, erfährt Taseer in Syrien, dass und auf welche Weise sich die islamische Welt ihrer Kultur beraubt fühlt, wie »der ganze Schrott der Moderne« (S. 90) abgelehnt und doch genutzt wird. Doch sieht er sofort, dass hier kein spezifisch islamisches Problem vorliegt, sondern eines, das die ganze Welt betrifft – »und daher schien der Koran zur Lösung dieser Probleme wenig beitragen zu können.« (S. 91) Der Reisende in Sachen Vater und Islam bemerkt, dass in der Damaszensischen »Moschee von Abu Nur zwar wichtige Probleme zur Sprache gebracht, dann aber mit dem Gebet erstickt worden waren.« (S. 91) Auf syrischem Boden wird dem Autor immer deutlicher, dass es darum geht, ein Gefühl der Kränkung auszunutzen und zu schüren. Ihm wird fasslich, auf welche Weise sein Vater sich als Moslem versteht, ohne die Glaubensgrundsätze des Islam zu teilen: Bei der großen moslemischen Kränkung dreht es sich eher um den Verlust politischer Macht als um göttliche Gebote. Wer bereit sei, dieses Gefühl der Kränkung zu teilen, könne auch als Ungläubiger Moslem sein. Taseer hält sich in Damaskus auf, als die Kunde von den Mohammed-Karrikaturen eintrifft; er schildert dramatische Ereignisse. Und ihm leuchtet ein, dass das Recht auf Presse- und Meinungsfreiheit außerhalb des Verstehenshorizontes von Menschen liegen muss, die in Staaten leben, in denen Religion und Politik nicht getrennt sind. Von Syrien aus geht es mit dem Auto nach Saudi-Arabien. Neugewonnene Kameraden wollen Taseer zum Beten mit nach Mekka nehmen. Da er nicht genau weiß, wie man das macht, bekommt er eine Schnelleinweisung. Kurz vor Mekka »teilte sich die Autobahn in eine Fahrbahn für ‚Nichtmuslime’, auch unter dem Namen ‚christliche Umgehungsstraße’ bekannt, und eine andere, ‚Nur für Mekka-Muslime’, und die nahmen wir.« (S. 121) Vor seiner Reise glaubte Taseer, nichts über den Islam zu wissen. Bereits in Saudi-Arabien, auf halber Reisestrecke, glaubt er, genug zu wissen. Denn er hat mit eigenen Augen gesehen und mit eigenen Ohren gehört, in welchem Ausmaß religiöse Vorschriften in den besuchten Ländern in alle Poren öffentlichen und privaten Daseins dringen: »Ich wusste mehr über den Islam, aber damit war auch mein Interesse an ihm erloschen. Ich glaubte jetzt nicht mehr, dass ich die Religion und insbesondere ihr heiliges Buch noch besser kennenlernen musste, um ihr Wiedererstarken in der heutigen Zeit erklären zu können.« (S. 130) Warum geht die Reise dennoch weiter? Was treibt den Autor bis nach Pakistan? Hat er nicht bereits in Saudi-Arabien Antworten auf seine Fragen gefunden? Die Art und Weise, wie er den fortbestehenden Reise-Impetus darlegt, überzeugt nicht. Trotzdem ist der Leser froh, dass es weitergeht. Sein Anliegen, so Taseer, sei jetzt, »zu beobachten, wie der Islam über die Sphäre des Glaubens hinaus Menschen und Gesellschaften prägte...« (S. 130) Also begibt er sich nach Teheran, um die dortige aus einer islamischen Revolution hervorgegangene Gesellschaft zu betrachten. Obgleich auf die Abkehr vom Islam die Todesstrafe steht, stößt Taseer in Teheran auf ein religiöses Vakuum und auf ein Bedürfnis nach echter Religiosität. Die Jugend, so führt er aus, »kannte den Islam nur noch als Instrument der Unterdrückung« (S. 170) und leide unter einer »Tyrannei der Belanglosigkeiten«. Mitten in der iranischen Hauptstadt trifft er auf Hare Krishna-Anhänger. Sie erklären ihm, die Perser seien einst Anhänger der Lehre Zarathustras gewesen und folglich von jeher dem Krishnaismus nahestehend. Taseers Aufenthalt in der Subkultur Teherans hat Folgen: Die Geheimpolizeit heftet sich an seine Fersen, er wird verhört, sein Visum nicht verlängert.
Schließlich kommt Taseer
im Land seines Vaters an, dem um der Religion willen gegründeten Pakistan,
dessen Staatsziel mit der Säuberung von Nichtmoslems erreicht schien. Taseer
nennt es »ein Indien nur für Moslems« (S. 256). Er lernt den »Mangokönig«
kennen, einen Feudalherren, der sein Bedauern über das Verschwinden der
indischen Mittelschicht ausdrückt, da dies den wirtschaftlichen Niedergang
Pakistans zur Folge gehabt habe. Taseer lässt seine Leser an überaus
interessanten Überlegungen teilhaben: Zwar liege der Entstehungsgrund des
Staates Pakistan im Willen zur Abgrenzung von Indien. Dennoch sei »das indische
Erbe noch in den feinsten sozialen Verästelungen der pakistanischen Gesellschaft
wirksam...« (S. 285) Zugleich aber sei, was in Indien normal ist, in Pakistan
ein Kuriosum: Außerhalb der Stadt Hyderabad besucht er einen sufistischen
Schrein, an dem Moslems und ein paar verbliebene Hindus gemeinsam beten. Immer
deutlicher wird der Unterschied zu Indien. Während in Indien über einem Nenner
gemeinsamer Kultur unterschiedliche Religionen stehen, ist dies in Pakistan
nicht der Fall. Pakistan hatte seinen Entstehensgrund in der Ablehnung Indiens
als gelebter kultureller Vielfalt. Ȇbrig blieben die fleischlosen Knochen der
Religion.« (S. 313) |
Aatish Taseer |
||
|
|
||||

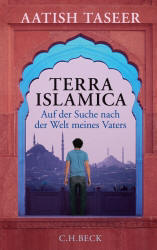 Die
fleischlosen Knochen der Religion
Die
fleischlosen Knochen der Religion