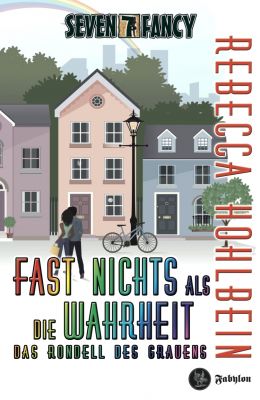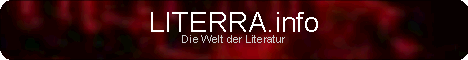
|
|
Startseite > Bücher > Episodenroman > Fabylon > Rebecca Hohlbein > FAST NICHTS ALS DIE WAHRHEIT: DAS RONDELL DES GRAUENS > Leseproben > Leseprobe 3 |
Leseprobe 3
| FAST NICHTS ALS DIE WAHRHEIT: DAS RONDELL DES GRAUENS
Rebecca Hohlbein Fabylon
SEVEN FANCY: Band 6 Sep. 2017, 14.90 EUR |
Über dem Rondell hat sich ein schachbrettartiges Wolkenmuster formatiert, so lückenlos und gleichmäßig, dass es nahezu unnatürlich wirkt. Es bedeckt den Sommerabendhimmel rechter Hand bis zum sichtbaren Horizont. Als ich den Blick nach links wende, sehe ich auch, warum sich die Wolken so eng aneinanderdrängeln, dass kein Senfkorn dazwischen hindurchrutschen könnte: Offensichtlich haben sie Angst.
Sie fürchten sich vor dem gigantischen schwarzen Monster, das aus der anderen Richtung auf sie zurast – eine Unwetterfront, die ich erst im Nachhinein und nur mit viel Fantasie als solche bezeichnen kann.
Was sich uns da nähert, erscheint mir vielmehr wie ein lautstark brüllender, grellweiße und violette Blitze um sich schleudernder Rachegott, wütend und entschlossen, alles, was sich ihm in den Weg stellt, zu zermalmen und zu verschlingen. Wie eine massive Wand aus nachtschwarzem Turmalin erstreckt sie sich nach oben hin bis schier in die Unendlichkeit. Das wenige bisschen Sommerhimmel, das noch unter den Schottenmusterwolken über uns hervorlugt, läuft vor Furcht grün an.
So etwas habe ich noch nie gesehen. Für einen Moment ist sogar Helgas tragisches Schicksal (von dem meine Söhne offenbar noch nichts wissen) vergessen. Der Anblick ist so obskur, so beeindruckend und beängstigend, dass ich sekundenlang nur dastehe, jedes Kind intuitiv an einer Hand gepackt, und mit offenem Mund zu dem Spektakel im Himmel hinaufstarre.
Lila Blitze!
Der Luftdruck fällt so rapide, dass es in meinen Ohren pfeift. Die Schwarze Wand, wie ich das Monster in diesem Moment innerlich taufe und als welche sie mir den Rest meines Lebens in Erinnerung bleiben wird, treibt in ihrer blinden Raserei einen heftigen Wind vor sich her, der mit losen Zweigen, Sand, winzigen Steinchen und auch schon dem einen oder anderen kleineren Blumentopf bewaffnet ist.
Aber das ist nur die Vorhut, soviel steht fest.
„Was ist das, Mum?“, verlangt mein jüngerer Sohn zu wissen.
„Ich weiß es nicht“, antworte ich ehrlich und der Unglaube lässt mich die Worte fast flüstern. „Aber es ist kein normales Gewitter.“
Tatsächlich fühle ich mich in ein Weltuntergangsszenario aus einem Hollywoodfilm versetzt. Ein nicht unerheblicher Teil von mir zweifelt daran, dass es sich bei dem, was sich da am Himmel abspielt, nur um ein seltenes Wetterphänomen handelt. Stattdessen muss ich an überdimensionale Raumschiffe, Supervulkane und ABC-Waffen denken.
Allerdings fehlt mir die Zeit, auch nur eine weitere Sekunde in meinem irrwitzigen Kopfkino zu verharren. Ich mache auf dem Absatz kehrt und scheuche die Kinder dabei ins hoffentlich sichere Innere des Hauses.
„Alle Fenster schließen! Stecker ziehen, Rollos runter!“, kommandiere ich. Als wir all das keine zwei Minuten später hektisch erledigt und zur Sicherheit auch gleich noch alle Zwischentüren geschlossen haben, hat die Schwarze Wand uns schon erreicht.
In derselben Sekunde fällt der Strom aus. Weißes, violettes und hellblaues Licht zuckt im raschen Wechsel durch das Wohnzimmer – positive und negative Blitze, die die Schwarze Wand zu umhüllen scheinen wie eine elektrische Membran.
„Hammer!“, kommentiert mein jüngerer Sohn und tastet sich zur Terrassentür. Obwohl sie ebenso fest verschlossen ist wie alle anderen Fenster und Türen, flattern die Vorhänge im Wind.
Ich reiße ihn im selben Moment von der Glastür weg, in dem Sabines großer, schwerer Sonnenschirm zunächst in Dennis’ Garten und dann in den meiner Eltern am anderen Ende des Reihenhausblockes hüpft, während meine Zündapp, die auf der Terrasse geparkt ist, mit einem Geräusch, das mir selbst über das Tosen des Sturmes hinweg in den Ohren (und vor allem im Herzen) schmerzt, über das Mosaik schlittert und sich im angrenzenden Haselnussstrauch verheddert.
„Hinter die Couch!“, bestimme ich, weil mir selbst der Bereich unter der Treppe nicht mehr sicher genug erscheint. Die Gartentür hat nämlich kein Rollo, sodass jederzeit irgendetwas durch das Glas schmettern könnte. Wir brauchen Deckung, und obwohl meine Kinder aller Aufregung zum Trotz eher fasziniert als ängstlich scheinen, gehorchen sie anstandslos und drängen sich mit mir hinter dem Sofa zusammen.
Im gleichen Moment bin ich plötzlich stolzer Besitzer zweier Bierbänke, die mit voller Wucht vor die Terrassentür brettern, wo sie sich über Kreuz verkeilen, wie mit Absicht zu unserem Schutz dort angebracht. Das hätte verdammt schiefgehen können, denke ich und danke der höheren Macht, die sich meiner in der Not angenommen zu haben scheint, für die provisorische Sicherung der einzigen rollofreien Scheibe im Haus. Gott schützt mich. Danke, Käsekuchenhannes. Wären die Bierbänke nämlich statt in der Waagerechten der Länge nach angeflogen gekommen, hätten sie die Stube wahrscheinlich durchquert, um erst von der Rückwand der Küche gebremst zu werden.
Ziegel poltern vom Dach und zersplittern auf dem Boden. Der Sturm heult in erbarmungswürdigen Frequenzen. Donnerschläge lassen die Wände erzittern, Unmengen von Regen stürzen vom Himmel. Hagelkörner, so groß wie Tischtennisbälle, hämmern auf Blech, Holz und Stein. Der Boden kann so viel Wasser vor und hinter dem Haus nicht fassen und drückt kleine Wellen davon durch die Dichtungen in den Flur und ins Wohnzimmer.
Es ist kein kurzes Intermezzo. Eine gute Viertelstunde lang beobachten wir aus unserer Deckung hinter dem Sofa heraus, wie die Schwarze Wand alles um unser Haus herum buchstäblich kurz und klein schlägt. Selbst die größten und stärksten Bäume werden abgeknickt oder gleich entwurzelt. Die miteinander verkeilten Bierbänke bremsen den Kugelgrill aus, der im hohen Bogen aus Dennis’ Garten herbeigeflogen kommt. Der Spielbereich von Sabines Kindern verteilt sich samt Klettergerüst und Rutsche in Einzelteilen in der direkten und entfernteren Nachbarschaft. Dass meine Hintertür der Gewalt des Sturmes standhält, erscheint mir von Sekunde zu Sekunde weniger sicher.
„Toll. Was machen wir jetzt?“, erkundigt sich mein Ninja nach einer gefühlten Ewigkeit.
Ich reiße mich vom Anblick dessen los, was der Wettermann mir am kommenden Tag sachlich und emotionslos als konvektiven Cluster verkaufen wird und sehe meinen Kleinen neben mir gelangweilt auf seinem Smartphone herumdrücken, während der Große mit meinem Feuerzeug am Docht einer Kerze zündelt, den er immer wieder ausbläst, sobald er ihn entfacht hat. Ich glaube, beide haben zu viele apokalyptische Filme gesehen. Wahrscheinlich finden sie, dass es jetzt langsam Zeit für ein spektakuläres Finale wird. Davon scheint das Drehbuch jedoch noch weit entfernt.
„Schokolade?“, schlage ich deshalb vor.
Die Kinder strahlen.
„Schokolade!“, stimmen sie zu und ich lange an meinem Großen vorbei in die Medikamentenkiste im Regal, die mir bis zu diesem Moment als geheimstes Geheimversteck für meine Süßigkeiten gedient hat. Weil das Ende der Welt anscheinend angebrochen ist, brauche ich es wohl ohnehin nicht mehr. Und ich bin nicht bereit, auch nur einen Krümel meiner guten Pfefferminz- und Luftschokolade zurückzulassen, wenn meine Zeit gekommen ist.
Das Drama dauert eine weitere Viertelstunde an, wenn nicht noch länger, aber selbst ich verzichte darauf, bekümmert über die Sofalehne zu spinzeln, sondern teile meinen allergeheimsten Notfallschokoladenvorrat gerecht mit meinen Kindern. Er ist ziemlich umfangreich. Dennoch bleibt kein einziges Stückchen übrig. Als auch das letzte Verpackungspapierchen zusammengeknüllt und achtlos auf den Boden geworfen ist und unser aller Finger und Mäuler mit klebrigen Süßigkeiten beschmiert sind, sodass wir bei Licht betrachtet vermutlich aussähen wie Dreijährige am Martinsabend, ist die Schwarze Wand endlich vorübergezogen.
Sie hinterlässt viel Wasser und ein Trümmerfeld. Der Preis dafür ist der Strom. Der ist nämlich immer noch weg. Aber das bekümmert mich nicht im Geringsten, denn aller Aufregung und allem Schrecken zum Trotz habe ich gerade eine bedeutende Erfahrung sammeln dürfen: Wenn das Ende der Welt irgendwann tatsächlich hereinbricht, das weiß ich jetzt, sitze ich mit meinen Kindern hinter dem Sofa und esse Schokolade. Ein Gedanke, der mich in eine tiefe innere Ruhe versetzt.
Weitere Leseproben
| Leseprobe 1 |
| Leseprobe 2 |
[Zurück zum Buch]
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info