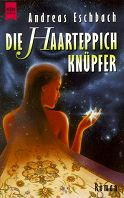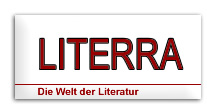
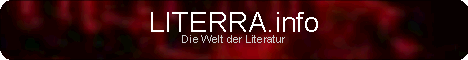
|
|
Startseite > Kolumnen > Dr. Franz Rottensteiner > GRANTELEIEN EINES ALTEN SF-DINOSAURIERS > Europäische Science Fiction und Fantasy im englischen Sprachraum |
Europäische Science Fiction und Fantasy im englischen Sprachraum
Nüchtern betrachtet, hat übersetzte europäische SF in den USA und England keinerlei Stellenwert, und unter normalen kommerziellen Gesichtspunkten würde so gut wie keine SF übersetzt werden, weil es sich nicht rechnet. Bei Phantastik ist das schon etwas anders, siehe etwa Leo Perutz oder Gustav Meyrink, und bei Kinderliteratur ist der Markt viel offener – man vergleiche den Erfolg von Cornelia Funke und Kai Meyer auch in englischer Sprache. Was aber an europäischer SF erschienen ist, ist meist besonderen Bedingungen zu verdanken und hat weder besondere Aufmerksamkeit gefunden, noch war es ein Verkaufserfolg. Michel Jeurys Le temps incertain etwa gilt als großer französischer Klassiker; die Übersetzung (von Maxim Jakubowski) Chronolysis (1980) bei Macmillan fand, soweit ich es beurteilen kann, nicht die geringste Aufmerksamkeit. Man muss auch bedenken, dass es kaum angloamerikanische SF-Herausgeber gibt, die eine Fremdsprache beherrschen, sie müssten sich also auf die Meinung anderer verlassen, was sie angesichts des riesigen Angebots an eigenen Autoren kaum riskieren wollen. Man kann einem englischen oder amerikanischen Verlag daher nur in Ausnahmefällen SF in europäischen Originalsprachen anbieten.
Einige Beispiele für besondere Bedingungen:
Manche SF-Autoren sind auch Herausgeber und verfügen deshalb über besondere Beziehungen zu Autoren und anderen Verlagen, weil sie als Käufer auftreten können. Gérard Klein etwa ist Herausgeber der erfolgreichen französischen Reihe „Ailleurs et demain“ bei Robert Laffont, in der fast ausschließlich die Stars der angloamerikanischen SF erscheinen. So hat John Brunner, damals ein erfolgreicher Autor (und heute weitgehend vergessen) seinen wichtigsten Roman Les seigneurs de la guerre (1971) als The Overlords of War wohl 1973 bei Doubleday durchgesetzt und übersetzt. Der Roman ist aber z.B. nie in England erschienen.
Andreas Eschbach wiederum hat das Erscheinen seiner Haarteppichknüpfer bei Tor Orson Scott Card zu verdanken, der in Frankreich enthusiastische Meinungen zu dem Buch hörte, sich für das Buch einsetzte und auch einen Übersetzer kannte, der das Buch ins Englische übertrug. The Carpet Makers ist mit Gewissheit Eschbachs originellstes Buch, aber ich bin überzeugt davon, dass kein Interesse daran bestehen wird, seine SF-Thriller zu übersetzen. (Auch von den Carpet Makers gibt es keine Ausgabe im United Kingdom, und kein Taschenbuch in mass market).
Natürlich kann man als europäischer Autor auch seine Bücher auf eigene Kosten selbst ins Englische übersetzen lassen (was in der übrigen Literatur kaum je geschieht) oder aber einen Übersetzer finden, der bereit ist, auf eigenes Risiko, ohne Vertrag mit einem Verlag zu übersetzen. Normalerweise kosten Übersetzungen aber so viel, dass sich, angesichts der geringen Verkaufszahlen und der geringen Vorschüsse, die für ausländische SF in den USA erzielbar sind, nicht wirklich lohnt. Es ist eher eine Sache der PR als eine wirtschaftlich zu rechtfertigende Lösung und es ist auch keine Garantie für Erfolg. Michael Görden erzählte mir einmal, dass Wolfgang Hohlbein Das Druidentor ins Englische übersetzen ließ. Der Gedanke dahinter war, dass, wenn SF und Fantasy das große Geschäft ist und amerikanische Verlage locker § 20,000 Vorschuss bezahlen, die Übersetzungskosten mehr als gedeckt sind. Aber niemand wollte den Roman, und wenn auch, wenn das Angebot eigener Autoren in Amerika überwältigend ist. Dabei war das Buch in Deutschland ein höchst erfolgreicher Bestseller, beim Bertelsmann-Buchklub im Quartal seines Erscheinens überhaupt das bestverkaufte Buch. Spielt für Amerika alles keine Rolle. (Auf „normalem“ Wege erschienen nur die Bücher Michael Endes auf Englisch – und Hans Bemmans Stein und Flöte, das sogar mehrere Ausgaben erlebte). Und überhaupt, die hohen Vorschüsse: Es stimmt ja, dass amerikanische Verlage für manche Bücher irrsinnige Vorschüsse zahlen, aber für die Masse der Titel gilt das nicht, und die Kluft zwischen den wirklich erfolgreichen Büchern und all dem Rest dürfte eher noch größer geworden sein. Man hört auch, dass die Autoren von Star Trek oder Star Wars-Bücher gar keine Royalties mehr erhalten sollen, sondern mit einem Pauschalbetrag abgespeist werden. Und es ist so, dass Verlage lieber hunderttausend Dollar für ein Buch ausgeben als 5 x 20,000 Dollar für 5 Bücher – oder gar 10 x zehntausend Dollar für zehn Bücher. Jeschkes Midas z.B. erschien nur als englisches Taschenbuch, aber nie in den USA, The Last Day of Creation erschien sowohl in den USA (St. Martin’s Press) wie in England (Hutchinson) hatte aber keine Taschenbuchausgaben.
Anthologien europäischer SF erschienen nur durch den Einsatz prominenter Herausgeber (Brian W. Aldiss
Donald A. Wollheim gilt als einer der kommerziellsten Herausgeber der amerikanischen SF, der eine Nase für Verkaufserfolge hatte und so ziemlich jeden verkäuflichen Schrott publizierte. Das stimmt nicht ganz, denn er ging durchaus auch Risiken ein, so veröffentlichte er die ersten Bücher von Philip K. Dick (den er auch später immer wieder nachdruckte), Samuel R. Delany und Ursula K. Le Guin. Er war aber auch ein echter Fan, und er veröffentlichte in seinem eigenen Verlag DAW Books immer wieder Übersetzungen europäischer SF; zugegeben, nicht immer die beste und nicht in den besten Übersetzungen, aber bei ihm erschienen Gérard Klein, Philip Barbet, H.W. Frankes Orchideenkäfig und Das Gedankennetz, Egon Friedell’s Reise mit der Zeitmaschine, Bücher von Arkady und Boris Strugatsky und Anthologien übersetzter SF, aber das war wohl eher ein Hobby von ihm, und als seine Tochter Betsy Wollheim den Verlag übernahm, verschwanden diese Bücher sehr bald.
Macmillan hatte eine Zeitlang eine Reihe „Best of Soviet Science Fiction“ (wo auch viele Romane der Strugatzkis erschienen), die allerdings auch keine lange Lebensdauer hatte, immerhin aber war die UdSSR für Amerika interessant, solange die Sowjetunion als gefährliche Bedrohung galt; mit dem Schwinden der Macht Russlands erlahmte auch das Interesse der Verlage an russischen Themen ziemlich.
Ein Spezialfall, und der meistübersetzte und erfolgreichste europäische SF-Autor im englischen Sprachraum war Stanislaw Lem, dessen Publikationsgeschichte ich am besten kenne, weil ich sein Agent für das gesamte westliche Ausland mit Ausnahme des deutschen Sprachraums war. Lem fand vor allem deswegen Aufmerksamkeit, weil seine meisten Bücher von den berühmten Helen und Kurt Wolff Books, einer Abteilung von Harcourt Brace Jovanovich publiziert wurden – in der Gesellschaft von Autoren wie Georges Simenon, Günter Grass, Max Frisch, Italo Calvino, Umberto Eco oder György Konrad. Und weil er in Michael Kandel einen kongenialen Übersetzer hatte. Beides wusste er nicht richtig zu schätzen. Über ein halbes Dutzend seiner Geschichten erschienen als Vorabdruck im prestigeträchtigen New Yorker, und die New York Times war ihm gewogen. Zweimal wurde ihm die Titelseite der New York Times Book Reviewgewidmet, zuerst in einer Sammelrezension von Theodore Solotaroff, der ihn zu einem der „deep spirits of our age“ erklärte, dann für die Rezension von Fiasco. Der Solotaroff-Artikel hat immerhin bewirkt, dass Berkley Books die Taschenbuchlizenz für Solaris auf der Stelle erneuerten und der Roman dann auch ein mittlerer Erfolg wurde. Lem hat in akademischen Kreisen einige Aufmerksamkeit gefunden, vor allem wieder Solaris, aber die SF-Fans haben ihn gehasst, was nicht nur mit seinen Angriffen auf die amerikanische SF, vor allem die Übersetzung eines Artikels in der FAZ durch einen Nachrichtendienst hat böses Blut gemacht und zur Aberkennung seiner Ehrenmitgliedschaft in der SFWA geführt, zusammenhängt, sondern mehr mit der Art, wie er schreibt, welche die amerikanischen Leser so gar nicht anspricht – und die englischen vielleicht noch weniger. Auf dem Taschenbuchmarkt haben solche lobenden Kritiken gar nichts bewirkt, und nachdem Avon Books, die die frühen bei The Seabury Press erschienen Titel als Taschenbuch nachdruckten (und einige der Harcourt-Titel) die Bücher nicht durchsetzen konnten, hat überhaupt kein amerikanischer Taschenbuchverlag mehr ein Angebot gelegt und die Bücher erschienen nur mehr, mit bescheidenem Erfolg, als Trade Paperbacks bei den Harvest Books von Harcourt Brace.
Das übliche Verfahren bei Agenten ist, dass ein Autor einen Agenten im eigenen Land hat, der wiederum Sub-Agenten in anderen Ländern beschäftigt, die den jeweils eigenen Markt besser kennen. Das mag in der Regel funktionieren, aber nicht unbedingt in der SF (wo europäische SF-Autoren für jeden amerikanischen Agenten höchst uninteressant sind, weil mit Abschlüssen kaum zu rechnen ist und die finanziellen Erträge überhaupt nicht ins Gewicht fallen, es sich für den Agenten also gar nicht lohnt, viel zu unternehmen). Ich war kein gewöhnlicher Agent, weil ich außer Stanislaw Lem praktisch keinen Klienten hatte (bis auf gelegentliche Ausnahmen) und auch gar nicht bemüht war, welche zu gewinnen – wie es etwa Thomas Schlück tat, der aus kleinen fannischen Anfängen eine der größten Agenturen im deutschsprachigen Raum aufbaute, die es mit den etablierten Schweizer Agenturen Mohrbooks, Linder AG (Peter und Paul Fritz) und Ruth Liepman aufnehmen kann, eine der bemerkenswertesten Karrieren im Verlagsgeschäft. Ich wurde überhaupt nur aus Interesse an Lems Werk sein Agent, und habe mich verabschiedet, als der Autor merkwürdige Gewohnheiten an den Tag legte.
Als Agent habe ich Lem Jahrzehnte mit einer Discount-Provision subventioniert, weil ich nämlich nur 10% berechnet habe (und auch keine Nebenkosten wie Photokopien), und habe erst 20% (weil ich ja nur im Ausland tätig war) berechnet, als er Allüren entwickelte, was er zähneknirschend akzeptierte, was aber an ihm nagte und womit er sich nie abfinden wollte. Irgendwie hat er sich eingebildet, dass das der übliche Satz sei, und alles, was darüber hinausgeht, unstatthaft. Schlück soll ihn darin bestätigt haben, was ich für unmöglich halte, und was Wolfgang Jeschke höchst erstaunen würde. Thomas Schlück nimmt zwar nur zehn Prozent, aber er arbeitet auf dem Gebiet der SF in den USA mit Virginia Kidd zusammen, und die nimmt 15%, was schon 25% ergibt. Ich habe nur, wenn wirklich lokale Agenten eingeschaltet waren, diese Kosten weiterverrechnet, aber selbst in Japan habe ich rund ein Dutzend Verträge ohne japanischen Agenten direkt geschlossen.
Dazu kommt noch, dass Verlage (und Agenten) vor allem an neuen Büchern, die erst geschrieben werden, interessiert sind. Dafür lassen sich hohe Vorschüsse erzielen – nicht aber mit Büchern, die schon vorher erschienen sind. James Gunn z.B. hat immer wieder geklagt, dass seine neuen Agenten überhaupt kein Interesse hatten, alte Verträge aufzukündigen und für diese Titel neue Verlage zu finden. Ein Autor wie Lem, der wenig Neues schrieb, hatte aber nur eine, oft Jahrzehnte alte Backlist, zumal viele der älteren Bücher besser sind als die neueren.
Natürlich hat auch Lem sich von einem amerikanischen Agenten viel Geld erwartet, und das er wohl auch für den amerikanischen Solaris-Film (und eventuelle Filmoptionen erhalten), aber seit meiner Zeit hat es keine weiteren amerikanischen Übersetzungen mehr gegeben, auch, weil sich Lem mit Harcourt Brace überwarf und ihnen eine Reihe zunehmend beleidigender Briefe schrieb. Sein neuer Agent war ja auch ein Filmagent (der damalige von Jonathan Carroll) mit vermutlich wenig Interesse am Kleingeld des Buchgeschäfts. Lem war es gewohnt, dass man ihm nachgab, er hatte keinen Stil, und wenn er „verhandelte“ begann er meist mit einem Wutanfall, was man ihm angetan hätte, und beruhigte sich erst allmählich. Er hatte, glaube ich, auch nie das Gefühl, dass man Dienste für ihn leistete, sondern fühlte sich als Lehensherr, der anderen die Gnade erwies, sich von ihnen vertreten zu lassen, wobei es weniger auf Erfolg oder Misserfolg ankam, als seinen Launen zu entsprechen.
Ich hatte mit HBJ noch einen Vertrag für eine Kurzgeschichtensammlung geschlossen, von dem der zweite Honorarvorschuss bei Erscheinen fällig war. Die Publikation verzögerte sich, weil es keinen Übersetzer für das Buch gab, und Lem empfahl dann eine (inkompetente, aber dafür aggressive Übersetzerin, die er gar nicht gekannt haben kann). Der Verlag hatte Bedenken, ob er diese Geschichten, die er für altmodisch hielt, überhaupt veröffentlichen sollte, aber er hätte es sicher getan, doch wollte Lem unbedingt die Rechte zurückhaben (und den bereits bezahlten Vorschuss behalten, was er schließlich auch erreichte). Ich nehme an, dass er sich vorstellte, das Buch würde dann für mehr Geld bei einem anderen Verlag erscheinen und er würde doppelt kassieren. Nur gab es eben keinen solchen Verlag und der Agent „an Ort und Stelle“ nützte ihm in dem Fall gar nichts. Vielleicht auch wollte er auch nur, dass ich um den Rest meiner Provision umfiel, denn er war ein Mensch, der es sich, auch wenn er das Geld liebte, etwas kosten ließ, wenn er nur einen anderen schädigen konnte. Er war dann auch sehr empört, als ich ihm die Provision trotzdem in Rechnung stellte, weil ich der Meinung war, dass es sein eigenes Verschulden war, dass das Buch erschien, klagte aber deswegen, trotz dieser Drohung nicht, sondern klagte vielmehr verschiedene Dummheiten ein.
Warum ich mit Lem nichts mehr zu tun haben wollte, hing auch mit Harcourt zusammen. Ich hatte, nachdem ich die Rechte an fünf alten Büchern zurückgeholt hatte, nach vielen Mühen einen neuen Vertrag für Harvest-Taschenbücher mit Harcourt ausgehandelt. Ich hatte dafür einen bestimmten Betrag gefordert, der Verlag machte ein geringeres Gegenangebot, das Lem annahm. Nachdem er zuvor schon bei einem anderen Reprint so vorgegangen war, dass er zuerst ein Angebot annahm, dann aber, als der Vertrag kam, es für unzureichend erklärte und sich zu unterschreiben weigerte (was den Verlag erstaunte und mir peinlich war), bestand ich darauf, dass er mir die Annahme des Angebots ausdrücklich schriftlich bestätigte (denn Lem liebte es, sich sehr gewunden und zweideutig auszudrücken). Das erwies sich als sehr voraussehend, als mich Lem schließlich klagte und behauptete, das Angebot sei „unannehmbar“ gewesen, konnte ich bei der Schlussverhandlung diesen Brief als Trumpf vorlegen. Lem hatte dankenswerterweise in demselben Brief auch seine sehr individuellen Ansichten zum Steuerzahlen dargelegt, und als die Richterin beim Lesen soweit war, fing sie zu lachen an, und da wusste ich, dass der Prozess gewonnen war.
Jedenfalls weigerte sich Lem schließlich, diesen Vertrag zu unterzeichnen, behauptete, in ihm würden Filmrechte vergeben (was Unsinn war, denn der Verlag war analog von etwa einem Dutzend früherer, in denen nie Filmrechte vergeben wurden), er habe jetzt einen amerikanischen Agenten und überhaupt, er wünsche sich einen „dynamischeren Verlag“. Er erklärte sich zwar bereit, mir meine Provision aus dem nicht-unterzeichneten Vertrag zu bezahlen (er hat also ohne guten Grund zwei Provisionen bezahlt, mir und seinem neuen Agenten), aber den von mir ausgehandelten Vertrag wollte er nicht unterzeichnen. Er wollte zwar ausdrücklich einen anderen amerikanischen Agenten, (zu „meiner Entlastung“) aber überall sonst sollte ich ihn weiterhin vertreten.
Nachdem er mir erklärt hatte, er wünsche sich einen „dynamischeren“ Verlag, schrieb er sofort an Harcourt, dass die von „mir begonnenen“ Verhandlungen mit seinem neuen Agenten weitergehen sollen. Nach allem, was ich für ihn getan hatte, war ich nicht gewillt, solch ein Verhalten hinzunehmen: schließlich machte er jemandem, den er überhaupt nicht kannte, von meiner Arbeit ein Geschenk, auch wenn mir kein finanzieller Nachteil daraus erwuchs. Der schließlich unterzeichnete Vertrag sah übrigens genau jenes Garantiehonorar vor, das ich ursprünglich gefordert hatte, wovon Lem aber kaum einen Vorteil hatte, da er ja nunmehr zwei Provisionen zahlte, und da sich die Bücher schlecht verkauften, ist es sehr zweifelhaft, ob er je zusätzliche Honorare aus diesem Vertrag erhielt. Damit endete auch Lems Karriere als Autor in den USA, denn der Solaris-Film von Soderbergh war ein totaler Flop, der für die Bücher gar nichts bewirkte und nur die in amerikanischen Verlagskreisen bestehende Meinung verfestigte, dass Lem ein Autor sei, der sich nicht verkaufe (schließlich wissen die großen amerikanischen Verlage ja Bescheid, was die anderen machen).
Dann hat mich Lem noch, in ziemlich quixottischer Weise, mit einem Streitwert von DM 100,000 verklagt, welchen Prozess er mit Bomben und Granaten nach fast fünf Jahren verlor.
Ich bin überzeugt, dass er mir zuerst unverschämte Forderungen durch seinen Anwalt schreiben ließ und dann so exorbitant hoch klagte, weil er glaubte, ich würde mich vor ihm fürchten (schließlich kannte ich ihn genau), mir einen Prozess nicht leisten können und klein beigeben. Das war allerdings eine doppelte Fehlkalkulation. Er hat dann noch Harcourt angewiesen, alle Abrechnungen und Zahlungen nur an ihn zu leisten, und die mir zustehenden Provisionen in die eigene Tasche gesteckt, in der richtigen Überzeugung, dass ich ihn wegen dieser winzigen Beträge angesichts des nicht sehr entwickelten polnischen Gerichteswesens kaum verklagen würde, und seine Erben halten es genau so. Diese Summen seien ihnen vergönnt und ich habe sie unter Lem’scher Vertragstreue und Dankbarkeit verbucht.
Zuweilen glauben Polen, dass Lem in den USA ein „Bestseller“-Autor gewesen sei, was nur ihre Unkenntnis des Verlagswesens dokumentiert; denn bei 2-3000 verkauften Exemplaren bei Hardcovern (und in England weniger als 1000) und unwesentlich mehr Taschenbüchern, war er ein unrentabler Autor, und Harcourts Lektorin wurde immer wieder von anderen Verlegern gefragt (und ich habe keinen Grund, ihr das nicht zu glauben), warum man so viele Bücher von ihm verlege (immerhin an die 20). Ein „dynamischerer“ (d.h. weniger literarischer Verlag als Harcourt) hätte ihn, wenn er ihn überhaupt verlegt hätte, schon längst verramscht und nicht Bücher lieferbar gehalten (was in den USA absolut unüblich ist), von denen sich im Halbjahr oft weniger als 50 Stück verkaufen.
GRANTELEIEN EINES ALTEN SF-DINOSAURIERS
Beitrag Europäische Science Fiction und Fantasy im englischen Sprachraum von Dr. Franz Rottensteiner
vom 03. Mar. 2009
Weitere Beiträge
|
|
Europäische Science Fiction und Fantasy im englischen Sprachraum
Dr. Franz Rottensteiner |
|
|
Die süße Idiotie des Fandoms
Dr. Franz Rottensteiner |
|
|
Erlebnisse mit Stanislaw Lem
Dr. Franz Rottensteiner |
|
|
Ein alter SF-Dinosaurier stellt sich vor
Dr. Franz Rottensteiner |
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info