Wie eine Heimsuchung kommt Selim daher. Ständig arbeitet er seine Texte um. Zunächst ein Theaterstück, dann ein Roman basierend auf diesem Theaterstück. Schließlich sogar Gedichte. Immer nur einen kurzen Blieck werfen, bitteschön. Wenn er Schleichwege nimmt, ruft ihn Selim an, schickt ihm Mails. Der Schriftsteller ist nicht mehr in der Lage, an seine eigenen Romane zu denken. Das Niveau verfällt dadurch anscheinend; Texte, die er seinem Verlag schickt, werden vollkommen ungewohnt mit neuen Vokabeln wie »gleichwohl« oder »indes« versehen.
Selims Aktivitäten sind enorm. Er schickt seine Briefe an Bühnen, Regisseure, Theaterzeitschriften, Baletttänzer, Universitätsprofessoren oder Bibliothekare. Er schickte wahllos und massenhaft. Er schickte an alle Autoren, die ihm in den Sinn kamen, an unbekannte Autoren und an bekannte Autoren, an Büchnerpreisträger und Nobelpreisträger…Er schickte an verstorbene Autoren und an noch lebende Autoren. Und nie ohne die neueste Fassung seines immer weiter bearbeiteten Lebenslaufs, in dem er noch mehr Tätigkeiten und noch mehr Lebensstationen aufführt.
Es sind scheinbar Jahre, die so ins Land gehen. Des Erzählers Stimmung schwankt zwischen Zorn, Taktgefühl, Sprachlosigkeit, Resignation und Bosheit. Bis Selim ihm eine Geschichte von Kamelen auf einem ägyptischen Flughafen erzählt, die sich nicht vertreiben ließen und an den Tragflächen der Flugzeuge knabberten. Der Schriftsteller ermuntert ihn, diese Geschichte aufzuschreiben, aber es kommt das übliche ausgewalzte, jeder Grammatik und Orthografie sich verweigernde Konvolut heraus. Aber irgendwie muss es Selim gelungen sein, die Geschichte in eine halbwegs lesbare Form zu bringen, denn plötzlich kommt er mit der Nachricht, ein Verlag habe ihm geantwortet und Mehr davon fast gefordert.
Und es ist nicht irgendein Verlag – sondern der Verlag, sozusagen der Verlag der Verlage und es gelingt Selim sieben Geschichten zu schreiben (plus zwei zur Reserve) und der Verlag ist begeistert und der Schriftsteller verdutzt, überrumpelt, kann es nicht glauben: Da ist ein Mensch, der eigentlich gar nicht schreiben kann, der nur einen skurrilen, aufgeblähten und halb geschwindelten Lebenslauf zu bieten hat – und er bekommt ein Angebot, dass er, der Schriftsteller, der gerade erfahren hat, dass seine Bücher nicht mehr lieferbar sind und nicht mehr nachgedruckt werden, ein solches Angebot noch nie erhalten hat. Selim weiss gar nicht, wie ihm geschieht. Er kennt den Verlag und dessen Reputation gar nicht. Er weiss nichts von Vorschüssen, Honoraren, Vermarktungen. Der Schriftsteller weiss davon, aber nur vom Hörensagen, während Selim dies nun alles erlebt. Das Ende soll nicht verraten werden; es ist mehrschichtig und durchaus pfiffig. Als Epilog ist noch ein kurzer Text von Joachim Zelter aus 2011 abgedruckt, der auf sachliche Weise die Zustände zusammenfasst.
Diese »Literaturnovelle« ist in vielen Punkten aus der Art gefallen: Zum einen werden nicht im üblichem Jammerton die Verhältnisse des sogenannten »Betriebs« beklagt (ich glaube, dieses Wort fällt nicht einmal). Zum anderen beschäftigt sich Zelter nicht mit wohlfeilem Großautoren- oder – wahlweise – Literaturkritikerbashing. Stattdessen analysiert er den immer stärker um sich greifenden »Autorismus« der Branche, der sich in den 90er Jahren kurzzeitig im sogenannten »Fräuleinwunder« zeigte und jetzt immer mehr in Richtung Exotismus driftet, und wenn es um die Schlagkraft von Wohnorten geht, wie etwa Hiroshima (dabei übersieht er, dass es tatsächlich Menschen gibt, die dort wohnen und arbeiten, und zwar ohne jegliches Posieren).
Bis ungefähr zur Hälfte kommt dieses Buch mit der stillen, aber zupackenden Komik daher, die Zelter so virtuos beherrscht. Als dann jedoch der Sprachdilettant Selim als Schriftsteller reüssiert, bleibt nicht nur dem Ich-Erzähler der Witz im Hals stecken. So sympathisch dieser drollige Mensch mit seiner Braut auch daherkommt, so satirisch wird diese Marktmaschine, die sich nun um den usbekischen Ägypter (oder ägyptischen Usbeken) zusammenbraut, geschildert. Aber es ist nicht nur Satire – es ist auch eine gehörige Portion Zorn. Von Verbitterung zu sprechen, wäre zu viel. Aber dass das jemandem die Richtung nicht passt, ist eindeutig.
Curricularismus oder Curricularer Vitalismus nennt Zelter das neue Zeitalter, die neue literarische Epoche nach Romantik, Naturalismus, Expressionismus und (Neo-)Realismus. Eine geniale Formulierung und schlüssige Widerlegung für die These vom »Tod des Autors«. Nicht der Autor sei tot, sondern der literarische Text. Es gelte nur noch der (möglichst »authentisch« daherkommende) Lebenslauf des Autors als Dokument globalen Lebens. Die Literatur sei nur noch Abglanz. Es ist schon mehr als interessant, wenn ein stilistisch antipodischer Schriftsteller wie Botho Strauß in seinem neuesten aphoristischen Kulturklagebuch »Lichter des Toren« zu einer ähnlichen Diagnose kommt: »Inzwischen zählt der Dichter nur noch als veranstalteter. Sein Werk findet bei Gelegenheit statt.«
Weiter passend hatte unlängst der Verleger Jochen Jung in einem Beitrag für die Neue Zürcher Zeitung beklagt, dass die natürliche Aura eines Autors immer mehr der Gemachtheit, der Darstellung, weiche. Der Autor werde zum »Autorendarsteller«, so Jung. Zum einen fast zwangsläufig, zum anderen jedoch wohl auch durch Werbe- und Marketingmaßnahmen von Verlagen. Jung erweitert die Kritik an diesen Zuständen, in dem er das durch ökonomische Zwänge teilweise erzwungene Tingeln des Schriftstellers durch die Medien aufgreift. Sie werden mit etwas Glück (und Beziehungen) prominent und »Prominente machen sich ja auch Gedanken, über die Politik oder das Internet, die Rolle des Mannes in der Küche, den Klimawandel, Migranten und so weiter, und was Prominente so im Kopf haben, will die Welt wissen, sie ist so.«
Einer der Vorzüge dieses Buches ist es, dass hier kein schweres, kulturkritisches Geschütz aufgefahren wird. Es ist eine leise Elegie, die den Leser nach zwei Lektürestunden in leicht melancholischer Stimmung zurücklässt. Am Ende dann noch der Pressetext: Da steht dann die Kurzbiographie des Autors und seine bisherigen Werke nebst (berechtigter) Lobe. Der Verlag, der seine Bücher anonym, d. h. ohne Angabe des Autors, publiziert, muss noch gegründet werden. Aber wohin soll dann der Autor mit seiner Eitelkeit?
Die kursiv gesetzten Passagen sind Zitate aus dem besprochenen Buch.
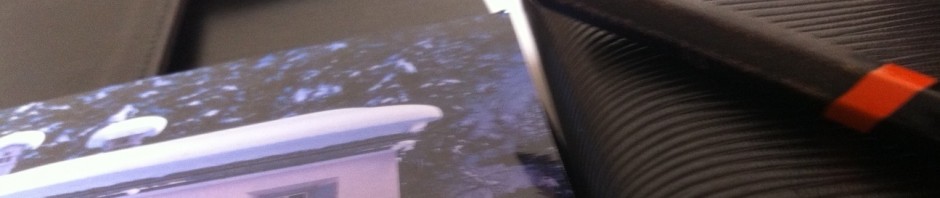
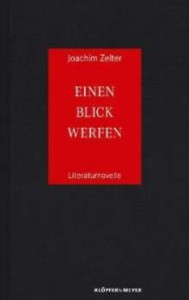


















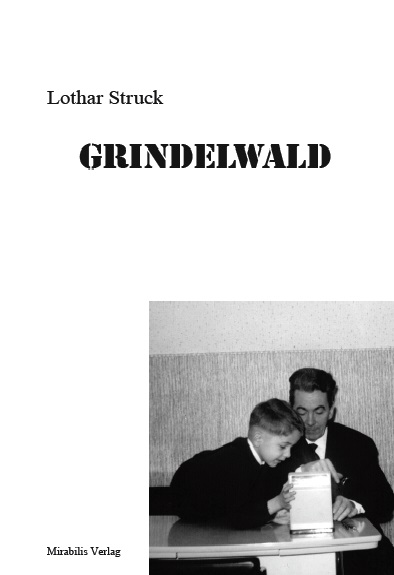
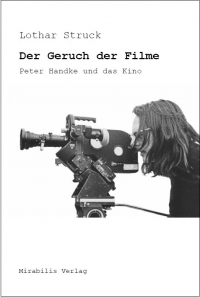
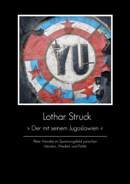
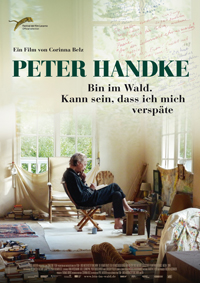
Die Novelle ist ja groß im Kommen, das Ereignis, welches sie transportiert, muss aber auch erstaunen. In diesem Fall (ohne Lektüre) würde ich erwarten:
Oh, der Andere, der Legastheniker ist ein großer Autor, und er hat (das darf ja wohl nicht wahr sein!) ein Buch platziert, obwohl er so ein schräger Vogel ist, und kein spießbürgerliches Kriterium erfüllt. Er passt nicht mal in das Schema des poete maudit, er ist ein Trottel ohne Bewusstsein seiner selbst, aber mit Talent.
Das wäre nicht schlecht gewesen, und durchgehalten satirisch.
Aus Keuschnigs Beschreibung lese ich noch eine ganz andere Aktualität: die Schriftsteller schauen sich viel genauer als früher gegenseitig auf die Finger. Sie sind rivalisierende Experten, und diese Rivalität ist nicht marktbedingt. Es ist für mich eine offene Frage, inwieweit noch von einem generellen Expertentum in Sachen Literatur gesprochen werden kann.
Oder konkret: WEN würden Sie als Experten für Weltliteratur, d.h. für die Literatur aller Kulturen nennen?! Wo kein Name, da kein Auftrag…
#1
Berechtigter Einwand. Mich hat auch die Rubrizierung als Novelle ein bisschen verwundert. Man kann es so lesen: Die »unerhörte Begebenheit« ist der Erfolg des vermeintlichen Trottels.
#2