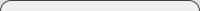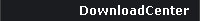BR.de Homepage


Get the Flash Player to see this player.
Sie suchen eine ganz bestimmte Podcastfolge ...? Drû¥cken Sie "F3" und geben Sie Sendungstitel oder Stichwort ein. Das Ergebnis erscheint farbig markiert unten auf der Seite.
Jede Zeit ist HûÑrspielzeit. Der HûÑrspiel Pool bietet Produktionen des Bayerischen Rundfunks zum Herunterladen.
Podcast abonnieren:
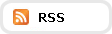 Podcast abonnieren: hier klicken! Im neuen Fenster den Text in der Adresszeile (http://...) markieren, kopieren und danach in Ihren Podcatcher einfû¥gen.
Podcast abonnieren: hier klicken! Im neuen Fenster den Text in der Adresszeile (http://...) markieren, kopieren und danach in Ihren Podcatcher einfû¥gen.
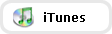 Sie benutzen iTunes? Dann hier klicken! iTunes startet und ûÑffnet die Seite dieses Podcasts. Dann einfach auf "ABONNIEREN" klicken.
Sie benutzen iTunes? Dann hier klicken! iTunes startet und ûÑffnet die Seite dieses Podcasts. Dann einfach auf "ABONNIEREN" klicken.
 Anleitung: So kûÑnnen Sie Podcasts abspielen, herunterladen und abonnieren.
Anleitung: So kûÑnnen Sie Podcasts abspielen, herunterladen und abonnieren.
| Valû´re Novarina: Dem unbekannten Gott - 07.01.2017 | ||
|
Aus dem FranzûÑsischen von Leopold von Verschuer / Mit Eva Brunner, Leopold von Verschuer, Tony de Mayer, Manuel RûÑsler / Realisation: Leopold von Verschuer / BR 2011 / LûÊnge: 79.23 // La Chair de l'homme / Das Fleisch des Menschen, 2005 erschienen, ist mit 525 Seiten das bislang umfangreichste dramatische Werk von Valû´re Novarina. Kapitel XXV - Au dieu inconnu / "Dem unbekannten Gott" besteht aus einer AufzûÊhlung von dreihundertundelf Gottesdefinitionen. Ein nicht endender Versuch, das Unaussprechliche in Worte zu fassen, der an die Grenzen des Denk- und Formulierbaren fû¥hrt und ein schillerndes Kaleidoskop freilegt. Die zitierten Autoren reichen von der Antike û¥ber die KirchenvûÊter und Mystiker aller Religionen zur Moderne, von erklûÊrten Agnostikern zu bekannten wie unbekannten Zeitgenossen. In Zeiten der Neubesinnung auf ReligiositûÊt weist dieser Text weit hinaus û¥ber jede ideologische Engfû¥hrung. Er stellt ein Abenteuer menschlichen Denkens und der Sprache dar. Aufgewachsen am Genfer See und in den Bergen, schreibt Novarina tûÊglich seit 1958, verûÑffentlicht seit 1978 und wurde zu einer absolut singulûÊren Stimme der Literatur und des Theaters in Frankreich. Sein Schreiben steht in seiner Unbedingtheit dem der Autoren der Art brut, Artaud und Jarry nûÊher als jeder narrativen Konvention. Zirkus, Jahrmarkttheater, Mysterienspiel, Pinocchio und Louis de Funû´s, aber auch das japanische N?-Theater sind Referenzen, die er sich in seinen û¥berschûÊumenden Sprachkunstwerken anverwandelt. Neologismen, verdrehte Grammatik, seitenlange AufzûÊhlungen von Namen oder Ereignissen, Stehgreif- oder Kinderverse, Nachrichten im Stile von TagesaktualitûÊten oder Schlachtenberichten, berufsspezifische Wendungen, Zitate quer durch die Geistesgeschichte, Politparolen, Werbesprû¥che ã der gesamte Fundus der Sprache ist Gegenstand seines Schreibens, das die VitalitûÊt des Sprechens jenseits bloûen Informationstransfers mobilisiert und ein Begreifen in anderen Tiefenschichten provoziert: ontologisches, welthaltiges Worttheater und vielstimmiger Roman thûˋûÂtral. Fû¥r die ûbersetzung von Dem unbekannten Gott recherchierte Leopold von Verschuer jede einzelne Originalquelle der Zitate und holt dafû¥r so viele Stimmen wie zitierte Autoren vors Mikrofon. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 07.01.2017
Datum: 07.01.2017Länge: 01:19:47 Größe: 73.06 MB |
||
| Michael Farin: Mir geht nichts û¥ber mich! Oder: Wie sich Max Stirner die Welt dachte - 30.12.2016 | ||
|
Mit Nadeshda Brennicke, Marijam Agischewa, Gert Heidenreich, Jens Harzer, Wolfgang Hess / Komposition: zeitblom / Regie: Michael Farin / BR 2006 / LûÊnge: 55'50 // Eine Kampfansage, eine Attacke war es, was Johann Caspar Schmidt im Jahre 1844 unter dem ominûÑsen Autornamen Max Stirner und mit dem kryptischen Titel "Der Einzige und sein Eigentum" verûÑffentlichte. ãWas soll nicht alles Meine Sache sein! Vor allem die gute Sache, dann die Sache Gottes, die Sache der Menschheit, der Wahrheit, der Freiheit, der HumanitûÊt, der Gerechtigkeit; ferner die Sache Meines Volkes, Meines Fû¥rsten, Meines Vaterlandes; endlich gar die Sache des Geistes und tausend andere Sachen. Nur Meine Sache soll niemals Meine Sache sein.ã Wohl niemals zuvor hatte ein Philosoph ãseine Sacheã mit einer solchen Ausschlieûlichkeit auf sich selbst zu stellen gewagt: ãJedes hûÑhere Wesen û¥ber Mir, sei es Gott, sei es der Mensch, schwûÊcht das Gefû¥hl meiner Einzigkeit und erbleicht erst vor der Sonne dieses Bewuûtseins.ã Die Reaktion folgte auf dem Fuûe. Max Stirner erntete HûÊme, Hohn, Spott. ãHeiland der Einzigkeitã nannte man ihn, oder kurzerhand, wie Karl Marx und Friedrich Engels, ãSankt Maxã. Immerhin widmeten die beiden UrvûÊter des Kommunismus dem Urvater des individualistischen Anarchismus û¥ber 300 Seiten ihres Werkes Die deutsche Ideologie. Darin exemplifizierten sie ihre These, dass den Menschen ãdie Ausgeburten ihrer KûÑpfe û¥ber den Kopf gewachsen seien.ã Max Stirner scheint die schlimmsten EinschûÊtzungen zu rechtfertigen, denn er hebelt mit seinem Hauptwerk nicht nur altgewohnte Denkstrukturen aus, er stellt auch jede gesellschaftliche, jede moralische Kategorie in Frage: Ich ãbin durch Mich berechtigt zu morden, wenn Ich Mirãs selbst nicht verbiete.ã Ein Zernichter der Welt also? Albert Camus jedenfalls beschreibt ihn als einen ãnihilistischen Rebellenã im Rausch der ZerstûÑrung: ãSo kû¥ndet auf den Ruinen der Welt das trostlose Lachen des kûÑniglichen Individuums den letzten Sieg des Geistes der Revolte.ã Stirner lûÊsst sich aber ebensogut auch, wie in diesem HûÑrspiel, als Gastgeber eines Fests der Begriffe begreifen, als ein Jongleur der Bedeutungen, ein gewiefter Experte des Lebens, als einer, der mit seinem DûÊmon dãaccord ist. Dank der Musik von Zeitblom verschmelzen seine SûÊtze dann mit denen von Hegel, Marx/Engels und Panizza zu einem Blues mit wechselnden Mustern und Schatten, perkussiven SchrûÊgheiten, Gitarrenriffs, elektronischem Flirren, tiefen Dub-BûÊssen, wechselnden Tempi und Tonarten, zu einer seltsamen undurchdringlichen Mixtur ã zu einem Wort/Welt-Gewitter. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 30.12.2016
Datum: 30.12.2016Länge: 00:56:15 Größe: 51.51 MB |
||
| Andreas Ammer: Eigentum am Lebenslauf. Das Gesamte im Werk des Alexander Kluge - 23.12.2016 | ||
|
Mit Alexander Kluge, Andreas Ammer / Komposition: Console/Martin Gretschmann / Realisation: Andreas Ammer / BR 2007 / LûÊnge: 53'59 // Alexander Kluge hat in seinem Leben viel erzûÊhlt. LebenslûÊufe hieûen die Geschichten, mit denen der spûÊtere Filmemacher und Fernsehgestalter Anfang der 60er Jahre erstmals als Schriftsteller ûÑffentlich auftrat. Sie seien "teils erfunden, teils nicht erfunden. Zusammen ergeben sie eine traurige Geschichte." Als am Ende des Jahrtausends dann Kluge sein ãsummum opusã, die vieltausendseitige Chronik der Gefû¥hle vorlegte, trug deren zweite HûÊlfte immer noch den gleichen lakonischen Titel: LebenslûÊufe. Die Geschichten ergaben die traurige Geschichte des 20. Jahrhunderts (beginnend mit dem Urknall). Viel mehr jedoch hat Alexander Kluge in seinem Leben erzûÊhlen lassen: In seinen TV-Magazinen ist er der geduldige ZuhûÑrer, ein elektronischer Sokrates, der jeden seiner GûÊste bis an die Grenze des ErtrûÊglichen davon erzûÊhlen lûÊsst, was ihr Leben und die gesamte Welt im Innersten zusammenhûÊlt. ErzûÊhlen / lassen. Fû¥r Eigentum am Lebenslauf hat Andreas Ammer diese beiden Facetten des Alexander Kluge dialektisch zusammengefû¥gt und daraus ein HûÑrspiel produziert. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 23.12.2016
Datum: 23.12.2016Länge: 00:54:23 Größe: 49.80 MB |
||
| Roland Reuû/Julian Doepp: Kafkas "Process" als Handschrift - 19.12.2016 | ||
|
Roland Reuû (Herausgeber der historisch-kritischen Franz-Kafka-Ausgabe) im GesprûÊch mit Julian Doepp / BR 2010 // "Ich schreibe seit ein paar Tagen ... mein regelmûÊûiges, leeres, irrsinniges, junggesellenmûÊûiges Leben hat eine Rechtfertigung", notiert Franz Kafka im August 1914 in sein Tagebuch. Nicht lange danach erwûÊhnt er zum ersten Mal den "Process". Der Akt des Schreibens an dem Romanfragment dokumentiert sich in der historisch-kritischen Edition. Denn die Faksimiles und Transkriptionen von Kafkas Handschrift zeigen keinen linearen, abgeschlossenen Text, sondern offenbaren den "Process" als work in progress. In einem ausfû¥hrlichen GesprûÊch mit Roland Reuû, der die Edition unter Mitarbeit von Peter Staengle herausgegeben hat, wird deutlich, welche Entscheidungen fû¥r das editorische Vorgehen ausschlaggebend waren - angesichts einer Textû¥berlieferung, aus der sich viele Fragen ergeben: Wie erkennt man ein unvollendetes Kapitel? Warum hat Kafka versucht, Anfang und Ende des Romans gleichzeitig zu verfassen? VerûÊndert sich der Stil eines Autors, wenn er sich beim Schreiben dem unteren Seitenrand nûÊhert? Und ist es Zufall, dass die Initialen der Romanfigur Frau Bû¥rstner mit denen von Kafkas Ex-Verlobter Felice Bauer identisch sind? Die Versuchung, eindeutige Antworten auf diese und ûÊhnliche Fragen zu konstruieren, ist groû. Gerade die Wissenslû¥cken aber, so zeigt die Edition von Reuû und Staengl, fû¥hren in das Abenteuer, sich auf die Auseinandersetzung mit der Handschrift einzulassen, auf durchgestrichene SûÊtze, nicht nummerierte Kapitel und das Schwanken des Autors. Das Fû¥r und Wider von Leseausgaben kommt hier ebenso zur Sprache wie die Umsetzung des Editionskonzepts in eine HûÑrspielfassung. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 19.12.2016
Datum: 19.12.2016Länge: 00:57:48 Größe: 52.93 MB |
||
| Klaus Wagenbach/Julian Doepp: Leben mit Kafka - 19.12.2016 | ||
| Klaus Wagenbach (Verleger) im GesprûÊch mit Julian Doepp / BR 2010 // Der Legende nach geschah es im Sommer 1950, dass Klaus Wagenbach den ersten Satz von Franz Kafkas "Process" las. Als Lehrling im S.-Fischer-Verlag sollte er den Umfang eines schlecht gedruckten, braunen Buches schûÊtzen, das der Verlag neu herausbringen wollte. Das ZeilenzûÊhlen fû¥hrte zu einer Lektû¥re, die sein Leben verûÊnderte. Von der Dissertation, die 1958 erschien und die Jugend des Schriftstellers dokumentiert, û¥ber eine Begegnung mit Max Brod und ausgedehnte Forschungsreisen bis zur weltweit grûÑûten Sammlung von Kafka-PortrûÊts, die er in einem KûÊstchen aufbewahrt. Anders als viele Forscher hat Klaus Wagenbach von Anfang an die materiellen LebensumstûÊnde des Dichters in Augenschein genommen: GegenstûÊnde und Fotografien ebenso wie Wohn- und Ferienorte, fû¥r den Arbeitgeber erstellte Berichte oder das sogenannte Familiantenbuch der Kafkas. Seine VerûÑffentlichungen waren einschneidende Ereignisse. In seiner Dissertation stellte Wagenbach erstmals den ãlinkenã Kafka vor und verûÊnderte das gewohnte Bild vom ewig schwermû¥tigen Autor, als er 1983 im eigenen Verlag eine û¥berbordende Bildmonographie herausgab - mit einem lachenden Kafka auf der Titelseite. Wagenbach beschreibt sich heute selbst als ãdienstûÊlteste aller Kafka-Witwenã und wandelt, mit 80 Jahren, noch immer auf den Spuren dieses ãseltsamen Heiligenã. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 19.12.2016
Datum: 19.12.2016Länge: 00:41:29 Größe: 37.98 MB |
||
| Klaus Buhlert: "Erkunden, was der Text macht" - Zur HûÑrspielinszenierung von Frank Kafka: Der Process - 19.12.2016 | ||
| Klaus Buhlert (Regisseur) im GesprûÊch mit Julian Doepp / BR 2010 | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 19.12.2016
Datum: 19.12.2016Länge: 00:26:27 Größe: 24.23 MB |
||
| Eran Schaerf: Sie hûÑrten Nachrichten - 16.12.2016 | ||
| Mit Peter Veit / Realisation: Eran Schaerf / BR 2005 / LûÊnge: 26'22 // "Sie hûÑrten Nachrichten". Aber was hûÑren wir denn in Eran Schaerfs gleichnamigem HûÑrspiel? Keine Nachrichten, die morgen schon Schnee von gestern sind. Wir hûÑren etwas, als ob es schon einmal gewesen wûÊre, wûÊhrend wir gleichzeitig das HûÑren selbst als VergegenwûÊrtigung eines schon vorher Gewesenen begreifen, das von neuem mûÑglich wird. Das liegt nicht nur daran, dass Schaerf seine Nachrichten sorgfûÊltig auswûÊhlt, die allesamt gegenwûÊrtige Konflikte berû¥hren, wie sie die Rechtsprechung in Frage stellen. Es liegt vor allem auch daran, wie Schaerf seine Nachrichten kombiniert, unterbricht und dort weitererzûÊhlt, wo sich die Grenzen der Genres, der Nachrichten und des HûÑrspiels, der Wirklichkeit und der Fiktion verwischen und unsere MaûstûÊbe ins Rutschen bringen. Im Gegensatz zu den Nachrichten, gibt Schaerfs HûÑrspiel uns nicht nur das, was gewesen ist und uns mit Ohnmacht und Ressentiment erfû¥llt. Dieses HûÑrspiel ist ein sowohl ernsthaftes als auch vergnû¥gliches NachrichtengedûÊchtnis, das auch das Gewesene wieder mit MûÑglichkeit auflûÊdt. WûÊhrend wir zuhûÑren, begreifen wir, wie etwas mûÑglich wurde, und dass alles, selbst das, was wir gerade hûÑren, mûÑglich ist. In Schaerfs Nachrichten geht es nicht darum, die Wirklichkeit, von der sie berichten, wahrscheinlich zu machen. Es geht darum, sie wieder mûÑglich werden zu lassen durch eine Berichterstattung, die ihre Technik der Montage in den Vordergrund rû¥ckt. Die Wirklichkeit selbst wird zu einer Montage von MûÑglichkeiten und das heiût, dass wir in sie eingreifen kûÑnnen. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 16.12.2016
Datum: 16.12.2016Länge: 00:26:46 Größe: 24.51 MB |
||
| Fragen fû¥r alle - Fragen an die Macherinnen - Mit Heike Geiûler/Anke Dyes - 09.12.2016 | ||
| Heike Geiûler (Autorin) und Anke Dyes (Kû¥nstlerin) im GesprûÊch mit Christine Grimm. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 09.12.2016
Datum: 09.12.2016Länge: 00:23:50 Größe: 21.83 MB |
||
| Heike Geiûler/Anke Dyes: Fragen fû¥r alle - 09.12.2016 | ||
|
Beate Himmelstoû, Peter Veit sowie 47 Fragende und Befragte / Realisation: Heike Geiûler/Anke Dyes / BR 2016 / LûÊnge: 51'50 // "Wie spûÊt ist es? Sind Sie gerade allein? Sind Sie froh dort zu sein, wo Sie gerade sind? WûÊre es jetzt bereits Zeit fû¥r ein wenig Alkohol? Was fehlt? Kann ein guter Tag schlecht beginnen?" Fragen kûÑnnen offen sein oder geschlossen, allgemein oder speziell, sachlich oder persûÑnlich. Fragen irritieren oder motivieren. Sie sind suggestiv, rhetorisch, paradox, aber auch pragmatisch, direkt, humorvoll. Sie kûÑnnen Antworten provozieren, Ratlosigkeit und neue Fragen. Sie kûÑnnen die Augen ûÑffnen fû¥r die Welt, oder den Befragten auf sich selbst zurû¥ckwerfen. Sie speisen sich aus dem Staunen, der Neugier und der Unwissenheit, genauso aber auch aus Macht, Hierarchien und Hilflosigkeit. So vielfûÊltig und vielschichtig Fragen sind, so wichtig bleibt eines: Dass sie gestellt werden. Und deshalb haben die Autorin Heike Geiûler und die Kû¥nstlerin Anke Dyes ein scheinbar nicht enden wollendes Fragenkonvolut zusammengestellt, mit dem sie Bekannte, Passanten und den HûÑrer ihres HûÑrspiels konfrontieren. "Fragen fû¥r alle" stellt Fragen zu allem: Person, Gesellschaft, Politik, Medien, Moral und noch vielem mehr. In Straûeninterviews und GesprûÊchen untersuchen die Autorinnen die Welt, die Gefragten, den Fragenden und das Medium der Frage selbst. So heterogen die Ausgangslage ist, so divergent sind denn auch die Antworten in den OriginaltûÑnen, den Studioaufnahmen und im Kopf des HûÑrers, der immer mit angesprochen ist. In ihnen erûÑffnen sich weniger eindeutige Standpunkte, als vielmehr in Gang gesetzte Prozesse der Reflexion oder Destabilisierung und Versuche, Orientierung zu gewinnen. Fragen als vielleicht besonders zeitgemûÊûe Form, û¥ber uns, unsere Gesellschaft und unsere Zeit Erkenntnis zu gewinnen. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 09.12.2016
Datum: 09.12.2016Länge: 00:52:15 Größe: 47.84 MB |
||
| Klaus Ramm: Die Welt im Wort entdecken - Helmut Heiûenbû¥ttel - der Autor als Rezensent - 02.12.2016 | ||
|
Mit Bernt Hahn, Klaus Ramm / BR 2016 / LûÊnge: 71'40 // Der Bû¥chnerpreistrûÊger Helmut Heiûenbû¥ttel war eine der prûÊgenden PersûÑnlichkeiten der deutschen Nachkriegsliteratur, auch zur Erneuerung des HûÑrspiels hat er mit seinem akustischen Werk und seinen programmatischen Essays entscheidende Impulse gegeben. Zwanzig Jahre nach seinem Tod portrûÊtiert ihn Klaus Ramm aus einer ganz anderen Perspektive: Heiûenbû¥ttel war zugleich ein leidenschaftlicher Leser und unorthodoxer Literaturkritiker, der in dem eher bieder-konventionell orientierten literarischen Klima der fû¥nfziger und sechziger Jahre den Blick ûÑffnete auf Ungewohntes, Unabgesichertes und unbekannt Gebliebenes: auf die europûÊische und amerikanische Moderne ebenso wie auf die durch die Nazizeit verschû¥tteten Traditionen und die avancierten NeuansûÊtze der deutschen Literatur. Seine Rezensionen sind - wie seine HûÑrspiele - û¥berzeugende PlûÊdoyers fû¥r eine andere, offenere, risikoreichere Wahrnehmung der Welt durch Sprache und durch Literatur. Bernt Hahn liest ausgewûÊhlte Kritiken zu Uwe Johnson, Alexander Kluge, Franz Mon, Charles Olson, Andy Warhol und anderen aus dem Band Zur Lockerung der Perspektive. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 02.12.2016
Datum: 02.12.2016Länge: 01:12:05 Größe: 66.00 MB |
||
| Virginia Woolf: Zum Leuchtturm (3/3) Der Leuchtturm - 27.11.2016 | ||
| Aus dem Englischen von Gaby Hartel / Mit Zoe Hutmacher, Wiebke Puls, Irina Wanka, Walter Hess, Caroline Ebner, Sven Gey, Karolina Horster / Bearbeitung: Gaby Hartel / Komposition: Ulrike Haage / Regie: Katja Langenbach / BR 2016 / LûÊnge: 47'14 // Zum Leuchtturm ist Virginia Woolfs fû¥nftes literarisches Experiment und liegt damit so zentral in ihrem Schaffen, wie der strukturgebende Baum, den die Protagonistin Lily Briscoe ganz entschieden in die leere Mitte ihres Bildes setzt, um es zu vollenden. Vier Romane liegen vor diesem Buch und vier werden ihm noch folgen. Fû¥r die Autorin war es ihr wichtigstes Werk, in dem sie nichts weniger fassen wollte als ãdas Tragische, das Komische, die Leidenschaft und das Lyrischeã. Mehr noch als in Mrs. Dalloway oder Jacobs Zimmer, arbeitet Woolf hier an der VerschrûÊnkung und Verdichtung von Zeit-, Gefû¥hls- und Erlebnisebenen. Am Anfang steht die Frage des kleinen James Ramsay, ob die fû¥r den nûÊchsten Tag geplante Segeltour zum Leuchtturm stattfinden wird. Das Wetter verhindert den Ausflug. Zehn Jahre vergehen bis zur Erfû¥llung seines Kindheitstraums, womit der Roman endet. Anhand der Erlebnisse der Familie Ramsay und einiger Freunde in einem schottischen Ferienhaus, verschachtelt Woolf die Gleichzeitigkeit und Unordnung von unmittelbar erfahrenem und reflektiertem Leben. Sie kontrastiert einen auf die Menschen gerichteten Blickcluster mit der vom menschlichen Schicksal ungerû¥hrt fortschreitenden Zeit, in der Kriege und menschliche TragûÑdien nur winzige, unwichtige Episoden darstellen. Diese Perspektive ist akustisch markiert vom GerûÊusch der am Strand sich brechenden Wellen, was gleichzeitig bedrohlich und beruhigend wirkt. Virginia Woolf wusste frû¥h, dass dieser Roman vom Klang des Meeres unterlegt sein sollte und es scheint, als habe sich die Autorin so auch in einen Schreibrhythmus gewiegt, der sie in ihre Kindheit zurû¥ckfû¥hrte. Mr. und Mrs. Ramsay sind den Eltern der Autorin nachempfunden: Julia Stephen, der charismatischen, frû¥h verstorbenen Mutter und Leslie Stephen, dem cholerischen Vater und einflussreichen Schriftsteller. Wenn dieses Werk auch von Woolfs emotionaler Ambivalenz gegenû¥ber den Eltern angetrieben wird, so lûÊsst es das Autobiografische doch weit hinter sich. Die Autorin verdichtet ihr Nachdenken û¥ber das eigene Leben ins Universale, indem sie eine Reihe von GegensûÊtzen untersucht: mûÊnnlich / weiblich, Leben / Tod, KreativitûÊt (Malen, Schreiben, Reden) / steriler Egozentrismus, VergûÊnglichkeit des Augenblicks / Schaffen einer dauerhaften Erfahrung. Diese Dualismen bettet Woolf in die drei Teile ihres Romans ein, von denen der erste an einem Nachmittag und Abend spielt, der zweite zehn Jahre umfasst, in denen fast ausschlieûlich das Haus Protagonist der ErzûÊhlung ist und der dritte einen langen Vormittag darstellt. Zum Leuchtturm wird von Natur- und AlltagsgerûÊuschen getragen, von GesprûÊchsfetzen oder erinnerten Stimmen, die dieses Textgebilde schon beim Lesen emotional zum Leuchten bringen. Im Radio kommen sie zu sich. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 27.11.2016
Datum: 27.11.2016Länge: 00:47:21 Größe: 43.35 MB |
||
| Virginia Woolf: Zum Leuchtturm (2/3) Zeit vergeht - 20.11.2016 | ||
| Aus dem Englischen von Gaby Hartel / Mit Zoe Hutmacher, Wiebke Puls, Irina Wanka, Elisabeth Schwarz, Caroline Ebner, Peter Brombacher, Julia Loibl, Christian LûÑber / Bearbeitung: Gaby Hartel / Komposition: Ulrike Haage / Regie: Katja Langenbach / BR 2016 / LûÊnge: 49'16 // Zum Leuchtturm ist Virginia Woolfs fû¥nftes literarisches Experiment und liegt damit so zentral in ihrem Schaffen, wie der strukturgebende Baum, den die Protagonistin Lily Briscoe ganz entschieden in die leere Mitte ihres Bildes setzt, um es zu vollenden. Vier Romane liegen vor diesem Buch und vier werden ihm noch folgen. Fû¥r die Autorin war es ihr wichtigstes Werk, in dem sie nichts weniger fassen wollte als ãdas Tragische, das Komische, die Leidenschaft und das Lyrischeã. Mehr noch als in Mrs. Dalloway oder Jacobs Zimmer, arbeitet Woolf hier an der VerschrûÊnkung und Verdichtung von Zeit-, Gefû¥hls- und Erlebnisebenen. Am Anfang steht die Frage des kleinen James Ramsay, ob die fû¥r den nûÊchsten Tag geplante Segeltour zum Leuchtturm stattfinden wird. Das Wetter verhindert den Ausflug. Zehn Jahre vergehen bis zur Erfû¥llung seines Kindheitstraums, womit der Roman endet. Anhand der Erlebnisse der Familie Ramsay und einiger Freunde in einem schottischen Ferienhaus, verschachtelt Woolf die Gleichzeitigkeit und Unordnung von unmittelbar erfahrenem und reflektiertem Leben. Sie kontrastiert einen auf die Menschen gerichteten Blickcluster mit der vom menschlichen Schicksal ungerû¥hrt fortschreitenden Zeit, in der Kriege und menschliche TragûÑdien nur winzige, unwichtige Episoden darstellen. Diese Perspektive ist akustisch markiert vom GerûÊusch der am Strand sich brechenden Wellen, was gleichzeitig bedrohlich und beruhigend wirkt. Virginia Woolf wusste frû¥h, dass dieser Roman vom Klang des Meeres unterlegt sein sollte und es scheint, als habe sich die Autorin so auch in einen Schreibrhythmus gewiegt, der sie in ihre Kindheit zurû¥ckfû¥hrte. Mr. und Mrs. Ramsay sind den Eltern der Autorin nachempfunden: Julia Stephen, der charismatischen, frû¥h verstorbenen Mutter und Leslie Stephen, dem cholerischen Vater und einflussreichen Schriftsteller. Wenn dieses Werk auch von Woolfs emotionaler Ambivalenz gegenû¥ber den Eltern angetrieben wird, so lûÊsst es das Autobiografische doch weit hinter sich. Die Autorin verdichtet ihr Nachdenken û¥ber das eigene Leben ins Universale, indem sie eine Reihe von GegensûÊtzen untersucht: mûÊnnlich / weiblich, Leben / Tod, KreativitûÊt (Malen, Schreiben, Reden) / steriler Egozentrismus, VergûÊnglichkeit des Augenblicks / Schaffen einer dauerhaften Erfahrung. Diese Dualismen bettet Woolf in die drei Teile ihres Romans ein, von denen der erste an einem Nachmittag und Abend spielt, der zweite zehn Jahre umfasst, in denen fast ausschlieûlich das Haus Protagonist der ErzûÊhlung ist und der dritte einen langen Vormittag darstellt. Zum Leuchtturm wird von Natur- und AlltagsgerûÊuschen getragen, von GesprûÊchsfetzen oder erinnerten Stimmen, die dieses Textgebilde schon beim Lesen emotional zum Leuchten bringen. Im Radio kommen sie zu sich. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 20.11.2016
Datum: 20.11.2016Länge: 00:49:22 Größe: 45.21 MB |
||
| Virginia Woolf: Zum Leuchtturm (1/3) Die Tû¥r aus Glas - 13.11.2016 | ||
|
Aus dem Englischen von Gaby Hartel / Mit Zoe Hutmacher, Wiebke Puls, Irina Wanka, Krista Posch, Walter Hess, Caroline Ebner, Shenja Lacher, Julia Loibl, Christian LûÑber, Peter Brombacher, Moritz Zehner / Bearbeitung: Gaby Hartel / Komposition: Ulrike Haage / Regie: Katja Langenbach / BR 2016 / LûÊnge: 51'23 // Zum Leuchtturm ist Virginia Woolfs fû¥nftes literarisches Experiment und liegt damit so zentral in ihrem Schaffen, wie der strukturgebende Baum, den die Protagonistin Lily Briscoe ganz entschieden in die leere Mitte ihres Bildes setzt, um es zu vollenden. Vier Romane liegen vor diesem Buch und vier werden ihm noch folgen. Fû¥r die Autorin war es ihr wichtigstes Werk, in dem sie nichts weniger fassen wollte als ãdas Tragische, das Komische, die Leidenschaft und das Lyrischeã. Mehr noch als in Mrs. Dalloway oder Jacobs Zimmer, arbeitet Woolf hier an der VerschrûÊnkung und Verdichtung von Zeit-, Gefû¥hls- und Erlebnisebenen. Am Anfang steht die Frage des kleinen James Ramsay, ob die fû¥r den nûÊchsten Tag geplante Segeltour zum Leuchtturm stattfinden wird. Das Wetter verhindert den Ausflug. Zehn Jahre vergehen bis zur Erfû¥llung seines Kindheitstraums, womit der Roman endet. Anhand der Erlebnisse der Familie Ramsay und einiger Freunde in einem schottischen Ferienhaus, verschachtelt Woolf die Gleichzeitigkeit und Unordnung von unmittelbar erfahrenem und reflektiertem Leben. Sie kontrastiert einen auf die Menschen gerichteten Blickcluster mit der vom menschlichen Schicksal ungerû¥hrt fortschreitenden Zeit, in der Kriege und menschliche TragûÑdien nur winzige, unwichtige Episoden darstellen. Diese Perspektive ist akustisch markiert vom GerûÊusch der am Strand sich brechenden Wellen, was gleichzeitig bedrohlich und beruhigend wirkt. Virginia Woolf wusste frû¥h, dass dieser Roman vom Klang des Meeres unterlegt sein sollte und es scheint, als habe sich die Autorin so auch in einen Schreibrhythmus gewiegt, der sie in ihre Kindheit zurû¥ckfû¥hrte. Mr. und Mrs. Ramsay sind den Eltern der Autorin nachempfunden: Julia Stephen, der charismatischen, frû¥h verstorbenen Mutter und Leslie Stephen, dem cholerischen Vater und einflussreichen Schriftsteller. Wenn dieses Werk auch von Woolfs emotionaler Ambivalenz gegenû¥ber den Eltern angetrieben wird, so lûÊsst es das Autobiografische doch weit hinter sich. Die Autorin verdichtet ihr Nachdenken û¥ber das eigene Leben ins Universale, indem sie eine Reihe von GegensûÊtzen untersucht: mûÊnnlich / weiblich, Leben / Tod, KreativitûÊt (Malen, Schreiben, Reden) / steriler Egozentrismus, VergûÊnglichkeit des Augenblicks / Schaffen einer dauerhaften Erfahrung. Diese Dualismen bettet Woolf in die drei Teile ihres Romans ein, von denen der erste an einem Nachmittag und Abend spielt, der zweite zehn Jahre umfasst, in denen fast ausschlieûlich das Haus Protagonist der ErzûÊhlung ist und der dritte einen langen Vormittag darstellt. Zum Leuchtturm wird von Natur- und AlltagsgerûÊuschen getragen, von GesprûÊchsfetzen oder erinnerten Stimmen, die dieses Textgebilde schon beim Lesen emotional zum Leuchten bringen. Im Radio kommen sie zu sich. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 13.11.2016
Datum: 13.11.2016Länge: 00:51:30 Größe: 47.15 MB |
||
| Ingo Schulze: Augusto, der Richter - 11.11.2016 | ||
|
Mit Paul Herwig, Christian Redl, Judith Rosmair, Krista Posch u.a. / Regie: Ulrich Lampen / MDR/BR 2016 / LûÊnge: 65'14 // Einem deutschen Schriftsteller, mit Frau und TûÑchtern zu Gast in der Villa Massimo, reiût beim Fuûballspielen die Achilles-Sehne, nach der Operation steckt er wochenlang im Haus fest. Umso grûÑûer die Freude, als er sich zum ersten Mal wieder zu Fuû in die Stadt wagt. ûbermû¥tig beschlieût er, gleich die nûÑtigen Besorgungen zu machen - der Supermarkt ist ganz in der NûÊhe. Nur, dass er den ausliegenden KûÑstlichkeiten unter diesen UmstûÊnden noch schwerer widerstehen kann als sonst! Bald bekommt er den Wagen kaum noch vom Fleck, dafû¥r melden sich die Schmerzen im Bein wieder. Wie soll er das alles jemals nach Hause schaffen? Da kommt dieser Augusto wie gerufen - ein RumûÊne, wie sich herausstellt, mit grû¥ner Warnweste û¥berm ausgewaschenen Shirt. Ist er, wie er unterwegs behauptet, ebenfalls Schriftsteller? Fesselnd erzûÊhlen kann er jedenfalls: NûÊmlich von den schier unglaublichen Erlebnissen der vergangenen Nacht. Zuerst hatte er nur einer reichen Signora beim Transport der EinkûÊufe geholfen. Doch dann in ihrem Palazzo werden ganz andere Dienste von ihm erwartet. Denn die drei Grazien, die dort residieren, geben ein Fest. Dazu einen Tanzwettstreit - nach jeder Runde wird ein Paar abgewûÊhlt. Und Augusto, gebadet und in duftende GewûÊnder gehû¥llt, ist der Richter. Doch als das Fest in eine Orgie von Sex und Gewalt mû¥ndet, bricht Augusto ab. Will der Schriftsteller ihn deshalb unbedingt noch einmal treffen? Oder wegen der zwei Fû¥nfzig-Euro-Scheine, die aus seinem Portemonnaie verschwunden sind? Oder weil er nicht damit zurechtkommt, dass der Eine lebt wie im Paradies auf Erden, und der Andere ihm die Schlemmereien trûÊgt? |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 11.11.2016
Datum: 11.11.2016Länge: 01:05:20 Größe: 59.82 MB |
||
| RûÑmische NûÊchte und ihre ErzûÊhler - Mit Ingo Schulze - 11.11.2016 | ||
| Ingo Schulze (Autor) im GesprûÊch mit Marie Schoeû. BR 2016 | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 11.11.2016
Datum: 11.11.2016Länge: 00:13:57 Größe: 12.78 MB |
||
| Malen nach Vokalen -Mit Karl Bruckmaier - 04.11.2016 | ||
| Karl Bruckmaier im GesprûÊch mit Marie Schoeû (BR 2016) | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 04.11.2016
Datum: 04.11.2016Länge: 00:22:39 Größe: 20.74 MB |
||
| Karl Bruckmaier: Jedenfalls KrûÊhen - Ein HûÑrspiel fû¥r Peter Weiss - 04.11.2016 | ||
| g | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 04.11.2016
Datum: 04.11.2016Länge: 00:41:50 Größe: 38.31 MB |
||
| Wolfgang Mû¥ller: Intervallum - Eine Hommage an die Pause - 28.10.2016 | ||
| Mit Claudia Urbschat-Mingues, Felix Mû¥ller, Wolfgang Mû¥ller, Ernst Mitzka, Chris Dreier, Carola Regnier, Charlotte Simon, Gudrun Gut / Realisation: Wolfgang Mû¥ller / BR 2016 / LûÊnge: 54'41 // In einem 1928 publizierten Buch û¥ber Valeska Gert finden sich 26 Tanzfiguren, die von der TûÊnzerin selbst ausgefû¥hrt werden: Tod, NervositûÊt, Sport, Vergnû¥gte Verzweiflung, Canaille, Alt-Paris, Zirkus und auf Seite 48 ein ganzseitiges Foto mit dem Titel "Pause". Die 1892 in Berlin geborene Valeska Gert beschûÊftigte sich wûÊhrend der Zwanziger Jahre intensiv mit den Brû¥chen der Moderne. Dabei setzte sie sich mit dem Unmittelbaren, ûbersehenen, Vergessenen, Unwiederholbaren, AlltûÊglichen und VerdrûÊngten auseinander. Was in jener Zeit Walter Benjamin in der Sprache erforschte, nûÊmlich das begrifflich nicht Fixierbare dennoch sprachlich einzuholen, das unternahm Valeska Gert mit dem KûÑrper und seinen Bewegungen. Vom modernen Tanz ausgehend, erweiterte sie die Grenzen des noch jungen Genres mit sogenannten TontûÊnzen sowie mit PrûÊ-Formen von Vokal-Art, Happening und Performance. Die Art und Weise, mit der die Avantgardistin die Fragmente ihrer Beobachtungen zu neuen Einheiten zusammenfû¥gte, machte diese in grotesker Gestalt oft erst wahrnehmbar. Valeska Gert: ãTransparenz bedeutet: Das Reale wird durchsichtig. Ich vergeistige Stoff.ã Gerts Tanzfigur Pause diente Wolfgang Mû¥ller als Anregung fû¥r sein HûÑrspiel Intervallum ã eine Hommage an die Pause. In seiner akustischen Exkursion setzt Mû¥ller zum einen Valeska Gerts wenig bekanntes Tanzkonzept Pause aus dem Jahr 1919 in Beziehung zu einem anderen radikalûÊsthetischen Kunstwerk des 20. Jahrhunderts: Marcel Duchamps berû¥hmtes Objekt Fountain aus dem Jahr 1917. Beide Kunstwerke sind ausschlieûlich û¥ber Reproduktionen in Form von Fotografien, Druckwerken und Sprache û¥berliefert. Zum anderen nûÊhert sich Mû¥ller Valeska Gert mit kû¥nstlerischen Mitteln und stellt ihr kompromissloses und visionûÊres Schaffen in einen zeitgenûÑssischen Kontext. Er erinnert an eine Musik(er)pause, die er 1984 mit seiner Gruppe Die TûÑdliche Doris wûÊhrend einer Modenschau in Westberlin inszenierte. Sie war zugleich Arbeits- und Vesperpause. Mit einer poetischen LogopûÊdin trainiert Mû¥ller die StimmbûÊnder mit SûÊtzen voll kurzer oder langer Pausen, er spricht mit einem Zeitzeugen û¥ber die Kû¥nstlerin Valeska Gert und ein Song aus GerûÊuschen des WCs bei der Toilettenpause im ICE leitet û¥ber zu den 361 Sprechpausen in Andy Warhols Roman ãAã von 1969. Mit Wortfragmenten aus diesem Roman fû¥llte 1982, vier Jahre nach dem Tod von Valeska Gert Die TûÑdliche Doris ihren Song In der Pause. Rastlose Stimmen suchen Orte der Freiheit. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 28.10.2016
Datum: 28.10.2016Länge: 00:55:23 Größe: 50.71 MB |
||
| Die intermediale Kû¥nstlerin Valeska Gert - Mit Wolfgang Mû¥ller - 28.10.2016 | ||
| Wolfgang Mû¥ller (Kû¥nstler) im GesprûÊch mit Christine Grimm / BR 2016 | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 28.10.2016
Datum: 28.10.2016Länge: 00:33:34 Größe: 30.74 MB |
||
| Rainald Goetz: loslabern - 23.10.2016 | ||
| Mit Rainald Goetz / Realisation: Leopold von Verschuer / BR/intermedium rec. 2010 / LûÊnge: 53'08 // Eine Art monologisches Sprechen hebt an, es ist die Stimme des Autors, die zu hûÑren ist. Es ist die am Mikrofon stattfindende Wiederbegegnung bzw. Selbstkonfrontation mit dem eigenen, Monate zuvor entstandenen und mittlerweile in Buchform vorliegenden Text, der seinen Anfang nimmt in der Beschreibung eines initiatorischen Moments, und zwar exakt des Moments, der von der Empfindung und Denkbewegung zur Schreibaktion fû¥hrt. "In einer Aufwallung von Direktheit und quasi sinnfreier IntentionalitûÊt hatte der HûÑllor, die Arme von sich werfend himmelwûÊrts, ausgerufen: LOSLABERN: Traktat, Traktat û¥ber den Tod, û¥ber Wahn, Sex und Text, und, erheitert von diesem soeben durch ihn hindurchgefahrenen ExpressivitûÊtsereignis: Bericht!" Es ist keine Autorenlesung, die im Studio aufgezeichnet wird. Aber auch kein dramatisches Sprechen, kein Inszenieren, kein verkû¥nsteltes Adaptieren des Textes ins akustische Medium ã und auch kein HûÑrspielmonolog. Die eigenen Interpretations- oder RezitationsansûÊtze des Autors und die im Studio gebotenen MûÑglichkeiten, in schmaler Differenz akustische RûÊume zu erûÑffnen, kennzeichnen das Konzept der Produktion. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 23.10.2016
Datum: 23.10.2016Länge: 00:53:14 Größe: 48.75 MB |
||
| Elfriede Jelinek: Neid (10/10) - 14.10.2016 | ||
| Mit Sophie Rois, Elfriede Jelinek / Komposition: Frode Haltli/Maja Ratkje / Bearbeitung und Regie: Karl Bruckmaier / BR 2011 // Fortsetzungsroman, Bekenntnisliteratur, Kû¥nstlerinnenroman, Autobiografie, Internet-Tagebuch - Elfriede Jelineks Literatur strûÊubt sich seit jeher gegen eindeutige Zuschreibungen und mit ihrem Roman "Neid" ist das nicht anders. Zwischen dem 3. MûÊrz 2007 und dem 24. April 2008 hat die Autorin ca. 936 Seiten Text unter der Gattungsbezeichnung ãPrivatromanã online gestellt. Privat ist der Text zunûÊchst deshalb, weil er unabhûÊngig von einem Verlag direkt dem Leser û¥bereignet wird. Dieser soll das Werk gar nicht erst ausdrucken, sondern laut Gebrauchsanweisung am Bildschirm eines Computers, eines E-Books oder am Display eines Handys lesen, kurz: damit machen, was er will. Ein Privatroman ist "Neid" aber auch, weil die Autorin sehr umfangreich Aspekte der eigenen Biografie in den Text mit einbezogen hat. Elfriede Jelinek ist mehr denn je anwesend in ihrem Text, dies aber auch nur deshalb, weil er sich aufgrund seines Erscheinens im Internet als vorhanden und abwesend zugleich erweist, jederzeit im weltweiten Netz verschwinden oder daraus entfernt werden kann. ãGespensterhaftã nennt Jelinek diese Erscheinungsform, die Autorin, ErzûÊhlerin, den Roman und die darin enthaltenen figuralen RestbestûÊnde und Themen eint. Untot sind die Ich-ErzûÊhlerin, ihre Hauptfigur Brigitte K. oder auch die Opfer in der nationalsozialistischen Vergangenheit des Ortes Erzberg, dem fiktiven Schauplatz des Romans. Hier wird nach dem Niedergang des Erzbergbaus und dem Abbau von ArbeitsplûÊtzen um Einwohner und Touristen gekûÊmpft. Vorlage ist Eisenerz in der Steiermark, dessen Bemû¥hungen um Fremdenverkehr im Text in den grotesken Gegensatz zur ûÑsterreichischen Einwanderungspolitik oder dem sogenannten Eisenerzer Todesmarsch gerû¥ckt werden, bei dem 1945 mehrere tausend Juden umkamen. In Erzberg lebt auch Brigitte K., Geigenlehrerin, betrogene Ehefrau, hintergangene Geliebte und phantomhafte Protagonistin des Romans. Ihre Existenz als lebende Tote und schlieûlich MûÑrderin scheint in Neid ebenso auf, wie aktuelles Geschehen, etwa die FûÊlle Natascha Kampusch oder Amstetten. Im Redefluss der ErzûÊhlerin bleibt wenig unberû¥hrt, das ErzûÊhlte aber letztlich hinter dem ErzûÊhlen selbst zurû¥ck. "Neid" ist vor allem Rede-Roman: Stilisierte Mû¥ndlichkeit, ausgestellte Zerstreutheit, stûÊndiges Neu-Ansetzen, Abschweifen und das Unterlaufen von Gliederungseinheiten wie Kapitel und Unterkapitel markieren die Verweigerung eines Heimischwerdens in intakter ErzûÊhlung oder Eindeutigkeit. Das sprechende Ich blickt zwar auf die es umgebende Welt und hûÊlt dieser den Spiegel vor. Die Sprecherin wird im ausgefeilten Redeschwall aber vor allem zur permanenten Beobachterin ihrer selbst. In der HûÑrspielfassung des Bayerischen Rundfunks leiht Sophie Rois diesem performativen ErzûÊhlen ihre Stimme und û¥berfû¥hrt die Sprache des Romans vom flû¥chtigen Internet-Text-KûÑrper in den stimmlichen Klangraum. Dieser verbleibt schlieûlich durch das Angebot der 10 Teile von "Neid" als Download im HûÑrspiel Pool in seinem genuinen Medium. Nicht in Form privater Lektû¥re und geordneter Leseakte, sondern in ûquivalenz zur Rezeption von Texten im Netz erfûÊhrt der HûÑrer in der HûÑrspielfassung Wege und Umwege, Verknû¥pfungen und HûÊnger der Suchmaschine "Neid". | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 14.10.2016
Datum: 14.10.2016Länge: 00:55:19 Größe: 50.65 MB |
||
| "Havarie" - Ein Dokumentarfilm als Medienkunststû¥ck - 14.10.2016 | ||
| Am 14.9.2012 um 14:56 Uhr meldet das Kreuzfahrtschiff "Adventure of the Seas" der spanischen Seenotrettung die Sichtung eines havarierten Schlauchbootes mit 13 Personen an Bord. Aus einem Youtube-Clip und biografischen Szenen entsteht eine Choreografie, in der sich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Reisenden auf dem Mittelmeer spiegeln. Philip Scheffner (Filmemacher) im GesprûÊch mit Christine Grimm. BR 2016 | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 14.10.2016
Datum: 14.10.2016Länge: 00:26:56 Größe: 24.67 MB |
||
| Elfriede Jelinek: Neid (09/10) - 07.10.2016 | ||
|
Mit Sophie Rois, Elfriede Jelinek / Komposition: Frode Haltli/Maja Ratkje / Bearbeitung und Regie: Karl Bruckmaier / BR 2011 // Fortsetzungsroman, Bekenntnisliteratur, Kû¥nstlerinnenroman, Autobiografie, Internet-Tagebuch - Elfriede Jelineks Literatur strûÊubt sich seit jeher gegen eindeutige Zuschreibungen und mit ihrem Roman "Neid" ist das nicht anders. Zwischen dem 3. MûÊrz 2007 und dem 24. April 2008 hat die Autorin ca. 936 Seiten Text unter der Gattungsbezeichnung ãPrivatromanã online gestellt. Privat ist der Text zunûÊchst deshalb, weil er unabhûÊngig von einem Verlag direkt dem Leser û¥bereignet wird. Dieser soll das Werk gar nicht erst ausdrucken, sondern laut Gebrauchsanweisung am Bildschirm eines Computers, eines E-Books oder am Display eines Handys lesen, kurz: damit machen, was er will. Ein Privatroman ist "Neid" aber auch, weil die Autorin sehr umfangreich Aspekte der eigenen Biografie in den Text mit einbezogen hat. Elfriede Jelinek ist mehr denn je anwesend in ihrem Text, dies aber auch nur deshalb, weil er sich aufgrund seines Erscheinens im Internet als vorhanden und abwesend zugleich erweist, jederzeit im weltweiten Netz verschwinden oder daraus entfernt werden kann. ãGespensterhaftã nennt Jelinek diese Erscheinungsform, die Autorin, ErzûÊhlerin, den Roman und die darin enthaltenen figuralen RestbestûÊnde und Themen eint. Untot sind die Ich-ErzûÊhlerin, ihre Hauptfigur Brigitte K. oder auch die Opfer in der nationalsozialistischen Vergangenheit des Ortes Erzberg, dem fiktiven Schauplatz des Romans. Hier wird nach dem Niedergang des Erzbergbaus und dem Abbau von ArbeitsplûÊtzen um Einwohner und Touristen gekûÊmpft. Vorlage ist Eisenerz in der Steiermark, dessen Bemû¥hungen um Fremdenverkehr im Text in den grotesken Gegensatz zur ûÑsterreichischen Einwanderungspolitik oder dem sogenannten Eisenerzer Todesmarsch gerû¥ckt werden, bei dem 1945 mehrere tausend Juden umkamen. In Erzberg lebt auch Brigitte K., Geigenlehrerin, betrogene Ehefrau, hintergangene Geliebte und phantomhafte Protagonistin des Romans. Ihre Existenz als lebende Tote und schlieûlich MûÑrderin scheint in Neid ebenso auf, wie aktuelles Geschehen, etwa die FûÊlle Natascha Kampusch oder Amstetten. Im Redefluss der ErzûÊhlerin bleibt wenig unberû¥hrt, das ErzûÊhlte aber letztlich hinter dem ErzûÊhlen selbst zurû¥ck. "Neid" ist vor allem Rede-Roman: Stilisierte Mû¥ndlichkeit, ausgestellte Zerstreutheit, stûÊndiges Neu-Ansetzen, Abschweifen und das Unterlaufen von Gliederungseinheiten wie Kapitel und Unterkapitel markieren die Verweigerung eines Heimischwerdens in intakter ErzûÊhlung oder Eindeutigkeit. Das sprechende Ich blickt zwar auf die es umgebende Welt und hûÊlt dieser den Spiegel vor. Die Sprecherin wird im ausgefeilten Redeschwall aber vor allem zur permanenten Beobachterin ihrer selbst. In der HûÑrspielfassung des Bayerischen Rundfunks leiht Sophie Rois diesem performativen ErzûÊhlen ihre Stimme und û¥berfû¥hrt die Sprache des Romans vom flû¥chtigen Internet-Text-KûÑrper in den stimmlichen Klangraum. Dieser verbleibt schlieûlich durch das Angebot der 10 Teile von "Neid" als Download im HûÑrspiel Pool in seinem genuinen Medium. Nicht in Form privater Lektû¥re und geordneter Leseakte, sondern in ûquivalenz zur Rezeption von Texten im Netz erfûÊhrt der HûÑrer in der HûÑrspielfassung Wege und Umwege, Verknû¥pfungen und HûÊnger der Suchmaschine "Neid". |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 07.10.2016
Datum: 07.10.2016Länge: 00:56:57 Größe: 52.14 MB |
||
| Elfriede Jelinek: Neid (08/10) - 30.09.2016 | ||
|
Mit Sophie Rois, Elfriede Jelinek / Komposition: Frode Haltli/Maja Ratkje / Bearbeitung und Regie: Karl Bruckmaier / BR 2011 // Fortsetzungsroman, Bekenntnisliteratur, Kû¥nstlerinnenroman, Autobiografie, Internet-Tagebuch - Elfriede Jelineks Literatur strûÊubt sich seit jeher gegen eindeutige Zuschreibungen und mit ihrem Roman "Neid" ist das nicht anders. Zwischen dem 3. MûÊrz 2007 und dem 24. April 2008 hat die Autorin ca. 936 Seiten Text unter der Gattungsbezeichnung ãPrivatromanã online gestellt. Privat ist der Text zunûÊchst deshalb, weil er unabhûÊngig von einem Verlag direkt dem Leser û¥bereignet wird. Dieser soll das Werk gar nicht erst ausdrucken, sondern laut Gebrauchsanweisung am Bildschirm eines Computers, eines E-Books oder am Display eines Handys lesen, kurz: damit machen, was er will. Ein Privatroman ist "Neid" aber auch, weil die Autorin sehr umfangreich Aspekte der eigenen Biografie in den Text mit einbezogen hat. Elfriede Jelinek ist mehr denn je anwesend in ihrem Text, dies aber auch nur deshalb, weil er sich aufgrund seines Erscheinens im Internet als vorhanden und abwesend zugleich erweist, jederzeit im weltweiten Netz verschwinden oder daraus entfernt werden kann. ãGespensterhaftã nennt Jelinek diese Erscheinungsform, die Autorin, ErzûÊhlerin, den Roman und die darin enthaltenen figuralen RestbestûÊnde und Themen eint. Untot sind die Ich-ErzûÊhlerin, ihre Hauptfigur Brigitte K. oder auch die Opfer in der nationalsozialistischen Vergangenheit des Ortes Erzberg, dem fiktiven Schauplatz des Romans. Hier wird nach dem Niedergang des Erzbergbaus und dem Abbau von ArbeitsplûÊtzen um Einwohner und Touristen gekûÊmpft. Vorlage ist Eisenerz in der Steiermark, dessen Bemû¥hungen um Fremdenverkehr im Text in den grotesken Gegensatz zur ûÑsterreichischen Einwanderungspolitik oder dem sogenannten Eisenerzer Todesmarsch gerû¥ckt werden, bei dem 1945 mehrere tausend Juden umkamen. In Erzberg lebt auch Brigitte K., Geigenlehrerin, betrogene Ehefrau, hintergangene Geliebte und phantomhafte Protagonistin des Romans. Ihre Existenz als lebende Tote und schlieûlich MûÑrderin scheint in Neid ebenso auf, wie aktuelles Geschehen, etwa die FûÊlle Natascha Kampusch oder Amstetten. Im Redefluss der ErzûÊhlerin bleibt wenig unberû¥hrt, das ErzûÊhlte aber letztlich hinter dem ErzûÊhlen selbst zurû¥ck. "Neid" ist vor allem Rede-Roman: Stilisierte Mû¥ndlichkeit, ausgestellte Zerstreutheit, stûÊndiges Neu-Ansetzen, Abschweifen und das Unterlaufen von Gliederungseinheiten wie Kapitel und Unterkapitel markieren die Verweigerung eines Heimischwerdens in intakter ErzûÊhlung oder Eindeutigkeit. Das sprechende Ich blickt zwar auf die es umgebende Welt und hûÊlt dieser den Spiegel vor. Die Sprecherin wird im ausgefeilten Redeschwall aber vor allem zur permanenten Beobachterin ihrer selbst. In der HûÑrspielfassung des Bayerischen Rundfunks leiht Sophie Rois diesem performativen ErzûÊhlen ihre Stimme und û¥berfû¥hrt die Sprache des Romans vom flû¥chtigen Internet-Text-KûÑrper in den stimmlichen Klangraum. Dieser verbleibt schlieûlich durch das Angebot der 10 Teile von "Neid" als Download im HûÑrspiel Pool in seinem genuinen Medium. Nicht in Form privater Lektû¥re und geordneter Leseakte, sondern in ûquivalenz zur Rezeption von Texten im Netz erfûÊhrt der HûÑrer in der HûÑrspielfassung Wege und Umwege, Verknû¥pfungen und HûÊnger der Suchmaschine "Neid". |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 30.09.2016
Datum: 30.09.2016Länge: 00:57:36 Größe: 52.74 MB |
||
| Elfriede Jelinek: Neid (07/10) - 23.09.2016 | ||
|
Mit Sophie Rois, Elfriede Jelinek / Komposition: Frode Haltli/Maja Ratkje / Bearbeitung und Regie: Karl Bruckmaier / BR 2011 // Fortsetzungsroman, Bekenntnisliteratur, Kû¥nstlerinnenroman, Autobiografie, Internet-Tagebuch - Elfriede Jelineks Literatur strûÊubt sich seit jeher gegen eindeutige Zuschreibungen und mit ihrem Roman "Neid" ist das nicht anders. Zwischen dem 3. MûÊrz 2007 und dem 24. April 2008 hat die Autorin ca. 936 Seiten Text unter der Gattungsbezeichnung ãPrivatromanã online gestellt. Privat ist der Text zunûÊchst deshalb, weil er unabhûÊngig von einem Verlag direkt dem Leser û¥bereignet wird. Dieser soll das Werk gar nicht erst ausdrucken, sondern laut Gebrauchsanweisung am Bildschirm eines Computers, eines E-Books oder am Display eines Handys lesen, kurz: damit machen, was er will. Ein Privatroman ist "Neid" aber auch, weil die Autorin sehr umfangreich Aspekte der eigenen Biografie in den Text mit einbezogen hat. Elfriede Jelinek ist mehr denn je anwesend in ihrem Text, dies aber auch nur deshalb, weil er sich aufgrund seines Erscheinens im Internet als vorhanden und abwesend zugleich erweist, jederzeit im weltweiten Netz verschwinden oder daraus entfernt werden kann. ãGespensterhaftã nennt Jelinek diese Erscheinungsform, die Autorin, ErzûÊhlerin, den Roman und die darin enthaltenen figuralen RestbestûÊnde und Themen eint. Untot sind die Ich-ErzûÊhlerin, ihre Hauptfigur Brigitte K. oder auch die Opfer in der nationalsozialistischen Vergangenheit des Ortes Erzberg, dem fiktiven Schauplatz des Romans. Hier wird nach dem Niedergang des Erzbergbaus und dem Abbau von ArbeitsplûÊtzen um Einwohner und Touristen gekûÊmpft. Vorlage ist Eisenerz in der Steiermark, dessen Bemû¥hungen um Fremdenverkehr im Text in den grotesken Gegensatz zur ûÑsterreichischen Einwanderungspolitik oder dem sogenannten Eisenerzer Todesmarsch gerû¥ckt werden, bei dem 1945 mehrere tausend Juden umkamen. In Erzberg lebt auch Brigitte K., Geigenlehrerin, betrogene Ehefrau, hintergangene Geliebte und phantomhafte Protagonistin des Romans. Ihre Existenz als lebende Tote und schlieûlich MûÑrderin scheint in Neid ebenso auf, wie aktuelles Geschehen, etwa die FûÊlle Natascha Kampusch oder Amstetten. Im Redefluss der ErzûÊhlerin bleibt wenig unberû¥hrt, das ErzûÊhlte aber letztlich hinter dem ErzûÊhlen selbst zurû¥ck. "Neid" ist vor allem Rede-Roman: Stilisierte Mû¥ndlichkeit, ausgestellte Zerstreutheit, stûÊndiges Neu-Ansetzen, Abschweifen und das Unterlaufen von Gliederungseinheiten wie Kapitel und Unterkapitel markieren die Verweigerung eines Heimischwerdens in intakter ErzûÊhlung oder Eindeutigkeit. Das sprechende Ich blickt zwar auf die es umgebende Welt und hûÊlt dieser den Spiegel vor. Die Sprecherin wird im ausgefeilten Redeschwall aber vor allem zur permanenten Beobachterin ihrer selbst. In der HûÑrspielfassung des Bayerischen Rundfunks leiht Sophie Rois diesem performativen ErzûÊhlen ihre Stimme und û¥berfû¥hrt die Sprache des Romans vom flû¥chtigen Internet-Text-KûÑrper in den stimmlichen Klangraum. Dieser verbleibt schlieûlich durch das Angebot der 10 Teile von "Neid" als Download im HûÑrspiel Pool in seinem genuinen Medium. Nicht in Form privater Lektû¥re und geordneter Leseakte, sondern in ûquivalenz zur Rezeption von Texten im Netz erfûÊhrt der HûÑrer in der HûÑrspielfassung Wege und Umwege, Verknû¥pfungen und HûÊnger der Suchmaschine "Neid". |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 23.09.2016
Datum: 23.09.2016Länge: 00:55:40 Größe: 50.97 MB |
||
| Eran Schaerf: Ich hatte das Radio an - 23.09.2016 | ||
| Mit Tim Heller / Musik: Normal Love/Pauline Boudry, Ben Kaan / BR 2016 / LûÊnge: 30'58 // "Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Das ist wirklich nichts Neues, bringt aber gelegentlich Neues hervor, jedenfalls bei uns - willkommen bei 'NûÊher dran', heute aus Berlin. Am Mikrofon begrû¥ût Sie wieder der Notdienstsprecher Paul Esterhazy, voller Hoffnung, dass Sie fû¥r aktuelle Ereignisse ein Ohr haben, das auch fû¥r das offen bleibt, was eigentlich nicht gesendet werden soll..." | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 23.09.2016
Datum: 23.09.2016Länge: 00:31:04 Größe: 28.45 MB |
||
| Ulrich Lampen: Helmut Heiûenbû¥ttels "Zwei oder PortrûÊts" 2016 - 17.09.2016 | ||
| BR 2016 | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 17.09.2016
Datum: 17.09.2016Länge: 00:08:04 Größe: 7.39 MB |
||
| Klaus Ramm: Von der auûergewûÑhnlichen Entstehungsgeschichte der "Zwei oder drei PortrûÊts" von Helmut Heiûenbû¥ttel - 17.09.2016 | ||
| BR 2016 | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 17.09.2016
Datum: 17.09.2016Länge: 00:15:47 Größe: 14.46 MB |
||
| Helmut Heiûenbû¥ttel: Zwei oder drei PortrûÊts - 17.09.2016 | ||
| Mit Sebastian Blomberg, Wiebke Puls und Udo Samel / Regie: Ulrich Lampen / BR 2016 / LûÊnge: 41ã45 // "Woraus setzt sich das Bild eines Menschen zusammen? Aus Eindrû¥cken oder aus SûÊtzen?" Mit dieser Frage kû¥ndigte der Bayerische Rundfunk 1970 das erste HûÑrspiel Helmut Heiûenbû¥ttels an: "Zwei oder drei PortrûÊts". Der Bû¥chner-PreistrûÊger hatte nûÊmlich der HûÑrspielredaktion - zu der Zeit noch eine kleine Provokation - nur eine Ansammlung von SûÊtzen geliefert, auf beliebig viele Sprecher zu verteilen: keine Rollen, keine Handlung, sondern nur Gerede, unbestimmte Aussagen, stereotype Beschreibungen, Widersprû¥che und Wiederholungen. Die Redefetzen scheinen zuerst einen Kunstkritiker zu umkreisen, dann eine zweite Person, einen jungen Maler, und anschlieûend stellte Heiûenbû¥ttel die Frage, ob sich ãvielleicht aus Teilen dieser beiden PortrûÊts ein noch kû¥nstlicheres drittes bildenã lieûe. Als die Produktion dann û¥berraschend den renommierten HûÑrspielpreis der Kriegsblinden erhielt, bestand Heiûenbû¥ttel darauf, dass der Dramaturg HansjûÑrg Schmitthenner und der Regisseur Heinz Hostnig mit ihm gemeinsam als Autoren ausgezeichnet wurden, denn die beiden hatten ã mit Schere, Klebstoff und stereophoner Phantasie ã aus dem Textmaterial heraus tatsûÊchlich zwei PortrûÊts und nebenbei ein neues drittes entstehen lassen: ein ernstes und amû¥santes Spiel mit den Mechanismen unseres tagtûÊglichen Sprechens und mit der Illusion von der IdentitûÊt des Subjekts, das in seinen satirischen ObertûÑnen auch die kulturpolitische Situation um 1968 anklingen lieû. Zwanzig Jahre nach dem Tod von Helmut Heiûenbû¥ttel, der in Theorie und Praxis die Entwicklung des HûÑrspiels in der Bundesrepublik maûgeblich geprûÊgt hat, werden die "Zwei oder drei PortrûÊts" noch einmal zur Diskussion gestellt: in der Originalversion von 1970 mit einem kurzen Essay von Klaus Ramm, der die ungewûÑhnliche Entstehungsgeschichte nachzeichnet, und vor allem in einer neuen, aktuellen Fassung. Wie sieht im Jahr 2016 ein HûÑrspiel aus, das sich noch einmal auf Heiûenbû¥ttels Versuchsanordnung einlûÊsst und das im Archiv entdeckte und rekonstruierte Ausgangsmaterial von damals verwendet? | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 17.09.2016
Datum: 17.09.2016Länge: 00:41:51 Größe: 38.32 MB |
||
| Elfriede Jelinek: Neid (06/10) - 16.09.2016 | ||
| Mit Sophie Rois, Elfriede Jelinek / Komposition: Frode Haltli/Maja Ratkje / Bearbeitung und Regie: Karl Bruckmaier / BR 2011 // Fortsetzungsroman, Bekenntnisliteratur, Kû¥nstlerinnenroman, Autobiografie, Internet-Tagebuch - Elfriede Jelineks Literatur strûÊubt sich seit jeher gegen eindeutige Zuschreibungen und mit ihrem Roman "Neid" ist das nicht anders. Zwischen dem 3. MûÊrz 2007 und dem 24. April 2008 hat die Autorin ca. 936 Seiten Text unter der Gattungsbezeichnung ãPrivatromanã online gestellt. Privat ist der Text zunûÊchst deshalb, weil er unabhûÊngig von einem Verlag direkt dem Leser û¥bereignet wird. Dieser soll das Werk gar nicht erst ausdrucken, sondern laut Gebrauchsanweisung am Bildschirm eines Computers, eines E-Books oder am Display eines Handys lesen, kurz: damit machen, was er will. Ein Privatroman ist "Neid" aber auch, weil die Autorin sehr umfangreich Aspekte der eigenen Biografie in den Text mit einbezogen hat. Elfriede Jelinek ist mehr denn je anwesend in ihrem Text, dies aber auch nur deshalb, weil er sich aufgrund seines Erscheinens im Internet als vorhanden und abwesend zugleich erweist, jederzeit im weltweiten Netz verschwinden oder daraus entfernt werden kann. ãGespensterhaftã nennt Jelinek diese Erscheinungsform, die Autorin, ErzûÊhlerin, den Roman und die darin enthaltenen figuralen RestbestûÊnde und Themen eint. Untot sind die Ich-ErzûÊhlerin, ihre Hauptfigur Brigitte K. oder auch die Opfer in der nationalsozialistischen Vergangenheit des Ortes Erzberg, dem fiktiven Schauplatz des Romans. Hier wird nach dem Niedergang des Erzbergbaus und dem Abbau von ArbeitsplûÊtzen um Einwohner und Touristen gekûÊmpft. Vorlage ist Eisenerz in der Steiermark, dessen Bemû¥hungen um Fremdenverkehr im Text in den grotesken Gegensatz zur ûÑsterreichischen Einwanderungspolitik oder dem sogenannten Eisenerzer Todesmarsch gerû¥ckt werden, bei dem 1945 mehrere tausend Juden umkamen. In Erzberg lebt auch Brigitte K., Geigenlehrerin, betrogene Ehefrau, hintergangene Geliebte und phantomhafte Protagonistin des Romans. Ihre Existenz als lebende Tote und schlieûlich MûÑrderin scheint in Neid ebenso auf, wie aktuelles Geschehen, etwa die FûÊlle Natascha Kampusch oder Amstetten. Im Redefluss der ErzûÊhlerin bleibt wenig unberû¥hrt, das ErzûÊhlte aber letztlich hinter dem ErzûÊhlen selbst zurû¥ck. "Neid" ist vor allem Rede-Roman: Stilisierte Mû¥ndlichkeit, ausgestellte Zerstreutheit, stûÊndiges Neu-Ansetzen, Abschweifen und das Unterlaufen von Gliederungseinheiten wie Kapitel und Unterkapitel markieren die Verweigerung eines Heimischwerdens in intakter ErzûÊhlung oder Eindeutigkeit. Das sprechende Ich blickt zwar auf die es umgebende Welt und hûÊlt dieser den Spiegel vor. Die Sprecherin wird im ausgefeilten Redeschwall aber vor allem zur permanenten Beobachterin ihrer selbst. In der HûÑrspielfassung des Bayerischen Rundfunks leiht Sophie Rois diesem performativen ErzûÊhlen ihre Stimme und û¥berfû¥hrt die Sprache des Romans vom flû¥chtigen Internet-Text-KûÑrper in den stimmlichen Klangraum. Dieser verbleibt schlieûlich durch das Angebot der 10 Teile von "Neid" als Download im HûÑrspiel Pool in seinem genuinen Medium. Nicht in Form privater Lektû¥re und geordneter Leseakte, sondern in ûquivalenz zur Rezeption von Texten im Netz erfûÊhrt der HûÑrer in der HûÑrspielfassung Wege und Umwege, Verknû¥pfungen und HûÊnger der Suchmaschine "Neid". | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 16.09.2016
Datum: 16.09.2016Länge: 00:54:09 Größe: 49.58 MB |
||
| ARD Radio Tatort: Robert Hû¥ltner: Unten am Fluss - 14.09.2016 | ||
|
Mit Brigitte Hobmeier, Florian Karlheim, Eisi Gulp u.a. / Komposition: zeitblom / Regie: Ulrich Lampen / BR 2016 // Mehrere Brandherde bei einem Groûfeuer in der Brucker Altstadt, bei dem eine betagte Mieterin ums Leben kam - fû¥r die Kripo ist dies ein untrû¥gliches Indiz fû¥r gezielte Brandstiftung. Da das Opfer beraubt wurde, erhûÊrtet sich der Verdacht. Nachdem das Diebesgut wenig spûÊter in der Wohnung eines nach langer Haftzeit entlassenen BankrûÊubers entdeckt wird, sind alle Zweifel restlos beseitigt. WûÊhrend die Kripo ermittelt, schlagen sich die Beamten der Polizeiinspektion Bruck am Inn mit ihren alltûÊglichen Problemen herum. Das geringere davon ist noch, dass der alte Luk, das liebenswert-stûÑrrische Brucker Original, wieder einmal seit Tagen nicht mehr auffindbar ist. Revierleiter ûttl empûÑrt vor allem, dass seit Tagen anonyme InterneteintrûÊge kursieren, in denen der Polizei vorgeworfen wird, Informationen û¥ber die wahren Brandstifter und RaubmûÑrder zu verschweigen und die ûffentlichkeit zu belû¥gen. Er erteilt Senta und Rudi den Auftrag, die Urheber dieses Gerû¥chts auszuforschen und zur Verantwortung zu ziehen. Von all dem bekommt Luk, der sich wieder in seine Eremitage am Ufer des Inns zurû¥ckgezogen hat und in der Waldeinsamkeit û¥ber Welt und Leben philosophiert, nichts mit. Eines Tages erhûÊlt er einen Besuch von seinem Jugendfreund Harry, der nach langer Abwesenheit nach Bruck am Inn zurû¥ck gekehrt ist. Auf die weinselige Wiedersehensfreude fûÊllt jedoch bald ein Schatten, als sich die Kripo auf Harry als HauptverdûÊchtigen einzuschieûen beginnt und ihn schlieûlich festnimmt. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 14.09.2016
Datum: 14.09.2016Länge: 00:53:26 Größe: 48.93 MB |
||
| Elfriede Jelinek: Neid (05/10) - 09.09.2016 | ||
| Mit Sophie Rois, Elfriede Jelinek / Komposition: Frode Haltli/Maja Ratkje / Bearbeitung und Regie: Karl Bruckmaier / BR 2011 // Fortsetzungsroman, Bekenntnisliteratur, Kû¥nstlerinnenroman, Autobiografie, Internet-Tagebuch - Elfriede Jelineks Literatur strûÊubt sich seit jeher gegen eindeutige Zuschreibungen und mit ihrem Roman "Neid" ist das nicht anders. Zwischen dem 3. MûÊrz 2007 und dem 24. April 2008 hat die Autorin ca. 936 Seiten Text unter der Gattungsbezeichnung ãPrivatromanã online gestellt. Privat ist der Text zunûÊchst deshalb, weil er unabhûÊngig von einem Verlag direkt dem Leser û¥bereignet wird. Dieser soll das Werk gar nicht erst ausdrucken, sondern laut Gebrauchsanweisung am Bildschirm eines Computers, eines E-Books oder am Display eines Handys lesen, kurz: damit machen, was er will. Ein Privatroman ist "Neid" aber auch, weil die Autorin sehr umfangreich Aspekte der eigenen Biografie in den Text mit einbezogen hat. Elfriede Jelinek ist mehr denn je anwesend in ihrem Text, dies aber auch nur deshalb, weil er sich aufgrund seines Erscheinens im Internet als vorhanden und abwesend zugleich erweist, jederzeit im weltweiten Netz verschwinden oder daraus entfernt werden kann. ãGespensterhaftã nennt Jelinek diese Erscheinungsform, die Autorin, ErzûÊhlerin, den Roman und die darin enthaltenen figuralen RestbestûÊnde und Themen eint. Untot sind die Ich-ErzûÊhlerin, ihre Hauptfigur Brigitte K. oder auch die Opfer in der nationalsozialistischen Vergangenheit des Ortes Erzberg, dem fiktiven Schauplatz des Romans. Hier wird nach dem Niedergang des Erzbergbaus und dem Abbau von ArbeitsplûÊtzen um Einwohner und Touristen gekûÊmpft. Vorlage ist Eisenerz in der Steiermark, dessen Bemû¥hungen um Fremdenverkehr im Text in den grotesken Gegensatz zur ûÑsterreichischen Einwanderungspolitik oder dem sogenannten Eisenerzer Todesmarsch gerû¥ckt werden, bei dem 1945 mehrere tausend Juden umkamen. In Erzberg lebt auch Brigitte K., Geigenlehrerin, betrogene Ehefrau, hintergangene Geliebte und phantomhafte Protagonistin des Romans. Ihre Existenz als lebende Tote und schlieûlich MûÑrderin scheint in Neid ebenso auf, wie aktuelles Geschehen, etwa die FûÊlle Natascha Kampusch oder Amstetten. Im Redefluss der ErzûÊhlerin bleibt wenig unberû¥hrt, das ErzûÊhlte aber letztlich hinter dem ErzûÊhlen selbst zurû¥ck. "Neid" ist vor allem Rede-Roman: Stilisierte Mû¥ndlichkeit, ausgestellte Zerstreutheit, stûÊndiges Neu-Ansetzen, Abschweifen und das Unterlaufen von Gliederungseinheiten wie Kapitel und Unterkapitel markieren die Verweigerung eines Heimischwerdens in intakter ErzûÊhlung oder Eindeutigkeit. Das sprechende Ich blickt zwar auf die es umgebende Welt und hûÊlt dieser den Spiegel vor. Die Sprecherin wird im ausgefeilten Redeschwall aber vor allem zur permanenten Beobachterin ihrer selbst. In der HûÑrspielfassung des Bayerischen Rundfunks leiht Sophie Rois diesem performativen ErzûÊhlen ihre Stimme und û¥berfû¥hrt die Sprache des Romans vom flû¥chtigen Internet-Text-KûÑrper in den stimmlichen Klangraum. Dieser verbleibt schlieûlich durch das Angebot der 10 Teile von "Neid" als Download im HûÑrspiel Pool in seinem genuinen Medium. Nicht in Form privater Lektû¥re und geordneter Leseakte, sondern in ûquivalenz zur Rezeption von Texten im Netz erfûÊhrt der HûÑrer in der HûÑrspielfassung Wege und Umwege, Verknû¥pfungen und HûÊnger der Suchmaschine "Neid". | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 09.09.2016
Datum: 09.09.2016Länge: 00:53:55 Größe: 49.37 MB |
||
| Raphael Montanez Ortiz: Duncan Terrace Piano Destruction Concert London 1966 - 09.09.2016 | ||
| Destruction in Art Symposium, 10.09.1966 / LûÊnge: 25'23 // Zu hûÑren ist, wie der Kû¥nstler Raphael MontaûÝez Ortiz beim "Destruction in Art Symposium" in London 1966 ein Piano mit einer Axt zertrû¥mmert. Es ist das rare Dokument eines kunstgeschichtlich wichtigen Symposiums, das die Destruktionskunst erstmals als internationale ZeitstrûÑmung sichtbar machte. Initiator war der in Nû¥rnberg geborene Kû¥nstler Gustav Metzger - Sohn jû¥discher Eltern, die Opfer des Holocaust wurden. Pete Townshends GitarrenzerstûÑrungen gehen auf Metzgers Konzept der Destruktionskunst zurû¥ck. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 09.09.2016
Datum: 09.09.2016Länge: 00:25:31 Größe: 23.37 MB |
||
| Loopspool: Beschleunigter Zerfall. Piano Destruction Concert 1966. Remix - 09.09.2016 | ||
|
BR 2008 / LûÊnge: 25'13 / Der BR und intermedium records prûÊsentieren mit "Beschleunigter Zerfall" den Remix einer originalen Aufnahme einer Pianozertrû¥mmerung durch Raphael Ortiz, genauer des "Piano Destruction Concert 1966". Seit Mitte der 60er Jahre realisierte Ralph Ortiz ã wie er sich damals nannte ã ûÑffentlich Klavier-, Stuhl- und Matratzendestruktionen. Seine kû¥nstlerische Entwicklung nahm ihren Weg von der Malerei und der Filmmontage û¥ber die Objektkunst zum Destruktionsprozess. Loopspool notiert zur Arbeit an seinem Remix: ãAls Ortiz 1966 einen Konzertflû¥gel zerschlug, zerstûÑrte er nicht nur ein Instrument das eine Aura der Erhabenheit und Unantastbarkeit umgibt, sondern er fû¥hrte ein Symbol auf sein Materie zurû¥ck, um eine Zeit einzuleiten, in der die Kunst auf einem Fundus dekonstruierter Symbole zurû¥ckgreifen kann. Aus diesem Materialfundus schûÑpfe ich fû¥r meine musikalische Arbeit.ã |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 09.09.2016
Datum: 09.09.2016Länge: 00:25:20 Größe: 23.20 MB |
||
| Elfriede Jelinek: Neid (04/10) - 02.09.2016 | ||
| Mit Sophie Rois, Elfriede Jelinek / Komposition: Frode Haltli/Maja Ratkje / Bearbeitung und Regie: Karl Bruckmaier / BR 2011 // Fortsetzungsroman, Bekenntnisliteratur, Kû¥nstlerinnenroman, Autobiografie, Internet-Tagebuch - Elfriede Jelineks Literatur strûÊubt sich seit jeher gegen eindeutige Zuschreibungen und mit ihrem Roman "Neid" ist das nicht anders. Zwischen dem 3. MûÊrz 2007 und dem 24. April 2008 hat die Autorin ca. 936 Seiten Text unter der Gattungsbezeichnung ãPrivatromanã online gestellt. Privat ist der Text zunûÊchst deshalb, weil er unabhûÊngig von einem Verlag direkt dem Leser û¥bereignet wird. Dieser soll das Werk gar nicht erst ausdrucken, sondern laut Gebrauchsanweisung am Bildschirm eines Computers, eines E-Books oder am Display eines Handys lesen, kurz: damit machen, was er will. Ein Privatroman ist "Neid" aber auch, weil die Autorin sehr umfangreich Aspekte der eigenen Biografie in den Text mit einbezogen hat. Elfriede Jelinek ist mehr denn je anwesend in ihrem Text, dies aber auch nur deshalb, weil er sich aufgrund seines Erscheinens im Internet als vorhanden und abwesend zugleich erweist, jederzeit im weltweiten Netz verschwinden oder daraus entfernt werden kann. ãGespensterhaftã nennt Jelinek diese Erscheinungsform, die Autorin, ErzûÊhlerin, den Roman und die darin enthaltenen figuralen RestbestûÊnde und Themen eint. Untot sind die Ich-ErzûÊhlerin, ihre Hauptfigur Brigitte K. oder auch die Opfer in der nationalsozialistischen Vergangenheit des Ortes Erzberg, dem fiktiven Schauplatz des Romans. Hier wird nach dem Niedergang des Erzbergbaus und dem Abbau von ArbeitsplûÊtzen um Einwohner und Touristen gekûÊmpft. Vorlage ist Eisenerz in der Steiermark, dessen Bemû¥hungen um Fremdenverkehr im Text in den grotesken Gegensatz zur ûÑsterreichischen Einwanderungspolitik oder dem sogenannten Eisenerzer Todesmarsch gerû¥ckt werden, bei dem 1945 mehrere tausend Juden umkamen. In Erzberg lebt auch Brigitte K., Geigenlehrerin, betrogene Ehefrau, hintergangene Geliebte und phantomhafte Protagonistin des Romans. Ihre Existenz als lebende Tote und schlieûlich MûÑrderin scheint in Neid ebenso auf, wie aktuelles Geschehen, etwa die FûÊlle Natascha Kampusch oder Amstetten. Im Redefluss der ErzûÊhlerin bleibt wenig unberû¥hrt, das ErzûÊhlte aber letztlich hinter dem ErzûÊhlen selbst zurû¥ck. "Neid" ist vor allem Rede-Roman: Stilisierte Mû¥ndlichkeit, ausgestellte Zerstreutheit, stûÊndiges Neu-Ansetzen, Abschweifen und das Unterlaufen von Gliederungseinheiten wie Kapitel und Unterkapitel markieren die Verweigerung eines Heimischwerdens in intakter ErzûÊhlung oder Eindeutigkeit. Das sprechende Ich blickt zwar auf die es umgebende Welt und hûÊlt dieser den Spiegel vor. Die Sprecherin wird im ausgefeilten Redeschwall aber vor allem zur permanenten Beobachterin ihrer selbst. In der HûÑrspielfassung des Bayerischen Rundfunks leiht Sophie Rois diesem performativen ErzûÊhlen ihre Stimme und û¥berfû¥hrt die Sprache des Romans vom flû¥chtigen Internet-Text-KûÑrper in den stimmlichen Klangraum. Dieser verbleibt schlieûlich durch das Angebot der 10 Teile von "Neid" als Download im HûÑrspiel Pool in seinem genuinen Medium. Nicht in Form privater Lektû¥re und geordneter Leseakte, sondern in ûquivalenz zur Rezeption von Texten im Netz erfûÊhrt der HûÑrer in der HûÑrspielfassung Wege und Umwege, Verknû¥pfungen und HûÊnger der Suchmaschine "Neid". | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 02.09.2016
Datum: 02.09.2016Länge: 00:57:19 Größe: 52.49 MB |
||
| Elfriede Jelinek: Neid (03/10) - 26.08.2016 | ||
|
Mit Sophie Rois, Elfriede Jelinek / Komposition: Frode Haltli/Maja Ratkje / Bearbeitung und Regie: Karl Bruckmaier / BR 2011 // Fortsetzungsroman, Bekenntnisliteratur, Kû¥nstlerinnenroman, Autobiografie, Internet-Tagebuch - Elfriede Jelineks Literatur strûÊubt sich seit jeher gegen eindeutige Zuschreibungen und mit ihrem Roman "Neid" ist das nicht anders. Zwischen dem 3. MûÊrz 2007 und dem 24. April 2008 hat die Autorin ca. 936 Seiten Text unter der Gattungsbezeichnung ãPrivatromanã online gestellt. Privat ist der Text zunûÊchst deshalb, weil er unabhûÊngig von einem Verlag direkt dem Leser û¥bereignet wird. Dieser soll das Werk gar nicht erst ausdrucken, sondern laut Gebrauchsanweisung am Bildschirm eines Computers, eines E-Books oder am Display eines Handys lesen, kurz: damit machen, was er will. Ein Privatroman ist "Neid" aber auch, weil die Autorin sehr umfangreich Aspekte der eigenen Biografie in den Text mit einbezogen hat. Elfriede Jelinek ist mehr denn je anwesend in ihrem Text, dies aber auch nur deshalb, weil er sich aufgrund seines Erscheinens im Internet als vorhanden und abwesend zugleich erweist, jederzeit im weltweiten Netz verschwinden oder daraus entfernt werden kann. ãGespensterhaftã nennt Jelinek diese Erscheinungsform, die Autorin, ErzûÊhlerin, den Roman und die darin enthaltenen figuralen RestbestûÊnde und Themen eint. Untot sind die Ich-ErzûÊhlerin, ihre Hauptfigur Brigitte K. oder auch die Opfer in der nationalsozialistischen Vergangenheit des Ortes Erzberg, dem fiktiven Schauplatz des Romans. Hier wird nach dem Niedergang des Erzbergbaus und dem Abbau von ArbeitsplûÊtzen um Einwohner und Touristen gekûÊmpft. Vorlage ist Eisenerz in der Steiermark, dessen Bemû¥hungen um Fremdenverkehr im Text in den grotesken Gegensatz zur ûÑsterreichischen Einwanderungspolitik oder dem sogenannten Eisenerzer Todesmarsch gerû¥ckt werden, bei dem 1945 mehrere tausend Juden umkamen. In Erzberg lebt auch Brigitte K., Geigenlehrerin, betrogene Ehefrau, hintergangene Geliebte und phantomhafte Protagonistin des Romans. Ihre Existenz als lebende Tote und schlieûlich MûÑrderin scheint in Neid ebenso auf, wie aktuelles Geschehen, etwa die FûÊlle Natascha Kampusch oder Amstetten. Im Redefluss der ErzûÊhlerin bleibt wenig unberû¥hrt, das ErzûÊhlte aber letztlich hinter dem ErzûÊhlen selbst zurû¥ck. "Neid" ist vor allem Rede-Roman: Stilisierte Mû¥ndlichkeit, ausgestellte Zerstreutheit, stûÊndiges Neu-Ansetzen, Abschweifen und das Unterlaufen von Gliederungseinheiten wie Kapitel und Unterkapitel markieren die Verweigerung eines Heimischwerdens in intakter ErzûÊhlung oder Eindeutigkeit. Das sprechende Ich blickt zwar auf die es umgebende Welt und hûÊlt dieser den Spiegel vor. Die Sprecherin wird im ausgefeilten Redeschwall aber vor allem zur permanenten Beobachterin ihrer selbst. In der HûÑrspielfassung des Bayerischen Rundfunks leiht Sophie Rois diesem performativen ErzûÊhlen ihre Stimme und û¥berfû¥hrt die Sprache des Romans vom flû¥chtigen Internet-Text-KûÑrper in den stimmlichen Klangraum. Dieser verbleibt schlieûlich durch das Angebot der 10 Teile von "Neid" als Download im HûÑrspiel Pool in seinem genuinen Medium. Nicht in Form privater Lektû¥re und geordneter Leseakte, sondern in ûquivalenz zur Rezeption von Texten im Netz erfûÊhrt der HûÑrer in der HûÑrspielfassung Wege und Umwege, Verknû¥pfungen und HûÊnger der Suchmaschine "Neid". |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 26.08.2016
Datum: 26.08.2016Länge: 00:58:06 Größe: 53.20 MB |
||
| Elfriede Jelinek: Neid (02/10) - 19.08.2016 | ||
|
Mit Sophie Rois, Elfriede Jelinek / Komposition: Frode Haltli/Maja Ratkje / Bearbeitung und Regie: Karl Bruckmaier / BR 2011 // Fortsetzungsroman, Bekenntnisliteratur, Kû¥nstlerinnenroman, Autobiografie, Internet-Tagebuch - Elfriede Jelineks Literatur strûÊubt sich seit jeher gegen eindeutige Zuschreibungen und mit ihrem Roman "Neid" ist das nicht anders. Zwischen dem 3. MûÊrz 2007 und dem 24. April 2008 hat die Autorin ca. 936 Seiten Text unter der Gattungsbezeichnung ãPrivatromanã online gestellt. Privat ist der Text zunûÊchst deshalb, weil er unabhûÊngig von einem Verlag direkt dem Leser û¥bereignet wird. Dieser soll das Werk gar nicht erst ausdrucken, sondern laut Gebrauchsanweisung am Bildschirm eines Computers, eines E-Books oder am Display eines Handys lesen, kurz: damit machen, was er will. Ein Privatroman ist "Neid" aber auch, weil die Autorin sehr umfangreich Aspekte der eigenen Biografie in den Text mit einbezogen hat. Elfriede Jelinek ist mehr denn je anwesend in ihrem Text, dies aber auch nur deshalb, weil er sich aufgrund seines Erscheinens im Internet als vorhanden und abwesend zugleich erweist, jederzeit im weltweiten Netz verschwinden oder daraus entfernt werden kann. ãGespensterhaftã nennt Jelinek diese Erscheinungsform, die Autorin, ErzûÊhlerin, den Roman und die darin enthaltenen figuralen RestbestûÊnde und Themen eint. Untot sind die Ich-ErzûÊhlerin, ihre Hauptfigur Brigitte K. oder auch die Opfer in der nationalsozialistischen Vergangenheit des Ortes Erzberg, dem fiktiven Schauplatz des Romans. Hier wird nach dem Niedergang des Erzbergbaus und dem Abbau von ArbeitsplûÊtzen um Einwohner und Touristen gekûÊmpft. Vorlage ist Eisenerz in der Steiermark, dessen Bemû¥hungen um Fremdenverkehr im Text in den grotesken Gegensatz zur ûÑsterreichischen Einwanderungspolitik oder dem sogenannten Eisenerzer Todesmarsch gerû¥ckt werden, bei dem 1945 mehrere tausend Juden umkamen. In Erzberg lebt auch Brigitte K., Geigenlehrerin, betrogene Ehefrau, hintergangene Geliebte und phantomhafte Protagonistin des Romans. Ihre Existenz als lebende Tote und schlieûlich MûÑrderin scheint in Neid ebenso auf, wie aktuelles Geschehen, etwa die FûÊlle Natascha Kampusch oder Amstetten. Im Redefluss der ErzûÊhlerin bleibt wenig unberû¥hrt, das ErzûÊhlte aber letztlich hinter dem ErzûÊhlen selbst zurû¥ck. "Neid" ist vor allem Rede-Roman: Stilisierte Mû¥ndlichkeit, ausgestellte Zerstreutheit, stûÊndiges Neu-Ansetzen, Abschweifen und das Unterlaufen von Gliederungseinheiten wie Kapitel und Unterkapitel markieren die Verweigerung eines Heimischwerdens in intakter ErzûÊhlung oder Eindeutigkeit. Das sprechende Ich blickt zwar auf die es umgebende Welt und hûÊlt dieser den Spiegel vor. Die Sprecherin wird im ausgefeilten Redeschwall aber vor allem zur permanenten Beobachterin ihrer selbst. In der HûÑrspielfassung des Bayerischen Rundfunks leiht Sophie Rois diesem performativen ErzûÊhlen ihre Stimme und û¥berfû¥hrt die Sprache des Romans vom flû¥chtigen Internet-Text-KûÑrper in den stimmlichen Klangraum. Dieser verbleibt schlieûlich durch das Angebot der 10 Teile von "Neid" als Download im HûÑrspiel Pool in seinem genuinen Medium. Nicht in Form privater Lektû¥re und geordneter Leseakte, sondern in ûquivalenz zur Rezeption von Texten im Netz erfûÊhrt der HûÑrer in der HûÑrspielfassung Wege und Umwege, Verknû¥pfungen und HûÊnger der Suchmaschine "Neid". |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 19.08.2016
Datum: 19.08.2016Länge: 00:53:16 Größe: 48.77 MB |
||
| Elfriede Jelinek: Neid (01/10) - 12.08.2016 | ||
| Mit Sophie Rois, Elfriede Jelinek / Komposition: Frode Haltli/Maja Ratkje / Bearbeitung und Regie: Karl Bruckmaier / BR 2011 // Fortsetzungsroman, Bekenntnisliteratur, Kû¥nstlerinnenroman, Autobiografie, Internet-Tagebuch - Elfriede Jelineks Literatur strûÊubt sich seit jeher gegen eindeutige Zuschreibungen und mit ihrem Roman "Neid" ist das nicht anders. Zwischen dem 3. MûÊrz 2007 und dem 24. April 2008 hat die Autorin ca. 936 Seiten Text unter der Gattungsbezeichnung ãPrivatromanã online gestellt. Privat ist der Text zunûÊchst deshalb, weil er unabhûÊngig von einem Verlag direkt dem Leser û¥bereignet wird. Dieser soll das Werk gar nicht erst ausdrucken, sondern laut Gebrauchsanweisung am Bildschirm eines Computers, eines E-Books oder am Display eines Handys lesen, kurz: damit machen, was er will. Ein Privatroman ist "Neid" aber auch, weil die Autorin sehr umfangreich Aspekte der eigenen Biografie in den Text mit einbezogen hat. Elfriede Jelinek ist mehr denn je anwesend in ihrem Text, dies aber auch nur deshalb, weil er sich aufgrund seines Erscheinens im Internet als vorhanden und abwesend zugleich erweist, jederzeit im weltweiten Netz verschwinden oder daraus entfernt werden kann. ãGespensterhaftã nennt Jelinek diese Erscheinungsform, die Autorin, ErzûÊhlerin, den Roman und die darin enthaltenen figuralen RestbestûÊnde und Themen eint. Untot sind die Ich-ErzûÊhlerin, ihre Hauptfigur Brigitte K. oder auch die Opfer in der nationalsozialistischen Vergangenheit des Ortes Erzberg, dem fiktiven Schauplatz des Romans. Hier wird nach dem Niedergang des Erzbergbaus und dem Abbau von ArbeitsplûÊtzen um Einwohner und Touristen gekûÊmpft. Vorlage ist Eisenerz in der Steiermark, dessen Bemû¥hungen um Fremdenverkehr im Text in den grotesken Gegensatz zur ûÑsterreichischen Einwanderungspolitik oder dem sogenannten Eisenerzer Todesmarsch gerû¥ckt werden, bei dem 1945 mehrere tausend Juden umkamen. In Erzberg lebt auch Brigitte K., Geigenlehrerin, betrogene Ehefrau, hintergangene Geliebte und phantomhafte Protagonistin des Romans. Ihre Existenz als lebende Tote und schlieûlich MûÑrderin scheint in Neid ebenso auf, wie aktuelles Geschehen, etwa die FûÊlle Natascha Kampusch oder Amstetten. Im Redefluss der ErzûÊhlerin bleibt wenig unberû¥hrt, das ErzûÊhlte aber letztlich hinter dem ErzûÊhlen selbst zurû¥ck. "Neid" ist vor allem Rede-Roman: Stilisierte Mû¥ndlichkeit, ausgestellte Zerstreutheit, stûÊndiges Neu-Ansetzen, Abschweifen und das Unterlaufen von Gliederungseinheiten wie Kapitel und Unterkapitel markieren die Verweigerung eines Heimischwerdens in intakter ErzûÊhlung oder Eindeutigkeit. Das sprechende Ich blickt zwar auf die es umgebende Welt und hûÊlt dieser den Spiegel vor. Die Sprecherin wird im ausgefeilten Redeschwall aber vor allem zur permanenten Beobachterin ihrer selbst. In der HûÑrspielfassung des Bayerischen Rundfunks leiht Sophie Rois diesem performativen ErzûÊhlen ihre Stimme und û¥berfû¥hrt die Sprache des Romans vom flû¥chtigen Internet-Text-KûÑrper in den stimmlichen Klangraum. Dieser verbleibt schlieûlich durch das Angebot der 10 Teile von "Neid" als Download im HûÑrspiel Pool in seinem genuinen Medium. Nicht in Form privater Lektû¥re und geordneter Leseakte, sondern in ûquivalenz zur Rezeption von Texten im Netz erfûÊhrt der HûÑrer in der HûÑrspielfassung Wege und Umwege, Verknû¥pfungen und HûÊnger der Suchmaschine "Neid". | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 12.08.2016
Datum: 12.08.2016Länge: 00:54:54 Größe: 50.27 MB |
||
| Andreas Thom: Baal - 05.08.2016 | ||
|
Mit Wolfram Berger / Bearbeitung und Regie: Ulrich Gerhardt / BR 2016 / LûÊnge: 78'36 // Baal heiût im HebrûÊischen Herr, Meister, Besitzer, Ehemann, KûÑnig oder Gott. MûÑglich also, dass Ambros Maria Baal in dem Roman von Andreas Thom alle diese Epitheta wahnhaft auf sich beziehen mag. Andreas Thom nennt seinen expressionistischen Roman von 1918 Ambros Maria Baal allerdings "Roman einer Lû¥ge". Wo finden wir die Lû¥ge? Baal ist ein reiches Jû¥ngelchen, Sohn eines vermûÑgenden Bankiers, dem durch seine mehr als gesicherte Lebensgrundlage jedes Konzept fû¥r ein glû¥ckliches Leben fehlt. Folgerichtig glaubt er, das Leben habe ãnur einen einzigen Inhalt, und der ist animalisch: sich selbst zu erhalten. Wie der Einzelne das lûÑst, ist fû¥r den Zweck belanglosã. Indem man rigoros, meint Baal, sein Glû¥ck einfordert, und wenn es û¥ber Leichen geht. Da er in jeder Hinsicht von seinem Vater abhûÊngig ist, dessen Geld er deshalb hasst, kann der auch in jeder Hinsicht in sein Leben eingreifen: eine Heirat wird zur dynastischen Verfû¥gung angeordnet; die Mittel werden gekû¥rzt, wenn der Vaterhass û¥berhandnimmt. Die Zweckehe bietet beiden Eheleuten die MûÑglichkeit, ihrer gegenseitigen Abneigung durch ungehemmte Machtspiele zur Blû¥te zu verhelfen. Baal behûÊlt die Oberhand. Bevor Baal sich und das Erbe zugrunde richtet, zerstûÑrt er alle, von denen er abhûÊngt. Die HûÑrspielfassung folgt dem Roman in leicht gekû¥rzter Form. Die Herausforderung war es, dem expressionistischen Duktus, der Knappheit der Sprache zu folgen, Literatur Literatur bleiben zu lassen und nicht in szenische Opulenz zu verfallen. Das wurde durch Konzentration auf die Sprache durch EINE Stimme erreicht, die dennoch durch Montage aus unterschiedlichen Haltungen und Ebenen in radikaler Kû¥nstlichkeit prismenartig zusammengesetzt wird. Brecht soll von diesem Roman zu seinem Theaterstû¥ck und Titel Baal angeregt worden sein. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 05.08.2016
Datum: 05.08.2016Länge: 01:18:42 Größe: 72.07 MB |
||
| Raoul Schrott: Erste Erde Epos: XVI. Primaten - 30.07.2016 | ||
| Mit Patrick Gû¥ldenberg, Sophie von Kessel, Vera Teltz / Regie: Michael Farin / BR 2016 / LûÊnge: 52'43 // "Nie zuvor gab es so viel an Wissen û¥ber den Menschen und das Universum - doch je mehr Daten und Details angehûÊuft werden, desto weniger verstehen wir im Grunde. Wir wissen zwar, dass die alten Mythen nicht mehr stimmig sind - eine andere Geschichte, die uns und die Welt erklûÊrt, gibt es jedoch nicht." Raoul Schrott Eine deutsche Verhaltensforscherin fû¥hrt ein Vorstandsmitglied eines Schweizer Pharmakonzerns durch die Affengehege des Leipziger Zoos. Fasziniert vom SolitûÊren der Orang-Utans und der Gruppendynamik der Schimpansen und Bonobos entspinnt sich darauf zwischen beiden ein Dialog in Mails und Telefonaten û¥ber die Natur des Menschen. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 30.07.2016
Datum: 30.07.2016Länge: 00:52:49 Größe: 48.36 MB |
||
| Raoul Schrott: Erste Erde Epos: XIV. Zwischen den Welten - 23.07.2016 | ||
| Mit Florian von Manteuffel, Vera Teltz / Regie: Michael Farin / BR 2016 / LûÊnge: 52'44 // J"Nie zuvor gab es so viel an Wissen û¥ber den Menschen und das Universum - doch je mehr Daten und Details angehûÊuft werden, desto weniger verstehen wir im Grunde. Wir wissen zwar, dass die alten Mythen nicht mehr stimmig sind - eine andere Geschichte, die uns und die Welt erklûÊrt, gibt es jedoch nicht." Raoul Schrott Jahrelang hat ein im Land verbliebener Teilnehmer einer ûÑsterreichischen Brasilienexpedition fû¥r ein geplantes Museum die Fauna und Flora des Amazonasgebietes durchstreift und gesammelt. 1830 entdeckte er den Lungenfisch. In der Folge stritt die Wissenschaft, ob dieser noch den Fischen oder bereits den Amphibien zuzuordnen sei, und suchte nach Grû¥nden, weshalb er an Landgekommen war: Der Lungenfisch ist der nûÊchste noch lebende Verwandte eines Muskelflossers, den man 2004 auf Ellesmere Island in der kanadischen Arktis ausgegraben und Tiktaalik getauft hat. Dieser Spezies verdanken wir nicht nur unsere Lunge ã aus ihren knochigen Flossenstummeln gingen auch unsere Gliedmaûen hervor: Ober- und Unterschenkel beziehungsweise Oberarm, Elle und Speiche samt der Fû¥nfzahl unserer Finger und Zehen. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 23.07.2016
Datum: 23.07.2016Länge: 00:52:51 Größe: 48.39 MB |
||
| Raoul Schrott: Erste Erde Epos: XIII. Erste Pflanzen - 16.07.2016 | ||
| Mit Vera Teltz, Raoul Schrott / Regie: Michael Farin / BR 2016 / LûÊnge: 48'18 // "Nie zuvor gab es so viel an Wissen û¥ber den Menschen und das Universum - doch je mehr Daten und Details angehûÊuft werden, desto weniger verstehen wir im Grunde. Wir wissen zwar, dass die alten Mythen nicht mehr stimmig sind - eine andere Geschichte, die uns und die Welt erklûÊrt, gibt es jedoch nicht." Raoul Schrott Ein Vorarlberger Botaniker schildert die vor 500 Jahrmillionen beginnende Landnahme der Pflanzen und ihre Entstehung aus einer Grû¥nalgenart, deren Verwandte sich heute noch auf Gletscherfeldern und in alpinen Seen und Weihern finden. Er erzûÊhlt von einer Reise nach Irland zu der Fundstelle der ûÊltesten fossil erhaltenen Pflanze, vom Sein der BûÊume und von seiner an der Totgeburt eines Kindes zerbrochenen Ehe. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 16.07.2016
Datum: 16.07.2016Länge: 00:48:24 Größe: 44.32 MB |
||
| Erste Erde Forum: XIII. Die Entstehung der Pflanzen - Mit Michael Krings - 16.07.2016 | ||
| Raoul Schrott im GesprûÊch mit Michael Krings (PalûÊobotaniker) | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 16.07.2016
Datum: 16.07.2016Länge: 00:31:19 Größe: 28.68 MB |
||
| Erste Erde Forum: IX. Geologische Prozesse und Leben - Mit Gerhard WûÑrner - 15.07.2016 | ||
| Raoul Schrott im GesprûÊch mit dem Mineralogen, Geologen, Petrographen, Vulkanologen und Geochemiker Prof. Dr. Gerhard WûÑrner (BR 2015) | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 15.07.2016
Datum: 15.07.2016Länge: 00:33:34 Größe: 30.74 MB |
||
| Raoul Schrott: Erste Erde Epos: Exkurs - Abiogenesis - 09.07.2016 | ||
|
Mit Bibiana Beglau und Martin Umbach / Regie: Michael Farin / BR 2016 / LûÊnge: 42'58 // ãDie Wissenschaften untersuchen die Eigenschaften der Welt mittels Instrumenten, berechnen sie aufgrund von û¥berprû¥fbaren Theoremen und stellen KausalitûÊten fest; die Dichtung tut ûÊhnliches, auch sie vergleicht, muss in sich kohûÊrent sein und weist ihre eigenen Strukturen auf ã aber sie fû¥hrt alles zu uns und auf uns zurû¥ck. Da ist das Verlangen, mûÑglichst viel û¥ber die Welt zu wissen, und das ebenso groûe Verlangen, uns zu verstehen, im Innersten, als gûÊbe es eine Zeichenschrift, die, wenn sie sich entziffern lieûe, einem alles û¥ber uns verriete ã ohne dass alles jemals offenkundig werden wû¥rde: letztlich sind wir ebenso unverstûÊndlich wie Welt.ã (Raoul Schrott) |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 09.07.2016
Datum: 09.07.2016Länge: 00:43:04 Größe: 39.44 MB |
||
| Raoul Schrott: Erste Erde Epos: Epilog - Raoul Schrott û¥ber Erste Erde Epos - 09.07.2016 | ||
| GesprûÊch und Montage: Michael Farin / Aufnahme: 02.03.2016 in Mû¥nchen / BR 2016 / LûÊnge: 21'58 | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 09.07.2016
Datum: 09.07.2016Länge: 00:22:03 Größe: 20.20 MB |
||
| Kathrin RûÑggla: Normalverdiener - 03.07.2016 | ||
| Mit Martin Engler, Leslie Malton, Verena Unbehaun, Severin von Hoensbroech, Cornelius Schwalm, Heiko Scholz, Georg Scharegg, Ulrich Peltzer, Tony de Maeyer / Komposition: Bo Wiget / Regie: Leopold von Verschuer / BR 2016 // Sie sind Architekten, Unternehmer, Lebenskû¥nstler oder Bankrotteure. Sie stehen im Leben, manchmal daneben, wissen um die Anforderungen des Alltags und um ihre verlorenen Ideale. Sie sind GroûstûÊdter mit mehr oder weniger intakten Erwerbsbiographien. Karsten und Sandra, Tine und Normann, Sven, Johannes, Ueli oder Gebhart. Und so heterogen ihre WerdegûÊnge sind, so unterschiedlich ihre Geschichten sich anhûÑren, eines schweiût sie zusammen: sie sind anders als ER, der alte Freund, der es inzwischen zu sehr viel Geld gebracht und jetzt eine Einladung ausgesprochen hat. Fû¥r ein paar Tage soll es in seinem luxuriûÑsen Ferienressort zum Wiedersehen kommen. Eine Gelegenheit, die sie, die Normalverdiener, einfach nicht ausschlagen kûÑnnen. Und die Chance, sich diese Welt der spekulativen GroûgeschûÊfte, des Luxus und des unstillbaren Narzissmus einmal aus der NûÊhe anzusehen. Doch anders als erwartet bleibt der groûzû¥gige Gastgeber meistens abwesend. Er entzieht sich den Freunden, denen so nichts anderes û¥brig bleibt als û¥ber ihn zu reden und dabei vor allem sehr viel von sich selbst zu verraten. Die behauptete Distanz zum grûÑûenwahnsinnigen GeschûÊftsmann wird in ihren Reden genauso relativ wie der vermeintliche Abstand zur narzisstischen Selbstbespiegelung. Letztlich erweisen sich die Normalverdiener, die sich so gerne als Opfer sehen wû¥rden, lûÊngst als Teil des Systems, das sie vordergrû¥ndig verurteilen. Die FûÊhigkeit, die Umwelt und sich selbst mehr oder weniger unverzerrt wahrzunehmen, ist ihnen nûÊmlich genauso abhanden gekommen wie ihrem alten Freund. Als sich diese Umwelt in Form ûÊuûerst katastrophischer RealitûÊt ins Bild vom Ferienidyll zu schieben beginnt, sind die Normalverdiener schon lange keine Opfer mehr. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 03.07.2016
Datum: 03.07.2016Länge: 00:54:32 Größe: 49.94 MB |
||
| ûber/wider das postdemokratische Schreiben - Mit Kathrin RûÑggla - 01.07.2016 | ||
| Kathrin RûÑggla (Autorin) im GesprûÊch mit Julian Doepp (BR 2016) | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 01.07.2016
Datum: 01.07.2016Länge: 00:20:27 Größe: 18.73 MB |
||
| Virginia Woolf: Orlando. Eine Biographie (6/6) - 26.06.2016 | ||
| Aus dem Englischen von Gaby Hartel / Mit Georgia Stahl, Vera Weisbrod, Wiebke Puls, Paul Herwig, Fabian GrûÑver, Hans Kremer / Bearbeitung: Gaby Hartel / Komposition: Ulrike Haage / Regie: Katja Langenbach / BR 2013/ LûÊnge: 52'07// "Ich will die Biographie û¥ber Nacht revolutionieren!" notierte sich Virginia Woolf spûÊt im Jahr 1927 euphorisch ins Tagebuch und der Funke war gezû¥ndet. Begeistert stû¥rzte sie sich in das "Projekt Orlando", das zum "Rû¥ckgrat ihres Herbstes" wurde, ein Buch, das sie leichthûÊndig "vor dem Abendessen schreiben" konnte. Es machte ihr unendlich viel Spaû! Den Lesern û¥brigens auch, wie die Verkaufszahlen der ersten drei Wochen zeigten, die selbst die kû¥hnsten Erwartungen û¥bertrafen. Orlando war von Anfang an Legende. Was die energetische Dynamik anging, war dieses Buch ein Glû¥cksfall fû¥r Woolf. Zwar floss bei dieser Autorin immer Privates mit Beruflichem zusammen, doch jetzt war sie angefeuert von der engen Beziehung, Begeisterung und Liebe zu einer schillernden Abenteurerin, der adeligen Vita Sackville-West. Als schûÑnsten Liebesbrief der Literaturgeschichte hat man Orlando bezeichnet. Und sicher: Sackville-West stand ihrer Freundin in vielem Modell fû¥r diese Fantasie. Fakten wurden mit Fiktivem vermischt, zu symbolischen Szenen verdichtet, mit Goldstaub û¥berzogen. Trotzdem greift die Beschreibung vom Liebesbrief zu kurz. Denn vor allem gelang es Woolf hier unaufgeregt und verspielt, gesellschaftspolitisch und kulturhistorisch relevante Themen aufzugreifen. Die Stellung der Frau, die Aggression des Empire, die rû¥ckwirkende Deutung von Geschichte aus machtpolitischen Grû¥nden. Alles, was Virginia Woolf als Denkerin ausmacht, finden wir hier. Scheinbar Unverrû¥ckbares wird funkelnd und satirisch zugleich demontiert: Stand, Status, Geschlecht und Geschichtsschreibung, Macht, Posen und Konventionen. Besonders viel Sorgfalt verwendet Woolf auf die Darstellung der RelativitûÊt von Zeit und Begebenheit. Neben ihrer Begeisterung fû¥r Sackville-Wests Person, behandelt Orlando eine weitere Leidenschaft Woolfs: ihre Liebe zur Biographie als Genre. Als Leserin verschlang sie diese Bû¥cher und reflektierte in ihren Notizen û¥ber die Form. Woher kam der oft anmaûende, allwissende Ton der Autoren? Woher der Glaube, die Figur so gut fassen zu kûÑnnen? Wieso erfahren wir oft mehr û¥ber Zeit und Moral des Biographen, als û¥ber die Person, die zur Debatte steht? Wieso erstickte oft eine buchhalterische Sprache jedes Gefû¥hl fû¥r einen Menschen, der vor langer Zeit sehr lebendig war. Und, ganz zentral: wer legt eigentlich fest, dass Phantasie und Dichtung in einer Biographie nichts zu suchen haben. Woolf selbst gibt in Orlando vielen Positionen eine Stimme. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 26.06.2016
Datum: 26.06.2016Länge: 00:52:14 Größe: 47.83 MB |
||
| Frank Witzel: Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969 - 25.06.2016 | ||
| Mit Edmund TelgenkûÊmper, Jonas Nay, Valerie Tschplanowa, Shenja Lacher, Christiane Roûbach, Peter Fricke, Oliver NûÊgele, GûÑtz Schulte / Musik: Frank Witzel / Bearbeitung: Leonhard Koppelmann/Frank Witzel / Regie: Leonhard Koppelmann / BR 2016 / LûÊnge: 69'25 // Gudrun Ensslin, eine Indianersquaw aus braunem Plastik, und Andreas Baader, ein Ritter in schwarzglûÊnzender Rû¥stung, - so vermischen sich im Kopf des 13-jûÊhrigen namenlosen ErzûÊhlers in Frank Witzels Roman "Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969" die politischen Verwerfungen in der BRD des Jahres 1969 mit seinen kindlich-spielerischen Fantasien. Das Jugendzimmer wird hier zum Echoraum der Geschichte und der hier ausgetragene Aufstand gegen die Trias Familie, Staat und Kirche ist nicht minder real, als die von der RAF getrûÊumte Revolution auf bundesdeutschen Straûen. Zusammen mit dem Teenager begeben wir uns in den oszillierenden Raum seiner manischen-depressiven StûÑrung ã seine Lebensorte û¥berlagern sich und verwischen, da erscheinen das bereits erwûÊhnte Jugendzimmer ebenso, wie der letzte Ort seines kurzen Lebens im UniversitûÊtsklinikum Hamburg-Eppendorf. In diese EchorûÊume schieben sich aber immer wieder auch konkrete Lebenserinnerungen des Teenagers. Die Vergangenheit, ihr Geruch, ihr Geschmack und die darin wohnenden ûngste und Traumata brechen durch eine mû¥hsam geklitterte OberflûÊche, genauso wie in dieser Zeit die Wundkrusten der bundesrepublikanischen Nachkriegsgesellschaft aufreiûen und die Metastasen der verborgenen und verdrûÊngten Nazizeit plûÑtzlich freilegen. Seine Jugend zwischen Kirche und Krankheit setzt den jugendlichen ErzûÊhler fortwûÊhrenden Befragungs-, Verho?r- und Gesta?ndnissituationen aus ã ob in seiner Therapie oder im Beichtstuhl. Und mit jeder Frage und jedem GestûÊndnis brechen neue Krusten auf. Schlieûlich erliegt er diesem inneren Zeitbeben. ûber seine manische-depressive StûÑrung befindet der ErzûÊhler dabei, ãman ist ja nicht immer wahnsinnig, sondern man ist wahnsinnig und dann wieder nicht, so wie man liebt und dann wieder nicht.ã So unstet wie seine ZustûÊnde ist auch seine ErzûÊhlung, und so befindet er weiter: ãerlûÑse uns von unseren Gedanken und Meinungen und dem Versuch, Geschichte zu rekonstruieren und immer gleiche Gedanken in Wiederholungen zu perpetuieren und damit das kardiovaskulûÊre System langsam nach unten zu fahren.ã Das Aufheben der linearen und chronologischen ErzûÊhlweise ist hier eben nicht erzûÊhlerisches Mittel zum Zweck, sondern Ausdruck dieser ãfrei in der Zeit flottierenden Geschichtsschreibungã, mit der sich Frank Witzels Roman gegen die herkûÑmmliche Deutung der Geschichtsschreibung und Interpretation wendet. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 25.06.2016
Datum: 25.06.2016Länge: 02:39:15 Größe: 145.80 MB |
||
| Die Entstehung der Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager - Mit Leonhard Koppelmann - 24.06.2016 | ||
| Leonhard Koppelmann (Regisseur) im GesprûÊch mit Marie Schoeû (BR 2016). | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 24.06.2016
Datum: 24.06.2016Länge: 00:16:09 Größe: 14.79 MB |
||
| Die Entstehung der Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager - Mit Frank Witzel - 24.06.2016 | ||
| Frank Witzel (Autor) im GesprûÊch mit Katarina Agathos (BR 2016). | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 24.06.2016
Datum: 24.06.2016Länge: 01:05:43 Größe: 60.17 MB |
||
| Virginia Woolf: Orlando. Eine Biographie (5/6) - 19.06.2016 | ||
| Aus dem Englischen von Gaby Hartel / Georgia Stahl, Vera Weisbrod, Wiebke Puls, Paul Herwig, Michaela Steiger, Fabian GrûÑver / Bearbeitung: Gaby Hartel / Komposition: Ulrike Haage / Regie: Katja Langenbach / BR 2013/ LûÊnge: 47'20 // "Ich will die Biographie û¥ber Nacht revolutionieren!" notierte sich Virginia Woolf spûÊt im Jahr 1927 euphorisch ins Tagebuch und der Funke war gezû¥ndet. Begeistert stû¥rzte sie sich in das "Projekt Orlando", das zum "Rû¥ckgrat ihres Herbstes" wurde, ein Buch, das sie leichthûÊndig "vor dem Abendessen schreiben" konnte. Es machte ihr unendlich viel Spaû! Den Lesern û¥brigens auch, wie die Verkaufszahlen der ersten drei Wochen zeigten, die selbst die kû¥hnsten Erwartungen û¥bertrafen. Orlando war von Anfang an Legende. Was die energetische Dynamik anging, war dieses Buch ein Glû¥cksfall fû¥r Woolf. Zwar floss bei dieser Autorin immer Privates mit Beruflichem zusammen, doch jetzt war sie angefeuert von der engen Beziehung, Begeisterung und Liebe zu einer schillernden Abenteurerin, der adeligen Vita Sackville-West. Als schûÑnsten Liebesbrief der Literaturgeschichte hat man Orlando bezeichnet. Und sicher: Sackville-West stand ihrer Freundin in vielem Modell fû¥r diese Fantasie. Fakten wurden mit Fiktivem vermischt, zu symbolischen Szenen verdichtet, mit Goldstaub û¥berzogen. Trotzdem greift die Beschreibung vom Liebesbrief zu kurz. Denn vor allem gelang es Woolf hier unaufgeregt und verspielt, gesellschaftspolitisch und kulturhistorisch relevante Themen aufzugreifen. Die Stellung der Frau, die Aggression des Empire, die rû¥ckwirkende Deutung von Geschichte aus machtpolitischen Grû¥nden. Alles, was Virginia Woolf als Denkerin ausmacht, finden wir hier. Scheinbar Unverrû¥ckbares wird funkelnd und satirisch zugleich demontiert: Stand, Status, Geschlecht und Geschichtsschreibung, Macht, Posen und Konventionen. Besonders viel Sorgfalt verwendet Woolf auf die Darstellung der RelativitûÊt von Zeit und Begebenheit. Neben ihrer Begeisterung fû¥r Sackville-Wests Person, behandelt Orlando eine weitere Leidenschaft Woolfs: ihre Liebe zur Biographie als Genre. Als Leserin verschlang sie diese Bû¥cher und reflektierte in ihren Notizen û¥ber die Form. Woher kam der oft anmaûende, allwissende Ton der Autoren? Woher der Glaube, die Figur so gut fassen zu kûÑnnen? Wieso erfahren wir oft mehr û¥ber Zeit und Moral des Biographen, als û¥ber die Person, die zur Debatte steht? Wieso erstickte oft eine buchhalterische Sprache jedes Gefû¥hl fû¥r einen Menschen, der vor langer Zeit sehr lebendig war. Und, ganz zentral: wer legt eigentlich fest, dass Phantasie und Dichtung in einer Biographie nichts zu suchen haben. Woolf selbst gibt in Orlando vielen Positionen eine Stimme. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 19.06.2016
Datum: 19.06.2016Länge: 00:47:27 Größe: 43.45 MB |
||
| Erste Erde Forum: XVII. Die Entstehung der Alpen und ihre Kulturgeschichte - Mit Bernhard Fû¥genschuh - 18.06.2016 | ||
| Raoul Schrott im GesprûÊch mit Prof. Bernhard Fû¥genschuh (Geologe) | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 18.06.2016
Datum: 18.06.2016Länge: 00:43:33 Größe: 39.87 MB |
||
| Raoul Schrott: Erste Erde Epos: XVIII. Namlos - 18.06.2016 | ||
| Mit Florian von Manteuffel, Raoul Schrott / Komposition: Saam Schlamminger / Regie: Michael Farin / BR 2016 / LûÊnge: 68'01 // "Nie zuvor gab es so viel an Wissen û¥ber den Menschen und das Universum - doch je mehr Daten und Details angehûÊuft werden, desto weniger verstehen wir im Grunde. Wir wissen zwar, dass die alten Mythen nicht mehr stimmig sind - eine andere Geschichte, die uns und die Welt erklûÊrt, gibt es jedoch nicht." Raoul Schrott Als sich der europûÊische Kontinent unter den afrikanischen zu schieben begann, also vor etwa 135 Millionen Jahren, entstanden die Alpen. Heute bildet der Nordrand Tirols und der Arlberg diese Grenze. Ihre Berge sind nichts anderes als Verfaltungen dieses weiterhin vor sich gehenden Zusammenstosses. Fossile Spuren ausgestorbenen Lebens legen davon Zeugnis ab. Auch sie sind Zeugnisse vorû¥bergehender Gestaltungsformen der Erde. An den Tiroler Ortsnamen lûÊsst sich die jû¥ngere Besiedlungsgeschichte ablesen. Illusionslos verweisen sie auf die Unwirtlichkeit des damaligen Lebens, denn lange Zeit war das Gebirge nur ûÑdes Territorium ã bis es von der Romantik und dem Tourismus mit klangvollen Bezeichnungen besetzt wurde und das letztlich Namenlose der Erde und der in den Bergen versteinerten Zeit verdeckte | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 18.06.2016
Datum: 18.06.2016Länge: 01:07:56 Größe: 62.20 MB |
||
| Virginia Woolf: Orlando. Eine Biographie (4/6) - 12.06.2016 | ||
| Aus dem Englischen von Gaby Hartel / Mit Georgia Stahl, Vera Weisbrod, Wiebke Puls, Paul Herwig, Brigitte Hobmeier, Michaela Steiger, Fabian GrûÑver, Hans Kremer / Bearbeitung: Gaby Hartel / Komposition: Ulrike Haage / Regie: Katja Langenbach / BR 2013/ LûÊnge: 49'37 // "Ich will die Biographie û¥ber Nacht revolutionieren!" notierte sich Virginia Woolf spûÊt im Jahr 1927 euphorisch ins Tagebuch und der Funke war gezû¥ndet. Begeistert stû¥rzte sie sich in das "Projekt Orlando", das zum "Rû¥ckgrat ihres Herbstes" wurde, ein Buch, das sie leichthûÊndig "vor dem Abendessen schreiben" konnte. Es machte ihr unendlich viel Spaû! Den Lesern û¥brigens auch, wie die Verkaufszahlen der ersten drei Wochen zeigten, die selbst die kû¥hnsten Erwartungen û¥bertrafen. Orlando war von Anfang an Legende. Was die energetische Dynamik anging, war dieses Buch ein Glû¥cksfall fû¥r Woolf. Zwar floss bei dieser Autorin immer Privates mit Beruflichem zusammen, doch jetzt war sie angefeuert von der engen Beziehung, Begeisterung und Liebe zu einer schillernden Abenteurerin, der adeligen Vita Sackville-West. Als schûÑnsten Liebesbrief der Literaturgeschichte hat man Orlando bezeichnet. Und sicher: Sackville-West stand ihrer Freundin in vielem Modell fû¥r diese Fantasie. Fakten wurden mit Fiktivem vermischt, zu symbolischen Szenen verdichtet, mit Goldstaub û¥berzogen. Trotzdem greift die Beschreibung vom Liebesbrief zu kurz. Denn vor allem gelang es Woolf hier unaufgeregt und verspielt, gesellschaftspolitisch und kulturhistorisch relevante Themen aufzugreifen. Die Stellung der Frau, die Aggression des Empire, die rû¥ckwirkende Deutung von Geschichte aus machtpolitischen Grû¥nden. Alles, was Virginia Woolf als Denkerin ausmacht, finden wir hier. Scheinbar Unverrû¥ckbares wird funkelnd und satirisch zugleich demontiert: Stand, Status, Geschlecht und Geschichtsschreibung, Macht, Posen und Konventionen. Besonders viel Sorgfalt verwendet Woolf auf die Darstellung der RelativitûÊt von Zeit und Begebenheit. Neben ihrer Begeisterung fû¥r Sackville-Wests Person, behandelt Orlando eine weitere Leidenschaft Woolfs: ihre Liebe zur Biographie als Genre. Als Leserin verschlang sie diese Bû¥cher und reflektierte in ihren Notizen û¥ber die Form. Woher kam der oft anmaûende, allwissende Ton der Autoren? Woher der Glaube, die Figur so gut fassen zu kûÑnnen? Wieso erfahren wir oft mehr û¥ber Zeit und Moral des Biographen, als û¥ber die Person, die zur Debatte steht? Wieso erstickte oft eine buchhalterische Sprache jedes Gefû¥hl fû¥r einen Menschen, der vor langer Zeit sehr lebendig war. Und, ganz zentral: wer legt eigentlich fest, dass Phantasie und Dichtung in einer Biographie nichts zu suchen haben. Woolf selbst gibt in Orlando vielen Positionen eine Stimme. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 12.06.2016
Datum: 12.06.2016Länge: 00:49:44 Größe: 45.53 MB |
||
| Erste Erde Forum: XVI. Von den Menschenaffen zum Homo sapiens - Mit Philipp Gunz - 11.06.2016 | ||
| Raoul Schrott im GesprûÊch mit Dr. Philipp Gunz (Max Planck Institut fû¥r evolutionûÊre Anthropologie) | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 11.06.2016
Datum: 11.06.2016Länge: 00:11:44 Größe: 10.75 MB |
||
| Raoul Schrott: Erste Erde Epos: XVII. FûÊhrten - 11.06.2016 | ||
| Mit Florian von Manteuffel, Raoul Schrott / Komposition: Saam Schlamminger / Regie: Michael Farin / BR 2016 / LûÊnge: 80'11 // "Nie zuvor gab es so viel an Wissen û¥ber den Menschen und das Universum - doch je mehr Daten und Details angehûÊuft werden, desto weniger verstehen wir im Grunde. Wir wissen zwar, dass die alten Mythen nicht mehr stimmig sind - eine andere Geschichte, die uns und die Welt erklûÊrt, gibt es jedoch nicht." Raoul Schrott Eine amerikanische Kunsthistorikern auf den Spuren der Menschenaffen, die sich nur langsam zum Homo sapiens entwickelten: Von den 3,7 Millionen Fuûabdrû¥cken im tansanischen Laetoli û¥ber den 1,8 Millionen Jahre alten SchûÊdel des Homo erectus, der erst den georgischen Kaukasus und spûÊter dann Spanien erreichte ã bis hin zu den FûÊhrten, die er dabei hinterlieû. Sie blieben in der Vulkanasche nûÑrdlich von Neapel erhalten. Bei Ebbe kommen sie auch an englischen StrûÊnden zum Vorschein. Sie beginnt zu verstehen, wie uns erst der aufrechte Gang zu dem machte, was wir sind: von der Form der Steinwerkzeuge bis hin zur Gestalt unseres KûÑrpers, von den ersten Kunstobjekten bis zum kulturellen Superorganismus, den unsere heutige Zivilisation darstellt. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 11.06.2016
Datum: 11.06.2016Länge: 01:20:17 Größe: 73.51 MB |
||
| Virginia Woolf: Orlando. Eine Biographie (3/6) - 05.06.2016 | ||
| Aus dem Englischen von Gaby Hartel / Mit Gabriel Raab, Georgia Stahl, Vera Weisbrod, Wiebke Puls, Paul Herwig, Brigitte Hobmeier, Michaela Steiger, Fabian GrûÑver, Hans Kremer / Bearbeitung: Gaby Hartel / Komposition: Ulrike Haage / Regie: Katja Langenbach / BR 2013/ LûÊnge: 47'28 // "Ich will die Biographie û¥ber Nacht revolutionieren!" notierte sich Virginia Woolf spûÊt im Jahr 1927 euphorisch ins Tagebuch und der Funke war gezû¥ndet. Begeistert stû¥rzte sie sich in das "Projekt Orlando", das zum "Rû¥ckgrat ihres Herbstes" wurde, ein Buch, das sie leichthûÊndig "vor dem Abendessen schreiben" konnte. Es machte ihr unendlich viel Spaû! Den Lesern û¥brigens auch, wie die Verkaufszahlen der ersten drei Wochen zeigten, die selbst die kû¥hnsten Erwartungen û¥bertrafen. Orlando war von Anfang an Legende. Was die energetische Dynamik anging, war dieses Buch ein Glû¥cksfall fû¥r Woolf. Zwar floss bei dieser Autorin immer Privates mit Beruflichem zusammen, doch jetzt war sie angefeuert von der engen Beziehung, Begeisterung und Liebe zu einer schillernden Abenteurerin, der adeligen Vita Sackville-West. Als schûÑnsten Liebesbrief der Literaturgeschichte hat man Orlando bezeichnet. Und sicher: Sackville-West stand ihrer Freundin in vielem Modell fû¥r diese Fantasie. Fakten wurden mit Fiktivem vermischt, zu symbolischen Szenen verdichtet, mit Goldstaub û¥berzogen. Trotzdem greift die Beschreibung vom Liebesbrief zu kurz. Denn vor allem gelang es Woolf hier unaufgeregt und verspielt, gesellschaftspolitisch und kulturhistorisch relevante Themen aufzugreifen. Die Stellung der Frau, die Aggression des Empire, die rû¥ckwirkende Deutung von Geschichte aus machtpolitischen Grû¥nden. Alles, was Virginia Woolf als Denkerin ausmacht, finden wir hier. Scheinbar Unverrû¥ckbares wird funkelnd und satirisch zugleich demontiert: Stand, Status, Geschlecht und Geschichtsschreibung, Macht, Posen und Konventionen. Besonders viel Sorgfalt verwendet Woolf auf die Darstellung der RelativitûÊt von Zeit und Begebenheit. Neben ihrer Begeisterung fû¥r Sackville-Wests Person, behandelt Orlando eine weitere Leidenschaft Woolfs: ihre Liebe zur Biographie als Genre. Als Leserin verschlang sie diese Bû¥cher und reflektierte in ihren Notizen û¥ber die Form. Woher kam der oft anmaûende, allwissende Ton der Autoren? Woher der Glaube, die Figur so gut fassen zu kûÑnnen? Wieso erfahren wir oft mehr û¥ber Zeit und Moral des Biographen, als û¥ber die Person, die zur Debatte steht? Wieso erstickte oft eine buchhalterische Sprache jedes Gefû¥hl fû¥r einen Menschen, der vor langer Zeit sehr lebendig war. Und, ganz zentral: wer legt eigentlich fest, dass Phantasie und Dichtung in einer Biographie nichts zu suchen haben. Woolf selbst gibt in Orlando vielen Positionen eine Stimme. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 05.06.2016
Datum: 05.06.2016Länge: 00:47:33 Größe: 43.55 MB |
||
| Raoul Schrott: Erste Erde Epos: XV. Stammlinien - 04.06.2016 | ||
| Mit Gabriele Blum, Felix von Manteuffel / Regie: Michael Farin / BR 2016 / LûÊnge: 52'09 // "Nie zuvor gab es so viel an Wissen û¥ber den Menschen und das Universum - doch je mehr Daten und Details angehûÊuft werden, desto weniger verstehen wir im Grunde. Wir wissen zwar, dass die alten Mythen nicht mehr stimmig sind - eine andere Geschichte, die uns und die Welt erklûÊrt, gibt es jedoch nicht." Raoul Schrott Eine emeritierte polnische Zoologin erzûÊhlt aus ihrem Leben: von ihrem Studium wûÊhrend der deutschen Besatzung, ihrer Teilnahme am Warschauer Aufstand, ihrer Vergewaltigung durch einen Kollaborateur, ihrer Inhaftierung und den Folterungen. Wie nebenbei erzûÊhlt sie, was den Menschen ã sein Raubtiergebiss etwa mit Kiefern und ReiûzûÊhnen ã mit den Reptilien verbindet. Jahre spûÊter, nach dem Fall der Mauer, wird sie Yukatan aufsuchen, um den 66 Millionen Jahre alten Einschlagskrater jenes Asteroiden zu sehen, der die Dinosaurier auslûÑschte, woraufhin sich dann SûÊugetiere zu in BûÊumen lebenden Affen zu entwickeln begannen: Ihrer ErnûÊhrung von Frû¥chten verdanken wir unseren nach vorne gerichteten Blick, unseren Farbsinn. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 04.06.2016
Datum: 04.06.2016Länge: 00:52:15 Größe: 47.84 MB |
||
| Erste Erde Forum: XV. Von den Amphibien û¥ber die Reptilien zu den ersten SûÊugetieren - Mit Thomas Martin - 04.06.2016 | ||
| Raoul Schrott im GesprûÊch mit Prof. Thomas Martin (Institut fû¥r PalûÊontologie, Bonn) | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 04.06.2016
Datum: 04.06.2016Länge: 00:20:17 Größe: 18.58 MB |
||
| Virginia Woolf: Orlando. Eine Biographie (2/6) - 29.05.2016 | ||
| Aus dem Englischen von Gaby Hartel / Mit Gabriel Raab, Vera Weisbrod, Wiebke Puls, Paul Herwig, Brigitte Hobmeier, Michaela Steiger, Fabian GrûÑver, Hans Kremer / Bearbeitung: Gaby Hartel / Komposition: Ulrike Haage / Regie: Katja Langenbach / BR 2013 / LûÊnge: 48'58 // "Ich will die Biographie û¥ber Nacht revolutionieren!" notierte sich Virginia Woolf spûÊt im Jahr 1927 euphorisch ins Tagebuch und der Funke war gezû¥ndet. Begeistert stû¥rzte sie sich in das "Projekt Orlando", das zum "Rû¥ckgrat ihres Herbstes" wurde, ein Buch, das sie leichthûÊndig "vor dem Abendessen schreiben" konnte. Es machte ihr unendlich viel Spaû! Den Lesern û¥brigens auch, wie die Verkaufszahlen der ersten drei Wochen zeigten, die selbst die kû¥hnsten Erwartungen û¥bertrafen. Orlando war von Anfang an Legende. Was die energetische Dynamik anging, war dieses Buch ein Glû¥cksfall fû¥r Woolf. Zwar floss bei dieser Autorin immer Privates mit Beruflichem zusammen, doch jetzt war sie angefeuert von der engen Beziehung, Begeisterung und Liebe zu einer schillernden Abenteurerin, der adeligen Vita Sackville-West. Als schûÑnsten Liebesbrief der Literaturgeschichte hat man Orlando bezeichnet. Und sicher: Sackville-West stand ihrer Freundin in vielem Modell fû¥r diese Fantasie. Fakten wurden mit Fiktivem vermischt, zu symbolischen Szenen verdichtet, mit Goldstaub û¥berzogen. Trotzdem greift die Beschreibung vom Liebesbrief zu kurz. Denn vor allem gelang es Woolf hier unaufgeregt und verspielt, gesellschaftspolitisch und kulturhistorisch relevante Themen aufzugreifen. Die Stellung der Frau, die Aggression des Empire, die rû¥ckwirkende Deutung von Geschichte aus machtpolitischen Grû¥nden. Alles, was Virginia Woolf als Denkerin ausmacht, finden wir hier. Scheinbar Unverrû¥ckbares wird funkelnd und satirisch zugleich demontiert: Stand, Status, Geschlecht und Geschichtsschreibung, Macht, Posen und Konventionen. Besonders viel Sorgfalt verwendet Woolf auf die Darstellung der RelativitûÊt von Zeit und Begebenheit. Neben ihrer Begeisterung fû¥r Sackville-Wests Person, behandelt Orlando eine weitere Leidenschaft Woolfs: ihre Liebe zur Biographie als Genre. Als Leserin verschlang sie diese Bû¥cher und reflektierte in ihren Notizen û¥ber die Form. Woher kam der oft anmaûende, allwissende Ton der Autoren? Woher der Glaube, die Figur so gut fassen zu kûÑnnen? Wieso erfahren wir oft mehr û¥ber Zeit und Moral des Biographen, als û¥ber die Person, die zur Debatte steht? Wieso erstickte oft eine buchhalterische Sprache jedes Gefû¥hl fû¥r einen Menschen, der vor langer Zeit sehr lebendig war. Und, ganz zentral: wer legt eigentlich fest, dass Phantasie und Dichtung in einer Biographie nichts zu suchen haben. Woolf selbst gibt in Orlando vielen Positionen eine Stimme. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 29.05.2016
Datum: 29.05.2016Länge: 00:49:04 Größe: 44.93 MB |
||
| Erste Erde Forum: XIV. Von den Einzellern zum Tier: Die BauplûÊne unseres KûÑrpers - Mit Detlev Arendt - 28.05.2016 | ||
| Raoul Schrott im GesprûÊch mit Prof. Detlev Arendt (EuropûÊisches Laboratorium fû¥r Molekularbiologie, Heidelberg) | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 28.05.2016
Datum: 28.05.2016Länge: 01:05:33 Größe: 60.02 MB |
||
| Raoul Schrott: Erste Erde Epos: XII. Autopsie 2 - 28.05.2016 | ||
| Mit Sophie von Kessel, Felix von Manteuffel / Regie: Michael Farin / BR 2016 / LûÊnge: 97'14 // "Nie zuvor gab es so viel an Wissen û¥ber den Menschen und das Universum - doch je mehr Daten und Details angehûÊuft werden, desto weniger verstehen wir im Grunde. Wir wissen zwar, dass die alten Mythen nicht mehr stimmig sind - eine andere Geschichte, die uns und die Welt erklûÊrt, gibt es jedoch nicht." Raoul Schrott Lebensgeschichte und Evolution miteinander konfrontierend lûÊsst sich die Welt aus einer anderen Perspektive wahrnehmen und betrachten: das erste Auge etwa, das Trilobiten mit Linsen aus Kristall in ihrer Haut herausbildeten, oder das GehûÑrorgan, mit dem Fische dem Wasser nachzuhorchen begannen, bis sich bei den Reptilien an Land deren Kiemenknochen schlieûlich zum Ohr formten. Und wie muss es gewesen sein, als die Welt zum ersten Mal sichtbar wurde? Sich zum ersten Mal hûÑren lieû? Und û¥berhaupt: Was macht das SchûÑne an einem Menschen aus? | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 28.05.2016
Datum: 28.05.2016Länge: 01:37:20 Größe: 89.12 MB |
||
| Virginia Woolf: Orlando. Eine Biographie (1/6) - 22.05.2016 | ||
|
Aus dem Englischen von Gaby Hartel / Mit Gabriel Raab, Vera Weisbrod, Wiebke Puls, Paul Herwig, Brigitte Hobmeier / Bearbeitung: Gaby Hartel / Komposition: Ulrike Haage / Regie: Katja Langenbach / BR 2013 / LûÊnge: 50'37 // "Ich will die Biographie û¥ber Nacht revolutionieren!" notierte sich Virginia Woolf spûÊt im Jahr 1927 euphorisch ins Tagebuch und der Funke war gezû¥ndet. Begeistert stû¥rzte sie sich in das "Projekt Orlando", das zum "Rû¥ckgrat ihres Herbstes" wurde, ein Buch, das sie leichthûÊndig "vor dem Abendessen schreiben" konnte. Es machte ihr unendlich viel Spaû! Den Lesern û¥brigens auch, wie die Verkaufszahlen der ersten drei Wochen zeigten, die selbst die kû¥hnsten Erwartungen û¥bertrafen. Orlando war von Anfang an Legende. Was die energetische Dynamik anging, war dieses Buch ein Glû¥cksfall fû¥r Woolf. Zwar floss bei dieser Autorin immer Privates mit Beruflichem zusammen, doch jetzt war sie angefeuert von der engen Beziehung, Begeisterung und Liebe zu einer schillernden Abenteurerin, der adeligen Vita Sackville-West. Als schûÑnsten Liebesbrief der Literaturgeschichte hat man Orlando bezeichnet. Und sicher: Sackville-West stand ihrer Freundin in vielem Modell fû¥r diese Fantasie. Fakten wurden mit Fiktivem vermischt, zu symbolischen Szenen verdichtet, mit Goldstaub û¥berzogen. Trotzdem greift die Beschreibung vom Liebesbrief zu kurz. Denn vor allem gelang es Woolf hier unaufgeregt und verspielt, gesellschaftspolitisch und kulturhistorisch relevante Themen aufzugreifen. Die Stellung der Frau, die Aggression des Empire, die rû¥ckwirkende Deutung von Geschichte aus machtpolitischen Grû¥nden. Alles, was Virginia Woolf als Denkerin ausmacht, finden wir hier. Scheinbar Unverrû¥ckbares wird funkelnd und satirisch zugleich demontiert: Stand, Status, Geschlecht und Geschichtsschreibung, Macht, Posen und Konventionen. Besonders viel Sorgfalt verwendet Woolf auf die Darstellung der RelativitûÊt von Zeit und Begebenheit. Neben ihrer Begeisterung fû¥r Sackville-Wests Person, behandelt Orlando eine weitere Leidenschaft Woolfs: ihre Liebe zur Biographie als Genre. Als Leserin verschlang sie diese Bû¥cher und reflektierte in ihren Notizen û¥ber die Form. Woher kam der oft anmaûende, allwissende Ton der Autoren? Woher der Glaube, die Figur so gut fassen zu kûÑnnen? Wieso erfahren wir oft mehr û¥ber Zeit und Moral des Biographen, als û¥ber die Person, die zur Debatte steht? Wieso erstickte oft eine buchhalterische Sprache jedes Gefû¥hl fû¥r einen Menschen, der vor langer Zeit sehr lebendig war. Und, ganz zentral: wer legt eigentlich fest, dass Phantasie und Dichtung in einer Biographie nichts zu suchen haben. Woolf selbst gibt in Orlando vielen Positionen eine Stimme. // |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 22.05.2016
Datum: 22.05.2016Länge: 00:50:43 Größe: 46.44 MB |
||
| Raoul Schrott: Erste Erde Epos: XI. Autopsie 1 - 21.05.2016 | ||
| Mit Patrick Gû¥ldenberg, Felix von Manteuffel / Regie: Michael Farin / BR 2016 / LûÊnge: 98'45 // "Nie zuvor gab es so viel an Wissen û¥ber den Menschen und das Universum - doch je mehr Daten und Details angehûÊuft werden, desto weniger verstehen wir im Grunde. Wir wissen zwar, dass die alten Mythen nicht mehr stimmig sind - eine andere Geschichte, die uns und die Welt erklûÊrt, gibt es jedoch nicht." Raoul Schrott Ein Augenarzt aus Nizza trauert um seine Frau, eine deutsche Schauspielerin, die Selbstmord begangen hat. Er beginnt eine Autopsie, die gleichsam zu einer Geschichte des menschlichen KûÑrpers wird ã dem altûÊgyptischen Mythos des Osiris nicht unûÊhnlich, dessen zerstû¥ckelte Glieder von Isis wieder zusammengesetzt wurden. Seine Reisen ã ein Tauchgang in einer unterseeischen HûÑhle vor La Ciotat, zu den rûÊtselhaften Fossilien des Ediacariums in Neufundland oder zu den Trilobitensuchern in Marokko ã fû¥hren zudem zu jenen Orten, die anschaulich machen, wie das tierische Leben zu seinen Formen fand. Die BauplûÊne jedweden tierischen Lebens entstanden in einem Zeitraum von nahezu 800 Jahrmillionen: von den SchwûÊmmen û¥ber die Rippenquallen, Wû¥rmern und Schleimaale zu den ersten Knochenfischen bis zur menschlichen Gestalt, bis zu Bauch und Rû¥cken, Kopf und Fuû, Mund, Muskeln und Verdauungstrakt, Skelett und Rû¥ckgrat, bis zum Gesicht. Mit der Herausbildung des KûÑrpers als Vehikel zur Fortpflanzung aber trat dann auch der Tod ins Leben. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 21.05.2016
Datum: 21.05.2016Länge: 01:48:51 Größe: 99.67 MB |
||
| "Das wichtigste beim Schreiben ist der natû¥rliche Redefluss." Virginia Woolfs Roman Orlando und sein Weg ins HûÑrspiel - 20.05.2016 | ||
| Katarina Agathos im GesprûÊch mit Gaby Hartel / BR 2013 / LûÊnge: 46'14 | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 20.05.2016
Datum: 20.05.2016Länge: 00:46:14 Größe: 42.34 MB |
||
| Saam Schlamminger: Aus der Heimat - 20.05.2016 | ||
|
Realisation: Saam Schlamminger / BR 2010 / LûÊnge: 43'04 // Aus der Ferne, aus der Fremde: In einem Augenblick, der dafû¥r bestimmt gewesen sein muss, entdeckt Saam eine Schellackplatte seines Urgroûvaters Karl Schlamminger. Die Platte trûÊgt den Titel "Aus der Heimat". Sie wurde 1924 aufgenommen. Karl spielt solo Zither: LûÊndler aus der Heimat, Marsch, Gruû vom Uetliberg ã es sind sechs Minuten Knistermaterial. Was anfangen mit diesem Fund, diesem Geschenk? Sich die Vergangenheit vergegenwûÊrtigen durch die Aufnahme eines ZwiegesprûÊchs? Welche Form, welchen Verlauf kann es nehmen? Karl Schlamminger (geboren 1883 in Fû¥rth, verstorben 1950 in Memmingen) war Vollblutmusiker, das Musizieren und Teilen mit anderen war fû¥r ihn essentiell. Saam Schlamminger, geboren 1966 in Istanbul. Aufgewachsen im Iran. 1979 Umzug nach Mû¥nchen. Spezialisierung auf die persischen Instrumente Zarb und Daf. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 20.05.2016
Datum: 20.05.2016Länge: 00:43:24 Größe: 39.74 MB |
||
| Raoul Schrott: Erste Erde Epos: X. Erstes Leben/Sex und Symbiosen - 14.05.2016 | ||
|
Mit Irm Hermannn, Patrick Gû¥ldenberg, Raoul Schrott / Regie: Michael Farin / BR 2016 / LûÊnge: 58'25 // "Nie zuvor gab es so viel an Wissen û¥ber den Menschen und das Universum - doch je mehr Daten und Details angehûÊuft werden, desto weniger verstehen wir im Grunde. Wir wissen zwar, dass die alten Mythen nicht mehr stimmig sind - eine andere Geschichte, die uns und die Welt erklûÊrt, gibt es jedoch nicht." Raoul Schrott In der NûÊhe der ehemaligen North-Pole-Mine in Westaustralien finden sich die Reste einer flachen vulkanischen Lagune, die 3,6 Milliarden Jahre alt ist. In ihr blieben die allerersten Fossilien erhalten, die von Leben zeugen: Stromatolithe ã auch Blumen- oder Decksteine genannt ã als kopffûÑrmige Ablagerungen von Matten von Cyanobakterien. Bis heute bilden sich diese algenartigen Mikroben in jedem Wassertû¥mpel. In der Frû¥hzeit der Erde waren sie die ersten Organismen, die vor û¥ber 2 Milliarden Jahren mittels der Energie des Lichts Wasser aufbrachen und dabei Sauerstoff abschieden: Ihnen haben wir die Luft zu verdanken, die wir atmen. Eine pensionierte Mikrobiologin sitzt jeden Tag in der U-Bahn Station des Londoner Embankments, um die Stimme ihres verstorbenen Mannes im Lautsprecher zu hûÑren, wie er die Aussteigenden vor dem Spalt an der Bahnsteigkarte warnt. In stillen Monologen mit ihm lûÊsst sie seinen Tod, ihr Leben mit ihm und ihrem autistischen Kind Revue passieren und reflektiert dabei, in welchem Ausmaû bakterielles Leben das unsere bestimmt. Die Shark Bay an der Kû¥ste ist eine der wenigen Stellen der Erde, wo sich noch heute Stromatolithen bilden, in denen man winzige SauerstoffblûÊschen aufsteigen sehen kann. Die Reise dorthin fû¥hrt an den Jack Hills vorbei, deren weit û¥ber vier Milliarden Jahre alte Gesteinskristalle Hinweise auf zu jener Zeit entstandenes Leben enthalten. Wie sich die Aborigines die SchûÑpfung vorstellten, wird spûÊter dann in einer Bar erzûÊhlt. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 14.05.2016
Datum: 14.05.2016Länge: 00:58:31 Größe: 53.59 MB |
||
| Erste Erde Forum: XII. SchwûÊmme und unsere Genetik - Mit Werner Mû¥ller - 14.05.2016 | ||
| Raoul Schrott im GesprûÊch mit Prof. Werner Mû¥ller (Molekularbiologe) | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 14.05.2016
Datum: 14.05.2016Länge: 00:38:59 Größe: 35.69 MB |
||
| Michaela MeliûÀn: Memory Loops - Tonspuren zu Orten des NS-Terrors in Mû¥nchen 1933-1945 (3/5) - 07.05.2016 | ||
|
Ettstraûe Maistraûe Haar Hackerbrû¥cke / Mit Peter Brombacher, Anna Clarin, Caroline Ebner, Florian Fischer, Julia Franz, David Herber, Johannes Herrschmann, Nicola Hecht, Gabriel Ascanio Hecker, Hans Kremer, Julia Loibl, Laura Maire, Stefan Merki, Wolfgang Pregler, Steven Scharf, Ferdinand von Canstein, Joana Verbeek von Loewis / Musikrealisation: Carl Oesterhelt/Michaela MeliûÀn / Komposition/Realisation: Michaela MeliûÀn / BR HûÑrspiel und Medienkunst in Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt Mû¥nchen/Kulturreferat, Freie Kunst im ûÑffentlichen Raum 2010 / LûÊnge: 56'37 // Die NS-Ideologie entschied, ob ein Mensch "lebensunwert" war und als SchûÊdling galt und damit auf gleicher Stufe mit Wanzen oder FlûÑhen stand. Pseudowissenschaftliche Diskurse lieferten die Rechtfertigung fû¥r das ãAusmerzenã ã ein Euphemismus fû¥r Zwangssterilisation und Massenmord. ãIch mûÑchte die Direktion in Eglfing-Haar bitten, mir û¥ber den Gesundheitszustand meines Kindes, Alter drei Jahre, Nachricht zukommen zu lassen, da das Kind von hier fort kam, ohne uns irgendetwas zu sagen...ã Dieser Memory Loop lûÊsst oft vergessene NS-Opfer zu Wort kommen und verortet ihre Stimmen an medizinischen Institutionen Mû¥nchens, die die Politik der ãRassenhygieneã praktizierten. Die Stimmen dieser Opfer sind zu einer Collage arrangiert: Berichte zweier Mû¥nchner Sinti, ein Schriftwechsel zwischen der Heil- und Pflegeanstalt Eglfing-Haar mit Patienten-AngehûÑrigen, die beunruhigt sind û¥ber das Verschwinden ihrer Verwandten sowie ErzûÊhlungen zwangssterilisierter Frauen und MûÊnner. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 07.05.2016
Datum: 07.05.2016Länge: 00:56:59 Größe: 52.17 MB |
||
| Michael Lentz: Diktate - 06.05.2016 | ||
| Mit Michael Hirsch, Michael Lentz, Sophia Siebert / Komposition: Gunnar Geisse / Realisation: Michael Lentz / BR 2016 / LûÊnge: 83'37 / Was ist in dem KûÊstchen, das der Sohn nachts hinter seinem Regal hervorholt, in das zu schauen die Mutter ihm verboten hat und ihm prompt jede Nacht abnimmt, kaum dass er Anstalten macht, es zu ûÑffnen? Der Sohn vermutet einen Schlû¥ssel in dem KûÊstchen. Die Mutter fû¥rchtet, der Sohn kûÑnne ein schlimmes Geheimnis entdecken. Es kommt der Tag des Jû¥ngsten Gerichts. Zur Verhandlung stehen neben dem KûÊstchen, das sich jede Nacht wieder einfindet, ein umfangreiches Notizbuch û¥ber all diese und andere merkwû¥rdige VorgûÊnge und eine Kammer, die mit dem KûÊstchen in Verbindung stehen muss. Die Mutter behauptet, ihr Sohn wolle sie umbringen, die Kammer sei der Beweis, er bete dort Gott an und betreibe Mummenschanz; der Sohn behauptet, er wisse nichts von einer Kammer, sein Notizbuch sei der Beweis fû¥r seine Aufrichtigkeit. Die Kammer sei eine Werkstatt, wenn auch eine imaginûÊre, sagt die Mutter, ihr Sohn habe sie dort als schwebendes Gewand ohne KûÑrper gemalt. Fû¥r den Sohn hat die Mutter schlicht sein Zimmer nicht aufgerûÊumt. Also rûÊumt der Sohn selbst sein Zimmer auf und entsorgt einen Heiligenschein, ein kleines betendes KapuzenmûÊnnlein, einen Auferstandenen, den Heiligen Geist, zwei SchafskûÑpfe, einen Rest Rotwein und schimmelndes Brot. Die Schreibmaschine der Firma Ideal hat es ihm allerdings angetan. Und sie ist es wohl auch, die den toten Vater wieder herbei imaginiert, kann der Sohn ihn doch mit ihrer Hilfe û¥berall hin projizieren. Er hat jedoch die Rechnung ohne das Eigenleben der Bilder, die in der erinnerten Vorstellung nie identisch sind, und der Sprache gemacht, mit deren Hilfe er die KursûÊnderungen der Bilder nachvollziehen will. Erinnerung und Wiederholung gehen zuweilen getrennte Wege und bringen jedes Mal neue Bilder hervor, manchmal mit nur kleinen, aber entscheidenden Differenzen, und so ist Vater einmal Bismarck, ein anderes Mal der eigene Opa, dann wieder der Sohn selbst. Zu GehûÑr kommt eine sich unentwegt modifizierende Veranschaulichung, die nichts anderes als Sprache in Bewegung ist, eine leibhafte Bewegung der Bilder. Das Ganze hat sicherlich mit einem Schrank zu tun, in dem der Bruder in eine Art Unterwelt verschwunden ist, und einer Camera obscura, die sich neben Vaters Bett befunden haben soll. Das Bett jedenfalls befindet sich als Brû¥cke û¥ber einem kleinen Bach im Freien, dahinter die Berge, in denen Mutter Ski fûÊhrt. Von der Brû¥cke aus steht das Wasser mit jedem Blick still und spiegelt û¥bergangslos die wunderlichsten Bilder und Szenen aus verschiedenen Zeiten. Memoria, ins Innere geht die Reise. Erinnern heiût Veranschaulichen, das im GedûÊchtnis Bewahrte sich zu eigen machen als Gegenwart. Den groûen Bach hat Gunnar Geisse anverwandelt als untergrû¥ndigen Passionsfluss, der alles durchwirkt. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 06.05.2016
Datum: 06.05.2016Länge: 01:23:43 Größe: 76.65 MB |
||
| Rainald Goetz: Johann Holtrop (2/2) - 30.04.2016 | ||
| Mit Rainald Goetz / Realistion: Leonhard Koppelmann / BR 2013 / LûÊnge: 80'13 // Ein Chef stû¥rzt ab. Johann Hotrop erzûÊhlt die Geschichte eines Chefs aus Deutschland in den Nullerjahren. "Als die Winter noch lang und schneereich und die Sommer heiû und trocken waren ã Da stand der schwarzglûÊserne Bû¥romonolith sinnlos riesig in der Nacht, am Ortsrand von KrûÑlpa, KrûÑlpa an der Unstrut, dahinter die WûÊlder, die KrûÑlpa nûÑrdlich zur Warthe hin abgrenzten, da leuchtete einsam, bûÑse und rot das glutrote Firmenlogo von Arrow PC oben am Dach û¥ber dem dû¥steren Riesen, aus schwarzem Stahl und schwarzem Glas gemacht, die rote Schrift darû¥ber, ein Neubau, so kaputt wie Deutschland in diesen Jahren, so hysterisch kalt und verblûÑdet konzeptioniert wie die Macher, die hier ihre Schreibtische hatten, sich die Welt vorstellten, weil sie selber so waren, gesteuert von Gier, der Gier ã" | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 30.04.2016
Datum: 30.04.2016Länge: 01:20:19 Größe: 73.54 MB |
||
| Andreas Ammer & Console: "Have You Ever Heard Of Wilhelm Reich?" - 29.04.2016 | ||
|
Mit Stefan Kastner, Marcus Calvin, Judith Huber, Eva LûÑbau / Komposition und Realisation: Andreas Ammer/Martin Gretschmann / BR 2009 / LûÊnge: 56'41 // Am Ende glaubte er, der Schû¥ler von Freud und Freund von Einstein, ein AbkûÑmmling einer himmlischen Rasse zu sein. Da hatte Wilhelm Reich bereits alle Probleme der Menschheit gelûÑst. Egal, ob frû¥h als genialer ûÑsterreichischer Psychiater (Die sexuelle Revolution), spûÊter als hellsichtiger Analyst der Weltkrise (Die Massenpsychologie des Faschismus), dann als Kommunist und Sexualpolitiker (Sexpol) oder am Ende ã nach seiner kryptischen Entdeckung der Orgonenergie ã als Krebsheiler und Regenmacher in der amerikanischen Wû¥ste (Das ORANUR-Experiment). Wilhelm Reich hat alle RûÊtsel der Welt und auch die des Weltraums gelûÑst.
Als Mitarbeiter von Wilhelm Reich der US-Regierung mitteilten, dass dieser das Geheimnis des Lebens entdeckt habe, antworteten die BehûÑrden, dass ein solches ihrer Meinung nach nicht existiere. Im Gegenteil: Den MûÊchtigen musste so viel Wissen unheimlich sein. ãHave You Ever Heard Of Wilhelm Reich?ã, ist eine der Fragen mit denen das FBI in den fû¥nfziger Jahren systematisch dem Universalgelehrten Wilhelm Reich hinterher spionierte. Der Geheimdienst suchte fieberhaft nach Grû¥nden, den einstmals gefeierten Psychiater das Handwerk als Quacksalber zu legen. Reich hingegen warnte das FBI im Gegenzug vor den ãroten Faschistenã, vor der ãEmotionalen Pestã (kurz: EP) oder den UFOs, die Amerika ja schwerlich ohne seine Hilfe besiegen kûÑnne.ôÇDas FBI verbrannte seine Bû¥cher. Wilhelm Reich starb 1957 in einem amerikanischen GefûÊngnis. Seine grûÑûten Erfolge hatte er da erst noch vor sich: Allerdings kehrte er nicht ã so wie er es sich ertrûÊumt hatte und Patti Smith es spûÊter besang (Birdland) ã in einem Raumschiff auf die Erde zurû¥ck, sondern posthum als Prophet der Studentenbewegung. Diese machte sich Reichs Slogan von der ãsexuellen Revolutionã zu eigen. Der Beat-Poet W.S. Burroughs verbrachte zur Inspiration Stunden in Reichs Orgon-Accumulatoren und Hippies sangen Hymnen auf Reichs Erfindungen. In Andenken an das Universalgenie Wilhelm Reich haben Andreas Ammer & Console aus geheimen Akten des FBI, aus der ûÑffentlichen Geschichte der Pop-Musik und aus anderen obskuren Archiven erbitterte Tracks erschaffen. ãHave You Ever Heard Of Wilhelm Reich?ã funktioniert wie ein Musical des Weltgeists oder ein akustischer Orgon-Accumulator. Ein Reichãscher Orgon-Accumulator (kurz: ORAC; Bauanleitung liegt bei) ist eine Holzkiste mit stûÊhlerner Innenwand, dessen Wirkungsweise die Space-Rock-Band Hawkwind einstmals folgendermaûen besang: ãI've got an Orgone Accumulator / It makes me feel greater (...) Itãs a back brain stimulator / Itãs a cerebral vibratorã. Dem folgt und davon singt dieses HûÑrspiel. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 29.04.2016
Datum: 29.04.2016Länge: 00:57:43 Größe: 52.88 MB |
||
| Rainald Goetz: Johann Holtrop (1/2) - 23.04.2016 | ||
| Mit Rainald Goetz / Realistion: Leonhard Koppelmann / BR 2013 / LûÊnge: 78'46 // Ein Chef stû¥rzt ab. "Johann Hotrop" erzûÊhlt die Geschichte eines Chefs aus Deutschland in den Nullerjahren. Der charismatische, schnelle, erfolgreiche Vorstandsvorsitzende Dr. Johann Holtrop, 48, seit drei Jahren Herr û¥ber 80.000 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von fast 20 Milliarden weltweit, ist aus der Boomzeit der spûÊten 90er Jahre noch ganz gut in die neuen, turbulenten, wirtschaftlich schwierigeren Zeiten gekommen. Die Handlung setzt ein im November 2001 und erzûÊhlt in drei Teilen, wie im Laufe der Nullerjahre aus Egomanie und mit den WiderstûÊnden wachsender Weltmissachtung, der Verachtung der Arbeit, der Menschen, der Gegenwart und des Rechts, ganz langsam und fû¥r Holtrop selber nie richtig klar erkennbar, ein totaler Absturz ins wirtschaftliche Aus, das persûÑnliche Desaster und das gesellschaftliche Nichts wird, so abgrundtief und endgû¥ltig, wie sein frû¥herer Aufstieg unwiderstehlich, glorios und plûÑtzlich gewesen war. Das war Ihr Leben, Johann Holtrop! Was sagen Sie dazu? | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 23.04.2016
Datum: 23.04.2016Länge: 01:18:52 Größe: 72.22 MB |
||
| Ulrich Bassenge: musaeum clausum - 22.04.2016 | ||
| Mit Michael Habeck, Matthew Rouse / Komposition und Realisation: Ulrich Bassenge / BR 2010 / LûÊnge: 47'36 // Als einer der letzten Menschen, die alles wussten (wie sonst nur noch sein Zeitgenosse Athanasius Kircher) notiert Sir Thomas Browne (1605-1682) in einem nachgelassenen Text die Desiderata eines imaginûÊren Museums. Er wû¥nscht sich ein verschollenes Ovid-Gedicht ebenso wie ein (nie erschaffenes) GemûÊlde eines ãElefanten auf dem Hochseil - geritten von einem Neger-Zwergã, ein Kruzifix aus Froschknochen oder ein Strauûenei, bemalt mit einem Bild der Schlacht von Alcazar, in der drei KûÑnige das Leben verloren. Vieles in dieser Liste sei verschollen, verloren, verbrannt, geraubt, verkauft, fragmentiert ... ist die ertrûÊumte Wunderkammer des britischen Universalgelehrten ein gelehrter Witz oder eine Utopie? Brownes virtuelles Museum ist nicht das erste seiner Art (bereits ein Jahrhundert zuvor parodierte Rabelais eine imaginûÊre Bibliothek), aber eines der sprachmûÊchtigsten. Wie kein anderer steht dieser kolossale Text mit seinen eigentû¥mlichen Vernetzungen fû¥r die verlorene Zeit, in der Wissen, Glauben, Kunst und Einbildungskraft wie selbstverstûÊndlich in eines zusammenflossen. Noch nicht aufgerissen scheint der Graben zwischen Information und Wissen, jene Wunde unserer Tage. Ulrich Bassenge exploriert mit Browne den Verlust universaler Bildung im Zeitalter des Internet. Er setzt das von W.G. Sebald beschriebene ãGefû¥hl der Levitationã, den ãgefahrvollen HûÑhenflug der Spracheã in der Prosa des groûen englischen Stilisten mit musikalischen Mitteln um. Ein broken consort aus TraversflûÑte, Gambe und Schlagwerk streift durch KlûÊnge und Figuren des 17. Jahrhunderts, die mit elektroakustischen Mitteln seziert, vergrûÑûert, modifiziert werden. So entsteht eine unvollstûÊndige Geschichte des Sammelns, ein Requiem auf die Gelehrsamkeit. ãWer weiû, wo alle diese SchûÊtze sich jetzt befinden, ist ein groûer Apollo. Ich bin sicher, dass ich ein solcher nicht bin.ã | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 22.04.2016
Datum: 22.04.2016Länge: 00:47:02 Größe: 43.11 MB |
||
| Inga Helfrich: Rettet das Geld - 18.04.2016 | ||
|
Mit Wiebke Puls, Edmund TelgenkûÊmper / Komposition: Rosalie Eberle / Realisation: Inga Helfrich / BR 2015 / LûÊnge: 53'16 // Zwei bewaffnete BankrûÊuber mit Sturzhelmen. 5.000 Zuschauer. Eine Riesenwatschn fû¥r einen Feuerwehrmann in spe. Blitzlichtgewitter. Eine Maschinenpistole und ein Revolver. Achtzehn Geiseln. KûÑche mit hohen, weiûen Mû¥tzen. Eine ãRote Frontã, die nicht politisch ist. LûÑsegeldforderung: 2 Millionen DM. Live-ûbertragung im Fernsehen. Catering vom besten FeinkostgeschûÊft der Stadt. Pfiffe fû¥r den MinisterprûÊsidenten. Hobby-JûÊger als Scharfschû¥tzen der Polizei. Was klingt wie die Zutaten fû¥r eine groteske KriminalkomûÑdie, war am Mittwoch, den 4. August 1971 grausame RealitûÊt. Zwei bewaffnete MûÊnner û¥berfallen die Filiale der Deutschen Bank in der Mû¥nchner Prinzregentenstraûe und verû¥ben den ersten bewaffneten Bankû¥berfall mit Geiselnahme in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Fû¥r die Freilassung der Geiseln verlangen sie 2 Millionen D-Mark. Auf ihre Forderungen lûÊsst sich die Kriminalpolizei nur zum Schein ein. Beim Sturmangriff der Polizei sterben eine Geisel und ein Geiselnehmer. Die Tasche mit den zwei Millionen wird noch wûÊhrend der Schieûerei sichergestellt. Der Innenminister stellt fest: ãNach Sachlage, blieb keine andere als die getroffene Entscheidung.ã In den Medien wird sowohl in einem bis dahin einzigartigen Spektakel live û¥ber das Geschehen berichtet, als auch anschlieûend die Geschichte bis ins kleinste Detail ausgeschlachtet: Zwei MûÊnner gehen û¥ber Leichen. Die demokratische Staatsmacht ist û¥berfordert. Es ist der alte Kampf zwischen Gut und BûÑse. Das Gericht statuiert ein Exempel. Der û¥berlebende TûÊter wird wegen fû¥nffachen Mordversuchs und rûÊuberischer Geiselnahme zu 22 Jahren Haft verurteilt. Das HûÑrspiel Rettet das Geld basiert auf dokumentarischem Material und den Befragungen von Beteiligten. Ein Ereignis in mehreren Perspektiven: Der Junge, der im Radio von dem ûberfall hûÑrte und spontan beschloss, zum Schauplatz des Verbrechens zu fahren, wo er sich unter tausende Schaulustige einreihte. Der Polizist, der frisch von der Polizeischule kam und fû¥r den die Geiselnahme der erste spektakulûÊre Fall seiner Karriere wurde. Der TûÊter, der 22 Jahre hinter Gittern verbracht hat. Und die Aussagen einer Geisel wenige Tage nach dem Schreckenstag. Aus ihren teils lakonischen, teils emotionalen Erinnerungen wird eine ErzûÊhlung û¥ber die Macht und Erotik des Geldes. Zugleich entsteht ein PortrûÊt der Stadt Mû¥nchen in den Siebziger Jahren. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 18.04.2016
Datum: 18.04.2016Länge: 00:53:22 Größe: 48.87 MB |
||
| Michaela MeliûÀn: Speicher - 08.04.2016 | ||
| Thematischer und formaler Ausgangspunkt fû¥r Speicher ist "VariaVision - Unendliche Fahrt", die 1965 realisierte, heute verschollene intermediale Arbeit von Alexander Kluge (Texte), Edgar Reitz (Filme) und Josef Anton Riedl (Musik) zum Thema des Reisens. // Mit Stefan Merki, Hans Kremer, Peter Brombacher, Christos Davidopoulos, Chris Dercon, Laura Maire / Komposition: Michaela MeliûÀn/Carl Oesterhelt / Realisation: Michaela MeliûÀn / BR in Zusammenarbeit mit den Mû¥nchner Kammerspielen 2008 / LûÊnge: 53'01 "VariaVision" versuchte als Rauminstallation durch die gleichzeitige Vorfû¥hrung und Wiedergabe von Filmen, mehrkanaliger Musik und Sprache eine neue und andere Wahrnehmung von Musik, Film und Text zu verwirklichen. Reitz und Kluge unterrichteten damals an der internationalen Hochschule fû¥r Gestaltung (HfG) Ulm, die in der kurzen Zeit ihres Bestehens zwischen 1955 und 1968 maûgeblich die deutsche und internationale Design-, Kunst- und Mediengeschichte geprûÊgt hat. Die HfG fû¥hrte als private Hochschule, getragen durch die Geschwister-Scholl-Stiftung, die gewaltsam beendete Tradition des Bauhauses fort und definierte fû¥r die BRD die Begriffe Moderne/Utopie/Gestaltung/Alltagskultur/Erziehung/frû¥he digitale Kultur im Sinne eines demokratischen und ûÊsthetischen Neuanfangs in Deutschland nach 1945, zwischen Utopien und RealitûÊtssinn. So befand sich in der Hochschule ab 1963 eines der ersten elektronischen Studios in Westdeutschland, das 1959 in Mû¥nchen gegrû¥ndete Siemens-Studio fû¥r elektronische Musik. Das Studio mit seinem Versprechen von neuen, rein elektronisch erzeugten KlûÊngen, wurde seinerzeit sehr erfolgreich international von Komponisten und Musikproduzenten genutzt, heute ist es im Deutschen Museum Mû¥nchen ausgestellt. Riedl realisierte in diesem Studio die Musik fû¥r "VariaVision". Fû¥r Speicher hat Michaela MeliûÀn das Studio im Deutschen Museum Mû¥nchen noch einmal zum Klingen gebracht. Diese KlûÊnge, TûÑne, GerûÊusche wurden aufgezeichnet und bilden die klanglichen Basisbausteine fû¥r eine neue Komposition. Dazu verschrûÊnkt sie Aussagen und Texte zu Reise und Bewegung zu tûÑnenden Schleifen und Spiralen. In den Mû¥nchner Kammerspielen entstand am 29. Februar 2008 wûÊhrend des Festivals "DOING IDENTITY-BASTARD MûNCHEN" (26.01.-08.03.08) mit "Speicher" eine Raumsituation, die die Konzeption von VariaVision mittels Projektionen und Wandzeichnungen, Stimme und Musik aufgreift, in der die Besucher sich als Teil derselben dynamisch wahrnehmen, in der der Standpunkt des Publikums nicht definiert ist. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 08.04.2016
Datum: 08.04.2016Länge: 00:53:07 Größe: 48.64 MB |
||
| Theodor W. Adorno: Traumprotokolle - 03.04.2016 | ||
| Mit Andreas Dorau / Komposition und Realisation: zeitblom / BR 2016 / LûÊnge: 51'46 // "Unsere TrûÊume sind nicht nur als 'unsereã untereinander verbunden, sondern bilden auch ein Kontinuum, gehûÑren einer einheitlichen Welt an, so etwa wie alle ErzûÊhlungen von Kafka in 'Demselbenã spielen." Adorno notierte diesen Gedanken Anfang 1956. Die Bedeutung des motivischen Zusammenhangs der TrûÊume lieû ihn eine Reihe von ihnen auswûÊhlen und fû¥r eine Publikation vorbereiten, die zu seinen Lebzeiten nicht mehr erschien. Der Zeitraum der ausgewûÊhlten TrûÊume umfasst rund 35 Jahre - von Januar 1934 bis April 1969. ãDie Traumprotokolle, aus einem umfangreichen Bestand ausgewûÊhlt, sind authentisch. Ich habe sie jeweils gleich beim Erwachen niedergeschrieben und fû¥r die Publikation nur die empfindlichsten sprachlichen MûÊngel korrigiertã ã so Adorno. Es sind knapp gehaltene, sehr pointiert geschriebene Zusammenfassungen von Angst- und AlptrûÊumen, libidinûÑsen TrûÊumen, TrûÊumen, die den trûÊumenden Autor beim Erwachen laut auflachen lassen ãû¥ber den vermeintlich genialen Witzã sowie nicht selten von TrûÊumen, die Begriffe und deren Bedeutungen nicht mit kategorisierender Ratio sondern mit einer bildhaften Traum-Logik reflektieren. Sie geben Einblick in die inneren Welten eines Philosophen, der sein theoretisches Denken immer als auûerordentlich nah an seinen kû¥nstlerischen Intentionen empfand. ãDie radiophone Umsetzung der Traumprotokolle mit Andreas Dorau versucht die Spur der TrûÊume aufzugreifen und auf einer Soundebene umzusetzen: Erratisch, mit wenigen Referenzpunkten. Aufgebaut auf einige wenige Loops und Samples, setzt sich ein akustischer Prozess in Gang. Ein nieselndes Rauschen, ein Nebel aus Knistern und Knacken, wie von einer abgespielten Nadel in der Auslaufrille. Die fragmentarischen und stark bearbeiteten KlûÊnge eines Streichquartetts, eines treated Pianos und der menschlichen Stimme prûÊgen das HûÑrstû¥ck. Unterbrochen nur von Ort- und Zeitangaben tauchen Melodiefragmente aus einem Fluss aus Tonmaterial und GerûÊuschen auf, mit einer Stimme die sich daraus hervorschûÊlt und wieder zurû¥ckziehtã. (zeitblom) | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 03.04.2016
Datum: 03.04.2016Länge: 00:51:51 Größe: 47.48 MB |
||
| Eran Schaerf/Eva Meyer: Europa von weitem - 01.04.2016 | ||
|
Mit Eva Meyer / Komposition: Inge Morgenroth / Realisation: Eva Meyer/Eran Schaerf / BR 1999 // In einem Museum soll eine Ausstellung stattfinden mit dem Titel: ãPortrûÊts einbalsamierter junger Frauen'. Es werden Frauen gesucht, die in die Rolle der Museumsexponate schlû¥pfen sollen. Die Darstellerinnen arbeiten sich ein, sie beginnen, eigene Geschichten zu entwickeln, sie ãwerden' die dargestellten Personen. ûber dieser Debatte verwirrt sich die anfangs reale Situation immer mehr. Es kommt zu unerwarteten Konfrontationen und Widersprû¥chen zwischen der eigenen Erinnerung und den vorgegebenen Bildern. Die Frauen werden zu Projektionen, die sich zu verschiedenen Zeiten zwischen Amerika und dem Nahen Osten aufhalten und ã von weitem ã Europa heiûen. Doch schon mit der Benennung wird die Grenze zwischen Vorstellung und Wirklichkeit durchlûÊssig. Nun sind sie Medien-Doubles von EuropûÊerinnen, die zwischen ihrer ReprûÊsentation als Frau und ihrer tatsûÊchlichen Existenz wechseln. Bin ich EuropûÊerin oder stelle ich sie dar oder stelle ich dar, wie ich eine darstelle? So aber lûÊsst sich Geschichte nicht erzûÊhlen. Die Frauen geben schlieûlich ihre Rolle als IdentitûÊtstrûÊger auf. Als WerbetrûÊger vermarkten sie ihre Projektion, damit sich endlich die Geschichte abspielen kann... ãDoch woran halten sich EuropûÊer, die keinem europûÊischen Staat angehûÑren? Sicher nicht an den Mythos eines vergangenen Europas, sondern an das Erfinden eines zukû¥nftigenã (Eva Meyer und Eran Schaerf). ãEuropa von weitemã wurde zugleich als Film realisiert. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 01.04.2016
Datum: 01.04.2016Länge: 01:13:51 Größe: 67.61 MB |
||
| Alexander Kluge: Die Pranke der Natur (und wir Menschen) Das Erdbeben in Japan, das die Welt bewegte, und das Zeichen von Tschernobyl (2/2) - 28.03.2016 | ||
| Mit Kathrin von Steinburg, Hannelore Hoger, Katja Bû¥rkle, Jochen Striebeck, Gabriel Raab, Nico Holonics, Helmut Stange, Alexandra Kluge, Helge Schneider / Komposition: Gustav, Alva Noto / Bearbeitung und Regie: Karl Bruckmaier / BR 2011 / LûÊnge: 51'49 // Kurze Zeit, bevor das Erdbeben die Nordinsel von Japan um 4 Meter versetzte, der Glockenschlag war bis in die Schweizer Berge zu messen, hatte eine Forschergruppe an der UniversitûÊt Sendai, die in der gleichen PrûÊfektur wie das AKW Fukushima liegt, festgestellt, dass 1000 Jahre zuvor, nûÊmlich im Jahre 869 n. Chr., bereits ein ûÊhnlich schweres Beben, gefolgt von einem Tsunami stattgefunden hat und das - nach ihren Messungen - alle 1000 Jahre sich ein solches Unglû¥ck wiederholt; jetzt seien bereits mehr als 1000 Jahre ins Land gegangen und sie mû¥ssten vor dem Groûen Beben warnen. Wenige Wochen spûÊter erschû¥tterten die Ereignisse in Japan die Welt. Wir Menschen sind auf diesen langen Atem der Natur und auch auf solche plûÑtzliche Gewalt nicht vorbereitet. Es gibt aber menschliche Gemeinwesen und Menschen, die auf die Pranke der Natur achten und auf sie zu antworten wissen. So haben die HollûÊnder ihr Land durch DûÊmme gegen die mordlustige Nordsee erfolgreich geschû¥tzt (so wie sie sich gegen den mûÑrderischen Herzog von Alba verteidigten). Und so sind wir in der Lage, die Zeichen von Fukushima und auch von Tschernobyl wenigstens nachtrûÊglich zu lesen. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 28.03.2016
Datum: 28.03.2016Länge: 00:51:56 Größe: 47.55 MB |
||
| Alexander Kluge: Die Pranke der Natur (und wir Menschen) Das Erdbeben in Japan, das die Welt bewegte, und das Zeichen von Tschernobyl (1/2) - 27.03.2016 | ||
| Mit Kathrin von Steinburg, Hannelore Hoger, Katja Bû¥rkle, Jochen Striebeck, Gabriel Raab, Nico Holonics, Helmut Stange, Alexander Kluge, Edgar Reitz / Komposition: Gustav, Ikue Mori / Bearbeitung und Regie: Karl Bruckmaier / BR 2011 / LûÊnge: 53'50 // Kurze Zeit, bevor das Erdbeben die Nordinsel von Japan um 4 Meter versetzte, der Glockenschlag war bis in die Schweizer Berge zu messen, hatte eine Forschergruppe an der UniversitûÊt Sendai, die in der gleichen PrûÊfektur wie das AKW Fukushima liegt, festgestellt, dass 1000 Jahre zuvor, nûÊmlich im Jahre 869 n. Chr., bereits ein ûÊhnlich schweres Beben, gefolgt von einem Tsunami stattgefunden hat und das - nach ihren Messungen - alle 1000 Jahre sich ein solches Unglû¥ck wiederholt; jetzt seien bereits mehr als 1000 Jahre ins Land gegangen und sie mû¥ssten vor dem Groûen Beben warnen. Wenige Wochen spûÊter erschû¥tterten die Ereignisse in Japan die Welt. Wir Menschen sind auf diesen langen Atem der Natur und auch auf solche plûÑtzliche Gewalt nicht vorbereitet. Es gibt aber menschliche Gemeinwesen und Menschen, die auf die Pranke der Natur achten und auf sie zu antworten wissen. So haben die HollûÊnder ihr Land durch DûÊmme gegen die mordlustige Nordsee erfolgreich geschû¥tzt (so wie sie sich gegen den mûÑrderischen Herzog von Alba verteidigten). Und so sind wir in der Lage, die Zeichen von Fukushima und auch von Tschernobyl wenigstens nachtrûÊglich zu lesen. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 27.03.2016
Datum: 27.03.2016Länge: 00:53:56 Größe: 49.39 MB |
||
| Elfriede Jelinek: Sportchor - 18.03.2016 | ||
|
Mit Stefan Kaminski / Musikalische Arrangements und Hammondorgel: Christoph M. Schaeffer / Regie: Leonhard Koppelmann / BR 2006 / LûÊnge: 54'25 // Alle sprechen vom Sport. Als Kommentar zur Fuûball-Weltmeisterschaft lûÊsst Elfriede Jelinek einen Sportchor auftreten, der alles ausplaudert. Was die Spieler nachts machen. Worû¥ber sie reden dû¥rfen. Warum sie ihren KûÑrper zur Schau stellen. Welches Image sie wollen kûÑnnen. Die Presse ist immer dabei, man darf und soll ihr alles sagen. ûber die biologische Wehrpflicht des Zuschauers, die Rebellion auf dem Rasen und den Anspruch auf die Frau. ûber Bewegung und Stillstand, Krieg und Frieden. Doch die Unterschiede gehen ins Aus und verloren. Der Bildschirm zeigt es. "Wir passen nun mal nicht zu dem Bild, das sich die Medien von uns gemacht haben, aber jetzt passen wir schon." Sport braucht Sprache. Der Sportchor vereinigt die Stimmen, die immer und û¥berall fû¥r die Massen berichten: Torwartdarsteller, Pressevertreter, Damenfuûballerinnen und authentische Helden. "Ich bin der andre, der heute gesiegt hat. Ich bin, der ich bin. Ich bin heute ein Gott. Ich bin ein Fuûballgott." Mit ihrem Sportchor schlieût Elfriede Jelinek an ihr 1998 uraufgefû¥hrtes 'Sportstû¥ck' an. Der Chor, der in der griechischen TragûÑdie am Rande des Spielfelds steht, rû¥ckt ins Rampenlicht, und die Kommentare zum Spiel verselbstûÊndigen sich: Gesellschaftsspiel, Geschlechterspiel, Kriegsspiel, Medienspiel, Fuûballspiel. "Mehr Menschen gehen nicht ins Auge." |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 18.03.2016
Datum: 18.03.2016Länge: 00:54:31 Größe: 49.92 MB |
||
| Christoph Buggert/Helga Pogatschar: Schachabend - Kriminaloper - 13.03.2016 | ||
|
Mit Salome Kammer (Stimme), Stephanie Pagitsch (FlûÑte), Giorgi Gvantseladze (Oboe), Slava Cernavca (Klarinette), Casey Rippon (Horn), Martynas Sedbaras (Fagott) / Libretto: Christoph Buggert / Komposition und Realisation: Helga Pogatschar / BR 2016 / LûÊnge: 55'52 // Erosion des Rechts von oben: Groûbanken und Industriekonzerne halten sich aufgrund ihrer Systemrelevanz fû¥r legitimiert, geltende Rechtsnormen auûer Kraft zu setzen. Wird man û¥berfû¥hrt, werden einige leitende PersûÑnlichkeiten ausgetauscht - ansonsten lûÊuft das Spiel frûÑhlich weiter. Was passiert, wenn solche Perversionen der Moral ins Alltagsleben unserer Eliten durchsickern? Schachabend ist Teil eines grûÑûeren szenischen Projekts von Christoph Buggert, das dieser Frage nachgeht. "Fû¥nf honorige und wohlsituierte Bû¥rger û¥bergeben einen ertappten Einbrecher nicht den Gerichten, sondern û¥bernehmen die Aburteilung gleich selbst. Sorgsam achtet man darauf, dass alles nach Recht und Gesetz ablûÊuft. Schlieûlich verfû¥gt einer der Herren in seinem Bû¥cherschrank û¥ber ein gut erhaltenes Exemplar des Kaiserlich-ûÑsterreichischen Kriegsstrafrechts. Oper und bû¥rgerliches Leben stehen sich seit jeher sehr nahe. Eine Fû¥lle von Ritualen, in denen die heutige Bû¥rger-Gesellschaft sich selbst darstellt ã Bundestagsdebatten, Talkshows, AktionûÊrs-Versammlungen, Vernissagen, Fachkongresse ã wû¥rden in gesungener Form erst richtig aufblû¥hen."(Christoph Buggert) Fû¥nf Blasinstrumente synchronisieren die Sprechrollen. Zusammen ergeben sie den skurrilen KlangkûÑrper eines BlûÊserquintetts. Die Rollen lûÑsen sich aber schnell auf: die Instrumente reiûen sich von den Rollen los, die Sprache demontiert sich selbst durch unsinnige Betonungen. "Salome Kammer û¥bernimmt die Rollen der fû¥nf Individuen in persona, leiht ihnen mal singend, mal sprechend ihre Frauenstimme. Alle sind sich einig und verhalten sich unterm Strich gleich. Der Text wird dabei nicht nach semantischer Bedeutung vertont, sondern nach rein musikalischen Aspekten dem eigentlichen Sinn entfremdet. So entsteht eine Stunde durchkomponierte Musik, eine Kriminaloper, in Form eines technokratischen Polizei-Protokolls. Grotesk und skuril, dabei in seiner teilnahmslosen Haltung dem unaussprechbar Schrecklichen gegenû¥ber umso grausamer." (Helga Pogatschar) |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 13.03.2016
Datum: 13.03.2016Länge: 00:55:58 Größe: 51.25 MB |
||
| Michaela MeliûÀn: Electric Ladyland - 11.03.2016 | ||
|
Mit Christos Davidopoulos, Juno Meinecke, Damian Rebgetz, Steven Scharf / Chor: Miriam von Aufschnaiter, Anton Winstel, Antonia Wirth, Moritz Zehner Gesang: Maximiliane Reichart Violine: Ruth May /Komposition und Realisation: Michaela MeliûÀn / BR 2016 / LûÊnge: 57'12 // Ausgangspunkt fû¥r Electric Ladyland ist die Musik Jacques Offenbachs und im Besonderen der zweite Akt aus Hoffmanns ErzûÊhlungen. Les Contes d'Hoffmann ist eine opûˋra comique, also eine Nummernoper mit gesprochenen Dialogen. Sie wurde 1881, ein Jahr nach Offenbachs Tod, in Paris uraufgefû¥hrt. Eine endgû¥ltige, von Offenbach autorisierte Partitur liegt fû¥r dieses Werk nicht vor, es existieren zahlreiche Manuskriptseiten mit Varianten. Offenbach hatte zumeist nur Sing- und die Klavierstimme skizziert. Der zweite Akt beruht auf der ErzûÊhlung Der Sandmann aus den Nachtstû¥cken von E.T.A. Hoffmann. Im Mittelpunkt steht hier die lebensgroûe, wunderschûÑne mechanische Puppe Olympia, es geht um lebende Augen und eine Brille, durch die die Welt in euphorischem Licht erscheint. In der Figur der Olympia verbindet sich die fantastische ErzûÊhlung von E.T.A. Hoffmann mit den Erfahrungen im Zeitalter der Industrialisierung. So ist das internationale Publikum auf der Weltausstellung 1867 in Paris fasziniert von neuen technischen Errungenschaften und kann sich gleichzeitig in den Erlebnisparks, den exotischen Architekturen und bei den VûÑlkerschauen amû¥sieren. Zum Beispiel besteht der Beitrag Preuûens in Paris unter anderem in einem maurischen Kiosk, daneben zeigt die deutsche Firma Krupp riesige, so noch nie gesehene Kanonen und Werner Siemens seine Dynamo-Maschine, die ein neues Zeitalter der Elektrotechnik einleitet. WûÊhrend die Pariser Gesellschaft im Operettenrausch und im durch Spekulationen an der BûÑrse erworbenen Reichtum schwelgt, steigen die Mieten und Alltagskosten unentwegt und die Arbeiter werden massenhaft in die Auûenbezirke von Paris abgedrûÊngt. Die Automatenpuppe Olympia ist das Vorbild fû¥r unzûÊhlige Darstellungen von Robotern, Androiden und Cyborgs in Film und Literatur. Mit ihrem immerwûÊhrenden LûÊcheln, und ihrem mehr als reduzierten SprachvermûÑgen (sie kann nur ãAchã sagen, was eigentlich immer passt) entspricht Olympia perfekt den Vorstellungen von einem gut erzogenen jungen MûÊdchen. Sie verhûÊlt sich einwandfrei, sie singt und tanzt gut. Ihr eigentliches Menschsein findet immer nur in den Augen derer statt, die sie betrachten. Aber Olympia hûÊlt sich nicht an ihre Programmierung, sie funktioniert nicht. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 11.03.2016
Datum: 11.03.2016Länge: 00:57:18 Größe: 52.46 MB |
||
| Aischylos: Die Perser - 05.03.2016 | ||
|
Mit Hildegard Schmahl, Sylvana Krappatsch, Stefan Hunstein, Wolfgang Pregler, Nico Holonics, Chor des Persischen Volkes: Rania Abdulkarim, Reyhan Abdulkarim, Isra Haitham Hussein, Afra Haitham Hussein, Chendar Hamid Sharif, Peter Hartel, Walter Hub, Bruno JûÊger, Rosemarie Leidenfrost, Adnan Mujic, Dzana Mujic, Kalikedan Mulugeta, Angelika Pietrzik, Anis Pohovac, Jû¥rgen von Salisch, Jasmina Taric, Theodora Winter, Christof Yelin u.a. / Aus dem Griechischen von Durs Grû¥nbein / Musik: Carl Oesterhelt, Salewski, Mathis Mayr / Regie: Johan Simons/Katja Langenbach / BR/Mû¥nchner Kammerspiele 2011 / LûÊnge: 97'26 // In "Die Perser" greift der griechische Dichter Aischylos acht Jahre nach der Schlacht bei Salamis 480 v. Chr. - bei der er selbst dabei war - einen aktuellen Stoff auf. Es ist das ûÊlteste Stû¥ck des klassich-antiken Theaters und gilt als eines der ûÊltesten der Welt. Auûerordentlich ist Aischylos' klug gewûÊhlte Perspektive, aus der Sicht des geschlagenen Gegners zu erzûÊhlen. Atossa, die Mutter des jungen PerserkûÑnigs Xerxes, ahnt das Unglû¥ck. Zusammen mit dem Rat der ûltesten wartet sie vor dem Palast in Susa auf Nachrichten aus der Schlacht. Xerxes ist erneut gegen die Griechen in den Krieg gezogen. Mit der Nachricht eines Boten werden die Befû¥rchtungen war. Gemeldet wird der Untergang der mehr als 200 Schiffe umfassenden Flotte bei Salamis und die Niederlage des Heeres. Die Klage von Chor und Mutter mû¥ndet in eine BeschwûÑrung des Geistes des Dareios, Vater und VorgûÊnger des Xerxes, der das Unglû¥ck als Strafe fû¥r Hybris, Machtstreben und Verblendung seines Sohnes deutet. Schlieûlich erscheint Xerxes: sich in Selbstanklage zerfleischend und zugleich die Ursache fû¥r die Katastrophe einem von auûen auferlegten Schicksal zuschreibend. Zusammen mit dem Chor ertûÑnt eine generationenû¥bergreifende Schmerzens- und Totenklage. ãDas Drama des zoon politikon, das ohne Not sein Gemeinwesen aufs Spiel setzt, sich selbst û¥berlassen, ausgeliefert den eigenen Kriegszielen und dem Phantasma der Allgewaltigen ã Statistiken, InformationsstrûÑme, Medien, DûÊmonen, das sind 'Die Perser' des Aischylosã schreibt der Lyriker Durs Grû¥nbein. In "Die Perser" zeigt sich die Utopie in der Empathie der Sieger fû¥r die Besiegten. Der geschlagene Gegner muss nicht herabgesetzt werden, vielmehr stellen die Griechen sich im Mitleiden mit den geschlagenen Persern selbst in Frage. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 05.03.2016
Datum: 05.03.2016Länge: 01:37:17 Größe: 89.08 MB |
||
| Hugo Ball: Tenderenda der Phantast (2/2) - 26.02.2016 | ||
| Mit Meret Becker, Nadeshda Brennicke, Katharina Franck, Patrick Gû¥ldenberg, Lilith Stangenberg / Musik: Franz Hautzinger / Regie: Michael Farin / BR 2016 / LûÊnge: 61'42 // Das ungestû¥me, wild û¥berbordende Textkonvolut "Tenderenda", dessen Teile in der Zeit zwischen Herbst 1914 und Juli 1920 geschrieben wurden, ist das "geheime VermûÊchtnis" Dadas. Das zweiteilige HûÑrspiel prûÊsentiert dieses von Ball auch einmal als "Phantatischer Roman" bezeichnete Werk ohne Kû¥rzungen. Es wurde einer Leserschaft erstmals 1967 in Buchform zugûÊnglich gemacht, aber bereits zu Lebzeiten Balls waren markante Teile dieses als "work in progress" entstandenen Textes auf diversen Dada-Soirûˋen immer aufs Neue bû¥hnenwirksam erprobt worden. Am 2. Juni 1916 schreibt Ball an seinen Freund August Hofmann: "Ich weiû einige sehr lustige Dinge, die mûÑchte ich gerne aufschreiben. Einiges davon lese ich oben in der Kneipe vor und man freut sich manchmal sehr darû¥ber. Das ist so etwas wie Bruchteile aus einem satirischphantastisch-pamphletisch-mystischen Roman. Weiû der Teufel, was fû¥r eine Miûgeburt. Aber irgendwie hûÊngts mit der Zeit zusammen." Wer sich heute an Tenderenda wagt, dem entzû¥ndet sich ein Feuerwerk. Die ûberschriften der 15 Sequenzen - "Das Karusselpferd Johann" etwa, "Der Untergang des Machetanz", "Satanopolis", "Grand Hotel Metaphysik", "Der Verwesungsdirigent" - sind dabei Programm. Jedes Genre ist erlaubt. Alles ist Parodie, alles Subversion. Eine jede Phantasie fû¥hrt in die richtige Richtung - und weist dabei stets auf jenes erschû¥tternde Ereignis hin, das die damalige Welt komplett aus den Angeln gehoben hat: den Ersten Weltkrieg. Seither war nichts mehr, wie es war. Schon gar nicht die Kunst. Wie alle weltanschaulichen GebûÊude zerfiel auch sie in lauter Einzelteile. Mit phantasievollen Tricks versuchten Kû¥nstler allerorten, sich den perfiden GedankengûÊngen der Herrschenden zu entziehen. Sie unterliefen die an sie gesteckten Erwartungen und konterkarierten den Wahnsinn der Welt durch Klamauk, was gedanklichen Tiefgang nicht ausschloss. Ihr Mittel, sich vom technokratischen Wahnsinn der Kriegstreiber zu distanzieren, war die absolute Freisetzung der Sprache. Und auch wenn sie dabei nicht selten um das Goldene Kalb des lãart pour lãart tanzten, wurden sie vielleicht gerade deswegen - je zynischer die Farce - zur moralischen Instanz. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 26.02.2016
Datum: 26.02.2016Länge: 01:01:44 Größe: 56.53 MB |
||
| Hugo Ball: Tenderenda der Phantast (1/2) - 19.02.2016 | ||
| Mit Meret Becker, Nadeshda Brennicke, Katharina Franck, Patrick Gû¥ldenberg, Lilith Stangenberg / Musik: Franz Hautzinger / Regie: Michael Farin / BR 2016 / LûÊnge: 67'02 // Das ungestû¥me, wild û¥berbordende Textkonvolut "Tenderenda", dessen Teile in der Zeit zwischen Herbst 1914 und Juli 1920 geschrieben wurden, ist das "geheime VermûÊchtnis" Dadas. Das zweiteilige HûÑrspiel prûÊsentiert dieses von Ball auch einmal als "Phantatischer Roman" bezeichnete Werk ohne Kû¥rzungen. Es wurde einer Leserschaft erstmals 1967 in Buchform zugûÊnglich gemacht, aber bereits zu Lebzeiten Balls waren markante Teile dieses als "work in progress" entstandenen Textes auf diversen Dada-Soirûˋen immer aufs Neue bû¥hnenwirksam erprobt worden. Am 2. Juni 1916 schreibt Ball an seinen Freund August Hofmann: "Ich weiû einige sehr lustige Dinge, die mûÑchte ich gerne aufschreiben. Einiges davon lese ich oben in der Kneipe vor und man freut sich manchmal sehr darû¥ber. Das ist so etwas wie Bruchteile aus einem satirischphantastisch-pamphletisch-mystischen Roman. Weiû der Teufel, was fû¥r eine Miûgeburt. Aber irgendwie hûÊngts mit der Zeit zusammen." Wer sich heute an Tenderenda wagt, dem entzû¥ndet sich ein Feuerwerk. Die ûberschriften der 15 Sequenzen - "Das Karusselpferd Johann" etwa, "Der Untergang des Machetanz", "Satanopolis", "Grand Hotel Metaphysik", "Der Verwesungsdirigent" - sind dabei Programm. Jedes Genre ist erlaubt. Alles ist Parodie, alles Subversion. Eine jede Phantasie fû¥hrt in die richtige Richtung - und weist dabei stets auf jenes erschû¥tternde Ereignis hin, das die damalige Welt komplett aus den Angeln gehoben hat: den Ersten Weltkrieg. Seither war nichts mehr, wie es war. Schon gar nicht die Kunst. Wie alle weltanschaulichen GebûÊude zerfiel auch sie in lauter Einzelteile. Mit phantasievollen Tricks versuchten Kû¥nstler allerorten, sich den perfiden GedankengûÊngen der Herrschenden zu entziehen. Sie unterliefen die an sie gesteckten Erwartungen und konterkarierten den Wahnsinn der Welt durch Klamauk, was gedanklichen Tiefgang nicht ausschloss. Ihr Mittel, sich vom technokratischen Wahnsinn der Kriegstreiber zu distanzieren, war die absolute Freisetzung der Sprache. Und auch wenn sie dabei nicht selten um das Goldene Kalb des lãart pour lãart tanzten, wurden sie vielleicht gerade deswegen - je zynischer die Farce - zur moralischen Instanz. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 19.02.2016
Datum: 19.02.2016Länge: 01:07:10 Größe: 61.51 MB |
||
| Walter Serner: Letzte Lockerung - 14.02.2016 | ||
|
Mit Dirk von Lowtzow / Komposition und Realisation: zeitblom / BR 2012 / LûÊnge: 56'40 // Letzte Lockerung. Ein Handbrevier fû¥r Hochstapler und solche, die es werden wollen, diese "glûÊnzende Analyse des Zeitalters des vollendeten Nihilismus" (JûÑrg Drews) schrieb Walter Serner 1918. 1920 verûÑffentlichte er den ersten Teil als dadaistisches Manifest. Erst 1927 kam ein weiterer Teil dazu und das Werk erhielt seinen Untertitel. Die Letzte Lockerung bietet Hinweise zu allem, worû¥ber Kosmopoliten informiert sein sollten, darunter Menschenkenntnis, Reisen und Hotels, MûÊnner, Frauen, Kleidung und Manieren, Elementares und Sonderlich Wichtiges. Serner wirft mit diesem Ratgeber fû¥r Dandytum und anarchischem Hedonismus Schlaglichter auf eine moralisch verkommene Gesellschaft und feiert die IndividualitûÊt. Neben unausfû¥hrbaren Handlungsanweisungen (womit er den Situationisten einige Jahrzehnte vorgegriffen hat) stehen scharfsinnige Analysen politischer ZustûÊnde und lakonisch formulierte Welterkenntnisse. Sieben Motti stellt er Teil 1, acht Motti Teil 2 voran. Dazwischen eingestreute Lieder zu vûÑllig anderem. Den roten Faden bildet die Zerstreuung, das EnzyklopûÊdische. ãWalter Serners Lektû¥re als letzte Lockerung vor der AuflûÑsung der Strukturen. Dirk von Lowtzows Stimme als Bindeglied zwischen Serners geistreich und kû¥hl aggressiver Hochstapler Lyrik und einer minimalistischen Elektrosymphonie. Lieder als bis ins Detail fragmentierte Tracks, werden zerhackt, aufgeladen mit Disharmonien, abgebrochene Rhythmen, melancholische Melodielinien, verfilterte Soundschleifen, eingestreute StûÑrsignale und Rauschen. Ein A-Capella Stil ã erst einstimmig, dann zweistimmig, um in einem mehrstimmigen Chor zu mû¥nden, unterlegt von sich endlos wiederholenden Sounds in variierenden Schattierungen. ãDer zerebrale Rausch, in dem diese Lektû¥re geschieht, kann nicht groû genug seinã, schrieb Walter Serner, der zerebrale Rausch, der beim HûÑren entsteht, sollte es ebenso sein.ã (zeitblom) |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 14.02.2016
Datum: 14.02.2016Länge: 00:56:27 Größe: 51.68 MB |
||
| Richard Huelsenbeck: Doctor Billig am Ende - 07.02.2016 | ||
| Mit Hans-Peter Hallwachs, Jens Harzer, Natalija Yefimkina, Sven Lehmann, Ingo Hû¥lsmann, Robert Gallinowski, Axel Werner, Martin Engler, Bernd Stempel, Gertie Honeck / Komposition: Gerd Bessler / Bearbeitung und Regie: Ulrich Gerhardt / BR 2011 / LûÊnge: 57'31 // Billig blickt dem Leben ins Gesicht! Anders als so viele seines akademischen Standes schafft der unerhûÑrte Dr. phil. sich ein Schicksal: Er entzieht sich dem bû¥rgerlichen Spieûertum, nur um am Ende an der organisierten Dummheit und BrutalitûÊt einer Gesellschaft des Krieges zu Grunde zu gehen. Auf einem Pferderennen begegnet Billig, Syndicus der Z.Y.N.K. mit unbefriedigten Sehnsû¥chten und Hang zum Abenteuer, der internationalen Kokotte Margot. Er gerûÊt in einen Taumel erotischer Verzû¥ckung und in ein Milieu von Kriegsgewinnlern, Hehlern und Schiebern, denen Margot als Unternehmerin vorsteht. Er wird Margots Geliebter, Direktor eines spekulativen GroûgeschûÊftes um rumûÊnisches Getreide und lebt sein Leben plûÑtzlich in halber Bewusstlosigkeit. Weil durch das offizielle Verbot von Handelsbeziehungen mit RumûÊnien das Projekt grandios scheitert und Billig mit einem Duell den letzten rettenden Geldgeber vergrault, lûÊsst Margot ihren kleinen Billig fallen, nicht bevor sie seine letzten finanziellen Reserven eingefordert hat. Ein von Margot in Auftrag gegebener grausamer Mord weckt Billig auf, empûÑrt ihn maûlos und lûÊsst ihn nun doch zum enthusiastischen Verteidiger von Moral und Gesetz werden. Am Ende, nach so vielen bedeutenden Erlebnissen und gestrandet als Obdachloser, hat Billig nicht nur seine Lebensstellung bei Z.Y.N.K. sondern auch den Glauben an den Menschen verloren. Einerseits als Roman gegen den Expressionismus geschrieben und bereits 1918 im Prospekt des Club Dada in Auszû¥gen abgedruckt, steht Richard Huelsenbecks Roman Doctor Billig am Ende andererseits in einer literarischen Tradition der Satire, wie sie mit Autoren wie Heinrich Mann, Carl Sternheim oder Walter Mehring aufgerufen ist. Die satirische Zeichnung des Bû¥rgers prûÊsentiert sich bei Huelsenbeck als sprachgewaltige Groteske, voller Energie und Bilderreichtum, ergûÊnzt von Illustrationen von Georg Grosz. Der realistische Ansatz kippt immer wieder um in phantastische Ausmalung und alptraumhafte Szenerien, in der der Schauplatz Berlin zum Mitspieler wird. Als der Roman 1921 im Verlag Kurt Wolff erschient, ist der Elan der Dada-Bewegung bereits abgeflaut und der Erste Weltkrieg seit drei Jahren zu Ende. Nicht zuletzt vor dieser Konstellation û¥bersteigen der Fall Billigs und die Schilderungen der Kriegsgewinnler die konkrete historische Situation hin zur Darstellung einer abgrû¥ndigen, skrupellos agierenden Gesellschaft des Kapitalismus, die aus heutiger Perspektive nichts an AktualitûÊt verloren hat. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 07.02.2016
Datum: 07.02.2016Länge: 00:54:46 Größe: 50.15 MB |
||
| Elfriede Jelinek: Die Schutzbefohlenen, Appendix - 30.01.2016 | ||
| Autorinnenlesung / BR 2016 / LûÊnge: 56'48 // Das 2013/2014 geschriebene Stû¥ck "Die Schutzbefohlenen" aktualisierte die Autorin im September und Oktober 2015 mit zwei Fortschreibungen, "Coda" und "Appendix". "Die Eroberung der Welt als Bild, das war einmal, denn Bild ist ja Herstellen. Die Menschen werden aber nicht hergestellt, und sie bleiben nicht, wo sie hingestellt werden. Sie kûÊmpfen um ihre Stellung, das ist keine Stellung, so wie Sie sich das vorstellen, das ist einfach, wie sie sind. Sie haben es aufgegeben, dem Seienden ein Maû zu geben, denn das Maû ist noch nicht geschûÑpft, in das sie hineingehen. Sie gehen aber. Sie gehen weiter. Keine sonnengebrûÊunten Wangen, aber wunde Herzen, trûÊnenkundig, ja, weinen, das kûÑnnen sie. Sie mû¥ssen es kûÑnnen, alle auûer ûrzten und Sehern, denen es schon vergangen ist, mû¥ssen es kûÑnnen. Was, Sie hatten drei Kinder, und jetzt sind es nur noch zwei, das dritte, zufûÊllig drei Jahre alt, fehlt plûÑtzlich? Das ist noch gar nichts im Vergleich zu anderen, die es gar nicht mehr gibt, beruhigen Sie sich!" (Elfriede Jelinek) | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 30.01.2016
Datum: 30.01.2016Länge: 00:58:44 Größe: 53.78 MB |
||
| Elfriede Jelinek: Die Schutzbefohlenen, Coda - 30.01.2016 | ||
| Autorinnenlesung / BR 2016 / LûÊnge: 56'48 // Das 2013/2014 geschriebene Stû¥ck "Die Schutzbefohlenen" aktualisierte die Autorin im September und Oktober 2015 mit zwei Fortschreibungen, "Coda" und "Appendix". "Da zittert was, das Boot, es zittert, das ist doch Zittern, oder?, nein, dafû¥r gibt es noch ein andres Wort, nein, das paût mir auch nicht, es wackelt, das Boot, es schwankt, wahrscheinlich weil Hermes und Athene nicht als Pinne im Kompaû eingebaut sind, zwischen ihnen zittert was, das Boot zittert vor Angst, nein, es schaukelt, weil diese Leute nicht ruhig sitzen kûÑnnen; kein Mann hûÊlt die Segel, Segel hat es keine, die wûÊren aber praktisch, es hat noch Luft, das Boot, es wird sie auch brauchen, da ist noch Luft drinnen, aber nicht mehr lang. Da ist noch Luft nach oben, aber nicht mehr lang. Dann gehts nach unten, dann nehmen wir ein Bad. Der KûÑrper wird zum Gedanken wird zum KûÑrper, und der Gedanke verhûÊlt sich zu seinem Wirt wie die Schneide zum Messer. Gehts hier in den marmornen Wald mit steinernen BûÊumen, wenn ja, dann wûÊren wir gern hier, nein, hier gehts nach Griechenland zu den GûÑttern, womûÑglich kommen Sie nie hin, Sie und die Kameraden, bitte, das Boot ist wie ein, jetzt fûÊllt es mir nicht ein, wie ein dicht bestecktes Nadelkissen in der Weiberwelt, voll will ich nicht sagen, ja, aber voll ist es trotzdem. Kein Nadelwald in der NûÊhe, den hat das Boot gemieden, das Wasser satter als Glas, aber unzerbrechlich, es teilt sich, es wûÊchst zusammen, was zusammengehûÑrt, alles eins, Wasser eben. Nur die Menschen gehen kaputt, die hineinfallen. Zerbrechen kûÑnnen sie nicht, das Wasser nimmt sie auf, es nimmt die Menschen in den Schnabel, nein, Schnabel kann man nicht sagen, so wie man zittern nicht sagen kann, bitte, kann mir jemand neue WûÑrter hereinreichen, vielen Dank, WûÑrter marschieren, auch hier sind welche aufgeschrieben, die Kû¥che ist erûÑffnet, nur zu essen gibt es nichts, nein, zu trinken auch nicht, ist Ihnen das denn nicht genug Wasser hier, wollen Sie etwa noch mehr?" (Elfriede Jelinek) | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 30.01.2016
Datum: 30.01.2016Länge: 00:56:53 Größe: 52.09 MB |
||
| Wassily Kandinsky: KlûÊnge (2/2) - 29.01.2016 | ||
|
Tracks: 1. David Grubbs: BlûÊtter, LûÊnge: 01.31, E-Gitarre und Komposition: David Grubbs, Becken: Eli Keszler, aufgenommen von Mitch Rackin in der Seaside Lounge, Brookly, NY, Stimme: Gabriel Raab / 2. Jeff Beer: Hû¥gel, LûÊnge: 10.26, Komposition und Musik: Jeff Beer, Stimme: Detlef Kû¥gow / 3. Sophia Domancich: Blick, LûÊnge: 01.50, Klavier, Elektronik, Samples und Komposition: Sophia Domancich,Kontrabass: Yves Rousseau, aufgenommen am 29.September.2014 im Studio de Noel û Boynes, Toningenieur: Thibû´re NûÑmis, Stimme: Helga Fellerer / 4. Antye Greie: Hoboe, LûÊnge: 02.28, Stimmen: Kaiku Choir Hailuoto, Stimme: Antye Greie-Ripatt / 5. Emily Manzo: Frû¥hling, LûÊnge: 04.01, Stimme, Gitarre und Komposition: Emily Manzo, aufgenommen von Andreas Schmid im Faust Studio, Scheer, Deutschland, Mix: Sarah Register / 6. Wreckmeister Harmonies: Glocke, LûÊnge: 07.27, Musik: JR Robinson, Stimme: Detlef Kû¥gow / 7. Federico SûÀnchez: Kreide und Ruû, LûÊnge: 02.57, Musik und Komposition: Federico SûÀnchez, aufgenommen im Schamoni Film & Medien Studio, Mû¥nchen im Oktober 2014, Stimme: Federico SûÀnchez / 8. Lydia Daher: Hymnus, LûÊnge: 02.05, Stimme, Gitarre: Lydia Daher, Trompete, prûÊpariertes Flû¥gelhorn, Schlagzeug: Markus Christ, Kontrabass: Tobias von Glenck, Schallplatten-Schneidemaschine, Klarinette: Moritz Illner, Arrangement: Markus Christ, Lydia Daher, Tobias von Glenck, Moritz Illner, Mix: Moritz Illner / 9. Jeff Beer: Blick und Blitz, LûÊnge: 06.31, Komposition und Perkussion: Jeff Beer, fû¥r Sprecher, aufgenommen im Tonstudio des HAWKHILL RECORDS Falkenberg, Mix: Andi Bauer, Stimme: Sebastian Weber / 10. Federico SûÀnchez: Einiges, LûÊnge: 02.12, Komposition und Musik: S. Schnitzenbaumer (Belp), Federico SûÀnchez aufgenommen im Schamoni Film & Medien Studio, Mû¥nchen, Oktober 2014, Stimme: Federico SûÀnchez / 11. Chris Cutler: Bunte Wiese, LûÊnge: 04.17, zusûÊtzlicher Text, Gesang: Susanne Lewis, Komposition und Schlagzeug: Chris Cutler, Bass, Gitarre: Bob Drake, aufgenommen und gemischt zwischen 23. September und 3. Oktober im Studio Midi-Pyrenees, Caudeval, Frankreich, Aufnahmen und Mastering Bob Drake, Stimme: Detlef Kû¥gow / 12. Glenn Jones: Erde, LûÊnge: 01.59, Musik: Glenn Jones, Musiker: Glenn Jones und Matthew Azevedo, Stimme: Sebastian Weber / 13. Antye Greie, KûÊfig, LûÊnge: 03.50, Komposition und Musik: Antye Greie-Ripatti, Produktion, Mastering: AGF, Stimme: Antye Greie-Ripatti / 14. Saam Schlamminger: Anders, LûÊnge: 01.10, Musik: Saam Schlamminger, Stimme: Detlef Kû¥gow / 15. Sophia Domancich: Lied, LûÊnge: 01.32, Musik: Sophia Domancich, Musik: Sophia Domancich (piano, electronique, samples), Sylvaine Hûˋlary (flute) aufgenommen am 29. September 2014 im Studio de Noel ûÀ Boynes, Toningenieur: Thibû´re NûÑmis, Stimme: Sebastian Weber / 16. Emily Manzo: Weiûer Schaum, LûÊnge: 06.35, Musik: Christy und Emily Manzo, Stimme: Emily Manzo / 17. Glenn Jones: Das, LûÊnge: 01.39, Musik: Glenn Jones, Musiker: Glenn Jones und Matthew Azevedo, Stimme: Helga Fellerer / 18. Emily Manzo: Nicht, LûÊnge: 02.51, Musik: Emily Manzo, Emily Manzo (Hammond Orgel, Klavier), aufgenommen von Andreas Schmid im Faustz Studios, Scheer, Deutschland, Mix: Sarah Register, Stimme: Kathrin von Steinburg / Realisation: Karl Bruckmaier und die beteiligten Musiker / Redaktion: Herbert Kapfer / BR 2015 / LûÊnge: 66'21 / Als "KlûÊnge" von Wassily Kandinsky 1912 im Mû¥nchner Piper Verlag erschien, ahnten weder Verlag noch ûffentlichkeit, dass mit diesem schmalen Band mit seinen Holzschnitten und Prosagedichten ein heute legendûÊres Bindeglied zwischen Epochen und Stilen publiziert wurde. Kandinsky selbst betrachtete die entstandene Verknû¥pfung von Bild und Text als Befreiung, als Akt der ûberwindung kû¥nstlerischer BeschrûÊnkungen. ãIn der Vergangenheit wurde ein Kû¥nstler stets schief angeschaut, wenn er sich schriftlich auszudrû¥cken suchte ã als Maler hatte man sogar mit dem Pinsel zu essen und so zu tun, als gûÊbe es keine Gabel.ã So wie sich Kandinsky in seiner Malerei Schritt fû¥r Schritt von der GegenstûÊndlichkeit entfernte, so versuchte er parallel dazu in einer ihm (eigentlich) fremden Sprache die oberflûÊchliche Bedeutung der WûÑrter zu û¥berwinden, die MûÑglichkeit einer neuen Bedeutung, die sich nur in Klang und Rhythmus des jeweiligen Wortes erschloss, zu ergrû¥nden. Manches erinnert hierbei an die expressionistische Dichtung der Zeit, doch geht Kandinsky oft auch einen Schritt weiter, gelingen ihm Zeilen, die schon auf etwas verweisen, das bald Dada heiûen wird. Kein Wunder, dass Hugo Ball û¥ber KlûÊnge ins SchwûÊrmen gerûÊt: ãNiemand, nicht einmal die Futuristen, haben die Sprache dermaûen ausgemistet.ã Wenn Kandinsky schreibt, kûÑnnen wir dem Maler beim Sehen zuhûÑren ã so nahe kommen wir selten dem Schaffensprozess eines Bildenden Kû¥nstlers. Dies mag daran liegen, dass fû¥r Kandinsky das Schreiben ãbloû ein Wechsel des Handwerkszeugsã ist: ãStatt der Palette verwende ich nun die Schreibmaschine. Aber mein innerer Antrieb bleibt derselbe.ã Das KlûÊnge-Projekt der Abteilung HûÑrspiel und Medienkunst des BR û¥bergibt nun diese Texte Kandinskys nach û¥ber einem Jahrhundert einer neuen, pop-sozialisierten Generation von Kû¥nstlern ã die meisten Musiker, manche auch in der Bildenden Kunst aktiv, manche selbst Kunstsammler und Kenner -, um auszuloten, welche Wechselwirkung die ãpression intûˋrieureã des nachgerade archetypischen ãmodernen Kû¥nstlersã Kandinsky in einem neuen Kontext auszulûÑsen in der Lage ist. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 29.01.2016
Datum: 29.01.2016Länge: 01:06:27 Größe: 60.85 MB |
||
| Elfriede Jelinek: Die Schutzbefohlenen - 24.01.2016 | ||
| Mit Jonas Minthe, Matthias Haase, Bettina Lieder, Christoph JûÑde, Janina Sachau / Regie: Leonhard Koppelmann / BR/ORF 2014 / LûÊnge: 56'20 // "Wir sind gekommen, doch wir sind gar nicht da", sagt der Chor in Elfriede Jelineks Die Schutzbefohlenen. Obwohl sie in jû¥ngster Zeit û¥berall prûÊsent sind, die Bilder von Flû¥chtlingsmengen, die sich auf Booten drûÊngen und unter Lebensgefahr die Festung Europa zu erobern suchen, oder von aufbegehrenden Asylbewerbern in deutschen StûÊdten, die auf ûÑffentlichen PlûÊtzen in den Hungerstreik treten, um auf ihre problematische Behandlung aufmerksam zu machen; Stimmen haben diese Menschen selten. Anders in Jelineks Text: Hier meldet sich ein Chor aus Flû¥chtlingen und Asylsuchenden in einer lautstarken Litanei zu Wort und wird doch ungehûÑrt bleiben von den Angerufenen. Geschrieben als Reaktion auf jû¥ngste Asylproteste in Wien, wo eine Gruppe von Flû¥chtlingen die Votivkirche besetzte, und spûÊter durch Zusatztexte zur Flû¥chtlingssituation auf Lampedusa erweitert, û¥berfû¥hrt Elfriede Jelinek in Die Schutzbefohlenen das Tagespolitische ins uralte Menschheitsdrama von Flucht und Abweisung: Die puzzleartig aufscheinenden aktuellen Ereignisse verweben sich mit anderen Texten und Diskursen, unter anderem mit Die Schutzflehenden des Aischylos. Aus den Schutzflehenden in der ûÊltesten bekannten griechischen TragûÑdie werden aber vor dem Hintergrund von aufgeklûÊrter westlicher Welt und vermeintlich allgemein gû¥ltigen humanistischen Werten die Schutzbefohlenen: also diejenigen, denen man verpflichtet ist, Schutz zu geben. Und es wird die Verweigerung dieses Schutzes nicht weniger als zum Verrat am Menschenrechtsgedanken selbst. Es ist nicht zuletzt die Entlarvung solchen Verrats, um den es im einmal devoten, einmal spûÑttischen und auch wieder sehr resignierten Chor der Schutzbefohlenen geht, in den sich auch andere Perspektiven mengen. In die Stimmen der Schutzsuchenden nisten sich die der Gegner und die von Ausnahmeerscheinungen, denen aus politischer GefûÊlligkeit, wegen ãbesonderer Verdiensteã oder einfach nur wegen ihrer Prominenz Sonderbehandlung zuteil wird. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 24.01.2016
Datum: 24.01.2016Länge: 00:56:27 Größe: 51.69 MB |
||
| Wassily Kandinsky: KlûÊnge (1/2) - 22.01.2016 | ||
|
Tracks: 1. Jeff Beer: Vorhang, LûÊnge 00ã35, Komposition: Jeff Beer, Stimme: Kathrin von Steinburg / 2.Glenn Jones: Lenz, LûÊnge 02ã09, Komposition: Glenn Jones, Musiker: Glenn Jones und Matthew Azevedo, Stimme: Gabriel Raab / 3. Sophia Domancich: Abenteuer, LûÊnge 03ã06, Komposition und Piano: Sophia Domancich, Batterie: Simon Goubert, aufgenommen am 29. September 2014 im Studio de Noûˆl, Boynes, Technik : Thibû´re NûÑmis, Stimme: Kathrin von Steinburg / 4. Antye Greie: SpûÊter, LûÊnge 04ã02, Musik: Vladislav Delay, Stimme: Antye Greie-Ripatti, Produktion, Mastering: AGF / 5. David Grubbs: Sehen, LûÊnge 01ã22, Bullroarer, Computer: David Grubbs, Bass drum: Eli Keszler, aufgenommen von Mitch Rackin in der Seaside Lounge, Brooklyn, NY, Stimme: Detlef Kû¥gow / 6. Lydia Daher: Offen, LûÊnge 02ã08, Trompete, prûÊpariertes Flû¥gelhorn, Schlagzeug, Gitarre: Markus Christ, Stimme, Gitarre: Lydia Daher, Kontrabass, Pianette: Tobias von Glenck, Schallplatten-Schneidemaschine, Xylofon, Klarinette: Moritz Illner, Konzept: Lydia Daher, Arrangement: Markus Christ, Lydia Daher, Tobias von Glenck, Moritz Illner, Mix: Moritz Illner / 7. Chris Cutler: Doch Noch, LûÊnge 05'15, Soundscape materials gesammelt von Chris Cutler, Brian Labcyz, Martyn Singleton, Marcelo Radulovic, Otomo Yoshihide, Tom Dimuzio, Jim Denley and Maggi Payne, Aufgenommen und gemischt zwischen 23.September und 3. Oktober 2014 im Studio Midi-Pyrenees, Caudeval, Frankreich, Technik, Mastering: Bob Drake, Stimme: Gabriel Raab / 8. Saam Schlamminger: Der Riss, LûÊnge 01ã15, Komposition: Saam Schlamminger, Stimme: Gabriel Raab / 9. Federico Sanchez: Ausgang, LûÊnge 02ã23, Komposition: Federico Sanchez, aufgenommen im Oktober 2014 im Schamoni Film & Medien Studio, Mû¥nchen, Stimme: Federico Sanchez / 10. David Grubbs: Wurzel, LûÊnge 01ã54, E-Gitarre, Computer: David Grubbs, Musik: David Grubbs, aufgenommen von Mitch Rackin in der Seaside Lounge, Brooklyn, NY, Stimmen: Helga Fellerer und Detlef Kû¥gow / 11. Lydia Daher: Im Wald, LûÊnge 03ã34, Trompete, prûÊpariertes Flû¥gelhorn, Schlagzeug, Gitarre: Markus Christ, Stimme, Gitarre: Lydia Daher, Kontrabass, Pianette: Tobias von Glenck, Schallplatten-Schneidemaschine, Xylofon, Klarinette: Moritz Illner, Konzept: Lydia Daher, Arrangement: Markus Christ, Lydia Daher, Tobias von Glenck, Moritz Illner, Mix: Moritz Illner / 12. David Grubbs: Warum, LûÊnge 01ã13, Banjo, Mandoline: David Grubbs, Snare drums: Eli Keszler, aufgenommen von Mitch Rackin in der Seaside Lounge, Brooklyn, NY, Stimme: Sebastian Weber / 13. Antye Greie: Wasser, LûÊnge 04ã42, Musik: Antye Greie-Ripatti, Produktion, Mastering: AGF, Stimme: Gudrun Gut / 14. Wrekmeister Harmonies: Der Turm, LûÊnge 05'10, Musik: JR Robinson mit Butchy Fuego (Liars), Stimme: Gabriel Raab / 15. Jeff Beer: Tisch, LûÊnge 01ã30, Komposition: Jeff Beer, Stimme: Helga Fellerer / 16. Chris Cutler: Vorfrû¥hling, LûÊnge 04'52, Klavier, Hammond Orgel, AufnahmegerûÊte, Calor Gasflasche: Chris Cutler, aufgenommen und gemischt zwischen 23.September und 3. Oktober 2014 im Studio Midi-Pyrenees, Caudeval, Frankreich, Technik, Mastering: Bob Drake, Stimme: Detlef Kû¥gow / 17. Emily Manzo: Fagott, LûÊnge 05ã44, Komposition: Till by Turning, Bassoon: Katherine Young, Violine: Erica Dicker, Klavier, broken piano, Moog: Emily Manzo, special thanks to Sanne Richter for extra vocals, aufgenommen von Andreas Schmid in den Faust Studios, Scheer, Germany, gemischt von Sarah Register in Brooklyn, NY, Stimme: Helga Fellerer / 18. Federico SûÀnchez: UnverûÊndert, LûÊnge 04ã48, Federico SûÀnchez feat. The Mistakeman, Musik: Federico SûÀnchez/Bû¥lent Kullukcu Mistakeman Studio, Mû¥nchen September 2014 / 19. Wrekmeister Harmonies: KlûÊnge, LûÊnge 10ã10, JR Robinson mit John Herndon (Tortoise), Ken Vandermark, Roger Miller, Stimme: Kathrin von Steinburg / 20. Saam Schlamminger: Das Weiche, LûÊnge 01ã11 / Komposition: Saam Schlamminger, Stimme: Detlef Kû¥gow / Realisation: Karl Bruckmaier und die beteiligten Musiker / Redaktion: Herbert Kapfer / BR 2015 / LûÊnge: 66'06 // Als KlûÊnge von Wassily Kandinsky 1912 im Mû¥nchner Piper Verlag erschien, ahnten weder Verlag noch ûffentlichkeit, dass mit diesem schmalen Band mit seinen Holzschnitten und Prosagedichten ein heute legendûÊres Bindeglied zwischen Epochen und Stilen publiziert wurde. Kandinsky selbst betrachtete die entstandene Verknû¥pfung von Bild und Text als Befreiung, als Akt der ûberwindung kû¥nstlerischer BeschrûÊnkungen. ãIn der Vergangenheit wurde ein Kû¥nstler stets schief angeschaut, wenn er sich schriftlich auszudrû¥cken suchte ã als Maler hatte man sogar mit dem Pinsel zu essen und so zu tun, als gûÊbe es keine Gabel.ã So wie sich Kandinsky in seiner Malerei Schritt fû¥r Schritt von der GegenstûÊndlichkeit entfernte, so versuchte er parallel dazu in einer ihm (eigentlich) fremden Sprache die oberflûÊchliche Bedeutung der WûÑrter zu û¥berwinden, die MûÑglichkeit einer neuen Bedeutung, die sich nur in Klang und Rhythmus des jeweiligen Wortes erschloss, zu ergrû¥nden. Manches erinnert hierbei an die expressionistische Dichtung der Zeit, doch geht Kandinsky oft auch einen Schritt weiter, gelingen ihm Zeilen, die schon auf etwas verweisen, das bald Dada heiûen wird. Kein Wunder, dass Hugo Ball û¥ber KlûÊnge ins SchwûÊrmen gerûÊt: ãNiemand, nicht einmal die Futuristen, haben die Sprache dermaûen ausgemistet.ã Wenn Kandinsky schreibt, kûÑnnen wir dem Maler beim Sehen zuhûÑren ã so nahe kommen wir selten dem Schaffensprozess eines Bildenden Kû¥nstlers. Dies mag daran liegen, dass fû¥r Kandinsky das Schreiben ãbloû ein Wechsel des Handwerkszeugsã ist: ãStatt der Palette verwende ich nun die Schreibmaschine. Aber mein innerer Antrieb bleibt derselbe.ã Das KlûÊnge-Projekt der Abteilung HûÑrspiel und Medienkunst des BR û¥bergibt nun diese Texte Kandinskys nach û¥ber einem Jahrhundert einer neuen, pop-sozialisierten Generation von Kû¥nstlern ã die meisten Musiker, manche auch in der Bildenden Kunst aktiv, manche selbst Kunstsammler und Kenner -, um auszuloten, welche Wechselwirkung die ãpression intûˋrieureã des nachgerade archetypischen ãmodernen Kû¥nstlersã Kandinsky in einem neuen Kontext auszulûÑsen in der Lage ist. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 22.01.2016
Datum: 22.01.2016Länge: 01:06:12 Größe: 60.62 MB |
||
| Hartmut Geerken: kalkfeld - 15.01.2016 | ||
|
Originalton und Stimme: Hartmut Geerken / Musik und Realisation: Hartmut Geerken / BR 2001 / LûÊnge: 70'10 // "kalkfeld" ist eine Art Requiem fû¥r das Volk der Hereros. Es entstand nach einer Reise des Autors Hartmut Geerken nach Namibia. Die Geschichte des Landes ist nur wenigen bekannt. Die deutschen Kolonialherren schlugen 1904 einen Aufstand der Hereros brutal nieder. Durch die Kriegshandlungen, vor allem aber durch drakonische Strafmaûnahmen der Sieger starben 75 Prozent des Hererovolkes. Ein Genozid, der dazu diente, die deutschen Ansprû¥che zu sichern und zu festigen. Geerken zeichnet auf seinen Wanderungen in der NûÊhe eines Ortes mit dem deutschen Namen Kalkfeld verschiedene GerûÊusche auf. Dieses Material verdichtet er im HûÑrspielstudio zu einer Originaltonkomposition, die die Geschichte des Landes hûÑrbar werden lûÊsst: keine Herero-Akustik, sondern menschenleere Gegenden mit riesigen Farmen, die ausnahmslos Weiûen gehûÑren. Gesangsfetzen klingen wie vom Wind herû¥bergetragene Laute, MetalldrûÊhte ûÊhneln gezupften Saiteninstrumenten. Aus WindrûÊdern, dem ûffnen und Schlieûen der Eisentore sowie dem Anschlagen eines Prû¥gels auf die DrûÊhte zwischen den hûÑlzernen PfûÊhlen der WeidezûÊune komponiert Geerken ein Klangbild. Hartmut Geerken schreibt zu seinem Projekt: "nachdem christliche missionare nicht nur mit der bibel, sondern auch mit waffen & alkohol den boden fû¥r die deutschen schutztruppen bereitet haben, wird 1895 die deutsche kolonialgesellschaft fû¥r sû¥dwestafrika gegrû¥ndet. ihre aufgabe bestand darin, siedler anzuwerben & das weideland der hereros unter die deutschen eindringlinge zu verteilen. die herden der hereros waren fû¥r die infrastruktur des volkes bestimmend. herden & land gehûÑrten allen & sie gingen davon aus, dass ihr vieh, trotz der zwielichtigen vertrûÊge mit den deutschen, auch in zukunft dort weiden kûÑnnte, wo es jahrhundertelang geweidet hatte.1904 erkennen die hereros, dass sie betrogen worden waren & erheben sich. general von trotha schlûÊgt den aufstand nieder. zwischen 60 000 & 80 000 hereros werden erschossen, erschlagen oder mit waffengewalt in die wasserlose wû¥ste getrieben, der jûÊmmerliche rest des ehemals freien stolzen volkes (herero heisst wûÑrtlich û¥bersetzt ãfrûÑhliches volkã) kommt um 1905 in konzentrationslager oder wird auf den deutschen farmen & in minen als sklaven eingesetzt. fast ganz namibia ist heute aufgeteilt in riesige postkoloniale farmen. das land ist durchzogen von endlosen drahtzûÊunen, die den besitzanspruch der farmer nur allzu deutlich werden lassen. mit einem prû¥gel in der rechten & einem aufnahmegerûÊt in der linken hand bin ich stundenlang mit schnellen schritten an diesen zûÊunen entlanggegangen. die entfernung der pfosten ist unterschiedlich gross, d.h. beim anschlagen entstehen oft minimale frequenzunterschiede. an den hauptzûÊunen sind schwere eisentore angebracht, die beim ûÑffnen & schliessen ihre eigene sprache sprechen. ab & zu knarrt ein windrad, das spûÊrliches wasser an die oberflûÊche holt. diese drei klangquellen bestimmen u.a. 'kalkfeld'. es sind eiserne zeugen von vergewaltigung & genozid des volkes der hereros, & nur ganz weit entfernt in dieser klanglandschaft meint man den tanz der hereros zu vernehmen, bei dem vier mûÊnner, mit den kûÑpfen einander berû¥hrend, die bewegungen von rindern nachahmen & rauhe schreie ausstossen." |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 15.01.2016
Datum: 15.01.2016Länge: 01:10:15 Größe: 64.32 MB |
||
| Uwe Dick: Sauwaldprosa (12/12) - 06.01.2016 | ||
| Mit Marisa Burger, Uwe Dick, Peter Fricke, Eisi Gulp, Jerzy May, Arnulf Schumacher, Sophia Siebert, Hanns Zischler / Regie: Michael Lentz / BR 2012 / LûÊnge: 53'06 // Die Sauwaldprosa von Uwe Dick erschien erstmals 1976 und wurde in den folgenden Jahren in sechs weiteren Ausgaben als work in progress vom Autor stûÊndig erweitert und ausgebaut. Das Wortwurzelwerk eines poetischen Rebellen wider alle Hierarchien - Dichtung des Zorns und Lachstaunen, Grobiansidiotikon und subtile Wortkunst - speist eine Waldkabbala, deren Magischer Surrealismus das Innviertel zum Inniversum potenziert. Uwe Dick steht fû¥r Sprache, nicht fû¥r Schreibe. Er glaubt an die Optimierung des Denkens durch Witz, sucht und erreicht - stets auf der Lauer nach dem Unvorhersehbaren - die Radikalisierung des Augenblicks, und denkt - bildmûÊchtig von kindauf - in Stimmen. Insofern ist das Radio der ideale Raum fû¥r seine unverwechselbaren AudioVisionen. Dass die Sauwaldprosa so gut wie alle literarischen Genres ã Roman, Essay, Krimi, MûÊrchen, Reportage, Stachelrede, Poly-, Dia- und Monolog, Brief, Tag- und Nachtbuch, Epigramm pp. ã vereinigt, ist eine Konsequenz der Maxime: ãVielfalt statt Einfalt, bitte!ã Wem das ã im HûÑrspiel wie im Buche ã ãzu vielã ist, dem gilt Uwe Dicks ZûÊrtlichkeit: ãJeder ist seines Glû¥ckes Hufeisen am eigenen Kopfã. Auch: ãDie wenigsten kommen blûÑde zur Welt. Sie werdens dann nur. Aus Bequemlichkeitã. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 06.01.2016
Datum: 06.01.2016Länge: 00:53:13 Größe: 48.73 MB |
||
| Uwe Dick: Sauwaldprosa (11/12) - 05.01.2016 | ||
| Mit Uwe Dick, Peter Fricke, Eisi Gulp, Arnulf Schumacher, Sophia Siebert, Hanns Zischler / Komposition: Gunnar Geisse / Regie: Michael Lentz / BR 2012 / LûÊnge: 51' // Die Sauwaldprosa von Uwe Dick erschien erstmals 1976 und wurde in den folgenden Jahren in sechs weiteren Ausgaben als work in progress vom Autor stûÊndig erweitert und ausgebaut. Das Wortwurzelwerk eines poetischen Rebellen wider alle Hierarchien - Dichtung des Zorns und Lachstaunen, Grobiansidiotikon und subtile Wortkunst - speist eine Waldkabbala, deren Magischer Surrealismus das Innviertel zum Inniversum potenziert. Uwe Dick steht fû¥r Sprache, nicht fû¥r Schreibe. Er glaubt an die Optimierung des Denkens durch Witz, sucht und erreicht - stets auf der Lauer nach dem Unvorhersehbaren - die Radikalisierung des Augenblicks, und denkt - bildmûÊchtig von kindauf - in Stimmen. Insofern ist das Radio der ideale Raum fû¥r seine unverwechselbaren AudioVisionen. Dass die Sauwaldprosa so gut wie alle literarischen Genres ã Roman, Essay, Krimi, MûÊrchen, Reportage, Stachelrede, Poly-, Dia- und Monolog, Brief, Tag- und Nachtbuch, Epigramm pp. ã vereinigt, ist eine Konsequenz der Maxime: ãVielfalt statt Einfalt, bitte!ã Wem das ã im HûÑrspiel wie im Buche ã ãzu vielã ist, dem gilt Uwe Dicks ZûÊrtlichkeit: ãJeder ist seines Glû¥ckes Hufeisen am eigenen Kopfã. Auch: ãDie wenigsten kommen blûÑde zur Welt. Sie werdens dann nur. Aus Bequemlichkeitã. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 05.01.2016
Datum: 05.01.2016Länge: 00:51:06 Größe: 46.79 MB |
||
| Uwe Dick: Sauwaldprosa (10/12) - 04.01.2016 | ||
| Mit Marisa Burger, Uwe Dick, Peter Fricke, Eisi Gulp, Arnulf Schumacher, Sophia Siebert, Hanns Zischler / Komposition: Gunnar Geisse / Regie: Michael Lentz / BR 2012 / LûÊnge: 53'22 // Die Sauwaldprosa von Uwe Dick erschien erstmals 1976 und wurde in den folgenden Jahren in sechs weiteren Ausgaben als work in progress vom Autor stûÊndig erweitert und ausgebaut. Das Wortwurzelwerk eines poetischen Rebellen wider alle Hierarchien - Dichtung des Zorns und Lachstaunen, Grobiansidiotikon und subtile Wortkunst - speist eine Waldkabbala, deren Magischer Surrealismus das Innviertel zum Inniversum potenziert. Uwe Dick steht fû¥r Sprache, nicht fû¥r Schreibe. Er glaubt an die Optimierung des Denkens durch Witz, sucht und erreicht - stets auf der Lauer nach dem Unvorhersehbaren - die Radikalisierung des Augenblicks, und denkt - bildmûÊchtig von kindauf - in Stimmen. Insofern ist das Radio der ideale Raum fû¥r seine unverwechselbaren AudioVisionen. Dass die Sauwaldprosa so gut wie alle literarischen Genres ã Roman, Essay, Krimi, MûÊrchen, Reportage, Stachelrede, Poly-, Dia- und Monolog, Brief, Tag- und Nachtbuch, Epigramm pp. ã vereinigt, ist eine Konsequenz der Maxime: ãVielfalt statt Einfalt, bitte!ã Wem das ã im HûÑrspiel wie im Buche ã ãzu vielã ist, dem gilt Uwe Dicks ZûÊrtlichkeit: ãJeder ist seines Glû¥ckes Hufeisen am eigenen Kopfã. Auch: ãDie wenigsten kommen blûÑde zur Welt. Sie werdens dann nur. Aus Bequemlichkeitã. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 04.01.2016
Datum: 04.01.2016Länge: 00:53:28 Größe: 48.96 MB |
||
| Uwe Dick: Sauwaldprosa (09/12) - 03.01.2016 | ||
| Mit Marisa Burger, Uwe Dick, Peter Fricke, Eisi Gulp, Sophia Siebert, Hanns Zischler / Komposition: Gunnar Geisse / Regie: Michael Lentz / BR 2012 / LûÊnge: 53'07 // Die Sauwaldprosa von Uwe Dick erschien erstmals 1976 und wurde in den folgenden Jahren in sechs weiteren Ausgaben als work in progress vom Autor stûÊndig erweitert und ausgebaut. Das Wortwurzelwerk eines poetischen Rebellen wider alle Hierarchien - Dichtung des Zorns und Lachstaunen, Grobiansidiotikon und subtile Wortkunst - speist eine Waldkabbala, deren Magischer Surrealismus das Innviertel zum Inniversum potenziert. Uwe Dick steht fû¥r Sprache, nicht fû¥r Schreibe. Er glaubt an die Optimierung des Denkens durch Witz, sucht und erreicht - stets auf der Lauer nach dem Unvorhersehbaren - die Radikalisierung des Augenblicks, und denkt - bildmûÊchtig von kindauf - in Stimmen. Insofern ist das Radio der ideale Raum fû¥r seine unverwechselbaren AudioVisionen. Dass die Sauwaldprosa so gut wie alle literarischen Genres ã Roman, Essay, Krimi, MûÊrchen, Reportage, Stachelrede, Poly-, Dia- und Monolog, Brief, Tag- und Nachtbuch, Epigramm pp. ã vereinigt, ist eine Konsequenz der Maxime: ãVielfalt statt Einfalt, bitte!ã Wem das ã im HûÑrspiel wie im Buche ã ãzu vielã ist, dem gilt Uwe Dicks ZûÊrtlichkeit: ãJeder ist seines Glû¥ckes Hufeisen am eigenen Kopfã. Auch: ãDie wenigsten kommen blûÑde zur Welt. Sie werdens dann nur. Aus Bequemlichkeitã. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 03.01.2016
Datum: 03.01.2016Länge: 00:53:13 Größe: 48.73 MB |
||
| Uwe Dick: Sauwaldprosa (08/12) - 02.01.2016 | ||
| Mit Marisa Burger, Uwe Dick, Peter Fricke, Eisi Gulp, Sophia Siebert, Hanns Zischler / Komposition: Gunnar Geisse / Regie: Michael Lentz / BR 2012 / LûÊnge: 52'46 // Die Sauwaldprosa von Uwe Dick erschien erstmals 1976 und wurde in den folgenden Jahren in sechs weiteren Ausgaben als work in progress vom Autor stûÊndig erweitert und ausgebaut. Das Wortwurzelwerk eines poetischen Rebellen wider alle Hierarchien - Dichtung des Zorns und Lachstaunen, Grobiansidiotikon und subtile Wortkunst - speist eine Waldkabbala, deren Magischer Surrealismus das Innviertel zum Inniversum potenziert. Uwe Dick steht fû¥r Sprache, nicht fû¥r Schreibe. Er glaubt an die Optimierung des Denkens durch Witz, sucht und erreicht - stets auf der Lauer nach dem Unvorhersehbaren - die Radikalisierung des Augenblicks, und denkt - bildmûÊchtig von kindauf - in Stimmen. Insofern ist das Radio der ideale Raum fû¥r seine unverwechselbaren AudioVisionen. Dass die Sauwaldprosa so gut wie alle literarischen Genres ã Roman, Essay, Krimi, MûÊrchen, Reportage, Stachelrede, Poly-, Dia- und Monolog, Brief, Tag- und Nachtbuch, Epigramm pp. ã vereinigt, ist eine Konsequenz der Maxime: ãVielfalt statt Einfalt, bitte!ã Wem das ã im HûÑrspiel wie im Buche ã ãzu vielã ist, dem gilt Uwe Dicks ZûÊrtlichkeit: ãJeder ist seines Glû¥ckes Hufeisen am eigenen Kopfã. Auch: ãDie wenigsten kommen blûÑde zur Welt. Sie werdens dann nur. Aus Bequemlichkeitã. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 02.01.2016
Datum: 02.01.2016Länge: 00:52:52 Größe: 48.42 MB |
||
| Uwe Dick: Sauwaldprosa (07/12) - 01.01.2016 | ||
| Mit Marisa Burger, Uwe Dick, Peter Fricke, Eisi Gulp, Sophia Siebert, Hanns Zischler / Komposition: Gunnar Geisse / Regie: Michael Lentz / BR 2012 / LûÊnge: 53'23 // Die Sauwaldprosa von Uwe Dick erschien erstmals 1976 und wurde in den folgenden Jahren in sechs weiteren Ausgaben als work in progress vom Autor stûÊndig erweitert und ausgebaut. Das Wortwurzelwerk eines poetischen Rebellen wider alle Hierarchien - Dichtung des Zorns und Lachstaunen, Grobiansidiotikon und subtile Wortkunst - speist eine Waldkabbala, deren Magischer Surrealismus das Innviertel zum Inniversum potenziert. Uwe Dick steht fû¥r Sprache, nicht fû¥r Schreibe. Er glaubt an die Optimierung des Denkens durch Witz, sucht und erreicht - stets auf der Lauer nach dem Unvorhersehbaren - die Radikalisierung des Augenblicks, und denkt - bildmûÊchtig von kindauf - in Stimmen. Insofern ist das Radio der ideale Raum fû¥r seine unverwechselbaren AudioVisionen. Dass die Sauwaldprosa so gut wie alle literarischen Genres ã Roman, Essay, Krimi, MûÊrchen, Reportage, Stachelrede, Poly-, Dia- und Monolog, Brief, Tag- und Nachtbuch, Epigramm pp. ã vereinigt, ist eine Konsequenz der Maxime: ãVielfalt statt Einfalt, bitte!ã Wem das ã im HûÑrspiel wie im Buche ã ãzu vielã ist, dem gilt Uwe Dicks ZûÊrtlichkeit: ãJeder ist seines Glû¥ckes Hufeisen am eigenen Kopfã. Auch: ãDie wenigsten kommen blûÑde zur Welt. Sie werdens dann nur. Aus Bequemlichkeitã. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 01.01.2016
Datum: 01.01.2016Länge: 00:53:29 Größe: 48.98 MB |
||
| Uwe Dick: Sauwaldprosa (06/12) - 31.12.2015 | ||
| Mit Marisa Burger, Uwe Dick, Peter Fricke, Eisi Gulp, Sophia Siebert, Hanns Zischler / Komposition: Gunnar Geisse / Regie: Michael Lentz / BR 2012 / LûÊnge: 53'31 // Die Sauwaldprosa von Uwe Dick erschien erstmals 1976 und wurde in den folgenden Jahren in sechs weiteren Ausgaben als work in progress vom Autor stûÊndig erweitert und ausgebaut. Das Wortwurzelwerk eines poetischen Rebellen wider alle Hierarchien - Dichtung des Zorns und Lachstaunen, Grobiansidiotikon und subtile Wortkunst - speist eine Waldkabbala, deren Magischer Surrealismus das Innviertel zum Inniversum potenziert. Uwe Dick steht fû¥r Sprache, nicht fû¥r Schreibe. Er glaubt an die Optimierung des Denkens durch Witz, sucht und erreicht - stets auf der Lauer nach dem Unvorhersehbaren - die Radikalisierung des Augenblicks, und denkt - bildmûÊchtig von kindauf - in Stimmen. Insofern ist das Radio der ideale Raum fû¥r seine unverwechselbaren AudioVisionen. Dass die Sauwaldprosa so gut wie alle literarischen Genres ã Roman, Essay, Krimi, MûÊrchen, Reportage, Stachelrede, Poly-, Dia- und Monolog, Brief, Tag- und Nachtbuch, Epigramm pp. ã vereinigt, ist eine Konsequenz der Maxime: ãVielfalt statt Einfalt, bitte!ã Wem das ã im HûÑrspiel wie im Buche ã ãzu vielã ist, dem gilt Uwe Dicks ZûÊrtlichkeit: ãJeder ist seines Glû¥ckes Hufeisen am eigenen Kopfã. Auch: ãDie wenigsten kommen blûÑde zur Welt. Sie werdens dann nur. Aus Bequemlichkeitã. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 31.12.2015
Datum: 31.12.2015Länge: 00:53:37 Größe: 49.10 MB |
||
| Uwe Dick: Sauwaldprosa (05/12) - 30.12.2015 | ||
| Mit Uwe Dick, Peter Fricke, Eisi Gulp / Komposition: Gunnar Geisse / Regie: Michael Lentz / BR 2012 / LûÊnge: 53'34 // Die Sauwaldprosa von Uwe Dick erschien erstmals 1976 und wurde in den folgenden Jahren in sechs weiteren Ausgaben als work in progress vom Autor stûÊndig erweitert und ausgebaut. Das Wortwurzelwerk eines poetischen Rebellen wider alle Hierarchien - Dichtung des Zorns und Lachstaunen, Grobiansidiotikon und subtile Wortkunst - speist eine Waldkabbala, deren Magischer Surrealismus das Innviertel zum Inniversum potenziert. Uwe Dick steht fû¥r Sprache, nicht fû¥r Schreibe. Er glaubt an die Optimierung des Denkens durch Witz, sucht und erreicht - stets auf der Lauer nach dem Unvorhersehbaren - die Radikalisierung des Augenblicks, und denkt - bildmûÊchtig von kindauf - in Stimmen. Insofern ist das Radio der ideale Raum fû¥r seine unverwechselbaren AudioVisionen. Dass die Sauwaldprosa so gut wie alle literarischen Genres ã Roman, Essay, Krimi, MûÊrchen, Reportage, Stachelrede, Poly-, Dia- und Monolog, Brief, Tag- und Nachtbuch, Epigramm pp. ã vereinigt, ist eine Konsequenz der Maxime: ãVielfalt statt Einfalt, bitte!ã Wem das ã im HûÑrspiel wie im Buche ã ãzu vielã ist, dem gilt Uwe Dicks ZûÊrtlichkeit: ãJeder ist seines Glû¥ckes Hufeisen am eigenen Kopfã. Auch: ãDie wenigsten kommen blûÑde zur Welt. Sie werdens dann nur. Aus Bequemlichkeitã. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 30.12.2015
Datum: 30.12.2015Länge: 00:53:40 Größe: 49.15 MB |
||
| Uwe Dick: Sauwaldprosa (04/12) - 29.12.2015 | ||
| Mit Marisa Burger, Uwe Dick, Peter Fricke, Eisi Gulp, Sophia Siebert, Hanns Zischler / Komposition: Gunnar Geisse / Regie: Michael Lentz / BR 2012 / LûÊnge: 53'16 // Die Sauwaldprosa von Uwe Dick erschien erstmals 1976 und wurde in den folgenden Jahren in sechs weiteren Ausgaben als work in progress vom Autor stûÊndig erweitert und ausgebaut. Das Wortwurzelwerk eines poetischen Rebellen wider alle Hierarchien - Dichtung des Zorns und Lachstaunen, Grobiansidiotikon und subtile Wortkunst - speist eine Waldkabbala, deren Magischer Surrealismus das Innviertel zum Inniversum potenziert. Uwe Dick steht fû¥r Sprache, nicht fû¥r Schreibe. Er glaubt an die Optimierung des Denkens durch Witz, sucht und erreicht - stets auf der Lauer nach dem Unvorhersehbaren - die Radikalisierung des Augenblicks, und denkt - bildmûÊchtig von kindauf - in Stimmen. Insofern ist das Radio der ideale Raum fû¥r seine unverwechselbaren AudioVisionen. Dass die Sauwaldprosa so gut wie alle literarischen Genres ã Roman, Essay, Krimi, MûÊrchen, Reportage, Stachelrede, Poly-, Dia- und Monolog, Brief, Tag- und Nachtbuch, Epigramm pp. ã vereinigt, ist eine Konsequenz der Maxime: ãVielfalt statt Einfalt, bitte!ã Wem das ã im HûÑrspiel wie im Buche ã ãzu vielã ist, dem gilt Uwe Dicks ZûÊrtlichkeit: ãJeder ist seines Glû¥ckes Hufeisen am eigenen Kopfã. Auch: ãDie wenigsten kommen blûÑde zur Welt. Sie werdens dann nur. Aus Bequemlichkeitã. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 29.12.2015
Datum: 29.12.2015Länge: 00:53:22 Größe: 48.87 MB |
||
| Uwe Dick: Sauwaldprosa (03/12) - 28.12.2015 | ||
| Mit Marisa Burger, Uwe Dick, Peter Fricke, Eisi Gulp, Sophia Siebert, Hanns Zischler / Komposition: Gunnar Geisse / Regie: Michael Lentz / BR 2012 / LûÊnge: 53'04 // Die Sauwaldprosa von Uwe Dick erschien erstmals 1976 und wurde in den folgenden Jahren in sechs weiteren Ausgaben als work in progress vom Autor stûÊndig erweitert und ausgebaut. Das Wortwurzelwerk eines poetischen Rebellen wider alle Hierarchien - Dichtung des Zorns und Lachstaunen, Grobiansidiotikon und subtile Wortkunst - speist eine Waldkabbala, deren Magischer Surrealismus das Innviertel zum Inniversum potenziert. Uwe Dick steht fû¥r Sprache, nicht fû¥r Schreibe. Er glaubt an die Optimierung des Denkens durch Witz, sucht und erreicht - stets auf der Lauer nach dem Unvorhersehbaren - die Radikalisierung des Augenblicks, und denkt - bildmûÊchtig von kindauf - in Stimmen. Insofern ist das Radio der ideale Raum fû¥r seine unverwechselbaren AudioVisionen. Dass die Sauwaldprosa so gut wie alle literarischen Genres ã Roman, Essay, Krimi, MûÊrchen, Reportage, Stachelrede, Poly-, Dia- und Monolog, Brief, Tag- und Nachtbuch, Epigramm pp. ã vereinigt, ist eine Konsequenz der Maxime: ãVielfalt statt Einfalt, bitte!ã Wem das ã im HûÑrspiel wie im Buche ã ãzu vielã ist, dem gilt Uwe Dicks ZûÊrtlichkeit: ãJeder ist seines Glû¥ckes Hufeisen am eigenen Kopfã. Auch: ãDie wenigsten kommen blûÑde zur Welt. Sie werdens dann nur. Aus Bequemlichkeitã. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 28.12.2015
Datum: 28.12.2015Länge: 00:53:10 Größe: 48.69 MB |
||
| Uwe Dick: Sauwaldprosa (02/12) - 27.12.2015 | ||
| Mit Marisa Burger, Uwe Dick, Peter Fricke, Eisi Gulp, Sophia Siebert, Branco Vukovic, Hanns Zischler / Komposition: Gunnar Geisse / Regie: Michael Lentz / BR 2012 / LûÊnge: 51'49 // Die Sauwaldprosa von Uwe Dick erschien erstmals 1976 und wurde in den folgenden Jahren in sechs weiteren Ausgaben als work in progress vom Autor stûÊndig erweitert und ausgebaut. Das Wortwurzelwerk eines poetischen Rebellen wider alle Hierarchien - Dichtung des Zorns und Lachstaunen, Grobiansidiotikon und subtile Wortkunst - speist eine Waldkabbala, deren Magischer Surrealismus das Innviertel zum Inniversum potenziert. Uwe Dick steht fû¥r Sprache, nicht fû¥r Schreibe. Er glaubt an die Optimierung des Denkens durch Witz, sucht und erreicht - stets auf der Lauer nach dem Unvorhersehbaren - die Radikalisierung des Augenblicks, und denkt - bildmûÊchtig von kindauf - in Stimmen. Insofern ist das Radio der ideale Raum fû¥r seine unverwechselbaren AudioVisionen. Dass die Sauwaldprosa so gut wie alle literarischen Genres ã Roman, Essay, Krimi, MûÊrchen, Reportage, Stachelrede, Poly-, Dia- und Monolog, Brief, Tag- und Nachtbuch, Epigramm pp. ã vereinigt, ist eine Konsequenz der Maxime: ãVielfalt statt Einfalt, bitte!ã Wem das ã im HûÑrspiel wie im Buche ã ãzu vielã ist, dem gilt Uwe Dicks ZûÊrtlichkeit: ãJeder ist seines Glû¥ckes Hufeisen am eigenen Kopfã. Auch: ãDie wenigsten kommen blûÑde zur Welt. Sie werdens dann nur. Aus Bequemlichkeitã. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 27.12.2015
Datum: 27.12.2015Länge: 00:53:18 Größe: 48.81 MB |
||
| Uwe Dick: Sauwaldprosa (01/12) - 26.12.2015 | ||
| Mit Marisa Burger, Uwe Dick, Peter Fricke, Eisi Gulp, Sophia Siebert, Hanns Zischler / Komposition: Gunnar Geisse / Regie: Michael Lentz / BR 2012 / LûÊnge: 51'49 // Die Sauwaldprosa von Uwe Dick erschien erstmals 1976 und wurde in den folgenden Jahren in sechs weiteren Ausgaben als work in progress vom Autor stûÊndig erweitert und ausgebaut. Das Wortwurzelwerk eines poetischen Rebellen wider alle Hierarchien - Dichtung des Zorns und Lachstaunen, Grobiansidiotikon und subtile Wortkunst - speist eine Waldkabbala, deren Magischer Surrealismus das Innviertel zum Inniversum potenziert. Uwe Dick steht fû¥r Sprache, nicht fû¥r Schreibe. Er glaubt an die Optimierung des Denkens durch Witz, sucht und erreicht - stets auf der Lauer nach dem Unvorhersehbaren - die Radikalisierung des Augenblicks, und denkt - bildmûÊchtig von kindauf - in Stimmen. Insofern ist das Radio der ideale Raum fû¥r seine unverwechselbaren AudioVisionen. Dass die Sauwaldprosa so gut wie alle literarischen Genres ã Roman, Essay, Krimi, MûÊrchen, Reportage, Stachelrede, Poly-, Dia- und Monolog, Brief, Tag- und Nachtbuch, Epigramm pp. ã vereinigt, ist eine Konsequenz der Maxime: ãVielfalt statt Einfalt, bitte!ã Wem das ã im HûÑrspiel wie im Buche ã ãzu vielã ist, dem gilt Uwe Dicks ZûÊrtlichkeit: ãJeder ist seines Glû¥ckes Hufeisen am eigenen Kopfã. Auch: ãDie wenigsten kommen blûÑde zur Welt. Sie werdens dann nur. Aus Bequemlichkeitã. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 26.12.2015
Datum: 26.12.2015Länge: 00:51:56 Größe: 47.55 MB |
||
| Robert Lax: the hill - 18.12.2015 | ||
| Autorenlesung / Aufnahme: Sigrid Hauff / BR 1999 / LûÊnge: 37'13 // Bei ihrem letzten Besuch des Dichters Robert Lax auf Patmos im SpûÊtsommer 1999 nahm Sigrid Hauff eine Lesung des kompletten Buches the hill auf. "Die Textpassagen voller Zweifel, Hoffnungslosigkeit, Leere in diesem gerade erschienenen Buch hatten mich beunruhigt. Sie sind so ganz und gar untypisch fû¥r Lax. Es stellt sich heraus, dass Paula Dias die Texte fû¥r dieses Buch zusammengestellt hat, und zwar ã wie ich vermutet hatte ã aus einem ûÊlteren Text aus der Zeit von 21 pages und einem neueren seltsam depressiven Text. 'No friends, no love, no memorable memories' ã das sind vûÑllig unerwartete Statements dieses Poeten der bewusst erlebten Augenblicke, wie wir sie z.B. in seinem Buch moments miterleben kûÑnnen. Es mûÑge ja vielleicht Menschen geben, die von morgens bis nachts glû¥cklich seien. Er gehûÑre nicht dazu. Niedergeschlagenheit, Hoffungslosigkeit, Leere ã diese Gefû¥hle kûÊmen eben auch in uns hoch. ãÎ Jeden Nachmittag liest Lax einige Seiten bei geschlossenen FensterlûÊden im hochsommerlich warmen Zimmer, im elektrischen Licht einer Tischlampe. Wenn er mû¥de wird, legt er das Buch beiseite und wir diskutieren weiter." (Sigrid Hauff) | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 18.12.2015
Datum: 18.12.2015Länge: 00:37:19 Größe: 34.17 MB |
||
| Laurence Sterne: Leben und Ansichten von Tristram Shandy, Gentleman (9/9) - 13.12.2015 | ||
|
Mit Stefan Merki, Peter Fricke, Anna Drexler, Hans Kremer, Helmut Stange, Michele Cucioffo, Helga Fellerer, Katja Bû¥rkle, Johannes Herrschmann, Gabriel Raab, Kathrin von Steinburg, Sebastian Weber, Michael Walter / Aus dem Englischen von Michael Walter / Komposition: Chris Cutler / Bearbeitung und Regie: Karl Bruckmaier / BR 2015 / LûÊnge: 53ã48 // Laurence Sternes Tristram Shandy ist ein einzigartiges Werk in der Literaturgeschichte: Erschienen zwischen den Jahren 1759 und 1767, experimentiert Sterne in diesem neunbûÊndigen Roman selbstbewusst mit der Form. In einer Zeit, als der Roman selbst noch nicht klar definiert oder gar etabliert ist, lotet Sterne bereits dessen Grenzen aus, spielt mit der Wirkung auf seine Leser und lûÊsst wie nebenbei fragwû¥rdig erscheinen, wie er û¥berhaupt erzûÊhlen kann, wovon er vorgibt, erzûÊhlen zu wollen: Leben und Ansichten von Tristram Shandy, Gentleman. Verspricht der Titel nûÊmlich eine wohlgeordnete und fein aufbereitete, womûÑglich auf ein Ziel hin erzûÊhlte Lebensgeschichte, so enttûÊuscht der ErzûÊhler diese Erwartungen sofort. Eine stringente Biografie beinhalten die neun BûÊnde sicherlich nicht. Stattdessen prûÊgt den Roman eine assoziative Struktur: Vor und zurû¥ck blickt der ErzûÊhler, der sich nicht an eine Chronologie halten mag; ebenso wechselt sein Gestus ã von beiûender Satire oder einem spûÑttischen Ton bis zu pathetischen Beschreibungen. Und auch optisch verrûÊt Sternes Roman, dass er sich nicht an das hûÊlt, was seine Gattung bisher auszeichnete. Das Vorwort leitet die Geschichte nicht ein, es wird stattdessen nachgereicht, mitten in der ErzûÊhlung. Und die wiederum ist gespickt mit AuffûÊlligkeiten: mit Auslassungen, Reihen von Sternchen-Symbolen, oder mit ganzen Kapiteln, die fehlen. Andere Seiten sind dafû¥r ganz in schwarz gehalten, gefû¥llt mit DruckerschwûÊrze, nicht mit sinnerfû¥llten Zeichen. All das sind Hinweise darauf, dass die Ordnung hier bewusst gebrochen wird, dass Autor und ErzûÊhler Freigeister sind, die weniger an einer Biografie interessiert sind als an der bis heute bestehenden Frage, ob sich eine solche erzûÊhlen lûÊsst. Vom Leben dieses vermeintlichen Protagonisten und Ich-ErzûÊhlers, Tristram Shandy, liest man entsprechend wenig ã seiner Zeugung wird ebenso viel Aufmerksamkeit geschenkt wie seiner Geburt, von der erst im dritten Band berichtet wird. Sehr einprûÊgsame und detailreiche Beschreibungen gelten dagegen anderen Figuren: allen voran Tristrams Vater und seinem Onkel Toby ã zwei ûÊuûerst eigenwillige, bisweilen schrullige Charaktere, die der ErzûÊhler aber nie so sehr dem LûÊcherlichen preisgibt, dass sie darû¥ber ihre liebenswerte Note verlieren, ganz Karikatur werden. Nietzsche galt Sterne deshalb als ãder freieste Schriftsteller aller Zeitenã, gegen ihn, so schreibt er in Menschliches Allzumenschliches II, seien ãalle anderen steif, vier-schrûÑtig, unduldsam und bûÊuerisch-geradezuã. Mit dieser Haltung hat Sterne die Geschichte des Romans geprûÊgt und ist zu einer Instanz fû¥r folgende Schriftstellergenerationen geworden. Auch in Deutschland blickten Autoren bewundernd auf den schreibenden Pfarrer aus England und seinen Tristram: Goethe und Zelter etwa tauschten im Briefwechsel ihre Lektû¥reeindrû¥cke aus, und Lessing lieû sich zu der Aussage bewegen, er wû¥rde Sterne gerne fû¥nf seiner Lebensjahre abtreten, wenn dieser sie nur schreibend verbringen wolle. Eine erste ûbersetzung ins Deutsche folgte entsprechend frû¥h, 1769. Auf der ûbertragung von Michael Walter basiert nun die Bearbeitung fû¥r das Radio von Karl Bruckmaier. Dessen Ziel es ist, ãden HûÑrgewohnheiten des 21. Jahrhunderts ebenso Rechnung zu tragen wie den zeitlosen, den klassischen QualitûÊten dieses Urtexts aller Genreverletzungen.ã |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 13.12.2015
Datum: 13.12.2015Länge: 00:53:26 Größe: 48.93 MB |
||
| Laurence Sterne: Leben und Ansichten von Tristram Shandy, Gentleman (8/9) - 06.12.2015 | ||
|
Mit Stefan Merki, Peter Fricke, Anna Drexler, Hans Kremer, Michele Cucioffo, Helga Fellerer, Katja Bû¥rkle, Gabriel Raab, Kathrin von Steinburg, Peter Veit, Sebastian Weber, Michael Walter / Aus dem Englischen von Michael Walter / Komposition: Chris Cutler / Bearbeitung und Regie: Karl Bruckmaier / BR 2015 / LûÊnge: 53ã48 // Laurence Sternes Tristram Shandy ist ein einzigartiges Werk in der Literaturgeschichte: Erschienen zwischen den Jahren 1759 und 1767, experimentiert Sterne in diesem neunbûÊndigen Roman selbstbewusst mit der Form. In einer Zeit, als der Roman selbst noch nicht klar definiert oder gar etabliert ist, lotet Sterne bereits dessen Grenzen aus, spielt mit der Wirkung auf seine Leser und lûÊsst wie nebenbei fragwû¥rdig erscheinen, wie er û¥berhaupt erzûÊhlen kann, wovon er vorgibt, erzûÊhlen zu wollen: Leben und Ansichten von Tristram Shandy, Gentleman. Verspricht der Titel nûÊmlich eine wohlgeordnete und fein aufbereitete, womûÑglich auf ein Ziel hin erzûÊhlte Lebensgeschichte, so enttûÊuscht der ErzûÊhler diese Erwartungen sofort. Eine stringente Biografie beinhalten die neun BûÊnde sicherlich nicht. Stattdessen prûÊgt den Roman eine assoziative Struktur: Vor und zurû¥ck blickt der ErzûÊhler, der sich nicht an eine Chronologie halten mag; ebenso wechselt sein Gestus ã von beiûender Satire oder einem spûÑttischen Ton bis zu pathetischen Beschreibungen. Und auch optisch verrûÊt Sternes Roman, dass er sich nicht an das hûÊlt, was seine Gattung bisher auszeichnete. Das Vorwort leitet die Geschichte nicht ein, es wird stattdessen nachgereicht, mitten in der ErzûÊhlung. Und die wiederum ist gespickt mit AuffûÊlligkeiten: mit Auslassungen, Reihen von Sternchen-Symbolen, oder mit ganzen Kapiteln, die fehlen. Andere Seiten sind dafû¥r ganz in schwarz gehalten, gefû¥llt mit DruckerschwûÊrze, nicht mit sinnerfû¥llten Zeichen. All das sind Hinweise darauf, dass die Ordnung hier bewusst gebrochen wird, dass Autor und ErzûÊhler Freigeister sind, die weniger an einer Biografie interessiert sind als an der bis heute bestehenden Frage, ob sich eine solche erzûÊhlen lûÊsst. Vom Leben dieses vermeintlichen Protagonisten und Ich-ErzûÊhlers, Tristram Shandy, liest man entsprechend wenig ã seiner Zeugung wird ebenso viel Aufmerksamkeit geschenkt wie seiner Geburt, von der erst im dritten Band berichtet wird. Sehr einprûÊgsame und detailreiche Beschreibungen gelten dagegen anderen Figuren: allen voran Tristrams Vater und seinem Onkel Toby ã zwei ûÊuûerst eigenwillige, bisweilen schrullige Charaktere, die der ErzûÊhler aber nie so sehr dem LûÊcherlichen preisgibt, dass sie darû¥ber ihre liebenswerte Note verlieren, ganz Karikatur werden. Nietzsche galt Sterne deshalb als ãder freieste Schriftsteller aller Zeitenã, gegen ihn, so schreibt er in Menschliches Allzumenschliches II, seien ãalle anderen steif, vier-schrûÑtig, unduldsam und bûÊuerisch-geradezuã. Mit dieser Haltung hat Sterne die Geschichte des Romans geprûÊgt und ist zu einer Instanz fû¥r folgende Schriftstellergenerationen geworden. Auch in Deutschland blickten Autoren bewundernd auf den schreibenden Pfarrer aus England und seinen Tristram: Goethe und Zelter etwa tauschten im Briefwechsel ihre Lektû¥reeindrû¥cke aus, und Lessing lieû sich zu der Aussage bewegen, er wû¥rde Sterne gerne fû¥nf seiner Lebensjahre abtreten, wenn dieser sie nur schreibend verbringen wolle. Eine erste ûbersetzung ins Deutsche folgte entsprechend frû¥h, 1769. Auf der ûbertragung von Michael Walter basiert nun die Bearbeitung fû¥r das Radio von Karl Bruckmaier. Dessen Ziel es ist, ãden HûÑrgewohnheiten des 21. Jahrhunderts ebenso Rechnung zu tragen wie den zeitlosen, den klassischen QualitûÊten dieses Urtexts aller Genreverletzungen.ã |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 06.12.2015
Datum: 06.12.2015Länge: 00:50:00 Größe: 45.78 MB |
||
| Sigrid Hauff: Erinnerungern an meinen letzten Besuch bei Robert Lax - 04.12.2015 | ||
| Sprecherin: Susanne SchrûÑder / BR 2015 | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 04.12.2015
Datum: 04.12.2015Länge: 00:13:35 Größe: 12.44 MB |
||
| Laurence Sterne: Leben und Ansichten von Tristram Shandy, Gentleman (7/9) - 29.11.2015 | ||
|
Mit Stefan Merki, Peter Fricke, Anna Drexler, Hans Kremer, Michele Cucioffo, Gabriel Raab, Kathrin von Steinburg, Sebastian Weber, Martin Schmidt, Michael Walter / Aus dem Englischen von Michael Walter / Komposition: Chris Cutler / Bearbeitung und Regie: Karl Bruckmaier / BR 2015 / LûÊnge: 53ã48 // Laurence Sternes Tristram Shandy ist ein einzigartiges Werk in der Literaturgeschichte: Erschienen zwischen den Jahren 1759 und 1767, experimentiert Sterne in diesem neunbûÊndigen Roman selbstbewusst mit der Form. In einer Zeit, als der Roman selbst noch nicht klar definiert oder gar etabliert ist, lotet Sterne bereits dessen Grenzen aus, spielt mit der Wirkung auf seine Leser und lûÊsst wie nebenbei fragwû¥rdig erscheinen, wie er û¥berhaupt erzûÊhlen kann, wovon er vorgibt, erzûÊhlen zu wollen: Leben und Ansichten von Tristram Shandy, Gentleman. Verspricht der Titel nûÊmlich eine wohlgeordnete und fein aufbereitete, womûÑglich auf ein Ziel hin erzûÊhlte Lebensgeschichte, so enttûÊuscht der ErzûÊhler diese Erwartungen sofort. Eine stringente Biografie beinhalten die neun BûÊnde sicherlich nicht. Stattdessen prûÊgt den Roman eine assoziative Struktur: Vor und zurû¥ck blickt der ErzûÊhler, der sich nicht an eine Chronologie halten mag; ebenso wechselt sein Gestus ã von beiûender Satire oder einem spûÑttischen Ton bis zu pathetischen Beschreibungen. Und auch optisch verrûÊt Sternes Roman, dass er sich nicht an das hûÊlt, was seine Gattung bisher auszeichnete. Das Vorwort leitet die Geschichte nicht ein, es wird stattdessen nachgereicht, mitten in der ErzûÊhlung. Und die wiederum ist gespickt mit AuffûÊlligkeiten: mit Auslassungen, Reihen von Sternchen-Symbolen, oder mit ganzen Kapiteln, die fehlen. Andere Seiten sind dafû¥r ganz in schwarz gehalten, gefû¥llt mit DruckerschwûÊrze, nicht mit sinnerfû¥llten Zeichen. All das sind Hinweise darauf, dass die Ordnung hier bewusst gebrochen wird, dass Autor und ErzûÊhler Freigeister sind, die weniger an einer Biografie interessiert sind als an der bis heute bestehenden Frage, ob sich eine solche erzûÊhlen lûÊsst. Vom Leben dieses vermeintlichen Protagonisten und Ich-ErzûÊhlers, Tristram Shandy, liest man entsprechend wenig ã seiner Zeugung wird ebenso viel Aufmerksamkeit geschenkt wie seiner Geburt, von der erst im dritten Band berichtet wird. Sehr einprûÊgsame und detailreiche Beschreibungen gelten dagegen anderen Figuren: allen voran Tristrams Vater und seinem Onkel Toby ã zwei ûÊuûerst eigenwillige, bisweilen schrullige Charaktere, die der ErzûÊhler aber nie so sehr dem LûÊcherlichen preisgibt, dass sie darû¥ber ihre liebenswerte Note verlieren, ganz Karikatur werden. Nietzsche galt Sterne deshalb als ãder freieste Schriftsteller aller Zeitenã, gegen ihn, so schreibt er in Menschliches Allzumenschliches II, seien ãalle anderen steif, vier-schrûÑtig, unduldsam und bûÊuerisch-geradezuã. Mit dieser Haltung hat Sterne die Geschichte des Romans geprûÊgt und ist zu einer Instanz fû¥r folgende Schriftstellergenerationen geworden. Auch in Deutschland blickten Autoren bewundernd auf den schreibenden Pfarrer aus England und seinen Tristram: Goethe und Zelter etwa tauschten im Briefwechsel ihre Lektû¥reeindrû¥cke aus, und Lessing lieû sich zu der Aussage bewegen, er wû¥rde Sterne gerne fû¥nf seiner Lebensjahre abtreten, wenn dieser sie nur schreibend verbringen wolle. Eine erste ûbersetzung ins Deutsche folgte entsprechend frû¥h, 1769. Auf der ûbertragung von Michael Walter basiert nun die Bearbeitung fû¥r das Radio von Karl Bruckmaier. Dessen Ziel es ist, ãden HûÑrgewohnheiten des 21. Jahrhunderts ebenso Rechnung zu tragen wie den zeitlosen, den klassischen QualitûÊten dieses Urtexts aller Genreverletzungen.ã |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 29.11.2015
Datum: 29.11.2015Länge: 00:49:31 Größe: 45.34 MB |
||
| Laurence Sterne: Leben und Ansichten von Tristram Shandy, Gentleman (6/9) - 22.11.2015 | ||
|
Mit Stefan Merki, Peter Fricke, Anna Drexler, Hans Kremer, Helmut Stange, Michele Cucioffo, Johannes Herrschmann, Katja Bû¥rkle, Gabriel Raab, Kathrin von Steinburg, Peter Veit, Sebastian Weber, Mathias Wendeborn / Aus dem Englischen von Michael Walter / Komposition: Chris Cutler / Bearbeitung und Regie: Karl Bruckmaier / BR 2015 / LûÊnge: 53ã48 // Laurence Sternes Tristram Shandy ist ein einzigartiges Werk in der Literaturgeschichte: Erschienen zwischen den Jahren 1759 und 1767, experimentiert Sterne in diesem neunbûÊndigen Roman selbstbewusst mit der Form. In einer Zeit, als der Roman selbst noch nicht klar definiert oder gar etabliert ist, lotet Sterne bereits dessen Grenzen aus, spielt mit der Wirkung auf seine Leser und lûÊsst wie nebenbei fragwû¥rdig erscheinen, wie er û¥berhaupt erzûÊhlen kann, wovon er vorgibt, erzûÊhlen zu wollen: Leben und Ansichten von Tristram Shandy, Gentleman. Verspricht der Titel nûÊmlich eine wohlgeordnete und fein aufbereitete, womûÑglich auf ein Ziel hin erzûÊhlte Lebensgeschichte, so enttûÊuscht der ErzûÊhler diese Erwartungen sofort. Eine stringente Biografie beinhalten die neun BûÊnde sicherlich nicht. Stattdessen prûÊgt den Roman eine assoziative Struktur: Vor und zurû¥ck blickt der ErzûÊhler, der sich nicht an eine Chronologie halten mag; ebenso wechselt sein Gestus ã von beiûender Satire oder einem spûÑttischen Ton bis zu pathetischen Beschreibungen. Und auch optisch verrûÊt Sternes Roman, dass er sich nicht an das hûÊlt, was seine Gattung bisher auszeichnete. Das Vorwort leitet die Geschichte nicht ein, es wird stattdessen nachgereicht, mitten in der ErzûÊhlung. Und die wiederum ist gespickt mit AuffûÊlligkeiten: mit Auslassungen, Reihen von Sternchen-Symbolen, oder mit ganzen Kapiteln, die fehlen. Andere Seiten sind dafû¥r ganz in schwarz gehalten, gefû¥llt mit DruckerschwûÊrze, nicht mit sinnerfû¥llten Zeichen. All das sind Hinweise darauf, dass die Ordnung hier bewusst gebrochen wird, dass Autor und ErzûÊhler Freigeister sind, die weniger an einer Biografie interessiert sind als an der bis heute bestehenden Frage, ob sich eine solche erzûÊhlen lûÊsst. Vom Leben dieses vermeintlichen Protagonisten und Ich-ErzûÊhlers, Tristram Shandy, liest man entsprechend wenig ã seiner Zeugung wird ebenso viel Aufmerksamkeit geschenkt wie seiner Geburt, von der erst im dritten Band berichtet wird. Sehr einprûÊgsame und detailreiche Beschreibungen gelten dagegen anderen Figuren: allen voran Tristrams Vater und seinem Onkel Toby ã zwei ûÊuûerst eigenwillige, bisweilen schrullige Charaktere, die der ErzûÊhler aber nie so sehr dem LûÊcherlichen preisgibt, dass sie darû¥ber ihre liebenswerte Note verlieren, ganz Karikatur werden. Nietzsche galt Sterne deshalb als ãder freieste Schriftsteller aller Zeitenã, gegen ihn, so schreibt er in Menschliches Allzumenschliches II, seien ãalle anderen steif, vier-schrûÑtig, unduldsam und bûÊuerisch-geradezuã. Mit dieser Haltung hat Sterne die Geschichte des Romans geprûÊgt und ist zu einer Instanz fû¥r folgende Schriftstellergenerationen geworden. Auch in Deutschland blickten Autoren bewundernd auf den schreibenden Pfarrer aus England und seinen Tristram: Goethe und Zelter etwa tauschten im Briefwechsel ihre Lektû¥reeindrû¥cke aus, und Lessing lieû sich zu der Aussage bewegen, er wû¥rde Sterne gerne fû¥nf seiner Lebensjahre abtreten, wenn dieser sie nur schreibend verbringen wolle. Eine erste ûbersetzung ins Deutsche folgte entsprechend frû¥h, 1769. Auf der ûbertragung von Michael Walter basiert nun die Bearbeitung fû¥r das Radio von Karl Bruckmaier. Dessen Ziel es ist, ãden HûÑrgewohnheiten des 21. Jahrhunderts ebenso Rechnung zu tragen wie den zeitlosen, den klassischen QualitûÊten dieses Urtexts aller Genreverletzungen.ã |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 22.11.2015
Datum: 22.11.2015Länge: 00:52:32 Größe: 48.11 MB |
||
| Laurence Sterne: Leben und Ansichten von Tristram Shandy, Gentleman (5/9) - 15.11.2015 | ||
|
Mit Stefan Merki, Peter Fricke, Hans Kremer, Michele Cucioffo, Wolfgang Hinze, Katja Bû¥rkle, Pascal Fligg, Johannes Herrschmann, Gabriel Raab, Kathrin von Steinburg, Peter Veit, Sebastian Weber, Sergei Mariev, Michael Walter / Aus dem Englischen von Michael Walter / Komposition: Chris Cutler / Bearbeitung und Regie: Karl Bruckmaier / BR 2015 / LûÊnge: 53ã48 // Laurence Sternes Tristram Shandy ist ein einzigartiges Werk in der Literaturgeschichte: Erschienen zwischen den Jahren 1759 und 1767, experimentiert Sterne in diesem neunbûÊndigen Roman selbstbewusst mit der Form. In einer Zeit, als der Roman selbst noch nicht klar definiert oder gar etabliert ist, lotet Sterne bereits dessen Grenzen aus, spielt mit der Wirkung auf seine Leser und lûÊsst wie nebenbei fragwû¥rdig erscheinen, wie er û¥berhaupt erzûÊhlen kann, wovon er vorgibt, erzûÊhlen zu wollen: Leben und Ansichten von Tristram Shandy, Gentleman. Verspricht der Titel nûÊmlich eine wohlgeordnete und fein aufbereitete, womûÑglich auf ein Ziel hin erzûÊhlte Lebensgeschichte, so enttûÊuscht der ErzûÊhler diese Erwartungen sofort. Eine stringente Biografie beinhalten die neun BûÊnde sicherlich nicht. Stattdessen prûÊgt den Roman eine assoziative Struktur: Vor und zurû¥ck blickt der ErzûÊhler, der sich nicht an eine Chronologie halten mag; ebenso wechselt sein Gestus ã von beiûender Satire oder einem spûÑttischen Ton bis zu pathetischen Beschreibungen. Und auch optisch verrûÊt Sternes Roman, dass er sich nicht an das hûÊlt, was seine Gattung bisher auszeichnete. Das Vorwort leitet die Geschichte nicht ein, es wird stattdessen nachgereicht, mitten in der ErzûÊhlung. Und die wiederum ist gespickt mit AuffûÊlligkeiten: mit Auslassungen, Reihen von Sternchen-Symbolen, oder mit ganzen Kapiteln, die fehlen. Andere Seiten sind dafû¥r ganz in schwarz gehalten, gefû¥llt mit DruckerschwûÊrze, nicht mit sinnerfû¥llten Zeichen. All das sind Hinweise darauf, dass die Ordnung hier bewusst gebrochen wird, dass Autor und ErzûÊhler Freigeister sind, die weniger an einer Biografie interessiert sind als an der bis heute bestehenden Frage, ob sich eine solche erzûÊhlen lûÊsst. Vom Leben dieses vermeintlichen Protagonisten und Ich-ErzûÊhlers, Tristram Shandy, liest man entsprechend wenig ã seiner Zeugung wird ebenso viel Aufmerksamkeit geschenkt wie seiner Geburt, von der erst im dritten Band berichtet wird. Sehr einprûÊgsame und detailreiche Beschreibungen gelten dagegen anderen Figuren: allen voran Tristrams Vater und seinem Onkel Toby ã zwei ûÊuûerst eigenwillige, bisweilen schrullige Charaktere, die der ErzûÊhler aber nie so sehr dem LûÊcherlichen preisgibt, dass sie darû¥ber ihre liebenswerte Note verlieren, ganz Karikatur werden. Nietzsche galt Sterne deshalb als ãder freieste Schriftsteller aller Zeitenã, gegen ihn, so schreibt er in Menschliches Allzumenschliches II, seien ãalle anderen steif, vier-schrûÑtig, unduldsam und bûÊuerisch-geradezuã. Mit dieser Haltung hat Sterne die Geschichte des Romans geprûÊgt und ist zu einer Instanz fû¥r folgende Schriftstellergenerationen geworden. Auch in Deutschland blickten Autoren bewundernd auf den schreibenden Pfarrer aus England und seinen Tristram: Goethe und Zelter etwa tauschten im Briefwechsel ihre Lektû¥reeindrû¥cke aus, und Lessing lieû sich zu der Aussage bewegen, er wû¥rde Sterne gerne fû¥nf seiner Lebensjahre abtreten, wenn dieser sie nur schreibend verbringen wolle. Eine erste ûbersetzung ins Deutsche folgte entsprechend frû¥h, 1769. Auf der ûbertragung von Michael Walter basiert nun die Bearbeitung fû¥r das Radio von Karl Bruckmaier. Dessen Ziel es ist, ãden HûÑrgewohnheiten des 21. Jahrhunderts ebenso Rechnung zu tragen wie den zeitlosen, den klassischen QualitûÊten dieses Urtexts aller Genreverletzungen.ã |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 15.11.2015
Datum: 15.11.2015Länge: 00:50:18 Größe: 46.06 MB |
||
| Michael Lentz: Exit - 13.11.2015 | ||
| Mit Michael Lentz, Konrad Kellen / BR 2005 / LûÊnge: 53'58 // EXIT - das HûÑrspiel als Erinnerungs- und VergegenwûÊrtigungsmaschine, als Osmose zwischen "Exil" und "Exit". Beschreibungsmomente lûÑsen Rû¥ckfragen aus, eine ErzûÊhlstimme streitet sich mit sich selber û¥ber die ãrichtigeã Beobachtung, û¥ber den immer wieder zu vergegenwûÊrtigenden Augenblick, der gleichzeitig einen Gesamtzusammenhang verlangt. AuslûÑser ist ein Besuch bei Konrad Katzenellenbogen (geb. 1913), der seit vielen Jahrzehnten unter dem Namen Konrad Kellen in Amerika (Pacific Palisades) lebt. 1933 ist Kellen aus Deutschland emigriert, 1935 gelangte er nach New York. Von 1941 bis 1943 war Kellen PrivatsekretûÊr von Thomas Mann. In dieser Zeit schrieb er u. a. das Manuskript von Joseph der ErnûÊhrer mit der Schreibmaschine ab und war fû¥r Thomas Mann osmotischer GesprûÊchspartner. Bis auf einen kurzen Besuch vor Jahrzehnten ist Kellen nicht mehr in Deutschland gewesen. Konrad Kellen erzûÊhlt. Ununterbrochen. Nach langem ErzûÊhlen der bemerkenswerte Satz: ãAber was kûÑnnte ich Ihnen denn erzûÊhlen?ã. Immer wieder die Frage ãWas macht Deutschland?ã Was sagt man da? Kellen transportiert ein Deutschlandbild aus gesûÊttigter Erinnerung, die fixiert bleibt, amerikanischer Kolportage, Exilantenberichten, Korrespondenzen und unwillkû¥rlicher Imagination. Im Gegenû¥ber eines ZuhûÑrenden (der ZuhûÑrer des HûÑrspiels) findet Kellen Stimulanz zu variierter Berichterstattung desselben Sachverhalts, derselben Mutmaûung. Einen ganzen Erinnerungskosmos breitet er aus, fest gespeicherte, prûÊsente, unverlierbare Erinnerungsinseln, die er, je nach Erkenntnisinteresse, dergestalt miteinander vernetzen kann, dass die Geschichte jedes Mal um etwas bereichert wird, jedes Mal erscheint sie anders, jedes Mal ist es dieselbe variierte Geschichte, unterschiedlich ausgeleuchtet. Die Ich-Stimme des HûÑrspiels wird aufgebrochen in mindestens zwei weitere Stimmen: eine Ich-Korrekturstimme und einen Kommentator. Der Kommentator soll spontan kommentieren. Dies soll mûÑglichst im Studio wûÊhrend der Produktion geschehen. Der Kommentator hat auch die Aufgabe, O-TûÑne einspielen zu lassen. Auf seinen Wunsch hin wird eine Kellen-ûuûerung wiederholt, werden Straûenszenen aus Chicago eingespielt etc. So entsteht ein Wechselspiel der Stimmen. Erinnern, Vergessen, GedûÊchtnis, Sprache, Tod bilden die ãakustische Zentrifugaleã des HûÑrspiels. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 13.11.2015
Datum: 13.11.2015Länge: 00:54:17 Größe: 37.32 MB |
||
| Laurence Sterne: Leben und Ansichten von Tristram Shandy, Gentleman (4/9) - 08.11.2015 | ||
|
Mit Stefan Merki, Peter Fricke, Hans Kremer, Wolfgang Hinze, Katja Bû¥rkle, Pascal Fligg, Gabriel Raab, Helmut Stange, Kathrin von Steinburg, Sebastian Weber, Robert Maier, Michael Walter / Aus dem Englischen von Michael Walter / Komposition: Chris Cutler / Bearbeitung und Regie: Karl Bruckmaier / BR 2015 / LûÊnge: 53ã48 // Laurence Sternes Tristram Shandy ist ein einzigartiges Werk in der Literaturgeschichte: Erschienen zwischen den Jahren 1759 und 1767, experimentiert Sterne in diesem neunbûÊndigen Roman selbstbewusst mit der Form. In einer Zeit, als der Roman selbst noch nicht klar definiert oder gar etabliert ist, lotet Sterne bereits dessen Grenzen aus, spielt mit der Wirkung auf seine Leser und lûÊsst wie nebenbei fragwû¥rdig erscheinen, wie er û¥berhaupt erzûÊhlen kann, wovon er vorgibt, erzûÊhlen zu wollen: Leben und Ansichten von Tristram Shandy, Gentleman. Verspricht der Titel nûÊmlich eine wohlgeordnete und fein aufbereitete, womûÑglich auf ein Ziel hin erzûÊhlte Lebensgeschichte, so enttûÊuscht der ErzûÊhler diese Erwartungen sofort. Eine stringente Biografie beinhalten die neun BûÊnde sicherlich nicht. Stattdessen prûÊgt den Roman eine assoziative Struktur: Vor und zurû¥ck blickt der ErzûÊhler, der sich nicht an eine Chronologie halten mag; ebenso wechselt sein Gestus ã von beiûender Satire oder einem spûÑttischen Ton bis zu pathetischen Beschreibungen. Und auch optisch verrûÊt Sternes Roman, dass er sich nicht an das hûÊlt, was seine Gattung bisher auszeichnete. Das Vorwort leitet die Geschichte nicht ein, es wird stattdessen nachgereicht, mitten in der ErzûÊhlung. Und die wiederum ist gespickt mit AuffûÊlligkeiten: mit Auslassungen, Reihen von Sternchen-Symbolen, oder mit ganzen Kapiteln, die fehlen. Andere Seiten sind dafû¥r ganz in schwarz gehalten, gefû¥llt mit DruckerschwûÊrze, nicht mit sinnerfû¥llten Zeichen. All das sind Hinweise darauf, dass die Ordnung hier bewusst gebrochen wird, dass Autor und ErzûÊhler Freigeister sind, die weniger an einer Biografie interessiert sind als an der bis heute bestehenden Frage, ob sich eine solche erzûÊhlen lûÊsst. Vom Leben dieses vermeintlichen Protagonisten und Ich-ErzûÊhlers, Tristram Shandy, liest man entsprechend wenig ã seiner Zeugung wird ebenso viel Aufmerksamkeit geschenkt wie seiner Geburt, von der erst im dritten Band berichtet wird. Sehr einprûÊgsame und detailreiche Beschreibungen gelten dagegen anderen Figuren: allen voran Tristrams Vater und seinem Onkel Toby ã zwei ûÊuûerst eigenwillige, bisweilen schrullige Charaktere, die der ErzûÊhler aber nie so sehr dem LûÊcherlichen preisgibt, dass sie darû¥ber ihre liebenswerte Note verlieren, ganz Karikatur werden. Nietzsche galt Sterne deshalb als ãder freieste Schriftsteller aller Zeitenã, gegen ihn, so schreibt er in Menschliches Allzumenschliches II, seien ãalle anderen steif, vier-schrûÑtig, unduldsam und bûÊuerisch-geradezuã. Mit dieser Haltung hat Sterne die Geschichte des Romans geprûÊgt und ist zu einer Instanz fû¥r folgende Schriftstellergenerationen geworden. Auch in Deutschland blickten Autoren bewundernd auf den schreibenden Pfarrer aus England und seinen Tristram: Goethe und Zelter etwa tauschten im Briefwechsel ihre Lektû¥reeindrû¥cke aus, und Lessing lieû sich zu der Aussage bewegen, er wû¥rde Sterne gerne fû¥nf seiner Lebensjahre abtreten, wenn dieser sie nur schreibend verbringen wolle. Eine erste ûbersetzung ins Deutsche folgte entsprechend frû¥h, 1769. Auf der ûbertragung von Michael Walter basiert nun die Bearbeitung fû¥r das Radio von Karl Bruckmaier. Dessen Ziel es ist, ãden HûÑrgewohnheiten des 21. Jahrhunderts ebenso Rechnung zu tragen wie den zeitlosen, den klassischen QualitûÊten dieses Urtexts aller Genreverletzungen.ã |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 08.11.2015
Datum: 08.11.2015Länge: 00:52:25 Größe: 48.00 MB |
||
| Ergo Phizmiz: Sonora Mystery - 06.11.2015 | ||
| Mit Michael Malak, Selina Bloechinger, Thea Martin, Ergo Phizmiz / Komposition und Realisation: Ergo Phizmiz / BR 2015 // In den 1950er Jahren wird in den USA ein besonderes Buch entdeckt. Charles A. A. Dellschau, der in der Mitte des 19. Jahrhunderts als deutscher Emigrant in die USA kam, hatte auf unzûÊhlbaren Seiten mehr oder weniger phantastische Flugmaschinen entworfen und mit einer Geheimsprache auf Deutsch und Englisch kommentiert: Collagen aus Aquarellen, Zeitungsausschnitten und Texten, zeichnerische Dokumentationen, phantastische Illustrationen und trûÊumerische Visionen, die - wie Forscher vermuten - mit den Experimenten des sogenannten "Sonora Aero Club" zusammehûÊngen. In dieser geheimen Vereinigung im Kalifornien des 19. Jahrhunderts wurden 50 Jahre vor den Gebrû¥dern Wright Flugmaschinen erforscht. Um den Club ranken sich Legenden und Gerû¥chte, die der HûÑrspielmacher Ergo Phizmiz aufgreift, weiterspinnt und daraus eine HûÑrspiel zwischen Fakt und Fiktion, Wissenschaft und Phantasie, Wort und Musik kreiert. Waren es vielleicht die Experimente des Sonora Aero Club, die mit zahlreichen UFO-Sichtungen im Amerika der 1890er Jahre zusammenhûÊngen? Welche Verbindung hatte der Club mit einer geheimnisvollen internationalen Organisation, deren deutscher Ableger spûÊter an der Entwicklung von Flugtechnologien fû¥r den Zweiten Weltkrieg beteiligt war? Hat der Club vielleicht sogar einen Mord zu verantworten? Als sich ein Mitglied des Clubs gegen das strikte Geheimhaltungsverbot der Gemeinschaft wendet, nehmen nûÊmlich die Machenschaften des MûÊnnerbundes verbrecherische Auswû¥chse an, denen bei Phizmiz auch Dellschau nur knapp entkommen kann. In einer Mischung aus historischer Dokumentation, Musical und Melodram entwickelt Phizmiz in Sonora Mystery eine mehrsprachige, formverspielte und aberwitzige ErzûÊhlung û¥ber Geheimbû¥nde, VerschwûÑrungstheorien und den Traum vom Fliegen; jenseits von Logik und Chronologie, historischen wie phantastischen Verbindungslinien folgend, ganz in Analogie zur Methodik der Bildvisionen von Charles Dellschau. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 06.11.2015
Datum: 06.11.2015Länge: 00:42:52 Größe: 39.25 MB |
||
| Walther von Goethe Quartett: Das Leben - Finale (Das Dieter Roth Orchester spielt kleine wolken, typische scheiûe und nie gehûÑrte musik) - 30.10.2015 | ||
| Herausgegeben von Wolfgang Mû¥ller/Barbara SchûÊfer / Komposition und Realisation: Andreas Dorau, Ghostigital, Khan, Namosh, Mouse on Mars, Max Mû¥ller, Stereo Total, Trabant, Wolfgang Mû¥ller / BR 2006 // Die oft zarte, zurû¥ckgenommene, aber auch kontroverse und kalauernde Lyrik eignete sich û¥berraschend gut als Textbasis fû¥r die Popsongs der Musiker, die Wolfgang Mû¥ller als Dieter Roth Orchester zusammengebracht hat. Es entstanden popmusikalische Konzepte, Songs, Kompositionen und Radiotexte einer jû¥ngeren Generation, die sich von Roths Werk inspiriert und beeinflusst sieht. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 30.10.2015
Datum: 30.10.2015Länge: 00:01:00 Größe: 0.93 MB |
||
| Stereo Total: Eine kleine Schweinerei ohne Ende (Das Dieter Roth Orchester spielt kleine wolken, typische scheiûe und nie gehûÑrte musik) - 30.10.2015 | ||
|
Herausgegeben von Wolfgang Mû¥ller/Barbara SchûÊfer / Komposition und Realisation: Andreas Dorau, Ghostigital, Khan, Namosh, Mouse on Mars, Max Mû¥ller, Stereo Total, Trabant, Wolfgang Mû¥ller / BR 2006 // Die oft zarte, zurû¥ckgenommene, aber auch kontroverse und kalauernde Lyrik eignete sich û¥berraschend gut als Textbasis fû¥r die Popsongs der Musiker, die Wolfgang Mû¥ller als Dieter Roth Orchester zusammengebracht hat. Es entstanden popmusikalische Konzepte, Songs, Kompositionen und Radiotexte einer jû¥ngeren Generation, die sich von Roths Werk inspiriert und beeinflusst sieht. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 30.10.2015
Datum: 30.10.2015Länge: 00:04:23 Größe: 4.02 MB |
||
| Khan: Eine Vase (Das Dieter Roth Orchester spielt kleine wolken, typische scheiûe und nie gehûÑrte musik) - 30.10.2015 | ||
|
Herausgegeben von Wolfgang Mû¥ller/Barbara SchûÊfer / Komposition und Realisation: Andreas Dorau, Ghostigital, Khan, Namosh, Mouse on Mars, Max Mû¥ller, Stereo Total, Trabant, Wolfgang Mû¥ller / BR 2006 // Die oft zarte, zurû¥ckgenommene, aber auch kontroverse und kalauernde Lyrik eignete sich û¥berraschend gut als Textbasis fû¥r die Popsongs der Musiker, die Wolfgang Mû¥ller als Dieter Roth Orchester zusammengebracht hat. Es entstanden popmusikalische Konzepte, Songs, Kompositionen und Radiotexte einer jû¥ngeren Generation, die sich von Roths Werk inspiriert und beeinflusst sieht. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 30.10.2015
Datum: 30.10.2015Länge: 00:01:11 Größe: 1.09 MB |
||
| Max Mû¥ller: Ich brannte einmal (Das Dieter Roth Orchester spielt kleine wolken, typische scheiûe und nie gehûÑrte musik) - 30.10.2015 | ||
|
Herausgegeben von Wolfgang Mû¥ller/Barbara SchûÊfer / Komposition und Realisation: Andreas Dorau, Ghostigital, Khan, Namosh, Mouse on Mars, Max Mû¥ller, Stereo Total, Trabant, Wolfgang Mû¥ller / BR 2006 // Die oft zarte, zurû¥ckgenommene, aber auch kontroverse und kalauernde Lyrik eignete sich û¥berraschend gut als Textbasis fû¥r die Popsongs der Musiker, die Wolfgang Mû¥ller als Dieter Roth Orchester zusammengebracht hat. Es entstanden popmusikalische Konzepte, Songs, Kompositionen und Radiotexte einer jû¥ngeren Generation, die sich von Roths Werk inspiriert und beeinflusst sieht. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 30.10.2015
Datum: 30.10.2015Länge: 00:02:35 Größe: 2.38 MB |
||
| Mouse on Mars: doit again (Das Dieter Roth Orchester spielt kleine wolken, typische scheiûe und nie gehûÑrte musik) - 30.10.2015 | ||
| Herausgegeben von Wolfgang Mû¥ller/Barbara SchûÊfer / Komposition und Realisation: Andreas Dorau, Ghostigital, Khan, Namosh, Mouse on Mars, Max Mû¥ller, Stereo Total, Trabant, Wolfgang Mû¥ller / BR 2006 // Die oft zarte, zurû¥ckgenommene, aber auch kontroverse und kalauernde Lyrik eignete sich û¥berraschend gut als Textbasis fû¥r die Popsongs der Musiker, die Wolfgang Mû¥ller als Dieter Roth Orchester zusammengebracht hat. Es entstanden popmusikalische Konzepte, Songs, Kompositionen und Radiotexte einer jû¥ngeren Generation, die sich von Roths Werk inspiriert und beeinflusst sieht. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 30.10.2015
Datum: 30.10.2015Länge: 00:04:35 Größe: 4.20 MB |
||
| ûlfur Hrû°dû°lfsson: In jener Welt... (Das Dieter Roth Orchester spielt kleine wolken, typische scheiûe und nie gehûÑrte musik) - 30.10.2015 | ||
| Herausgegeben von Wolfgang Mû¥ller/Barbara SchûÊfer / Komposition und Realisation: Andreas Dorau, Ghostigital, Khan, Namosh, Mouse on Mars, Max Mû¥ller, Stereo Total, Trabant, Wolfgang Mû¥ller / BR 2006 // Die oft zarte, zurû¥ckgenommene, aber auch kontroverse und kalauernde Lyrik eignete sich û¥berraschend gut als Textbasis fû¥r die Popsongs der Musiker, die Wolfgang Mû¥ller als Dieter Roth Orchester zusammengebracht hat. Es entstanden popmusikalische Konzepte, Songs, Kompositionen und Radiotexte einer jû¥ngeren Generation, die sich von Roths Werk inspiriert und beeinflusst sieht. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 30.10.2015
Datum: 30.10.2015Länge: 00:01:45 Größe: 1.61 MB |
||
| Trabant: das Meer - variante II (Das Dieter Roth Orchester spielt kleine wolken, typische scheiûe und nie gehûÑrte musik) - 30.10.2015 | ||
|
Herausgegeben von Wolfgang Mû¥ller/Barbara SchûÊfer / Komposition und Realisation: Andreas Dorau, Ghostigital, Khan, Namosh, Mouse on Mars, Max Mû¥ller, Stereo Total, Trabant, Wolfgang Mû¥ller / BR 2006 // Die oft zarte, zurû¥ckgenommene, aber auch kontroverse und kalauernde Lyrik eignete sich û¥berraschend gut als Textbasis fû¥r die Popsongs der Musiker, die Wolfgang Mû¥ller als Dieter Roth Orchester zusammengebracht hat. Es entstanden popmusikalische Konzepte, Songs, Kompositionen und Radiotexte einer jû¥ngeren Generation, die sich von Roths Werk inspiriert und beeinflusst sieht. ? |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 30.10.2015
Datum: 30.10.2015Länge: 00:04:06 Größe: 3.76 MB |
||
| Ghostigital: NEKROPHILOLOGIE: (Das Dieter Roth Orchester spielt kleine wolken, typische scheiûe und nie gehûÑrte musik) - 30.10.2015 | ||
|
Herausgegeben von Wolfgang Mû¥ller/Barbara SchûÊfer / Komposition und Realisation: Andreas Dorau, Ghostigital, Khan, Namosh, Mouse on Mars, Max Mû¥ller, Stereo Total, Trabant, Wolfgang Mû¥ller / BR 2006 // Die oft zarte, zurû¥ckgenommene, aber auch kontroverse und kalauernde Lyrik eignete sich û¥berraschend gut als Textbasis fû¥r die Popsongs der Musiker, die Wolfgang Mû¥ller als Dieter Roth Orchester zusammengebracht hat. Es entstanden popmusikalische Konzepte, Songs, Kompositionen und Radiotexte einer jû¥ngeren Generation, die sich von Roths Werk inspiriert und beeinflusst sieht. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 30.10.2015
Datum: 30.10.2015Länge: 00:05:10 Größe: 4.74 MB |
||
| Wollita: Ichbla willbla wasbla (Das Dieter Roth Orchester spielt kleine wolken, typische scheiûe und nie gehûÑrte musik) - 30.10.2015 | ||
|
Herausgegeben von Wolfgang Mû¥ller/Barbara SchûÊfer / Komposition und Realisation: Andreas Dorau, Ghostigital, Khan, Namosh, Mouse on Mars, Max Mû¥ller, Stereo Total, Trabant, Wolfgang Mû¥ller / BR 2006 // Die oft zarte, zurû¥ckgenommene, aber auch kontroverse und kalauernde Lyrik eignete sich û¥berraschend gut als Textbasis fû¥r die Popsongs der Musiker, die Wolfgang Mû¥ller als Dieter Roth Orchester zusammengebracht hat. Es entstanden popmusikalische Konzepte, Songs, Kompositionen und Radiotexte einer jû¥ngeren Generation, die sich von Roths Werk inspiriert und beeinflusst sieht. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 30.10.2015
Datum: 30.10.2015Länge: 00:03:29 Größe: 3.19 MB |
||
| Andreas Dorau: Sabelle fliegt (Das Dieter Roth Orchester spielt kleine wolken, typische scheiûe und nie gehûÑrte musik) - 30.10.2015 | ||
| Herausgegeben von Wolfgang Mû¥ller/Barbara SchûÊfer / Komposition und Realisation: Andreas Dorau, Ghostigital, Khan, Namosh, Mouse on Mars, Max Mû¥ller, Stereo Total, Trabant, Wolfgang Mû¥ller / BR 2006 // Die oft zarte, zurû¥ckgenommene, aber auch kontroverse und kalauernde Lyrik eignete sich û¥berraschend gut als Textbasis fû¥r die Popsongs der Musiker, die Wolfgang Mû¥ller als Dieter Roth Orchester zusammengebracht hat. Es entstanden popmusikalische Konzepte, Songs, Kompositionen und Radiotexte einer jû¥ngeren Generation, die sich von Roths Werk inspiriert und beeinflusst sieht. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 30.10.2015
Datum: 30.10.2015Länge: 00:04:00 Größe: 3.67 MB |
||
| Khan: MAN SAH DAS MEER SO WIE MAN SAH (Das Dieter Roth Orchester spielt kleine wolken, typische scheiûe und nie gehûÑrte musik) - 30.10.2015 | ||
|
Herausgegeben von Wolfgang Mû¥ller/Barbara SchûÊfer / Komposition und Realisation: Andreas Dorau, Ghostigital, Khan, Namosh, Mouse on Mars, Max Mû¥ller, Stereo Total, Trabant, Wolfgang Mû¥ller / BR 2006 // Die oft zarte, zurû¥ckgenommene, aber auch kontroverse und kalauernde Lyrik eignete sich û¥berraschend gut als Textbasis fû¥r die Popsongs der Musiker, die Wolfgang Mû¥ller als Dieter Roth Orchester zusammengebracht hat. Es entstanden popmusikalische Konzepte, Songs, Kompositionen und Radiotexte einer jû¥ngeren Generation, die sich von Roths Werk inspiriert und beeinflusst sieht. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 30.10.2015
Datum: 30.10.2015Länge: 00:05:50 Größe: 5.35 MB |
||
| Armand & Bruno: Wasbla ichbla willbla (Das Dieter Roth Orchester spielt kleine wolken, typische scheiûe und nie gehûÑrte musik) - 30.10.2015 | ||
| Herausgegeben von Wolfgang Mû¥ller/Barbara SchûÊfer / Komposition und Realisation: Andreas Dorau, Ghostigital, Khan, Namosh, Mouse on Mars, Max Mû¥ller, Stereo Total, Trabant, Wolfgang Mû¥ller / BR 2006 // Die oft zarte, zurû¥ckgenommene, aber auch kontroverse und kalauernde Lyrik eignete sich û¥berraschend gut als Textbasis fû¥r die Popsongs der Musiker, die Wolfgang Mû¥ller als Dieter Roth Orchester zusammengebracht hat. Es entstanden popmusikalische Konzepte, Songs, Kompositionen und Radiotexte einer jû¥ngeren Generation, die sich von Roths Werk inspiriert und beeinflusst sieht. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 30.10.2015
Datum: 30.10.2015Länge: 00:04:20 Größe: 3.98 MB |
||
| Trabant: das Meer - variante I (Das Dieter Roth Orchester spielt kleine wolken, typische scheiûe und nie gehûÑrte musik) - 30.10.2015 | ||
|
Herausgegeben von Wolfgang Mû¥ller/Barbara SchûÊfer / Komposition und Realisation: Andreas Dorau, Ghostigital, Khan, Namosh, Mouse on Mars, Max Mû¥ller, Stereo Total, Trabant, Wolfgang Mû¥ller / BR 2006 // Die oft zarte, zurû¥ckgenommene, aber auch kontroverse und kalauernde Lyrik eignete sich û¥berraschend gut als Textbasis fû¥r die Popsongs der Musiker, die Wolfgang Mû¥ller als Dieter Roth Orchester zusammengebracht hat. Es entstanden popmusikalische Konzepte, Songs, Kompositionen und Radiotexte einer jû¥ngeren Generation, die sich von Roths Werk inspiriert und beeinflusst sieht. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 30.10.2015
Datum: 30.10.2015Länge: 00:01:58 Größe: 1.80 MB |
||
| Walther von Goethe Quartett: Das Leben - Intro (Das Dieter Roth Orchester spielt kleine wolken, typische scheiûe und nie gehûÑrte musik) - 30.10.2015 | ||
| Herausgegeben von Wolfgang Mû¥ller/Barbara SchûÊfer / Komposition und Realisation: Andreas Dorau, Ghostigital, Khan, Namosh, Mouse on Mars, Max Mû¥ller, Stereo Total, Trabant, Wolfgang Mû¥ller / BR 2006 // Die oft zarte, zurû¥ckgenommene, aber auch kontroverse und kalauernde Lyrik eignete sich û¥berraschend gut als Textbasis fû¥r die Popsongs der Musiker, die Wolfgang Mû¥ller als Dieter Roth Orchester zusammengebracht hat. Es entstanden popmusikalische Konzepte, Songs, Kompositionen und Radiotexte einer jû¥ngeren Generation, die sich von Roths Werk inspiriert und beeinflusst sieht. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 30.10.2015
Datum: 30.10.2015Länge: 00:00:34 Größe: 0.53 MB |
||
| Wolfgang Mû¥ller: lache wider willen! (Das Dieter Roth Orchester spielt kleine wolken, typische scheiûe und nie gehûÑrte musik) - 30.10.2015 | ||
|
Herausgegeben von Wolfgang Mû¥ller/Barbara SchûÊfer / Komposition und Realisation: Andreas Dorau, Ghostigital, Khan, Namosh, Mouse on Mars, Max Mû¥ller, Stereo Total, Trabant, Wolfgang Mû¥ller / BR 2006 // Die oft zarte, zurû¥ckgenommene, aber auch kontroverse und kalauernde Lyrik eignete sich û¥berraschend gut als Textbasis fû¥r die Popsongs der Musiker, die Wolfgang Mû¥ller als Dieter Roth Orchester zusammengebracht hat. Es entstanden popmusikalische Konzepte, Songs, Kompositionen und Radiotexte einer jû¥ngeren Generation, die sich von Roths Werk inspiriert und beeinflusst sieht. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 30.10.2015
Datum: 30.10.2015Länge: 00:02:39 Größe: 2.44 MB |
||
| Wolfgang Mû¥ller: weine wider willen! (Das Dieter Roth Orchester spielt kleine wolken, typische scheiûe und nie gehûÑrte musik) - 30.10.2015 | ||
|
Herausgegeben von Wolfgang Mû¥ller/Barbara SchûÊfer / Komposition und Realisation: Andreas Dorau, Ghostigital, Khan, Namosh, Mouse on Mars, Max Mû¥ller, Stereo Total, Trabant, Wolfgang Mû¥ller / BR 2006 // Die oft zarte, zurû¥ckgenommene, aber auch kontroverse und kalauernde Lyrik eignete sich û¥berraschend gut als Textbasis fû¥r die Popsongs der Musiker, die Wolfgang Mû¥ller als Dieter Roth Orchester zusammengebracht hat. Es entstanden popmusikalische Konzepte, Songs, Kompositionen und Radiotexte einer jû¥ngeren Generation, die sich von Roths Werk inspiriert und beeinflusst sieht. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 30.10.2015
Datum: 30.10.2015Länge: 00:02:53 Größe: 2.65 MB |
||
| Namosh: Bild aus dem Kriege -I., Aus den Religionskriegen (Das Dieter Roth Orchester spielt kleine wolken, typische scheiûe und nie gehûÑrte musik) - 30.10.2015 | ||
|
Herausgegeben von Wolfgang Mû¥ller/Barbara SchûÊfer / Komposition und Realisation: Andreas Dorau, Ghostigital, Khan, Namosh, Mouse on Mars, Max Mû¥ller, Stereo Total, Trabant, Wolfgang Mû¥ller / BR 2006 // Die oft zarte, zurû¥ckgenommene, aber auch kontroverse und kalauernde Lyrik eignete sich û¥berraschend gut als Textbasis fû¥r die Popsongs der Musiker, die Wolfgang Mû¥ller als Dieter Roth Orchester zusammengebracht hat. Es entstanden popmusikalische Konzepte, Songs, Kompositionen und Radiotexte einer jû¥ngeren Generation, die sich von Roths Werk inspiriert und beeinflusst sieht. Herausgegeben von Wolfgang Mû¥ller/Barbara SchûÊfer / Komposition und Realisation: Andreas Dorau, Ghostigital, Khan, Namosh, Mouse on Mars, Max Mû¥ller, Stereo Total, Trabant, Wolfgang Mû¥ller / BR 2006 // Die oft zarte, zurû¥ckgenommene, aber auch kontroverse und kalauernde Lyrik eignete sich û¥berraschend gut als Textbasis fû¥r die Popsongs der Musiker, die Wolfgang Mû¥ller als Dieter Roth Orchester zusammengebracht hat. Es entstanden popmusikalische Konzepte, Songs, Kompositionen und Radiotexte einer jû¥ngeren Generation, die sich von Roths Werk inspiriert und beeinflusst sieht. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 30.10.2015
Datum: 30.10.2015Länge: 00:04:03 Größe: 3.72 MB |
||
| Mutter: Warum ist das so? (Das Dieter Roth Orchester spielt kleine wolken, typische scheiûe und nie gehûÑrte musik) - 30.10.2015 | ||
|
Herausgegeben von Wolfgang Mû¥ller/Barbara SchûÊfer / Komposition und Realisation: Andreas Dorau, Ghostigital, Khan, Namosh, Mouse on Mars, Max Mû¥ller, Stereo Total, Trabant, Wolfgang Mû¥ller / BR 2006 // Die oft zarte, zurû¥ckgenommene, aber auch kontroverse und kalauernde Lyrik eignete sich û¥berraschend gut als Textbasis fû¥r die Popsongs der Musiker, die Wolfgang Mû¥ller als Dieter Roth Orchester zusammengebracht hat. Es entstanden popmusikalische Konzepte, Songs, Kompositionen und Radiotexte einer jû¥ngeren Generation, die sich von Roths Werk inspiriert und beeinflusst sieht. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 30.10.2015
Datum: 30.10.2015Länge: 00:01:58 Größe: 1.81 MB |
||
| Laurence Sterne: Leben und Ansichten von Tristram Shandy, Gentleman (3/9) - 25.10.2015 | ||
|
Mit Stefan Merki, Peter Fricke, Hans Kremer, Helmut Stange, Michele Cucioffo, Katja Bû¥rkle, Gabriel Raab, Kathrin von Steinburg, Sebastian Weber, Rainer Maria Schieûler, Martin Schmidt / Aus dem Englischen von Michael Walter / Komposition: Chris Cutler / Bearbeitung und Regie: Karl Bruckmaier / BR 2015 / LûÊnge: 53ã48 // Laurence Sternes Tristram Shandy ist ein einzigartiges Werk in der Literaturgeschichte: Erschienen zwischen den Jahren 1759 und 1767, experimentiert Sterne in diesem neunbûÊndigen Roman selbstbewusst mit der Form. In einer Zeit, als der Roman selbst noch nicht klar definiert oder gar etabliert ist, lotet Sterne bereits dessen Grenzen aus, spielt mit der Wirkung auf seine Leser und lûÊsst wie nebenbei fragwû¥rdig erscheinen, wie er û¥berhaupt erzûÊhlen kann, wovon er vorgibt, erzûÊhlen zu wollen: Leben und Ansichten von Tristram Shandy, Gentleman. Verspricht der Titel nûÊmlich eine wohlgeordnete und fein aufbereitete, womûÑglich auf ein Ziel hin erzûÊhlte Lebensgeschichte, so enttûÊuscht der ErzûÊhler diese Erwartungen sofort. Eine stringente Biografie beinhalten die neun BûÊnde sicherlich nicht. Stattdessen prûÊgt den Roman eine assoziative Struktur: Vor und zurû¥ck blickt der ErzûÊhler, der sich nicht an eine Chronologie halten mag; ebenso wechselt sein Gestus ã von beiûender Satire oder einem spûÑttischen Ton bis zu pathetischen Beschreibungen. Und auch optisch verrûÊt Sternes Roman, dass er sich nicht an das hûÊlt, was seine Gattung bisher auszeichnete. Das Vorwort leitet die Geschichte nicht ein, es wird stattdessen nachgereicht, mitten in der ErzûÊhlung. Und die wiederum ist gespickt mit AuffûÊlligkeiten: mit Auslassungen, Reihen von Sternchen-Symbolen, oder mit ganzen Kapiteln, die fehlen. Andere Seiten sind dafû¥r ganz in schwarz gehalten, gefû¥llt mit DruckerschwûÊrze, nicht mit sinnerfû¥llten Zeichen. All das sind Hinweise darauf, dass die Ordnung hier bewusst gebrochen wird, dass Autor und ErzûÊhler Freigeister sind, die weniger an einer Biografie interessiert sind als an der bis heute bestehenden Frage, ob sich eine solche erzûÊhlen lûÊsst. Vom Leben dieses vermeintlichen Protagonisten und Ich-ErzûÊhlers, Tristram Shandy, liest man entsprechend wenig ã seiner Zeugung wird ebenso viel Aufmerksamkeit geschenkt wie seiner Geburt, von der erst im dritten Band berichtet wird. Sehr einprûÊgsame und detailreiche Beschreibungen gelten dagegen anderen Figuren: allen voran Tristrams Vater und seinem Onkel Toby ã zwei ûÊuûerst eigenwillige, bisweilen schrullige Charaktere, die der ErzûÊhler aber nie so sehr dem LûÊcherlichen preisgibt, dass sie darû¥ber ihre liebenswerte Note verlieren, ganz Karikatur werden. Nietzsche galt Sterne deshalb als ãder freieste Schriftsteller aller Zeitenã, gegen ihn, so schreibt er in Menschliches Allzumenschliches II, seien ãalle anderen steif, vier-schrûÑtig, unduldsam und bûÊuerisch-geradezuã. Mit dieser Haltung hat Sterne die Geschichte des Romans geprûÊgt und ist zu einer Instanz fû¥r folgende Schriftstellergenerationen geworden. Auch in Deutschland blickten Autoren bewundernd auf den schreibenden Pfarrer aus England und seinen Tristram: Goethe und Zelter etwa tauschten im Briefwechsel ihre Lektû¥reeindrû¥cke aus, und Lessing lieû sich zu der Aussage bewegen, er wû¥rde Sterne gerne fû¥nf seiner Lebensjahre abtreten, wenn dieser sie nur schreibend verbringen wolle. Eine erste ûbersetzung ins Deutsche folgte entsprechend frû¥h, 1769. Auf der ûbertragung von Michael Walter basiert nun die Bearbeitung fû¥r das Radio von Karl Bruckmaier. Dessen Ziel es ist, ãden HûÑrgewohnheiten des 21. Jahrhunderts ebenso Rechnung zu tragen wie den zeitlosen, den klassischen QualitûÊten dieses Urtexts aller Genreverletzungen.ã |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 25.10.2015
Datum: 25.10.2015Länge: 00:49:45 Größe: 45.56 MB |
||
| Josef Ruederer: Die MorgenrûÑte - Eine KomûÑdie aus dem Jahre 1848 - 24.10.2015 | ||
| Mit Helen Vita, Fritz Straûner, Ferdinand Anton, Charlotte von Bomhard, Luise Deschauer, Hanns Ernst JûÊger, Walter Holten, Karl Michael Vogler, Paul Kû¥rzinger, Ludwig Schmid-Wildy, Helmut Fischer, Gustl Weishappel u.a. / Regie: Edmund Steinberger / BR 1961 / LûÊnge: 75'39 // Im revolutionstrûÊchtigen Jahr 1848 trieb es auch die Mû¥nchner Bû¥rger auf die Barrikaden. Das "g'schlamperte VerhûÊltnis" ihres KûÑnigs Ludwig I. mit der TûÊnzerin Lola Montez - er hatte sie sogar in den Adelsstand erhoben und ihr den Titel "GrûÊfin Landsberg" verliehen - erhitzte die Gemû¥ter auûerordentlich. Als GrûÊfin mischte sie sich in die Landespolitik ein, entlieû UniversitûÊtsprofessoren und besetzte Ministerposten nach ihren Vorlieben. Fû¥r die Mû¥nchner stand fest: ãA Ruah kriang mer koane mehr, solang des Mensch no do is.ã Die Stimmung wurde weiter angeheizt, bis es zu einem regelrechten Aufstand kam, der mit der Verbannung der schûÑnen Lola endete. Josef Ruederer zeichnet das Mû¥nchener Kleinbû¥rgertum mit grimmiger SchûÊrfe und ûÊtzender Ironie. Ruederer galt in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg als der bedeutendste Konkurrent Ludwig Thomas. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 24.10.2015
Datum: 24.10.2015Länge: 01:15:46 Größe: 69.37 MB |
||
| Laurence Sterne: Leben und Ansichten von Tristram Shandy, Gentleman (2/9) - 18.10.2015 | ||
|
Mit Stefan Merki, Peter Fricke, Hans Kremer, Helmut Stange, Michele Cucioffo, Johannes Herrschmann, Gabriel Raab, Sebastian Weber / Aus dem Englischen von Michael Walter / Komposition: Chris Cutler / Bearbeitung und Regie: Karl Bruckmaier / BR 2015 / LûÊnge: 53ã48 // Laurence Sternes Tristram Shandy ist ein einzigartiges Werk in der Literaturgeschichte: Erschienen zwischen den Jahren 1759 und 1767, experimentiert Sterne in diesem neunbûÊndigen Roman selbstbewusst mit der Form. In einer Zeit, als der Roman selbst noch nicht klar definiert oder gar etabliert ist, lotet Sterne bereits dessen Grenzen aus, spielt mit der Wirkung auf seine Leser und lûÊsst wie nebenbei fragwû¥rdig erscheinen, wie er û¥berhaupt erzûÊhlen kann, wovon er vorgibt, erzûÊhlen zu wollen: Leben und Ansichten von Tristram Shandy, Gentleman. Verspricht der Titel nûÊmlich eine wohlgeordnete und fein aufbereitete, womûÑglich auf ein Ziel hin erzûÊhlte Lebensgeschichte, so enttûÊuscht der ErzûÊhler diese Erwartungen sofort. Eine stringente Biografie beinhalten die neun BûÊnde sicherlich nicht. Stattdessen prûÊgt den Roman eine assoziative Struktur: Vor und zurû¥ck blickt der ErzûÊhler, der sich nicht an eine Chronologie halten mag; ebenso wechselt sein Gestus ã von beiûender Satire oder einem spûÑttischen Ton bis zu pathetischen Beschreibungen. Und auch optisch verrûÊt Sternes Roman, dass er sich nicht an das hûÊlt, was seine Gattung bisher auszeichnete. Das Vorwort leitet die Geschichte nicht ein, es wird stattdessen nachgereicht, mitten in der ErzûÊhlung. Und die wiederum ist gespickt mit AuffûÊlligkeiten: mit Auslassungen, Reihen von Sternchen-Symbolen, oder mit ganzen Kapiteln, die fehlen. Andere Seiten sind dafû¥r ganz in schwarz gehalten, gefû¥llt mit DruckerschwûÊrze, nicht mit sinnerfû¥llten Zeichen. All das sind Hinweise darauf, dass die Ordnung hier bewusst gebrochen wird, dass Autor und ErzûÊhler Freigeister sind, die weniger an einer Biografie interessiert sind als an der bis heute bestehenden Frage, ob sich eine solche erzûÊhlen lûÊsst. Vom Leben dieses vermeintlichen Protagonisten und Ich-ErzûÊhlers, Tristram Shandy, liest man entsprechend wenig ã seiner Zeugung wird ebenso viel Aufmerksamkeit geschenkt wie seiner Geburt, von der erst im dritten Band berichtet wird. Sehr einprûÊgsame und detailreiche Beschreibungen gelten dagegen anderen Figuren: allen voran Tristrams Vater und seinem Onkel Toby ã zwei ûÊuûerst eigenwillige, bisweilen schrullige Charaktere, die der ErzûÊhler aber nie so sehr dem LûÊcherlichen preisgibt, dass sie darû¥ber ihre liebenswerte Note verlieren, ganz Karikatur werden. Nietzsche galt Sterne deshalb als ãder freieste Schriftsteller aller Zeitenã, gegen ihn, so schreibt er in Menschliches Allzumenschliches II, seien ãalle anderen steif, vier-schrûÑtig, unduldsam und bûÊuerisch-geradezuã. Mit dieser Haltung hat Sterne die Geschichte des Romans geprûÊgt und ist zu einer Instanz fû¥r folgende Schriftstellergenerationen geworden. Auch in Deutschland blickten Autoren bewundernd auf den schreibenden Pfarrer aus England und seinen Tristram: Goethe und Zelter etwa tauschten im Briefwechsel ihre Lektû¥reeindrû¥cke aus, und Lessing lieû sich zu der Aussage bewegen, er wû¥rde Sterne gerne fû¥nf seiner Lebensjahre abtreten, wenn dieser sie nur schreibend verbringen wolle. Eine erste ûbersetzung ins Deutsche folgte entsprechend frû¥h, 1769. Auf der ûbertragung von Michael Walter basiert nun die Bearbeitung fû¥r das Radio von Karl Bruckmaier. Dessen Ziel es ist, ãden HûÑrgewohnheiten des 21. Jahrhunderts ebenso Rechnung zu tragen wie den zeitlosen, den klassischen QualitûÊten dieses Urtexts aller Genreverletzungen.ã |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 18.10.2015
Datum: 18.10.2015Länge: 00:53:54 Größe: 49.36 MB |
||
| Laurence Sterne: Leben und Ansichten von Tristram Shandy, Gentleman (1/9) - 11.10.2015 | ||
|
Mit Stefan Merki, Peter Fricke, Anna Drexler, Hans Kremer, Gabriel Raab, Kathrin von Steinburg, Peter Veit, Sebastian Weber, Michael Walter / Aus dem Englischen von Michael Walter / Komposition:Robert Forster / Bearbeitung und Regie: Karl Bruckmaier / BR 2015 / LûÊnge: 54'06 // Laurence Sternes Tristram Shandy ist ein einzigartiges Werk in der Literaturge-schichte: Erschienen zwischen den Jahren 1759 und 1767, experimentiert Sterne in diesem neunbûÊndigen Roman selbstbewusst mit der Form. In einer Zeit, als der Roman selbst noch nicht klar definiert oder gar etabliert ist, lotet Sterne bereits dessen Grenzen aus, spielt mit der Wirkung auf seine Leser und lûÊsst wie nebenbei fragwû¥rdig erscheinen, wie er û¥berhaupt erzûÊhlen kann, wovon er vorgibt, erzûÊhlen zu wollen: Leben und Ansichten von Tristram Shandy, Gentleman. Verspricht der Titel nûÊmlich eine wohlgeordnete und fein aufbereitete, womûÑglich auf ein Ziel hin erzûÊhlte Lebensgeschichte, so enttûÊuscht der ErzûÊhler diese Erwartungen sofort. Eine stringente Biografie beinhalten die neun BûÊnde sicherlich nicht. Stattdessen prûÊgt den Roman eine assoziative Struktur: Vor und zurû¥ck blickt der ErzûÊhler, der sich nicht an eine Chronologie halten mag; ebenso wechselt sein Gestus ã von beiûender Satire oder einem spûÑttischen Ton bis zu pathetischen Be-schreibungen. Und auch optisch verrûÊt Sternes Roman, dass er sich nicht an das hûÊlt, was seine Gattung bisher auszeichnete. Das Vorwort leitet die Geschichte nicht ein, es wird stattdessen nachgereicht, mitten in der ErzûÊhlung. Und die wiederum ist gespickt mit AuffûÊlligkeiten: mit Auslassungen, Reihen von Sternchen-Symbolen, oder mit ganzen Kapiteln, die fehlen. Andere Seiten sind dafû¥r ganz in schwarz gehalten, gefû¥llt mit DruckerschwûÊrze, nicht mit sinnerfû¥llten Zeichen. All das sind Hinweise darauf, dass die Ordnung hier bewusst gebrochen wird, dass Autor und ErzûÊhler Freigeister sind, die weniger an einer Biografie interessiert sind als an der bis heute bestehenden Frage, ob sich eine solche erzûÊhlen lûÊsst. Vom Leben dieses vermeintlichen Protagonisten und Ich-ErzûÊhlers, Tristram Shandy, liest man entsprechend wenig ã seiner Zeugung wird ebenso viel Aufmerksamkeit geschenkt wie seiner Geburt, von der erst im dritten Band berichtet wird. Sehr einprûÊgsame und detailreiche Beschreibungen gelten dagegen anderen Figuren: allen voran Tristrams Vater und seinem Onkel Toby ã zwei ûÊuûerst eigenwillige, bisweilen schrullige Charaktere, die der ErzûÊhler aber nie so sehr dem LûÊcherlichen preisgibt, dass sie darû¥ber ihre liebenswerte Note verlieren, ganz Karikatur werden. Nietzsche galt Sterne deshalb als ãder freieste Schriftsteller aller Zeitenã, gegen ihn, so schreibt er in Menschliches Allzumenschliches II, seien ãalle anderen steif, vier-schrûÑtig, unduldsam und bûÊuerisch-geradezuã. Mit dieser Haltung hat Sterne die Geschichte des Romans geprûÊgt und ist zu einer Instanz fû¥r folgende Schriftstellergenerationen geworden. Auch in Deutschland blickten Autoren bewundernd auf den schreibenden Pfarrer aus England und seinen Tristram: Goethe und Zelter etwa tauschten im Briefwechsel ihre Lektû¥reeindrû¥cke aus, und Lessing lieû sich zu der Aussage bewegen, er wû¥rde Sterne gerne fû¥nf seiner Lebensjahre abtreten, wenn dieser sie nur schreibend verbringen wolle. Eine erste ûbersetzung ins Deutsche folgte entsprechend frû¥h, 1769. Auf der ûbertragung von Michael Walter basiert nun die Bearbeitung fû¥r das Radio von Karl Bruckmaier. Dessen Ziel es ist, ãden HûÑrgewohnheiten des 21. Jahrhunderts ebenso Rechnung zu tragen wie den zeitlosen, den klassischen QualitûÊten dieses Urtexts aller Genreverletzungen.ã |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 11.10.2015
Datum: 11.10.2015Länge: 00:54:13 Größe: 49.64 MB |
||
| Andreas Ammer/Markus Acher/Micha Acher: The King is Gone. Des BayernkûÑnigs Revolutionstage - 09.10.2015 | ||
| Nach einem zeitgenûÑssischen Text von Josef Benno Sailer / Mit Friedrich Ani, Eva LûÑbau, Judith Huber, Wowo Habdank / Musik: Die Hochzeitskapelle: Evi Keglmaier (Bratsche und Kinderklavier), Mathias GûÑtz (Posaune, Percussion und Glockenspiel), Alex Haas (Banjo, Kontrabass und Harmonium), Micha Acher (Tuba und Orgel), Markus Acher (Schlagzeug und Marimba) / Komposition: Markus Acher/Micha Acher / Realisation: Andreas Ammer / BR 2015 / LûÊnge: 56'41 // TrûÑûÑûÑt. Die Revolution bricht los, die "Hochzeitskapelle" spielt Blasmusik, der letzte KûÑnig ist traurig und packt seine Zigarren. Irgendjemand singt die Internationale. Und Karl Marx bekommt plûÑtzlich doch recht: "Die letzte Phase einer weltgeschichtlichen Phase ist ihre KomûÑdie." Die wichtigste Quelle des HûÑrspiels ist ein obskures braunes Heftchen eines gewissen Josef Benno Sailer, das 1919 - kurz nach der RûÊterevolution in Mû¥nchen - erschien und von Carl-Ludwig Reichert in der Publikation Umsturz in Mû¥nchen (1988) in Erinnerung gebracht worden ist. Sailer schildert dem Volk minutiûÑs "Des BayernkûÑnigs Revolutionstage". Bei einem Spaziergang im Englischen Garten wird der letzte bayerische KûÑnig Ludwig III. von einem freundlichen Untertan darauf aufmerksam gemacht, dass Revolution sei: der KûÑnig mûÑge sich lieber auf die Flucht vor der RûÊterepublik begeben. So nimmt die KomûÑdie ihren Lauf: Das kûÑnigliche Automobil im Marstall ist noch aufgebockt. Die Straûen Mû¥nchens sind mit RevolutionûÊren verstopft. Die Reise endet wiederholt im Straûengraben. Die Prinzessinnen auf dem Rû¥cksitz sind hungrig. Nacht und Nebel brechen ein. Nirgends ist ein Hemd mit der richtigen Kragenweite aufzutreiben. Andreas Ammers dokumentarisches HûÑrspiel "The King is Gone" verbindet revolutionûÊre Praxis mit der Perspektive der Klatschpresse. Es schildert Weltgeschichte als Roadmovie. Und es klingt, als hûÊtten die beiden Brû¥der Acher von The Notwist, um die Flucht des bayerischen KûÑnigs zu vertonen, eine All-Star-Blaskapelle um sich geschart ... was dann ã so wie alles in diesem HûÑrstû¥ck ã komisch klingen kann, aber in Gestalt der ãHochzeitskapelleã Tatsache ist. Noch einmal Marx: ãWarum dieser Gang der Geschichte? Damit die Menschheit heiter von ihrer Vergangenheit scheide.ã | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 09.10.2015
Datum: 09.10.2015Länge: 00:56:47 Größe: 51.99 MB |
||
| Mira Alexandra Schnoor: Empfindsame Reise zu Tristram Shandy und seinem SchûÑpfer Laurence Sterne. Eine AnnûÊherung in fû¥nfzehn Kapiteln - 04.10.2015 | ||
| Realisation: Mira Alexandra Schnoor / BR 2015 // Seinen ersten Roman schrieb er in einem Alter, in dem, so Virginia Woolf, andere bereits ihren zwanzigsten verfasst hatten. Als 1759 die ersten BûÊnde von Leben und Ansichten von Tristram Shandy, Gentleman erschienen, war der Autor Laurence Sterne in der literarischen Welt vûÑllig unbekannt. Der 1713 in Clonmel in Irland geborene Sterne hatte seit 1738 eine Pfarrstelle in Yorkshire inne. Er war verheiratet, Vater einer Tochter und fû¥hrte ein û¥berschaubares Leben in der englischen Provinz. Und dann, mit 46 Jahren, verûÑffentlichte der Landpfarrer die ersten BûÊnde eines Romans, der nichts Geringeres war als eine literarische Sensation, nicht nur in England, auch auf dem Kontinent, vor allem in Deutschland. Viele der wichtigsten Schriftsteller seiner Zeit gehûÑrten zu seinen Bewunderern: Lessing und Wieland, Diderot und Goethe, spûÊter Jean Paul, James Joyce, Virginia Woolf, Arno Schmidt und viele mehr. Sterne hatte einen Bestseller geschrieben, was aus vielerlei Hinsicht bemerkenswert ist: Er hatte als Schriftsteller noch keine Erfahrung und machte sich gleich mit seinem Erstling an ein neun BûÊnde und nahezu 800 Seiten umfassendes Werk. Ein ãwork in progressã, an dem er û¥ber acht Jahre hinweg weiterschrieb. Der Philosoph Friedrich Nietzsche, auch er ein groûer Verehrer, nannte Sterne den ãfreiesten Schriftsteller aller Zeitenã. Frei war er, weil er sich an keine Regel, keine Konvention der Romanliteratur hielt. Sei es die Chronologie einer Geschichte, die LinearitûÊt einer Handlung, die graphische Gestaltung des gedruckten Buches, die Verwendung von Satzzeichen, die ûkonomie des Aufbaus, egal welchen Aspekt der Romanschriftstellerei man herausgreift, Sterne brach die Regeln und schuf sich sein ganz eigenes System. Das war eine recht groûe Herausforderung an sein Publikum. Viele folgten ihm bereitwillig und mit groûem Genuss, andere verweigerten sich. Weshalb Sterne in einem Brief ironisch-verzweifelt ausrief: ãEs ist eine schwere Aufgabe, Bû¥cher zu schreiben und (dann) KûÑpfe zu finden, die sie verstehen.ã Sein zweites bekanntes Werk war die Empfindsame Reise durch Frankreich und Italien. Auch hier schrieb er sich die Regeln fû¥r einen Reisebericht selbst. Die Empfindsamkeit im Titel gab einer literarischen Epoche den Namen. Sternes Leben war an ûÊuûeren Ereignissen nicht gerade reich, es fand mehr in seinem Inneren, seiner Phantasie statt. Geschuldet war das auch der Tuberkulose, unter der er viele Jahre litt und an der er 1768 in London starb. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 04.10.2015
Datum: 04.10.2015Länge: 00:49:00 Größe: 44.86 MB |
||
| Elfriede Jelinek: Das schweigende MûÊdchen (4/4) - 02.10.2015 | ||
| Mit Brigitte Hobmeier, Stefan Hunstein, Jonas Minthe, Wolfgang Pregler, Johannes Silberschneider, Edmund TelgenkûÊmper, Stefan Wilkening, Elfriede Jelinek / Komposition: zeitblom / Regie: Leonhard Koppelmann / BR 2015 / LûÊnge: 83'31 // Im Anfang war das Wort. Zumindest im Anfang der christlichen Heilsgeschichte wie sie vom Evangelisten Johannes û¥berliefert ist. Das Gegenteil davon, nûÊmlich das Schweigen, steht bei Elfriede Jelinek im Anfang einer pervertierten Heilsgeschichte. Was nicht heiût, dass die Autorin nicht doch beim Wort, bei der Sprache und vielfach Geschriebenem ankommen wû¥rde. Seit dem 6. Mai 2013 lûÊuft in Mû¥nchen der sogenannte NSU-Prozess, einer der wichtigsten Gerichtsprozesse der deutschen Nachkriegsgeschichte. Dabei geht es um zehn û¥berwiegend rassistisch motivierte Morde und zwei SprengstoffanschlûÊge, die der rechtsextremen Terrorgruppe "Nationalsozialistischer Untergrund" zugeschrieben werden. Mehr als zwûÑlf Jahre konnte die Gruppe demnach diese Verbrechen relativ unbehelligt von zustûÊndigen Ermittlern und BehûÑrden ausfû¥hren. Vor dem Oberlandesgericht in Mû¥nchen steht die mutmaûlich letzte ûberlebende dieser Gruppe, Beate ZschûÊpe, und schweigt. Diejenige, die demzufolge detailliert û¥ber die Verbrechen der Gruppe sprechen kûÑnnte, verweigert sich, bleibt stumm. Gegen dieses Schweigen setzt Jelinek das Sprechen. Stimmen der Anklage, der Befragung und AbwûÊgung genauso wie Stimmen der VerdrûÊngung, der BeschûÑnigung und ûberhûÑhung. Auf der Grundlage von Prozessprotokollen, Ermittlungsakten, Medienberichten, mythologischen und religiûÑsen Motiven entfaltet Jelinek ein Jû¥ngstes Gericht, in dem sich Perspektiven û¥berlagern, die Geschichte der Zwickauer Zelle zur ErzûÊhlung û¥ber zwei tote ErlûÑser und die sie gebûÊrende schweigende Jungfrau und zur Antithese der biblischen Heilsgeschichte wird. Ein Tribunal gegen das Schweigen, das Nicht-Wissen, das Wegschauen, das sich zugleich selbst entlarvt als verstrickt in dieses Nicht-Wissen und Wegschauen. Zu Wort kommen ein vielstimmiges Volk, verkû¥ndende Engel, unwissende Propheten, ein fragender Richter, der Menschensohn, die Jungfrau Maria und Gott hûÑchst selbst. Dazwischen auch die Stimme der Autorin, die anklagt, spricht und schreibt, aber "die Wahrheit schon gar nicht". Allesamt treten sie vor, um eine Geschichte zu befragen, in der sich Nicht-Wissen und Wissen-Wollen unheilvoll verschrûÊnken und deren Wurzeln weit ins Unbewusste der deutschen Seele hineinreichen. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 02.10.2015
Datum: 02.10.2015Länge: 01:24:28 Größe: 77.34 MB |
||
| Elfriede Jelinek: Das schweigende MûÊdchen (3/4) - 25.09.2015 | ||
| Mit Brigitte Hobmeier, Stefan Hunstein, Jonas Minthe, Wolfgang Pregler, Johannes Silberschneider, Edmund TelgenkûÊmper, Stefan Wilkening, Elfriede Jelinek / Komposition: zeitblom / Regie: Leonhard Koppelmann / BR 2015 / LûÊnge: 83'31 // Im Anfang war das Wort. Zumindest im Anfang der christlichen Heilsgeschichte wie sie vom Evangelisten Johannes û¥berliefert ist. Das Gegenteil davon, nûÊmlich das Schweigen, steht bei Elfriede Jelinek im Anfang einer pervertierten Heilsgeschichte. Was nicht heiût, dass die Autorin nicht doch beim Wort, bei der Sprache und vielfach Geschriebenem ankommen wû¥rde. Seit dem 6. Mai 2013 lûÊuft in Mû¥nchen der sogenannte NSU-Prozess, einer der wichtigsten Gerichtsprozesse der deutschen Nachkriegsgeschichte. Dabei geht es um zehn û¥berwiegend rassistisch motivierte Morde und zwei SprengstoffanschlûÊge, die der rechtsextremen Terrorgruppe "Nationalsozialistischer Untergrund" zugeschrieben werden. Mehr als zwûÑlf Jahre konnte die Gruppe demnach diese Verbrechen relativ unbehelligt von zustûÊndigen Ermittlern und BehûÑrden ausfû¥hren. Vor dem Oberlandesgericht in Mû¥nchen steht die mutmaûlich letzte ûberlebende dieser Gruppe, Beate ZschûÊpe, und schweigt. Diejenige, die demzufolge detailliert û¥ber die Verbrechen der Gruppe sprechen kûÑnnte, verweigert sich, bleibt stumm. Gegen dieses Schweigen setzt Jelinek das Sprechen. Stimmen der Anklage, der Befragung und AbwûÊgung genauso wie Stimmen der VerdrûÊngung, der BeschûÑnigung und ûberhûÑhung. Auf der Grundlage von Prozessprotokollen, Ermittlungsakten, Medienberichten, mythologischen und religiûÑsen Motiven entfaltet Jelinek ein Jû¥ngstes Gericht, in dem sich Perspektiven û¥berlagern, die Geschichte der Zwickauer Zelle zur ErzûÊhlung û¥ber zwei tote ErlûÑser und die sie gebûÊrende schweigende Jungfrau und zur Antithese der biblischen Heilsgeschichte wird. Ein Tribunal gegen das Schweigen, das Nicht-Wissen, das Wegschauen, das sich zugleich selbst entlarvt als verstrickt in dieses Nicht-Wissen und Wegschauen. Zu Wort kommen ein vielstimmiges Volk, verkû¥ndende Engel, unwissende Propheten, ein fragender Richter, der Menschensohn, die Jungfrau Maria und Gott hûÑchst selbst. Dazwischen auch die Stimme der Autorin, die anklagt, spricht und schreibt, aber "die Wahrheit schon gar nicht". Allesamt treten sie vor, um eine Geschichte zu befragen, in der sich Nicht-Wissen und Wissen-Wollen unheilvoll verschrûÊnken und deren Wurzeln weit ins Unbewusste der deutschen Seele hineinreichen. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 25.09.2015
Datum: 25.09.2015Länge: 01:23:37 Größe: 76.56 MB |
||
| Elfriede Jelinek: Das schweigende MûÊdchen (2/4) - 18.09.2015 | ||
| Mit Brigitte Hobmeier, Stefan Hunstein, Jonas Minthe, Wolfgang Pregler, Johannes Silberschneider, Edmund TelgenkûÊmper, Stefan Wilkening, Elfriede Jelinek / Komposition: zeitblom / Regie: Leonhard Koppelmann / BR 2015 / LûÊnge: 83'51 // Im Anfang war das Wort. Zumindest im Anfang der christlichen Heilsgeschichte wie sie vom Evangelisten Johannes û¥berliefert ist. Das Gegenteil davon, nûÊmlich das Schweigen, steht bei Elfriede Jelinek im Anfang einer pervertierten Heilsgeschichte. Was nicht heiût, dass die Autorin nicht doch beim Wort, bei der Sprache und vielfach Geschriebenem ankommen wû¥rde. Seit dem 6. Mai 2013 lûÊuft in Mû¥nchen der sogenannte NSU-Prozess, einer der wichtigsten Gerichtsprozesse der deutschen Nachkriegsgeschichte. Dabei geht es um zehn û¥berwiegend rassistisch motivierte Morde und zwei SprengstoffanschlûÊge, die der rechtsextremen Terrorgruppe "Nationalsozialistischer Untergrund" zugeschrieben werden. Mehr als zwûÑlf Jahre konnte die Gruppe demnach diese Verbrechen relativ unbehelligt von zustûÊndigen Ermittlern und BehûÑrden ausfû¥hren. Vor dem Oberlandesgericht in Mû¥nchen steht die mutmaûlich letzte ûberlebende dieser Gruppe, Beate ZschûÊpe, und schweigt. Diejenige, die demzufolge detailliert û¥ber die Verbrechen der Gruppe sprechen kûÑnnte, verweigert sich, bleibt stumm. Gegen dieses Schweigen setzt Jelinek das Sprechen. Stimmen der Anklage, der Befragung und AbwûÊgung genauso wie Stimmen der VerdrûÊngung, der BeschûÑnigung und ûberhûÑhung. Auf der Grundlage von Prozessprotokollen, Ermittlungsakten, Medienberichten, mythologischen und religiûÑsen Motiven entfaltet Jelinek ein Jû¥ngstes Gericht, in dem sich Perspektiven û¥berlagern, die Geschichte der Zwickauer Zelle zur ErzûÊhlung û¥ber zwei tote ErlûÑser und die sie gebûÊrende schweigende Jungfrau und zur Antithese der biblischen Heilsgeschichte wird. Ein Tribunal gegen das Schweigen, das Nicht-Wissen, das Wegschauen, das sich zugleich selbst entlarvt als verstrickt in dieses Nicht-Wissen und Wegschauen. Zu Wort kommen ein vielstimmiges Volk, verkû¥ndende Engel, unwissende Propheten, ein fragender Richter, der Menschensohn, die Jungfrau Maria und Gott hûÑchst selbst. Dazwischen auch die Stimme der Autorin, die anklagt, spricht und schreibt, aber "die Wahrheit schon gar nicht". Allesamt treten sie vor, um eine Geschichte zu befragen, in der sich Nicht-Wissen und Wissen-Wollen unheilvoll verschrûÊnken und deren Wurzeln weit ins Unbewusste der deutschen Seele hineinreichen. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 18.09.2015
Datum: 18.09.2015Länge: 01:23:58 Größe: 76.87 MB |
||
| Robert Hû¥ltner: Menetekel - 16.09.2015 | ||
| Mit Brigitte Hobmeier, Florian Karlheim, Robert Giggenbach, Michael A. Grimm, Ercan Karacayli, Richard Oehmann, Alexander Duda, Susanne Schroeder, Stephan Zinner, Walter Schuster, Sebastian Weber, Karolina Horster, Gerhard Wittmann, Peter Albers, Ivone Eveline Punuh, Joschka Walser, Michael Schernthaner, Christian Jungwirth, Marcus Huber, Thomas Darchinger / Komposition: zeitblom / Regie: Ulrich Lampen / BR 2015 / LûÊnge: 47'17 // Es scheint nicht gerade das Verbrechen des Jahrhunderts zu sein, mit dessen AufklûÊrung sich die Beamten der Polizeiinspektion von Bruck am Inn befassen mû¥ssen: Die Gartenmauer von Fleischfabrikant Vogt wurde wiederholt mit wû¥sten Beleidigungen beschmiert, der GeschûÊdigte besteht energisch darauf, dass der oder die TûÊter zur Rechenschaft gezogen werden. Senta und Rudi tappen zunûÊchst im Dunkeln. Sie werden jedoch hellhûÑrig, als sie zufûÊllig Zeugen davon werden, dass einer jungen Asiatin die Zwangsabschiebung droht, die mit ihrem Sohn in Bruck am Inn lebt und als gut integriert gilt. Denn bei der um ihre Aufenthaltserlaubnis kûÊmpfenden Kadija handelt es sich um die Ex-Gattin des Fabrikanten. Liegt hier das Motiv fû¥r die nûÊchtlichen Schmier-Attacken? WûÊhrend Senta und Rudi nach ZusammenhûÊngen suchen, spitzt sich in Bruck der Konflikt zwischen einem Beamten der AuslûÊnderbehûÑrde und der zunehmend verzweifelten Kadija zu. Als die Zwangsausweisung durchgefû¥hrt werden soll, kommt es zum Eklat: Kadija und ihr Sohn haben sich in ihrer Wohnung verschanzt, eine Verzweiflungstat Kadijas kann nicht ausgeschlossen werden. Vor ihrem Haus demonstriert eine Gruppe empûÑrter Bû¥rger fû¥r ihr Bleiberecht. Senta und Rudi werden zur VerstûÊrkung gerufen, da schlûÊgt der û¥bereifrige Beamte des AuslûÊnderamts Alarm und behauptet, man habe einen Mordanschlag auf ihn verû¥bt. Ein schwer bewaffnetes Sonderkommando rû¥ckt an und beginnt mit den Vorbereitungen zur Stû¥rmung der Wohnung. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 16.09.2015
Datum: 16.09.2015Länge: 00:47:23 Größe: 43.39 MB |
||
| Elfriede Jelinek: Das schweigende MûÊdchen (1/4) - 11.09.2015 | ||
| Mit Brigitte Hobmeier, Stefan Hunstein, Jonas Minthe, Wolfgang Pregler, Johannes Silberschneider, Edmund TelgenkûÊmper, Stefan Wilkening, Elfriede Jelinek / Komposition: zeitblom / Regie: Leonhard Koppelmann / BR 2015 / LûÊnge: 84'30 // Im Anfang war das Wort. Zumindest im Anfang der christlichen Heilsgeschichte wie sie vom Evangelisten Johannes û¥berliefert ist. Das Gegenteil davon, nûÊmlich das Schweigen, steht bei Elfriede Jelinek im Anfang einer pervertierten Heilsgeschichte. Was nicht heiût, dass die Autorin nicht doch beim Wort, bei der Sprache und vielfach Geschriebenem ankommen wû¥rde. Seit dem 6. Mai 2013 lûÊuft in Mû¥nchen der sogenannte NSU-Prozess, einer der wichtigsten Gerichtsprozesse der deutschen Nachkriegsgeschichte. Dabei geht es um zehn û¥berwiegend rassistisch motivierte Morde und zwei SprengstoffanschlûÊge, die der rechtsextremen Terrorgruppe "Nationalsozialistischer Untergrund" zugeschrieben werden. Mehr als zwûÑlf Jahre konnte die Gruppe demnach diese Verbrechen relativ unbehelligt von zustûÊndigen Ermittlern und BehûÑrden ausfû¥hren. Vor dem Oberlandesgericht in Mû¥nchen steht die mutmaûlich letzte ûberlebende dieser Gruppe, Beate ZschûÊpe, und schweigt. Diejenige, die demzufolge detailliert û¥ber die Verbrechen der Gruppe sprechen kûÑnnte, verweigert sich, bleibt stumm. Gegen dieses Schweigen setzt Jelinek das Sprechen. Stimmen der Anklage, der Befragung und AbwûÊgung genauso wie Stimmen der VerdrûÊngung, der BeschûÑnigung und ûberhûÑhung. Auf der Grundlage von Prozessprotokollen, Ermittlungsakten, Medienberichten, mythologischen und religiûÑsen Motiven entfaltet Jelinek ein Jû¥ngstes Gericht, in dem sich Perspektiven û¥berlagern, die Geschichte der Zwickauer Zelle zur ErzûÊhlung û¥ber zwei tote ErlûÑser und die sie gebûÊrende schweigende Jungfrau und zur Antithese der biblischen Heilsgeschichte wird. Ein Tribunal gegen das Schweigen, das Nicht-Wissen, das Wegschauen, das sich zugleich selbst entlarvt als verstrickt in dieses Nicht-Wissen und Wegschauen. Zu Wort kommen ein vielstimmiges Volk, verkû¥ndende Engel, unwissende Propheten, ein fragender Richter, der Menschensohn, die Jungfrau Maria und Gott hûÑchst selbst. Dazwischen auch die Stimme der Autorin, die anklagt, spricht und schreibt, aber "die Wahrheit schon gar nicht". Allesamt treten sie vor, um eine Geschichte zu befragen, in der sich Nicht-Wissen und Wissen-Wollen unheilvoll verschrûÊnken und deren Wurzeln weit ins Unbewusste der deutschen Seele hineinreichen. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 11.09.2015
Datum: 11.09.2015Länge: 01:24:36 Größe: 77.47 MB |
||
| Herbert Kapfer: Die Welt als Format der Fortschreibung - Eran Schaerfs FM-Scenario - 04.09.2015 | ||
| Mit Katja Bû¥rkle, Thomas Loibl, Peter Veit / Aufnahmeleitung: Stephanie Metzger / BR 2015 / LûÊnge: 16'11 | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 04.09.2015
Datum: 04.09.2015Länge: 00:16:16 Größe: 14.91 MB |
||
| Eran Schaerf: Doppelbesetzung - 04.09.2015 | ||
| Mit Peter Veit, Franziska Ball, Pauline Boudry, Achim Bogdahn, Marina Marosch, Tim Gerrit Koehler / Zusammenstellung aus Modulen des Online-Studios fm-scenarion.net: Joerg Franzbecker und Eran Schaerf / Doppelbesetzung wurde von Joerg Franzbecker und Eran Schaerf zusammengestellt und besteht aus Modulen aus dem Audio-Archiv des Online-Studios fm-scenario.net. Das HûÑrspiel bildet den Ausgangspunkt fû¥r Eran Schaerfs Ausstellung "Eran Schaerf - and Charlotte Perriand brought a new object to the office every morning" m ûˋtablissement d'en face projects, Brû¥ssel (4. September-11. Oktober 2015). Die Stimme des HûÑrers ist ein Sender fû¥r HûÑrer*innenanrufe, der von einem Software-Programm betrieben wird. In seinem Online-Studio bietet der Sender HûÑrer*innen an, Geschichten aus ihrem Alltag auf Sendung wiederaufzufû¥hren. Dieses Angebot wird von den HûÑrer*innen unterschiedlich aufgenommen ã als die MûÑglichkeit, eine versûÊumte Sendung nachzuholen, sich auf eine Zeitreise zu begeben oder der Zeit ganz und gar zu entfliehen. Eine der HûÑrerinnen verspricht sich von diesem Angebot die Gelegenheit, ihre Geschichte hinter sich zu lassen. Wie jedes Softwareprogramm meldet sich Die Stimme des HûÑrers, sobald Anwendungen Risiken enthalten. ãWenn Sie ihre Geschichte verlassen, kûÑnnen bei der Aufnahme Fehler auftreten [...] Fehler 567: Doppelbesetzung. Sie sind diejenige, die berichtet, und diejenige, von der berichtet wirdã. Auf Sendung erfûÊhrt die wiederauffû¥hrende HûÑrerin, dass sie ihre Geschichte nur verlassen kann, um in einer anderen zu sein. Sie wird doppelt besetzt ã von ihrer alten und von ihrer neuen Geschichte. Doppelbesetzung erzûÊhlt von dieser Begegnung des menschlichen GedûÊchtnisses mit dem Cyberradio als Auffû¥hrungsort. FM-Scenario/Die Stimme des HûÑrers ist ein intermediales Projekt, das sich û¥ber Website, Sendungen, Ausstellungen und Publikationen realisiert. Eine Kooperation von: BR HûÑrspiel und Medienkunst; A Production e. V., Berlin; Hartware MedienKunstVerein, Dortmund; Haus der Kulturen der Welt, Berlin; Les Complices*, Zû¥rich; Museum fû¥r Konkrete Kunst, Ingolstadt; Zentrum fû¥r Kunst und Medientechnologie, Karlsruhe und ûˋtablissement dãen face projects, Brû¥ssel. GefûÑrdert durch die Kulturstiftung des Bundes. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 04.09.2015
Datum: 04.09.2015Länge: 00:53:03 Größe: 48.58 MB |
||
| Sigrid Hauff: Die innere Biografie des Robert Lax (3/3): Journals - 28.08.2015 | ||
| Mit Rainer Buck, Robert Lax / Regie: Herbert Kapfer/ BR 1995 / LûÊnge: 64'03 // "Journals" nennt Sigrid Hauff den dritten Teil der 'inneren Biografie'. Aus dem Leben der modernen Groûstadt zieht sich Lax auf eine griechische Insel zurû¥ck. Dort findet er die Ruhe und Besinnung, die ein meditatives Leben ermûÑglicht. Die Tagebû¥cher (Journals) beschreiben den Weg hin zu dem, was Lax geworden ist: ein weiser alter Mann, der jedem noch so banalen Alltagsgeschehen eine zeitlose und in ihrer Einfachheit faszinierende Poesie abgewinnt. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 28.08.2015
Datum: 28.08.2015Länge: 01:04:10 Größe: 58.75 MB |
||
| Sigrid Hauff: Die innere Biografie des Robert Lax (2/3): 21 Pages - 21.08.2015 | ||
|
Mit Rainer Buck, Robert Lax / Regie: Herbert Kapfer / BR 1995 / LûÊnge: 52'57 // ûuûere Schritte und innere in Einklang zu bringen, ist ein ungeheurer Anspruch: Robert Lax studiert Vorbilder und macht Versuche, in einer immer noch als bedrohlich empfundenen Welt Fuû zu fassen. Als Redakteur beim New Yorker, als Filmkritiker bei der Times, als Dozent an UniversitûÊten, als Rundfunkmitarbeiter, als Drehbuchautor in Hollywood. Eine poetische Biografie entsteht: "21 pages". Robert Lax verûÑffentlichte gezielt fast ausschlieûlich in Klein- und Kleinstverlagen: In seinen Gedichten, Episoden, Fabeln und Zeichnungen streift unsere Zeit ihre Hektik, Sinnverwirrung und Sinnleere ab. In dem Lax "einfache Dinge ganz einfach sagt", ûÑffnet er den Blick fû¥r BestûÊndiges und sinnenhaft Sinnvolles, lûÑst er Wahrheit aus ihrer zeitlichen Verkleidung und entdeckt Zeitloses: die hinter der Reizû¥berflutung verborgene Harmonie von Leben, das sich selbst in Frage stellt. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 21.08.2015
Datum: 21.08.2015Länge: 00:53:03 Größe: 48.58 MB |
||
| Sigrid Hauff: Die innere Biografie des Robert Lax (1/3): Circus - 14.08.2015 | ||
| Mit Rainer Buck, Robert Lax / Regie: Herbert Kapfer / BR 1995 / 58'33 // Sigrid Hauffs dreiteilige Sendung zeichnet eine "innere Biografie" auf, die die geistige Entwicklung des Dichters und Philosophen Robert Lax parallel zu ûÊuûeren OrtsverûÊnderungen dokumentiert. 1. Teil: "Circus". Auf der Suche nach einem Zugang zur Welt, hilflos û¥berfordert vom New York der Nachkriegsjahre, entdeckt Robert Lax im Zirkus eine beispielhafte und û¥berschaubare Welt, die ihm erstmals einen eigenen akzeptablen Platz zuweist. Den Zirkus und die Lebensphilosophie der Artisten und Jongleure û¥bertrûÊgt er auf den Lauf der Dinge, die Welt und die Rolle des Menschen. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 14.08.2015
Datum: 14.08.2015Länge: 00:58:40 Größe: 53.71 MB |
||
| Walter Serner: Die Tigerin - 08.08.2015 | ||
| Mit Anne Ratte-Polle, Jan Uplegger, Dorothee Metz, Martin Engler, Severin von Hoensbroech, Leopold von Verschuer / Komposition: Bo Wiget / Bearbeitung und Regie: Leopold von Verschuer / BR 2015 / LûÊnge: 89'57 // Paris, Nizza 1920. Der Hochstapler Henri Rilcer, genannt Fec, ist am Ende. Die Begegnung mit der Edelprostituierten Bichette, genannt "die Tigerin", stachelt ihn ein letztes Mal auf. Sie schlieûen einen Pakt, um sich als Paar neu zu erfinden. ãWir machen uns!ã ã Einzige Bedingung ihrer Allianz: sie soll ohne Liebe sein. Bichette fungiert als Lockvogel, wûÊhrend Fec die Rolle des gehûÑrnten Liebhabers û¥bernimmt, um Bichettes Kunden zu erpressen. Doch ihrem VerhûÊngnis entgehen sie nicht: Die Gefû¥hle sind stûÊrker als alle VorsûÊtze. Denn obwohl Fec und Bichette die Liebe aus ihrer Beziehung verbannt haben, ist plûÑtzlich echte Eifersucht im Spiel, wird aus dem Spiel Ernst. Fec beginnt Bichette zu umgarnen, und Bichette erliegt Fec. Eine Amour fou. Walter Serner, Dadaist, Essayist, Bohemien, rastloser Reisender, hat seine ErzûÊhlungen auf der Grenze von Eros, KûÊlte und Verbrechen situiert. Seine Texte wirken illusionslos, lapidar, kalt, seine Figuren bevûÑlkern die unwirtliche Halbwelt der frû¥hen Moderne. Es sind kleine Schurken und billige Schlampen, RaubmûÑrder und anûÊmische Morphinistinnen, immer auf der Suche nach einem Aufriss. Sie sprechen ein Kauderwelsch aus Deutsch und Argot, dem Pariser Ganovenjargon des Milieus, der die gesprochene Sprache gleichermaûen bereichert und reduziert. Kommunikation wird zur Losung, zur Parole. Erschienen 1925, sollte der Roman Die Tigerin 1931 in die ãListe der Schund- und Schmutzschriftenã aufgenommen werden. Nur ein Gutachten von Alfred DûÑblin verhinderte, dass das Buch der Zensur zum Opfer fiel. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 08.08.2015
Datum: 08.08.2015Länge: 01:30:03 Größe: 82.44 MB |
||
| Bernd Grashoff: Memoiren eines Butlers - Ein Rondo fû¥r Brandy, Gangster und Gespenster - 05.08.2015 | ||
| Mit Theo Lingen, Peter Pasetti, Gustav Knuth, Martin Benrath, Hanne Wieder, Norbert Kappen, Hans Clarin, Heini GûÑbel, Anton Reimer / Regie: Heinz-Gû¥nter Stamm / BR 1963 / LûÊnge: 57'25 // Lord Benmore, der letzte Erbe eines berû¥hmten schottischen Geschlechts, das sich seit Jahrhunderten nur durch Whiskybrennerei û¥ber Wasser hûÊlt, kehrt nach einer Reise zum Kontinent in das Schloss seiner VûÊter zurû¥ck. Sein Butler Limerick erkennt sofort, dass der Lord geknickt ist. Benmore bekennt seinem Diener: Er ist ruiniert. Er hat in Monte Carlo nûÊmlich nicht nur die Mitgift seiner Braut, sondern auch die zwûÑlf Millionen Dollar eines Chicagoer Gangsterbosses verspielt, die der ihm fû¥r die Whisky-Brennrechte gezahlt hat. Letzteres schockiert den traditionsbewussten Limerick besonders, zumal das GeschûÊft ohne sein Wissen geschehen ist. Benmore Castle ist zwar keine zwûÑlf Millionen Dollar wert, trotzdem muss der Lord das Schloss und seinen Butler an den Boss aus Chicago û¥bergeben. Schicksal und Zukunft des Schlosses sollen in Zukunft allein in Limericks HûÊnden liegen. Denn Lord Benmores Ehre verlangt es, sofort aus dem Leben zu scheiden. Da ihn das Knallen einer Pistole aber nervûÑs machen wû¥rde, empfiehlt Limerick einen diskreten Autounfall. Wenig spûÊter bemerkt auch der Herr aus Chicago, wie wertvoll Limericks RatschlûÊge sind. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 05.08.2015
Datum: 05.08.2015Länge: 00:57:31 Größe: 52.67 MB |
||
| Herbert Kapfer/Mira Alexandra Schnoor: kennen sie mich herren - Werkstattsendung zu Ernst Jandls "szenen aus dem wirklichen leben" - 02.08.2015 | ||
| Realisation: Herbert Kapfer/Mira Alexandra Schnoor / BR 1990 / LûÊnge: 25'03 // Die Werkstattsendung "kennen sie mich herren" dokumentiert die Regiearbeit und die Werkinterpretation des Autors Ernst Jandl und des Komponisten Ernst KûÑlz. In ausfû¥hrlichen RegiegesprûÊchen wûÊhrend der Produktion des HûÑrspiels "szenen aus dem wirklichen leben" hat Ernst Jandl seine Textmontage offengelegt und detailliert aufgeschlû¥sselt. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 02.08.2015
Datum: 02.08.2015Länge: 00:25:09 Größe: 23.03 MB |
||
| Michael Farin: Tanzt den Tanz der Krieger. Marinetti und der Futurismus - 24.07.2015 | ||
| Mit Katja Amberger, Martin Umbach, Michael Farin / Regie: Bernhard Jugel / BR 2002 / LûÊnge: 24'43 // Essay û¥ber Filippo Tommaso Marinetti und seinen Roman "Mafarka" Farin, Michael | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 24.07.2015
Datum: 24.07.2015Länge: 00:24:49 Größe: 22.72 MB |
||
| Hartmut Geerken: erwartet bobo sambo ein gerûÊusch? erwartet er eine stimme? - Ein HûÑrspiel fû¥r und mit Robert Lax - 17.07.2015 | ||
| Mit Robert Lax, Hartmut Geerken / Realisation: Hartmut Geerken / BR 1990 / LûÊnge: 57'10 // Robert Lax, ein groûer Unbekannter unter den zeitgenûÑssischen amerikanischen Dichtern, lebt seit fast 30 Jahren als Eremit auf einer griechischen Insel. ûber seine Begegnung mit Robert Lax schreibt Hartmut Geerken: "Ich traf ihn ãzufûÊlligã anfang 1982 in athen & seither verbinden uns sehr lange oder sehr kurze spaziergûÊnge, eine seltsame korrespondenz, geheimnisvolles gelûÊchter & vûÑllig abseitige musik aus indien, von den eskimos & der galaxis, manchmal verbeugen wir uns grundlos & hektisch voreinander, machen unvorhersehbare knickse & wenn wir zusammen durch athen, zû¥rich, mû¥nchen & die senne oder am ammersee entlanggehen, kûÑnnte so mancher, der uns sieht, meinen, hinter unseren schritten stû¥nde eine ausgeklû¥gelte choreografie, unsere abstrusen dialoge, unsere ausgedehnte korrespondenz (lax unterschreibt seine briefe & karten mit bobo & sambo & bertolucci & zabagwa & wabamba & albobo & wagwagwa), unsere vokalen grimassen & unsere vom sinn entleerten gesprûÊche û¥ber buddha & kant wûÊhrend unseres gemeinsamen gehens, nicht zuletzt bobos stille meditative dichtungen dringen in ãbobo samboã dem hûÑrer ins ohr. aber das hûÑrspiel ist kein portrûÊt des dichters robert lax, nicht einmal ein flû¥chtiges & der radikalen bescheidenheit des poeten bobo entsprechend kûÑnnte man am ende die frage aufwerfen: gibt es robert lax û¥berhaupt?" | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 17.07.2015
Datum: 17.07.2015Länge: 00:57:49 Größe: 52.95 MB |
||
| Dietmar Dath: Largoschmerzen. Ein sozialmedizinisches Desaster - 12.07.2015 | ||
|
Mit Bettina Lieder, Matthias Haase, Johanna Gastdorf, Mark Oliver BûÑgel, Sebastian Graf / Komposition: zeitblom / Regie: Leonhard Koppelmann / BR 2014 / LûÊnge: 51'01 // Die musikalische Vortragsbezeichnung "Largo" beschreibt laut Lexikoneintrag ein langsames musikalisches Tempo. Im Grunde nur eine geringe Modifikation des mittleren Zeitmaûes - so zumindest in der Musik des 17. und 18. Jahrhunderts - erweist sich das "Largo" in der Fiktion von Dietmar Daths neuem HûÑrspiel als umso folgenreicher. Denn Esther leidet an "Largoschmerzen". Immer wenn sie sich mit Kunst, Literatur oder Musik beschûÊftigt, die ihrem Eindruck nach zu langsam funktioniert, bekommt sie Schweiûausbrû¥che, ûbelkeit, gefriert ihr scheinbar das Blut in den Adern. ããÎso ein breites, sich kaum merklich voran wûÊlzendes Ding, wie Lava, wie die Platten der Erdkruste, noch langsamer als Adagio oder Lento, und das nannte man Largo, und das eben ruft bei mir diese Symptome hervor, diese ganzen AngstanfûÊlle und ûbelkeiten, das rasende Kopfweh bei bestimmten Sachen.ã Holger, Esthers Freund und Dozent fû¥r eine OnlineuniversitûÊt, sieht darin eher die Folgen eines zu ausgiebigen Konsums von Fernsehserien, Comics und Techno und rûÊt ihr, sich ganz bewusst dem langsamen Tempo anspruchsvoller Kunst auszusetzen. Statt diesen Rat zu befolgen, beginnt Esther eine Therapie bei Dr. Nina Milikan, die selbst an einer hypochondrischen StûÑrung leidet, sich diese aber zu Nutze gemacht hat. Dr. Milikan verschreibt Akzeptanz und Hineingehen in die vermeintliche Krankheit. Esther liest oder hûÑrt deshalb Romane, Gedichte, Musik einfach parallel, erhûÑht das Tempo und ist damit glû¥cklich. Im Gegensatz dazu hat Milikans Kollege, der Notarzt Dr. Dietze fû¥r seine Patienten ein anderes Mittel. Er macht sie abhûÊngig von der Droge Redonil. Damit ist einem alles egal, sogar wenn man keinen Nachschub der Droge mehr hat. So unterschiedlich diese AnsûÊtze sind, beide medizinischen Methoden erzeugen am Ende eine unvorhersehbare ûberraschung.
Mit Witz und subversiven Attacken auf Gesundheitssystem, Schulmedizin und die Trennung von U- und E-Kultur zeichnet Dath in Largoschmerzen ein aus konventioneller Perspektive betrachtet ãsozialmedizinisches Desasterã. Vor allem aber ein vom Realistischen ins Phantastische kippendes Szenario û¥ber Menschen, die in der Gesellschaft nicht funktionieren und dies als Alternative oder Subversion von bestehenden VerhûÊltnissen befûÑrdern. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 12.07.2015
Datum: 12.07.2015Länge: 00:51:08 Größe: 46.82 MB |
||
| Werner Penzel/Ikue Mori/Fred Frith: Zen ist die grûÑûte Lû¥ge aller Zeiten - 03.07.2015 | ||
| Zitate von Kodo Sawaki aus dem Japanischen von Muho NûÑlke / Mit Andrea HûÑrnke-Trieû / Originalton-Aufnahmen: Ayako Mogi / Komposition: Ikue Mori, Fred Frith / Realisation: Werner Penzel / BR 2015 / LûÊnge: 51'22 // Der rechte Fuû auf den linken Oberschenkel, die WirbelsûÊule ganz senkrecht, die Augen nur einen Spalt geûÑffnet - fû¥r einen AnfûÊnger ist es schwer, die Haltung der Zazen-Sitzmeditation lûÊngere Zeit durchzuhalten, ohne sich zu bewegen oder in Gedanken abzuschweifen. Im japanischen Zen Kloster Antai-ji, nûÑrdlich von Kobe auf einem schwer zugûÊnglichen Hochplateau gelegen, gehûÑrt diese ûbung neben gemeinschaftlichen Ritualen und der Arbeit zum festen Tagesablauf. Antai-ji ist ã anders als viele Zen-KlûÑster ã fû¥r MûÊnner und Frauen offen. Es gibt WLAN auf dem GelûÊnde und der derzeitige Abt Muho NûÑlke stammt ursprû¥nglich aus Berlin. Das Kloster Antai-ji wurde stark von dem Zen Meister Kodo Sawaki (1880ã1965) geprûÊgt. Nur wenige der zahlreichen Bû¥cher von Sawaki wurden in westliche Sprachen û¥bersetzt, darunter eine Anthologie mit dem Titel Zen ist die grûÑûte Lû¥ge aller Zeiten, die 2005 im Angkor Verlag erschien. ãZen bringt uns û¥berhaupt nichtsã, sagt Sawaki. ãEs gibt Leute, die betreiben Zen als Fortbildung. Das ist bloû Schminke. Zen ist keine Fortbildungsanstalt. Zen schmeichelt dir nicht, es putzt dich aber auch nicht runter. Zen bedeutet Geradeaus-Weitergehen. Was auch immer du gerade denkst, schon istãs wieder vorbei.ã Der Filmemacher Werner Penzel verbrachte mehrere lûÊngere Aufenthalte in Antai-ji und lieû seine Erfahrungen und BeschûÊftigung mit Kodo Sawaki schlieûlich in ein HûÑrstû¥ck und in ein Filmprojekt mû¥nden. Er nûÊhert sich diesem Ort gemeinsam mit den Musikern Fred Frith und Ikue Mori in freien Improvisationen, die ã wie bei der Sitzmeditation Zazen ã nur gelingen, wenn man beim Spielen stets aufmerksam bleibt und sich dem Risiko des Moments û¥berlûÊsst. Neben den teils lakonischen Texten des Zen Meisters Kodo Sawaki sind es vor allem die Tonaufnahmen aus Antai-ji, die ein Wechselspiel zwischen den verdichteten GerûÊuschfeldern Ikue Moris und dem behutsam aushorchenden Gitarrenspiel Fred Friths in Gang setzen. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 03.07.2015
Datum: 03.07.2015Länge: 00:51:31 Größe: 47.17 MB |
||
| Rolf Dieter Brinkmann: Longkamp - Erkundung fû¥r die PrûÊzisierung des Gefû¥hls fû¥r einen Aufstand: TrûÊume / AufstûÊnde / Gewalt / Morde / Reise / Zeit / Magazin (Tagebuch) - 26.06.2015 | ||
| Mit Christian Brû¥ckner / Bearbeitung und Regie: Ulrich Gerhardt / BR 2008 LûÊnge: 80'13 // Briefe, Notizen, Landkarten, aus denen ein Monolog entsteht - û¥ber die Frage, "wie jemand heute da raus kommt". Als Rolf Dieter Brinkmann Ende November 1972 fû¥r einige Wochen nach Longkamp, ein Dorf im Hunsrû¥ck, zieht, ist seine Flucht aus dem LûÊrm der Stadt zugleich ein Abschied vom Glauben an die Rebellion, an Pop und Untergrund. Auf der Suche nach einem ruhigen Ort fû¥r sich und nach dem Leben, das bisher immer woanders ist, zieht er in die alte Mû¥hle. In der Kû¥che, dem einzigen beheizbaren Raum, schlûÊft und schreibt er: Aufstehen um 10 nach 7, Dauerlauf, Bronchialtee, dann bei Kerzenlicht Tippen auf der Schreibmaschine. Er hûÑrt auf zu rauchen und nimmt ab, aber seine Verunsicherung und der Druck, der auf dem Schreiben lastet, bleiben. Die entstehenden Texte sind angefû¥llt mit Reflexionen û¥ber die Vergangenheit, û¥ber seine Beziehung, û¥ber KûÑln, die Menschen dort ã und vor allem û¥ber die eigenen Voreingenommenheiten, sein verkrampftes Verhalten, das Gefû¥hl, eingesperrt zu sein, sich nicht mehr entspannen zu kûÑnnen: ãIch bin nicht da, wo ich bin!ã Dem ãGrauen vor dem Muff der Dingeã setzt Brinkmann Konzentration als Methode der Selbstbefreiung entgegen: Fakten statt Bedeutungen, Tun statt Dahocken. In der Montage von Ulrich Gerhardt, der seit den 1970er Jahren mehrere HûÑrspieltexte von Rolf Dieter Brinkmann inszenierte und bearbeitete, zeigen sich die Longkamper Aufzeichnungen als fortgesetzte Arbeit an einer Sprache, die durch ihre Klarheit, SchûÊrfe und Genauigkeit befreien soll. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 26.06.2015
Datum: 26.06.2015Länge: 01:20:20 Größe: 73.55 MB |
||
| Gisela von Wysocki: Ich nehme ein Blau. Ich nehme ein Gelb. Akustisches Szenario û¥ber Charlotte Salomon - 20.06.2015 | ||
|
Mit Karin Anselm, Tanja Schleiff, Lorenz Meyboden, Christiane Roûbach, Manfred Zapatka, Peter Lersch, Helga Fellerer / Gesang: Barbara Mû¥ller, FlûÑte: Jana Boskovi?, Cello: Johanna Varner, Baritonsaxophon: Thomas Zoller / Komposition: Helga Pogatschar / Regie: Bernhard Jugel / BR 2003 / LûÊnge: 61'07 // Charlotte Salomon - 1917 in Berlin geboren, 1939 nach Sû¥dfrankreich emigriert, 1943 in Auschwitz ermordet - hat ein auûergewûÑhnliches Werk hinterlassen. In nur zwei Jahren ihres Lebens entstand der Zyklus "Leben? oder Theater?". Etwa 1300 Gouachen und TextblûÊtter konnte Charlotte Salomon vor ihrer Deportation noch an einen Freund û¥bergeben: Scharfsichtige, unsentimentale Darstellungen einer jû¥dischen Frau im Exil - Bilder und Texte, in denen biographische und fiktive Elemente, Kunst und Literatur, Film und Musik spielerisch miteinander verwoben sind. "Die Entstehung der vorliegenden BlûÊtter ist sich folgendermaûen vorzustellen: Der Mensch sitzt am Meer. Er malt. Eine Melodie kommt ihm plûÑtzlich in den Sinn. Indem er sie zu summen beginnt, bemerkt er, dass die Melodie genau auf das, was er zu Papier bringen will, passt." (Charlotte Salomon)
Gisela von Wysocki hat sich dem ãdreifarben Singespielã, den hunderten in die Malereien eingearbeiteten Dialogen, ûberschriften, ErzûÊhltexten angenommen und eine poetische AnnûÊherung an Charlotte Salomon gesucht. Sie stellt Fragen an die Entstehung dieses Werkes, sucht die familiûÊren und politischen Wurzeln zu dechiffrieren, aus dem der groûangelegte Zyklus hervorgegangen ist. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 20.06.2015
Datum: 20.06.2015Länge: 01:01:10 Größe: 56.01 MB |
||
| Thomas Meinecke/Move D: On the map - 12.06.2015 | ||
|
Text und Musik: Thomas Meinecke/Move D / Realisation: Thomas Meinecke/Move D / BR 2015 / LûÊnge: 53'58 // Sonisches Ermessen. Anhand diverser Ortschaften setzen sich der Schriftsteller/Musiker Thomas Meinecke und der Musiker/Produzent David Moufang in "On the map" mit Ballungen sowie Verschiebungen, auch dem Verschwinden kultureller und politischer Bedeutungen auseinander. Verschnitten mit Versatzstû¥cken gefundener Oral History, im O-Ton wie auch in sprecherischer Interpretation, zieht sich ein musikalisches Geflecht durch die einzelnen Stû¥cke, das diese Bewegungen sonisch erkennbar machen wird. Beispielsweise:
Der in beiden Weltkriegen von deutschen U-Booten verminte Kriegshafen von Norfolk, Virginia, als die schwarz-atlantische Wiege des technoiden Cyber R&B (Teddy Riley, Timbaland, Missy Elliott, The Neptunes). Die antike Bibliothek von Alexandria/The Library of Congress, Washington. D. C. Die Rekonstruktion ûgyptens in The Heliocentric Worlds of Sun Ra. Washingtons Our Lady of Perpetual Helpãs Panorama Room als BrutstûÊtte der afroamerikanischen Go-Go Music. Auch: Die Verlegung des Regierungssitzes von Philadelphia nach Washington. Das Comiskey Park Stadion in Chicago als StûÊtte der legendûÊren Disco Demolition Night 1979, in der sich homophobe Rock-Musik gegen sexuell andersdenkende Tanz-Subkulturen durchsetzte, die aber dann im Underground ganz neue Blû¥ten hervortrieben. St. Louis, Missouri ã vom syncopated Ragtime- und Blues-Komponisten W.C. Handy û¥ber Chuck Berrys hypnotische Riffs bis zu Miles Davis und seinen ozeanisch flieûenden Jazz-Entwû¥rfen. Dislozierte Musik nach der Abschaffung der Sklaverei. Oder: Minneapolis, Minnesota, ã Bob Dylans Studentenbude/Princes Paisley Park Studio. Auch: Die nûÊchtlich û¥ber den Clubs von Baltimore in der Luft stehenden Hubschrauber der Kriminalpolizei. Wie in dem Stadtteil Watts (Los Angeles) um den griechischen Gemischtwarenladen der Eltern von Johnny Otis ein schwarzes Ghetto heranwuchs, woraufhin sich Otis zu einem Afroamerikaner wandelte. Andere historische StûÊdte bzw. Zentren wie Aachen, Turin oder St. Petersburg liegen bei dieser Produktion ebenso auf der anvisierten Landkarte. Die Arbeit soll prozessual vor sich gehen, die Aneignung von Wissen sich im musikalischen Fortgang produktiv niederschlagen. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 12.06.2015
Datum: 12.06.2015Länge: 00:54:00 Größe: 49.44 MB |
||
| Felix Kubin: Orphûˋe Mûˋcanique - 05.06.2015 | ||
|
Mit Lars Rudolph, Gerhard Garbers, Yvon Jansen, Charlotte Crome, Traugott Buhre, Marlen Diekhoff / Chor: Yvon Jansen, Leûˋna Fahje, Nikola Duric / Orchester: ensemble Intûˋgrales / Komposition und Realisation: Felix Kubin / BR 2006/2012 / LûÊnge: 50'54 // Orpheus, Sohn eines Erfinders und einer SûÊngerin, wird von der versprengten Jugend fû¥r seine exzentrischen Konzerte gefeiert. Sein Instrument, das Psykotron, kann GedankenstrûÑme unmittelbar in elektronische Signale aus Musik, GerûÊuschen und Sprache verwandeln. Zusammen mit seiner groûen Liebe Eura fû¥hrt Orpheus ein unbekû¥mmertes Dandy-Dasein, bis eines Tages die Stadt von einer unheimlichen Krankheit heimgesucht wird, der auch Eura zum Opfer fûÊllt. BetûÊubt vom Schmerz beschlieût Orpheus, sie aus der Welt der Toten zurû¥ckzuholen. Felix Kubin entwickelte 2006 seine Neufassung des antiken Orpheus-Mythosã in Anlehnung an Dino Buzzatis ungewûÑhnlichen Pop-Art-Comic Orphi und Eura, mit dem der italienische Autor und Zeichner 1968 kurz vor seinem Tod ein û¥berraschend modernes SpûÊtwerk geschaffen hatte. Orpheusã Lieder wurden in diesem akustischen Comic zu hûÑrbar gemachten Erinnerungen, die den Begriff des Songs û¥ber seine traditionellen Grenzen hinaus ins Experimentelle und Fragmentarische erweitern. 2012 hat Kubin sich noch einmal mit der Formfrage auseinandergesetzt und aus dem handlungsorientierten Comic einen assoziativen akustischen Film gemacht. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 05.06.2015
Datum: 05.06.2015Länge: 00:51:00 Größe: 46.70 MB |
||
| Die Quellen sprechen. Teil 12: West- und Nordeuropa Juli 1942-1945 - 30.05.2015 | ||
|
Mit Wiebke Puls, Matthias Brandt, Charlotte Knobloch, Assia Gorban, Alfred Grosser, Jaqueline van Maarsen, Jules Schelvis, Mirjam Bolle, Berthold Winter / Bearbeitet von Barbara Lambauer/Katja Happe/Clemens Maier-Wolthausen, Maja Peers / Skript HûÑredition: Stephanie Metzger / Regie: Ulrich Lampen / BR HûÑrspiel und Medienkunst in Zusammenarbeit mit dem Institut fû¥r Zeitgeschichte/Edition 'Judenverfolgung 1933 - 1945ã, 2015 / LûÊnge: 111'39 // Die Quellen sprechen. Die Verfolgung und Ermordung der europûÊischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933-1945. Eine dokumentarische HûÑredition. Teil 12 der HûÑredition dokumentiert die Situation der Juden in Nord- und Westeuropa vom Sommer 1942 bis zur Befreiung durch die Alliierten. Die Quellen veranschaulichen die behûÑrdliche Festlegung von Deportationsquoten, Strategien der Verantwortlichen zu deren Einhaltung und zur Zusammenarbeit mit den einheimischen Regierungen und Exekutivorganen. In den Dokumenten der jû¥dischen Opfer vermitteln sich physische und psychische Belastungen durch die Angst vor der Abholung, willkû¥rliche Formen der Freistellung und deren Aufhebung, durch den Zwang ins Versteck und die Deportation. Die Quellen berichten von der Situation in den Lagern und in den Deportationszû¥gen, von (tûÑdlichen) Fluchtversuchen aus den Zû¥gen sowie von alltûÊglichem und organisiertem Widerstand. Das auf der Wannseekonferenz am 20. Januar 1942 explizit formulierte Ziel der Deutschen, die ãEndlûÑsung der Judenfrageã, beinhaltete auch die Deportation und Ermordung aller Juden in den westeuropûÊischen LûÊndern. Mit enormer Energie wurde es in den besetzten Gebieten verfolgt und in erschreckendem Ausmaû realisiert. Der Anteil der Deportierten und Ermordeten unter den Juden in den jeweiligen LûÊndern war sehr unterschiedlich. WûÊhrend in den Niederlanden mehr als 75 Prozent der Juden ums Leben kamen, waren es etwa 50 Prozent in Norwegen, 45 Prozent in Belgien, 34 Prozent in Luxemburg, 25 Prozent in Frankreich. In DûÊnemark kamen zwei Prozent der Juden ums Leben, vielen gelang von DûÊnemark aus die Flucht nach Schweden.
Nachdem sich ab Sommer 1942 die Verfolgung der Juden in Form von Aufforderungen zum Arbeitsdienst, Massenverhaftungen und Abtransporten in Durchgangslager vor Ort und in den Osten verschûÊrft hatte, erreichten die Deportationen mit Beginn des Jahres 1943 ihren HûÑhepunkt. Nun waren es nicht mehr allein staatenlose und auslûÊndische Juden, sondern auch einheimische Juden, die deportiert wurden. Vornehmliches Ziel der deutschen BehûÑrden war es, die Deportationsquoten, die von Adolf Eichmann und dem AuswûÊrtigen Amt in Berlin im Juni 1942 vorgegeben wurden, einzuhalten. Die Ausweitung der Verfolgung auf alle Juden, fû¥r die es jetzt ums nackte ûberleben ging, verstûÊrkte den Widerstand der einheimischen BevûÑlkerung und je nach Struktur und Organisation auch innerhalb der Kollaborationsregierungen. Unter dem Eindruck von Massenfestnahmen und der Deportation jû¥discher Kinder wechselte etwa die Vichy-Regierung in der unbesetzten franzûÑsischen Sû¥dzone von einer Politik der verhandelnden Kollaboration zu einer reservierten Haltung gegenû¥ber den Deutschen. Diejenigen Juden, die sich vor den Deportationen retten konnten, mussten untertauchen oder versuchten weiterhin die Flucht. Diverse Hilfsorganisationen und die Exilregierungen bemû¥hten sich darum, fû¥r die Flû¥chtlinge Hilfe und Asyl im Ausland sicher zu stellen. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 30.05.2015
Datum: 30.05.2015Länge: 01:51:46 Größe: 102.33 MB |
||
| Anne Chaplet: Nichts als die Wahrheit (2/2) - 25.05.2015 | ||
| Mit Gert Heidenreich, Krista Posch, Stephan Bissmeier, Axel Milberg, Ernst Jacobi, Eva Gosciejewicz, Christiane Roûbach, Franziska Ball, Michael Tregor, Oliver Stritzel, Christoph Lindert, Kai Taschner, Heiko Ruprecht, Tim Seyfi, Stephan Zinner, Kornelia Boje, Marion Breckwoldt, Michael Habeck, Jochen Nix, Paul Herwig, Jochen Noch, Martin Butzke, Rudolf Kowalski, Gesche Piening, Nicholas Reinke u.a. / Komposition: Pierre Oser / Bearbeitung und Regie: Walter Adler / BR 2005 / LûÊnge: 54' // Anne Buraus Rû¥ckkehr in die groûe Politik vollzieht sich unschûÑn und rûÊtselhaft. Warum ist Alexander Bunge, fû¥r den Anne Burau als "Nachrû¥ckerin" in den Bundestag einzieht, vom Turm der Frankfurter Nikolaikirche gefallen? Ist er gesprungen oder hat ihn jemand gestoûen? Was hat der Journalist Peter Zettel, ein alter Bekannter von Anne Burau, vom Berliner "Journal" mit der Sache zu tun? Im "Journal" hatte wenige Wochen zuvor jener Artikel gestanden, der Bunge als PûÊderasten outete. ãGrund genugã fû¥r die Frankfurter StaatsanwûÊltin Karen Stark, die an einen Selbstmord glaubt. Nicht fû¥r ihren jungen Kollegen Wenzel, der Bunge mehr als nur freundschaftlich verbunden war. Auch in der "Journalã-Redaktion in Berlin herrscht helle Aufregung. Wer hat den Bunge-Artikel recherchiert? Stimmen die Fakten? Woher kam der Tipp? Viele Fragen, auf die der junge Journalist Hansi Becker heimlich eine Antwort sucht. Antworten sucht auch Anne Burau. Warum nur wird sie von der SekretûÊrin bis zum Fraktionschef gehasst? Wo ist Peter Zettel? Liegt die Antwort vielleicht in Bunges Aufgabenbereich, den jetzt sie verwalten soll? Bunge war Vorsitzender der Baukommission des ûltestenrates im Bundestag gewesen, und damit zustûÊndig fû¥r sûÊmtliche Bauten des Bundes in Berlin. Eine mûÊchtige Position und wer mûÊchtig ist, hat auch viele Feinde. Oder liegt die Antwort auf Annes Fragen in der Vergangenheit, die sich hinter meterdickem Beton unter dem neuen und alten Regierungsviertel ausbreitet? | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 25.05.2015
Datum: 25.05.2015Länge: 00:53:34 Größe: 49.04 MB |
||
| Anne Chaplet: Nichts als die Wahrheit (1/2) - 24.05.2015 | ||
|
Mit Gert Heidenreich, Krista Posch, Stephan Bissmeier, Axel Milberg, Ernst Jacobi, Eva Gosciejewicz, Christiane Roûbach, Franziska Ball, Michael Tregor, Oliver Stritzel, Christoph Lindert, Kai Taschner, Heiko Ruprecht, Tim Seyfi, Stephan Zinner, Kornelia Boje, Marion Breckwoldt, Michael Habeck, Jochen Nix, Paul Herwig, Jochen Noch, Martin Butzke, Rudolf Kowalski, Gesche Piening, Nicholas Reinke u.a. / Komposition: Pierre Oser / Bearbeitung und Regie: Walter Adler / BR 2005 / LûÊnge: 54' // Anne Buraus Rû¥ckkehr in die groûe Politik vollzieht sich unschûÑn und rûÊtselhaft. Warum ist Alexander Bunge, fû¥r den Anne Burau als "Nachrû¥ckerin" in den Bundestag einzieht, vom Turm der Frankfurter Nikolaikirche gefallen? Ist er gesprungen oder hat ihn jemand gestoûen? Was hat der Journalist Peter Zettel, ein alter Bekannter von Anne Burau, vom Berliner "Journal" mit der Sache zu tun? Im "Journal" hatte wenige Wochen zuvor jener Artikel gestanden, der Bunge als PûÊderasten outete. ãGrund genugã fû¥r die Frankfurter StaatsanwûÊltin Karen Stark, die an einen Selbstmord glaubt. Nicht fû¥r ihren jungen Kollegen Wenzel, der Bunge mehr als nur freundschaftlich verbunden war. Auch in der "Journalã-Redaktion in Berlin herrscht helle Aufregung. Wer hat den Bunge-Artikel recherchiert? Stimmen die Fakten? Woher kam der Tipp? Viele Fragen, auf die der junge Journalist Hansi Becker heimlich eine Antwort sucht. Antworten sucht auch Anne Burau. Warum nur wird sie von der SekretûÊrin bis zum Fraktionschef gehasst? Wo ist Peter Zettel? Liegt die Antwort vielleicht in Bunges Aufgabenbereich, den jetzt sie verwalten soll? Bunge war Vorsitzender der Baukommission des ûltestenrates im Bundestag gewesen, und damit zustûÊndig fû¥r sûÊmtliche Bauten des Bundes in Berlin. Eine mûÊchtige Position und wer mûÊchtig ist, hat auch viele Feinde. Oder liegt die Antwort auf Annes Fragen in der Vergangenheit, die sich hinter meterdickem Beton unter dem neuen und alten Regierungsviertel ausbreitet? |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 24.05.2015
Datum: 24.05.2015Länge: 00:54:06 Größe: 49.54 MB |
||
| Die Quellen sprechen. Teil 9: Polen: Generalgouvernement August 1941-1945 - 23.05.2015 | ||
| Mit Wiebke Puls, Matthias Brandt, Helene Habermann, Pavel Kohn, Zelig Rosenblum, Margit Siebner, Henry Rotmensch / Bearbeitet von Klaus-Peter Friedrich / Skript HûÑredition: Angelika KûÑnigseder / Regie: Ulrich Lampen / BR HûÑrspiel und Medienkunst in Zusammenarbeit mit dem Institut fû¥r Zeitgeschichte/Edition 'Judenverfolgung 1933 - 1945ã, 2015 / LûÊnge: 112'03 // Die Quellen sprechen. Die Verfolgung und Ermordung der europûÊischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933-1945. Eine dokumentarische HûÑredition. Im Oktober 1939 war Polen zwischen Deutschland und der Sowjetunion aufgeteilt worden. Die westlichen Provinzen wurden dem Deutschen Reich zugeschlagen. Das restliche deutsch besetzte Areal wurde zum Generalgouvernement erklûÊrt. Mit dem Angriff auf die Sowjetunion im Juni 1941 erweiterte sich das Gebiet des Generalgouvernements noch einmal und es wurde zentraler Tatort des Holocaust. Hier lebten etwa 2,3 Millionen Juden, die seit Kriegsbeginn von den Deutschen sehr rasch entrechtet, enteignet und weitgehend isoliert wurden. Obwohl die Massenmorde in Polen spûÊter einsetzten als etwa im Gebiet der Sowjetunion, ging hier die deutsche Verwaltung gegen die Juden besonders erbarmungslos vor, im Vergleich auch erheblich gewalttûÊtiger als beispielsweise gegen die Juden im besetzten Mittel- und Westeuropa. Bereits von Oktober 1939 an waren Gettos eingerichtet worden. Sie waren schnell û¥berfû¥llt, die Bewohner litten unter Hunger, KûÊlte, Gewalt und fehlender medizinischer Versorgung. Schon hier begann das Massensterben. Die Jû¥dischen RûÊte sowie soziale Selbsthilfe und private Initiativen versuchten das Leiden in den Gettos zu mindern, meist vergeblich. Die von den Besatzern selbst geschaffenen katastrophalen ZustûÊnde in den Gettos, vor allem die Seuchengefahr, wurden zum Argument fû¥r weitere, massivere Maûnahmen. Als den BesatzungsfunktionûÊren im Generalgouvernement zudem klar wurde, dass eine Deportation der Juden aus dem eigenen Herrschaftsgebiet in die besetzten sowjetischen Gebiete nicht mûÑglich sein wû¥rde, und auûerdem Judentransporte aus dem Deutschen Reich und den westlichen Besatzungsgebieten einsetzten, wurden unter dem Titel ãAktion Reinhardã stationûÊre Vernichtungslager errichtet. Ab MûÊrz 1942 wurden in den Lagern von Belzec, Sobibor und Treblinka, spûÊter auch Auschwitz, Juden vergast. Zwischen Juli und September 1942 erreichten die Massenmorde ihren HûÑhepunkt. Im Juli 1943 galt die ãEndlûÑsungã im Generalgouvernement aus Sicht der deutschen BehûÑrden als weitgehend abgeschlossen, was letzte Ermordungen ûberlebender kurz vor dem Einmarsch der Roten Armee nicht verhinderte. In den Gaskammern der Vernichtungslager wurden bis Herbst 1943 fast sûÊmtliche Bewohner der Gettos im Generalgouvernement sowie abertausende Juden aus dem û¥brigen Europa ermordet. Fast zwei Millionen Menschen fielen in diesem Zeitraum dem Holocaust zum Opfer. Teil 9 der HûÑredition dokumentiert das AbwûÊgen der Deutschen zwischen Ausbeutung der Juden als ArbeitskrûÊfte und ihrer Ermordung und die Mithilfe einheimischer Instanzen. In den Quellen vermitteln sich die unmenschlichen ZustûÊnde in den Gettos und die allmûÊhliche Erkenntnis der Juden und der nichtjû¥dischen Beobachter û¥ber Art und Ausmaû der Vernichtung. Die Texte dokumentieren Gewaltszenarien bei der AuflûÑsung von Gettos oder bei dortigen AufstûÊnden und enthalten Berichte und Beobachtungen aus den Vernichtungslagern. Im Appell der polnischen Exilregierung an die Alliierten oder in der Selbstmordbegrû¥ndung eines jû¥dischen Delegierten der polnischen Exilregierung manifestiert sich der Vorwurf internationaler Tatenlosigkeit gegenû¥ber dem Massenmord an den Juden. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 23.05.2015
Datum: 23.05.2015Länge: 01:52:10 Größe: 102.69 MB |
||
| Elfriede Jelinek: WirtschaftskomûÑdie. Aber sicher! 2. Akt (fû¥r Rosa Luxemburg) Aber sicher! Nachtrag. Warnung an Griechenland vor der Freiheit - 17.05.2015 | ||
| Mit Robert DûÑlle, Bettina Engelhardt, Hans Kremer, Wolfgang Pregler, Wiebke Puls, GûÑtz Schulte, Johannes Silberschneider, Michael Tregor / Regie: Leonhard Koppelmann / BR/DKultur 2015 / LûÊnge: 53'41 // Das VerhûÊltnis ihrer Texte zur Wirklichkeit sei ein kontinuierliches aber undurchschaubares, ûÊuûerte Elfriede Jelinek in einem Interview. Die Wirklichkeit sei ein Tier, das immer neben dem Geschriebenen her laufe, es beiûen oder sich von ihm streicheln lassen kûÑnne. Was davon eintritt, ist nicht planbar. Mit "Die Kontrakte des Kaufmanns" von 2009 lûÊsst sich die Autorin besonders intensiv auf dieses VerhûÊltnis ein, indem sie das Stû¥ck zur Wirtschaftskrise fortschreibt. Noch 2009 entsteht "Schlechte Nachrede: Und jetzt?" als Epilog zu "Die Kontrakte des Kaufmanns". Das dreiaktige Stû¥ck "Aber sicher!" aus dem gleichen Jahr ist eine Fortsetzung. Schlieûlich bezeichnet Jelinek 2014 den bislang nicht aufgefû¥hrten Text "Warnung an Griechenland vor der Freiheit" als Zusatz zu "Die Kontrakte des Kaufmanns". In all diesen Texten zur ûÑkonomischen Krise, die Jelinek im HûÑrspielprojekt unter dem Titel "WirtschaftskomûÑdie" zusammenfasst, manifestiert sich ihr system- und sprachkritisches Anschreiben gegen den Kapitalismus. Die Stû¥cke enthû¥llen die Krise einer Gesellschaft, die sich in ein System von Gier, Geld und Schuld verstrickt hat und dies nicht sehen will. Ausgangspunkt von "Die Kontrakte des Kaufmanns" bilden die Skandale um die ûÑsterreichische Meinl Bank und die ûÑsterreichische Gewerkschaftsbank BAWAG. 2007 verlieren Kleinanleger durch fragwû¥rdige FinanzgeschûÊfte dieser Banken einen groûen Teil ihres VermûÑgens. So konkret diese VorgûÊnge in Jelineks Stû¥ck hinein spielen, wie etwa auch der Fall eines ûÑsterreichischen Familienvaters, der wegen seiner massiven Verschuldung fû¥nf Familienmitglieder erschlug, so chiffriert und û¥berformt werden sie zugleich im literarischen und sprachlichen Verfahren der Autorin. "WirtschaftskomûÑdie" entlarvt die Mechanismen der Gier, der Gewinnorientierung und der Verblendung, in die sich Kleinanleger genauso verstricken wie Banker. Es verdeutlicht den virtuelle Charakter des Marktes, in dem WertschûÑpfung und der Ursprung von Reichtum oder ProduktivitûÊt von Arbeit relativ werden und das Sprechen darû¥ber hohl. Zudem vermittelt sich die quasireligiûÑse Aufladung ûÑkonomischer ZusammenhûÊnge, die nicht mehr hinterfragt, geschweige denn durchdrungen werden. Dabei erweisen sich die fû¥r Jelineks Schreiben typischen Sprachspiele als wiederholende Praxis dessen, was in der Wirtschaft passiert, nûÊmlich als SchûÑpfungsakte aus dem Nichts: ãNur die Sprache, das verlogenste und gleichzeitig unbestechlichste Mittel im menschlichen Zahlungsverkehr (und sie kostet nichts! Wir alle haben sie!) kann das irgendwie fassen und darstellen, weil sie diese Differenz zwischen Wirklichkeit und Wirklichkeit û¥berspringen kann, also letztlich das Nichts, denn wir sind alle Spielmaterial, Jetons, die aber niemand einwechseln will. Auch die Autorin fûÊllt jedes Mal wieder auf sie rein, sie hat einen Vertrag mit der Sprache abgeschlossen, weiû aber nicht mehr, was sie da û¥berhaupt unterschrieben hat.ã (Elfriede Jelinek) | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 17.05.2015
Datum: 17.05.2015Länge: 00:53:48 Größe: 49.26 MB |
||
| Die Quellen sprechen. Teil 7: Sowjetunion mit annektierten Gebieten I - 16.05.2015 | ||
| Mit Wiebke Puls, Matthias Brandt, Stefan Hajdu, Jorge Hacker, Anna Kelen, Trude Simonsohn, Ina Iske, Ruth Meros, Paul Niedermann / / Bearbeitet von Bert Hoppe und Hildrun Glass / Skript HûÑredition: Michael Farin / Regie: Ulrich Lampen / BR HûÑrspiel und Medienkunst in Zusammenarbeit mit dem Institut fû¥r Zeitgeschichte/Edition 'Judenverfolgung 1933 - 1945ã, 2015 / LûÊnge: 113'13 // Die Quellen sprechen. Die Verfolgung und Ermordung der europûÊischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933-1945. Eine dokumentarische HûÑredition. Teil 7 der HûÑredition dokumentiert, wie die deutsche Fû¥hrung die Massenverbrechen vorbereitete und wie die Juden entrechtet, ausgebeutet und vielerorts sofort ermordet wurden. Die Quellen berichten von jû¥dischen Fluchtversuchen, von Misshandlungen und Erschieûungen bei Razzien, die mit einer universalen Beraubung der Juden einhergingen. Sie vermitteln die relative PassivitûÊt der auslûÊndischen Beobachter und enthalten Berichte û¥ber die katastrophalen ZustûÊnde in den Gettos, hilflose Aufrufe zum Widerstand und Berichte von Beobachtern und ûberlebenden der Massenerschieûungen. Mit dem deutschen ûberfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 begann der grûÑûte Vernichtungskrieg der Neuzeit. Der ûberfall markierte auch den entscheidenden Wendepunkt in der Verfolgung der europûÊischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland. Bereits Monate bevor sie die ersten Vernichtungslager in Betrieb nahmen, lûÑschten die Deutschen in Weiûrussland, Russland, der Ukraine und im Baltikum Hunderte jû¥dische Gemeinden aus. In den ersten sechs bis zehn Wochen des Feldzugs initiierten Mordkommandos zunûÊchst Pogrome ûÑrtlicher Milizen und erschossen gleichzeitig immer weiter gefasste Gruppen jû¥discher MûÊnner im wehrfûÊhigen Alter. In einer zweiten Phase, die im August 1941 einsetzte, fingen die Deutschen an, bei groûen Massenerschieûungen auch jû¥dische Frauen und Kinder zu ermorden. Innerhalb weniger Wochen nach dem deutschen Einmarsch weiteten damit die Einheiten der SS, der Polizei sowie der deutschen und der rumûÊnischen Armee den antijû¥dischen Terror zu einem systematischen VûÑlkermord aus. Die diffusen Anweisungen aus Berlin wurden von Hitlers Gefolgsleuten und von den Kommandofû¥hrern mit einem beachtlichen Maû an Eigeninitiative interpretiert und ausgefû¥hrt. Zudem beseitigte die deutsche Fû¥hrung alle Schranken, die das Kriegsrecht Soldaten auferlegte. Als die Mordeinheiten immer grûÑûere Gruppen umzubringen hatten, entwickelten sich die Massaker zu Szenen unvorstellbar brutaler und chaotischer Grausamkeit. Die einsetzenden Deportationen deutscher, ûÑsterreichischer und tschechischer Juden in den Osten beschleunigte ab Sommer 1942 nochmals die AuflûÑsung der Gettos und die Massenexekutionen. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 16.05.2015
Datum: 16.05.2015Länge: 01:53:19 Größe: 103.76 MB |
||
| Elfriede Jelinek: WirtschaftskomûÑdie Aber sicher! (Eine Fortsetzung) - 10.05.2015 | ||
| Mit Nico Holonics, Bernd Kuschmann / Regie: Leonhard Koppelmann / BR/DKultur 2015 / LûÊnge: 53ã41 // Das VerhûÊltnis ihrer Texte zur Wirklichkeit sei ein kontinuierliches aber undurchschaubares, ûÊuûerte Elfriede Jelinek in einem Interview. Die Wirklichkeit sei ein Tier, das immer neben dem Geschriebenen her laufe, es beiûen oder sich von ihm streicheln lassen kûÑnne. Was davon eintritt, ist nicht planbar. Mit "Die Kontrakte des Kaufmanns" von 2009 lûÊsst sich die Autorin besonders intensiv auf dieses VerhûÊltnis ein, indem sie das Stû¥ck zur Wirtschaftskrise fortschreibt. Noch 2009 entsteht "Schlechte Nachrede: Und jetzt?" als Epilog zu "Die Kontrakte des Kaufmanns". Das dreiaktige Stû¥ck "Aber sicher!" aus dem gleichen Jahr ist eine Fortsetzung. Schlieûlich bezeichnet Jelinek 2014 den bislang nicht aufgefû¥hrten Text "Warnung an Griechenland vor der Freiheit" als Zusatz zu "Die Kontrakte des Kaufmanns". In all diesen Texten zur ûÑkonomischen Krise, die Jelinek im HûÑrspielprojekt unter dem Titel "WirtschaftskomûÑdie" zusammenfasst, manifestiert sich ihr system- und sprachkritisches Anschreiben gegen den Kapitalismus. Die Stû¥cke enthû¥llen die Krise einer Gesellschaft, die sich in ein System von Gier, Geld und Schuld verstrickt hat und dies nicht sehen will. Ausgangspunkt von "Die Kontrakte des Kaufmanns" bilden die Skandale um die ûÑsterreichische Meinl Bank und die ûÑsterreichische Gewerkschaftsbank BAWAG. 2007 verlieren Kleinanleger durch fragwû¥rdige FinanzgeschûÊfte dieser Banken einen groûen Teil ihres VermûÑgens. So konkret diese VorgûÊnge in Jelineks Stû¥ck hinein spielen, wie etwa auch der Fall eines ûÑsterreichischen Familienvaters, der wegen seiner massiven Verschuldung fû¥nf Familienmitglieder erschlug, so chiffriert und û¥berformt werden sie zugleich im literarischen und sprachlichen Verfahren der Autorin. "WirtschaftskomûÑdie" entlarvt die Mechanismen der Gier, der Gewinnorientierung und der Verblendung, in die sich Kleinanleger genauso verstricken wie Banker. Es verdeutlicht den virtuelle Charakter des Marktes, in dem WertschûÑpfung und der Ursprung von Reichtum oder ProduktivitûÊt von Arbeit relativ werden und das Sprechen darû¥ber hohl. Zudem vermittelt sich die quasireligiûÑse Aufladung ûÑkonomischer ZusammenhûÊnge, die nicht mehr hinterfragt, geschweige denn durchdrungen werden. Dabei erweisen sich die fû¥r Jelineks Schreiben typischen Sprachspiele als wiederholende Praxis dessen, was in der Wirtschaft passiert, nûÊmlich als SchûÑpfungsakte aus dem Nichts: ãNur die Sprache, das verlogenste und gleichzeitig unbestechlichste Mittel im menschlichen Zahlungsverkehr (und sie kostet nichts! Wir alle haben sie!) kann das irgendwie fassen und darstellen, weil sie diese Differenz zwischen Wirklichkeit und Wirklichkeit û¥berspringen kann, also letztlich das Nichts, denn wir sind alle Spielmaterial, Jetons, die aber niemand einwechseln will. Auch die Autorin fûÊllt jedes Mal wieder auf sie rein, sie hat einen Vertrag mit der Sprache abgeschlossen, weiû aber nicht mehr, was sie da û¥berhaupt unterschrieben hat.ã (Elfriede Jelinek) | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 10.05.2015
Datum: 10.05.2015Länge: 00:53:07 Größe: 48.63 MB |
||
| Die Quellen sprechen. Teil 5: West- und Nordeuropa 1940-Juni 1942 - 09.05.2015 | ||
| Mit Wiebke Puls, Matthias Brandt, Wolfgang Nossen, Heinz HesdûÑrffer, Georg Heller, Szlomo Targownik, Ursula Mamlok, Kurt Salomon Maier, Peter Weitzner / Bearbeitet von Katja Happe, Michael Mayer, Maja Peers / Mitarbeit: Jean-Marc Dreyfus / Skript HûÑredition: Stephanie Metzger / Regie: Ulrich Lampen / BR HûÑrspiel und Medienkunst in Zusammenarbeit mit dem Institut fû¥r Zeitgeschichte/Edition 'Judenverfolgung 1933 - 1945ã, 2015 / LûÊnge: 112'02 // Die Quellen sprechen. Die Verfolgung und Ermordung der europûÊischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933-1945. Eine dokumentarische HûÑredition. Teil 5 der HûÑredition dokumentiert die Zeit in West- und Nordeuropa vom deutschen Einmarsch bis Mitte 1942. Neben den Akten zu den antijû¥dischen Maûnahmen der Besatzer und der Regierungen vermitteln Briefe und TagebucheintrûÊge die Belastungen der jû¥dischen Flû¥chtlinge, die Unsicherheit der einheimischen Juden û¥ber die PlûÊne der Besatzer und die Erschû¥tterung ihres SelbstverstûÊndnisses. Die Quellen berichten von den Versuchen Einzelner und jû¥discher Hilfsorganisationen, Emigration doch noch zu ermûÑglichen, und von Hunger und Verzweiflung in den Arbeitslagern. Sie dokumentieren das Dilemma der jû¥dischen Zwangsorganisationen, die Aufrufe zum Widerstand und zur internationalen Hilfeleistung. ãMit jedem Tage komme ich mir mehr wie eine Pflanze vor, welche aus dem Boden herausgeholt wurde und nun achtlos beiseite geworfen wird, um zu verdorren. Wir leben auf Abbruch. Nichts lûÊsst man uns mehr.ã Jenes ãLeben auf Abbruchã, das Felix Hermann Oestreicher in einem Brief an seine Kinder beschreibt, wurde mit dem Einmarsch der Deutschen Wehrmacht in die Staaten Nord- und Westeuropas im Mai 1940 fû¥r viele dorthin geflohene und einheimische Juden RealitûÊt. In den westeuropûÊischen LûÊndern, die vor der Besatzung Fluchtpunkt fû¥r eine groûe Anzahl jû¥discher Flû¥chtlinge geworden waren, zeigten sich die Deutschen zunûÊchst zurû¥ckhaltend. Je nach Organisation des Besatzungsregimes und Kooperation mit den einheimischen BehûÑrden wurden Strategien zwischen deutlicher Einflussnahme und Zurû¥ckhaltung gesucht, um Kollaborationsbereitschaft und wirtschaftliche Ressourcen zu sichern. Nach und nach und unterstû¥tzt von antisemitischen und nationalsozialistischen Gruppierungen der jeweiligen LûÊnder ergriffen die Besatzer aber auch in Norwegen, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und Frankreich die bereits im Deutschen Reich und in Polen angewandten Maûnahmen zur Entrechtung und Isolierung der Juden. Der behûÑrdlichen Erfassung und Registrierung von Juden folgten gesetzliche Diskriminierung und behûÑrdliche Schikane mit dem Ziel der Ausgrenzung sowie die systematische Enteignung jû¥dischen VermûÑgens und Besitzes. Die massiver werdende Verfolgung der jû¥dischen BevûÑlkerung stieû auf verschiedene WiderstûÊnde. Vertreter von Regierung und Wirtschaft, Kirchen, kommunistische Widerstandsgruppen und Teile der nicht jû¥dischen BevûÑlkerung protestierten, und nicht selten setzten die Widerstandsakte eine Spirale von erhûÑhter Repression und Gewalt durch die Besatzer in Gang. Auswanderungsverbote und der Transport von Juden in Internierungslager bereiteten schlieûlich die Deportationen in den Osten vor. 1942 waren die Juden in allen LûÊndern Westeuropas zum Tragen des ãJudensternsã verpflichtet. In Frankreich und Luxemburg hatten die Deportationen in die Gettos und Vernichtungslager bereits begonnen, in den anderen LûÊndern standen sie unmittelbar bevor. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 09.05.2015
Datum: 09.05.2015Länge: 01:52:08 Größe: 102.67 MB |
||
| Elfriede Jelinek: WirtschaftskomûÑdie. Die Kontrakte des Kaufmanns (4) Schlechte Nachrede: Und jetzt? - 03.05.2015 | ||
| Mit Martin Bross, Robert DûÑlle, Ekkehard Freye, Hans Kremer, Jonas Minthe, Wolfgang Pregler, Wiebke Puls, GûÑtz Schulte, Johannes Silberschneider, Elfriede Jelinek / Regie: Leonhard Koppelmann / BR/DKultur 2015 / LûÊnge: 53ã41 // Das VerhûÊltnis ihrer Texte zur Wirklichkeit sei ein kontinuierliches aber undurchschaubares, ûÊuûerte Elfriede Jelinek in einem Interview. Die Wirklichkeit sei ein Tier, das immer neben dem Geschriebenen her laufe, es beiûen oder sich von ihm streicheln lassen kûÑnne. Was davon eintritt, ist nicht planbar. Mit "Die Kontrakte des Kaufmanns" von 2009 lûÊsst sich die Autorin besonders intensiv auf dieses VerhûÊltnis ein, indem sie das Stû¥ck zur Wirtschaftskrise fortschreibt. Noch 2009 entsteht "Schlechte Nachrede: Und jetzt?" als Epilog zu "Die Kontrakte des Kaufmanns". Das dreiaktige Stû¥ck "Aber sicher!" aus dem gleichen Jahr ist eine Fortsetzung. Schlieûlich bezeichnet Jelinek 2014 den bislang nicht aufgefû¥hrten Text "Warnung an Griechenland vor der Freiheit" als Zusatz zu "Die Kontrakte des Kaufmanns". In all diesen Texten zur ûÑkonomischen Krise, die Jelinek im HûÑrspielprojekt unter dem Titel "WirtschaftskomûÑdie" zusammenfasst, manifestiert sich ihr system- und sprachkritisches Anschreiben gegen den Kapitalismus. Die Stû¥cke enthû¥llen die Krise einer Gesellschaft, die sich in ein System von Gier, Geld und Schuld verstrickt hat und dies nicht sehen will. Ausgangspunkt von "Die Kontrakte des Kaufmanns" bilden die Skandale um die ûÑsterreichische Meinl Bank und die ûÑsterreichische Gewerkschaftsbank BAWAG. 2007 verlieren Kleinanleger durch fragwû¥rdige FinanzgeschûÊfte dieser Banken einen groûen Teil ihres VermûÑgens. So konkret diese VorgûÊnge in Jelineks Stû¥ck hinein spielen, wie etwa auch der Fall eines ûÑsterreichischen Familienvaters, der wegen seiner massiven Verschuldung fû¥nf Familienmitglieder erschlug, so chiffriert und û¥berformt werden sie zugleich im literarischen und sprachlichen Verfahren der Autorin. "WirtschaftskomûÑdie" entlarvt die Mechanismen der Gier, der Gewinnorientierung und der Verblendung, in die sich Kleinanleger genauso verstricken wie Banker. Es verdeutlicht den virtuelle Charakter des Marktes, in dem WertschûÑpfung und der Ursprung von Reichtum oder ProduktivitûÊt von Arbeit relativ werden und das Sprechen darû¥ber hohl. Zudem vermittelt sich die quasireligiûÑse Aufladung ûÑkonomischer ZusammenhûÊnge, die nicht mehr hinterfragt, geschweige denn durchdrungen werden. Dabei erweisen sich die fû¥r Jelineks Schreiben typischen Sprachspiele als wiederholende Praxis dessen, was in der Wirtschaft passiert, nûÊmlich als SchûÑpfungsakte aus dem Nichts: ãNur die Sprache, das verlogenste und gleichzeitig unbestechlichste Mittel im menschlichen Zahlungsverkehr (und sie kostet nichts! Wir alle haben sie!) kann das irgendwie fassen und darstellen, weil sie diese Differenz zwischen Wirklichkeit und Wirklichkeit û¥berspringen kann, also letztlich das Nichts, denn wir sind alle Spielmaterial, Jetons, die aber niemand einwechseln will. Auch die Autorin fûÊllt jedes Mal wieder auf sie rein, sie hat einen Vertrag mit der Sprache abgeschlossen, weiû aber nicht mehr, was sie da û¥berhaupt unterschrieben hat.ã (Elfriede Jelinek) | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 03.05.2015
Datum: 03.05.2015Länge: 00:53:47 Größe: 49.25 MB |
||
| Elfriede Jelinek: WirtschaftskomûÑdie. Die Kontrakte des Kaufmanns (3) - 26.04.2015 | ||
| Mit Hans Kremer, Wolfgang Pregler, Wiebke Puls, GûÑtz Schulte, Johannes Silberschneider / Regie: Leonhard Koppelmann / BR/DKultur 2015 / LûÊnge: 53'21 // Das VerhûÊltnis ihrer Texte zur Wirklichkeit sei ein kontinuierliches aber undurchschaubares, ûÊuûerte Elfriede Jelinek in einem Interview. Die Wirklichkeit sei ein Tier, das immer neben dem Geschriebenen her laufe, es beiûen oder sich von ihm streicheln lassen kûÑnne. Was davon eintritt, ist nicht planbar. Mit "Die Kontrakte des Kaufmanns" von 2009 lûÊsst sich die Autorin besonders intensiv auf dieses VerhûÊltnis ein, indem sie das Stû¥ck zur Wirtschaftskrise fortschreibt. Noch 2009 entsteht "Schlechte Nachrede: Und jetzt?" als Epilog zu "Die Kontrakte des Kaufmanns". Das dreiaktige Stû¥ck "Aber sicher!" aus dem gleichen Jahr ist eine Fortsetzung. Schlieûlich bezeichnet Jelinek 2014 den bislang nicht aufgefû¥hrten Text "Warnung an Griechenland vor der Freiheit" als Zusatz zu "Die Kontrakte des Kaufmanns". In all diesen Texten zur ûÑkonomischen Krise, die Jelinek im HûÑrspielprojekt unter dem Titel "WirtschaftskomûÑdie" zusammenfasst, manifestiert sich ihr system- und sprachkritisches Anschreiben gegen den Kapitalismus. Die Stû¥cke enthû¥llen die Krise einer Gesellschaft, die sich in ein System von Gier, Geld und Schuld verstrickt hat und dies nicht sehen will. Ausgangspunkt von "Die Kontrakte des Kaufmanns" bilden die Skandale um die ûÑsterreichische Meinl Bank und die ûÑsterreichische Gewerkschaftsbank BAWAG. 2007 verlieren Kleinanleger durch fragwû¥rdige FinanzgeschûÊfte dieser Banken einen groûen Teil ihres VermûÑgens. So konkret diese VorgûÊnge in Jelineks Stû¥ck hinein spielen, wie etwa auch der Fall eines ûÑsterreichischen Familienvaters, der wegen seiner massiven Verschuldung fû¥nf Familienmitglieder erschlug, so chiffriert und û¥berformt werden sie zugleich im literarischen und sprachlichen Verfahren der Autorin. "WirtschaftskomûÑdie" entlarvt die Mechanismen der Gier, der Gewinnorientierung und der Verblendung, in die sich Kleinanleger genauso verstricken wie Banker. Es verdeutlicht den virtuelle Charakter des Marktes, in dem WertschûÑpfung und der Ursprung von Reichtum oder ProduktivitûÊt von Arbeit relativ werden und das Sprechen darû¥ber hohl. Zudem vermittelt sich die quasireligiûÑse Aufladung ûÑkonomischer ZusammenhûÊnge, die nicht mehr hinterfragt, geschweige denn durchdrungen werden. Dabei erweisen sich die fû¥r Jelineks Schreiben typischen Sprachspiele als wiederholende Praxis dessen, was in der Wirtschaft passiert, nûÊmlich als SchûÑpfungsakte aus dem Nichts: ãNur die Sprache, das verlogenste und gleichzeitig unbestechlichste Mittel im menschlichen Zahlungsverkehr (und sie kostet nichts! Wir alle haben sie!) kann das irgendwie fassen und darstellen, weil sie diese Differenz zwischen Wirklichkeit und Wirklichkeit û¥berspringen kann, also letztlich das Nichts, denn wir sind alle Spielmaterial, Jetons, die aber niemand einwechseln will. Auch die Autorin fûÊllt jedes Mal wieder auf sie rein, sie hat einen Vertrag mit der Sprache abgeschlossen, weiû aber nicht mehr, was sie da û¥berhaupt unterschrieben hat.ã (Elfriede Jelinek) | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 26.04.2015
Datum: 26.04.2015Länge: 00:53:30 Größe: 48.99 MB |
||
| Elfriede Jelinek: WirtschaftskomûÑdie. Die Kontrakte des Kaufmanns (2) - 19.04.2015 | ||
| Mit Hans Kremer, Wolfgang Pregler, Wiebke Puls, GûÑtz Schulte, Johannes Silberschneider / Regie: Leonhard Koppelmann / BR/DKultur 2015 / LûÊnge: 53'21 // Das VerhûÊltnis ihrer Texte zur Wirklichkeit sei ein kontinuierliches aber undurchschaubares, ûÊuûerte Elfriede Jelinek in einem Interview. Die Wirklichkeit sei ein Tier, das immer neben dem Geschriebenen her laufe, es beiûen oder sich von ihm streicheln lassen kûÑnne. Was davon eintritt, ist nicht planbar. Mit "Die Kontrakte des Kaufmanns" von 2009 lûÊsst sich die Autorin besonders intensiv auf dieses VerhûÊltnis ein, indem sie das Stû¥ck zur Wirtschaftskrise fortschreibt. Noch 2009 entsteht "Schlechte Nachrede: Und jetzt?" als Epilog zu "Die Kontrakte des Kaufmanns". Das dreiaktige Stû¥ck "Aber sicher!" aus dem gleichen Jahr ist eine Fortsetzung. Schlieûlich bezeichnet Jelinek 2014 den bislang nicht aufgefû¥hrten Text "Warnung an Griechenland vor der Freiheit" als Zusatz zu "Die Kontrakte des Kaufmanns". In all diesen Texten zur ûÑkonomischen Krise, die Jelinek im HûÑrspielprojekt unter dem Titel "WirtschaftskomûÑdie" zusammenfasst, manifestiert sich ihr system- und sprachkritisches Anschreiben gegen den Kapitalismus. Die Stû¥cke enthû¥llen die Krise einer Gesellschaft, die sich in ein System von Gier, Geld und Schuld verstrickt hat und dies nicht sehen will. Ausgangspunkt von "Die Kontrakte des Kaufmanns" bilden die Skandale um die ûÑsterreichische Meinl Bank und die ûÑsterreichische Gewerkschaftsbank BAWAG. 2007 verlieren Kleinanleger durch fragwû¥rdige FinanzgeschûÊfte dieser Banken einen groûen Teil ihres VermûÑgens. So konkret diese VorgûÊnge in Jelineks Stû¥ck hinein spielen, wie etwa auch der Fall eines ûÑsterreichischen Familienvaters, der wegen seiner massiven Verschuldung fû¥nf Familienmitglieder erschlug, so chiffriert und û¥berformt werden sie zugleich im literarischen und sprachlichen Verfahren der Autorin. "WirtschaftskomûÑdie" entlarvt die Mechanismen der Gier, der Gewinnorientierung und der Verblendung, in die sich Kleinanleger genauso verstricken wie Banker. Es verdeutlicht den virtuelle Charakter des Marktes, in dem WertschûÑpfung und der Ursprung von Reichtum oder ProduktivitûÊt von Arbeit relativ werden und das Sprechen darû¥ber hohl. Zudem vermittelt sich die quasireligiûÑse Aufladung ûÑkonomischer ZusammenhûÊnge, die nicht mehr hinterfragt, geschweige denn durchdrungen werden. Dabei erweisen sich die fû¥r Jelineks Schreiben typischen Sprachspiele als wiederholende Praxis dessen, was in der Wirtschaft passiert, nûÊmlich als SchûÑpfungsakte aus dem Nichts: ãNur die Sprache, das verlogenste und gleichzeitig unbestechlichste Mittel im menschlichen Zahlungsverkehr (und sie kostet nichts! Wir alle haben sie!) kann das irgendwie fassen und darstellen, weil sie diese Differenz zwischen Wirklichkeit und Wirklichkeit û¥berspringen kann, also letztlich das Nichts, denn wir sind alle Spielmaterial, Jetons, die aber niemand einwechseln will. Auch die Autorin fûÊllt jedes Mal wieder auf sie rein, sie hat einen Vertrag mit der Sprache abgeschlossen, weiû aber nicht mehr, was sie da û¥berhaupt unterschrieben hat.ã (Elfriede Jelinek) | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 19.04.2015
Datum: 19.04.2015Länge: 00:53:27 Größe: 48.94 MB |
||
| Elfriede Jelinek: WirtschaftskomûÑdie. Die Kontrakte des Kaufmanns (1) - 12.04.2015 | ||
| Mit Hans Kremer, Wolfgang Pregler, Wiebke Puls, GûÑtz Schulte, Johannes Silberschneider, Elfriede Jelinek / Regie: Leonhard Koppelmann / BR/DKultur 2015 / LûÊnge: 53'23 // Das VerhûÊltnis ihrer Texte zur Wirklichkeit sei ein kontinuierliches aber undurchschaubares, ûÊuûerte Elfriede Jelinek in einem Interview. Die Wirklichkeit sei ein Tier, das immer neben dem Geschriebenen her laufe, es beiûen oder sich von ihm streicheln lassen kûÑnne. Was davon eintritt, ist nicht planbar. Mit "Die Kontrakte des Kaufmanns" von 2009 lûÊsst sich die Autorin besonders intensiv auf dieses VerhûÊltnis ein, indem sie das Stû¥ck zur Wirtschaftskrise fortschreibt. Noch 2009 entsteht "Schlechte Nachrede: Und jetzt?" als Epilog zu "Die Kontrakte des Kaufmanns". Das dreiaktige Stû¥ck "Aber sicher!" aus dem gleichen Jahr ist eine Fortsetzung. Schlieûlich bezeichnet Jelinek 2014 den bislang nicht aufgefû¥hrten Text "Warnung an Griechenland vor der Freiheit" als Zusatz zu "Die Kontrakte des Kaufmanns". In all diesen Texten zur ûÑkonomischen Krise, die Jelinek im HûÑrspielprojekt unter dem Titel "WirtschaftskomûÑdie" zusammenfasst, manifestiert sich ihr system- und sprachkritisches Anschreiben gegen den Kapitalismus. Die Stû¥cke enthû¥llen die Krise einer Gesellschaft, die sich in ein System von Gier, Geld und Schuld verstrickt hat und dies nicht sehen will. Ausgangspunkt von "Die Kontrakte des Kaufmanns" bilden die Skandale um die ûÑsterreichische Meinl Bank und die ûÑsterreichische Gewerkschaftsbank BAWAG. 2007 verlieren Kleinanleger durch fragwû¥rdige FinanzgeschûÊfte dieser Banken einen groûen Teil ihres VermûÑgens. So konkret diese VorgûÊnge in Jelineks Stû¥ck hinein spielen, wie etwa auch der Fall eines ûÑsterreichischen Familienvaters, der wegen seiner massiven Verschuldung fû¥nf Familienmitglieder erschlug, so chiffriert und û¥berformt werden sie zugleich im literarischen und sprachlichen Verfahren der Autorin. "WirtschaftskomûÑdie" entlarvt die Mechanismen der Gier, der Gewinnorientierung und der Verblendung, in die sich Kleinanleger genauso verstricken wie Banker. Es verdeutlicht den virtuelle Charakter des Marktes, in dem WertschûÑpfung und der Ursprung von Reichtum oder ProduktivitûÊt von Arbeit relativ werden und das Sprechen darû¥ber hohl. Zudem vermittelt sich die quasireligiûÑse Aufladung ûÑkonomischer ZusammenhûÊnge, die nicht mehr hinterfragt, geschweige denn durchdrungen werden. Dabei erweisen sich die fû¥r Jelineks Schreiben typischen Sprachspiele als wiederholende Praxis dessen, was in der Wirtschaft passiert, nûÊmlich als SchûÑpfungsakte aus dem Nichts: ãNur die Sprache, das verlogenste und gleichzeitig unbestechlichste Mittel im menschlichen Zahlungsverkehr (und sie kostet nichts! Wir alle haben sie!) kann das irgendwie fassen und darstellen, weil sie diese Differenz zwischen Wirklichkeit und Wirklichkeit û¥berspringen kann, also letztlich das Nichts, denn wir sind alle Spielmaterial, Jetons, die aber niemand einwechseln will. Auch die Autorin fûÊllt jedes Mal wieder auf sie rein, sie hat einen Vertrag mit der Sprache abgeschlossen, weiû aber nicht mehr, was sie da û¥berhaupt unterschrieben hat.ã (Elfriede Jelinek) | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 12.04.2015
Datum: 12.04.2015Länge: 00:53:30 Größe: 48.98 MB |
||
| Alexander Kluge: 30. April 1945: Der Tag, an dem Hitler sich erschoû und die Westbindung der Deutschen begann (2/2) - 29.03.2015 | ||
| Mit Jochen Striebeck, Gabriel Raab, Helmut Stange, Sebastian Weber, Cornelie Mû¥ller, Lydia Daher, Katja Bû¥rkle, Dr. Joseph Vogl, Alexander Kluge / Komposition: Den Sorte Skole, Hûˋlû´ne Breschand / Regie: Karl Bruckmaier / BR 2015 / LûÊnge: 52'18 // "Niemand hat einen ûberblick û¥ber das Ganze", lûÊsst der Filmemacher und Schriftsteller Alexander Kluge einen seiner Protagonisten gleich zu Beginn seines 2014 erschienen Bandes 30. April 1945 - Der Tag, an dem Hitler sich erschoû und die Westbindung der Deutschen begann feststellen, um anschlieûend auf gut dreihundert Seiten (unterstû¥tzt von seinem Schriftstellerkollegen Reinhard Jirgl) uns eben diesen ûberblick û¥ber den historischen Wendepunkt zu schenken, den dieses Datum markiert. Kluge tut dies, indem er zum einen den Blick auf seine Jungen-Persona richtet ã den 13jûÊhrigen Alexander, der eben einen verheerenden Bombenangriff auf seine Vaterstadt û¥berlebt hat, aber viel mehr als am Krieg unter der Trennung der Eltern leidet ã zum anderen aber auch die Sieger und Besiegten aufsucht, sich in sie hineinversetzt, schlieûlich gar dem deutschen Geiste in Gestalt Martin Heideggers seine verwunderte Aufmerksamkeit schenkt und am Ende wie selbstverstûÊndlich Geistern begegnet, die, ausgehend vom Blocksberg, den UngerûÊchten dieses Gemetzels eine Art Stimme verleihen wollen, die sogar ein Ezra Pound noch zu vernehmen in der Lage ist. Die schriftstellerische Methode ist den Klugeãschen Lesern und Zuschauern vertraut: In kleinen ErzûÊhleinheiten werden Lebensgeschichten gerafft, Anekdoten ausgebreitet, û¥berraschende Verbindungen geknû¥pft, die in ihrer Gesamtheit ã fein einander ablûÑsend die TragûÑdie und die KomûÑdie ã ein ungemein scharfes Bild von einem bestimmten Thema, von einem bestimmten Zeitpunkt vermitteln kûÑnnen. Wieder und wieder wird eine letztlich poetische Kraft beschworen, die der ãGeisterwelt der objektiven Tatsachenã etwas Uraltes, etwas zutiefst Menschliches entgegenzusetzen hat, eine WiderstûÊndigkeit des ErzûÊhlens, die aus seinen Bû¥chern eine ãWagenburg der SubjektivitûÊtã macht, wie Kluge es einmal an anderer Stelle genannt hat. Und wenn wir uns in dieser Wagenburg zurechtgefunden haben, dann erschlieût sich uns Lesern und HûÑrern vielleicht auch dieses grûÑûte Wunder des 20. Jahrhunderts: dass diese ewig kriegfû¥hrenden Deutschen, dieser Aggressor im Herzen Europas, mit diesem 30. April 1945 die Waffen niederlegt. Und dies nicht aus einem taktischen Kalkû¥l heraus, sondern aus einer bis in die letzten Seelengrû¥nde reichenden ErschûÑpfung, die es mûÑglich macht, ohne Hintergedanken zu kapitulieren ã eine groûe zivilisatorische Leistung, fû¥r die Kluge wiederum historische Parallelen anzufû¥hren in der Lage ist, die aber auch etwas von einem MûÊrchen hat: die Deutschen als Hans im Glû¥ck, der zwar mit leeren HûÊnden dasteht, der aber von nun an ein anderes Leben fû¥hren kann. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 29.03.2015
Datum: 29.03.2015Länge: 00:52:25 Größe: 47.99 MB |
||
| Alexander Kluge: 30. April 1945: Der Tag, an dem Hitler sich erschoû und die Westbindung der Deutschen begann (1/2) - 22.03.2015 | ||
| Mit Dr. Mark Benecke, Eva Jantschitsch, Helge Schneider, Jochen Striebeck, Gabriel Raab, Pascal Fligg, Helmut Stange, Sebastian Weber, Johannes Herrschmann, Cornelie Mû¥ller, Lydia Daher, Katja Bû¥rkle, Alexander Kluge / Komposition: Den Sorte Skole, Wrekmeister Harmonies / Regie: Karl Bruckmaier / BR 2015 / LûÊnge: 52'11 // "Niemand hat einen ûberblick û¥ber das Ganze", lûÊsst der Filmemacher und Schriftsteller Alexander Kluge einen seiner Protagonisten gleich zu Beginn seines 2014 erschienen Bandes 30. April 1945 - Der Tag, an dem Hitler sich erschoû und die Westbindung der Deutschen begann feststellen, um anschlieûend auf gut dreihundert Seiten (unterstû¥tzt von seinem Schriftstellerkollegen Reinhard Jirgl) uns eben diesen ûberblick û¥ber den historischen Wendepunkt zu schenken, den dieses Datum markiert. Kluge tut dies, indem er zum einen den Blick auf seine Jungen-Persona richtet ã den 13jûÊhrigen Alexander, der eben einen verheerenden Bombenangriff auf seine Vaterstadt û¥berlebt hat, aber viel mehr als am Krieg unter der Trennung der Eltern leidet ã zum anderen aber auch die Sieger und Besiegten aufsucht, sich in sie hineinversetzt, schlieûlich gar dem deutschen Geiste in Gestalt Martin Heideggers seine verwunderte Aufmerksamkeit schenkt und am Ende wie selbstverstûÊndlich Geistern begegnet, die, ausgehend vom Blocksberg, den UngerûÊchten dieses Gemetzels eine Art Stimme verleihen wollen, die sogar ein Ezra Pound noch zu vernehmen in der Lage ist. Die schriftstellerische Methode ist den Klugeãschen Lesern und Zuschauern vertraut: In kleinen ErzûÊhleinheiten werden Lebensgeschichten gerafft, Anekdoten ausgebreitet, û¥berraschende Verbindungen geknû¥pft, die in ihrer Gesamtheit ã fein einander ablûÑsend die TragûÑdie und die KomûÑdie ã ein ungemein scharfes Bild von einem bestimmten Thema, von einem bestimmten Zeitpunkt vermitteln kûÑnnen. Wieder und wieder wird eine letztlich poetische Kraft beschworen, die der ãGeisterwelt der objektiven Tatsachenã etwas Uraltes, etwas zutiefst Menschliches entgegenzusetzen hat, eine WiderstûÊndigkeit des ErzûÊhlens, die aus seinen Bû¥chern eine ãWagenburg der SubjektivitûÊtã macht, wie Kluge es einmal an anderer Stelle genannt hat. Und wenn wir uns in dieser Wagenburg zurechtgefunden haben, dann erschlieût sich uns Lesern und HûÑrern vielleicht auch dieses grûÑûte Wunder des 20. Jahrhunderts: dass diese ewig kriegfû¥hrenden Deutschen, dieser Aggressor im Herzen Europas, mit diesem 30. April 1945 die Waffen niederlegt. Und dies nicht aus einem taktischen Kalkû¥l heraus, sondern aus einer bis in die letzten Seelengrû¥nde reichenden ErschûÑpfung, die es mûÑglich macht, ohne Hintergedanken zu kapitulieren ã eine groûe zivilisatorische Leistung, fû¥r die Kluge wiederum historische Parallelen anzufû¥hren in der Lage ist, die aber auch etwas von einem MûÊrchen hat: die Deutschen als Hans im Glû¥ck, der zwar mit leeren HûÊnden dasteht, der aber von nun an ein anderes Leben fû¥hren kann. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 22.03.2015
Datum: 22.03.2015Länge: 00:52:17 Größe: 47.88 MB |
||
| Erste Erde Forum: X. Theorien zum Ursprung des Lebens - Mit William Martin - 21.03.2015 | ||
| Raoul Schrott (Dichter) im GesprûÊch mit dem Molekularbiologen Prof. William Martin: Theorien zum Ursprung des Lebens | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 21.03.2015
Datum: 21.03.2015Länge: 00:40:51 Größe: 37.41 MB |
||
| Raoul Schrott: Erste Erde Epos: IX. Lebende Steine - 21.03.2015 | ||
| Mit Tobias Lelle, Bibiana Beglau, Jens Harzer, Dagmar Manzel, Katja Bû¥rkle, Kathi Angerer / Regie: Michael Farin / BR 2015 / LûÊnge: 42'42 // "Nie zuvor gab es so viel an Wissen û¥ber den Menschen und das Universum - doch je mehr Daten und Details angehûÊuft werden, desto weniger verstehen wir im Grunde. Wir wissen zwar, dass die alten Mythen nicht mehr stimmig sind - eine andere Geschichte, die uns und die Welt erklûÊrt, gibt es jedoch nicht." Raoul Schrott Zufolge den im Augenblick plausibelsten Theorien zu seinem Ursprung bildete sich das Leben am Meeresgrund in und an so genannten "Weiûen Rauchern": Heiûwasserkaminen, in denen das aufsteigende Sû¥ûwasser mit dem kalten Meereswasser reagiert und feinporige Schlote bildet. Die in diesen Poren ausgefûÊllten Mineralien dienten dann als Katalysatoren fû¥r die Verkettungen von organischen Molekû¥len, die irgendwann beginnen, sich selbst zu reproduzieren, von Poren geschû¥tzt wie von einer Zellhû¥lle, um sich daraus loszulûÑsen und sich als erste Mikroben frei zu schwimmen. Solche Heiûwasserkamine finden sich zumeist in Tausenden von Metern Meerestiefe: in einer Bucht im Norden Islands reichen sie bis knapp unter die OberflûÊche des Wassers. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 21.03.2015
Datum: 21.03.2015Länge: 00:42:48 Größe: 39.20 MB |
||
| Hartmut Geerken: bombus terrestris - 20.03.2015 | ||
|
Realisation: Hartmut Geerken / BR 1998 / LûÊnge: 78'26 // es gehûÑrt zum arroganten selbstverstûÊndnis des menschen, daû er nur das unter sprache versteht, was er versteht. dabei ist das summen & und brummen der hummeln eine der ûÊltesten sprachen auf diesem planeten. die hummeln haben gesummt & gebrummt lange bevor der mensch seinen ersten laut von sich gab. weltweit gibt es etwa 500 hummelarten, davon sind 63 in europa beheimatet, davon wiederum 46 im deutschsprachigen raum & 31 im deutschen. die ãbombus terrestrisã, die groûe erdhummel, ist in deutschland wohl die hûÊufigste hummelart.
flû¥gel, die das mikrofon kurz berû¥hren oder hummelbeine, die flû¥chtig darû¥ber hinwegkrabbeln, erzeugen die akustik eines unscharf eingestellten radiosenders. es bleiben nur die zischlaute û¥brig. beim genauen hinhûÑren entdeckt man metasprachen, von denen die hummeln wahrscheinlich nichts ahnen. zeitzeugen berichten, daû das gerûÊusch der sterbenden in den gaskammern von auschwitz an das summen & brummen eines bienenstocks erinnert habe. jeder hûÑrer entdeckt wieder andere metasprachen & hûÑrt damit jeweils sein eigenes hûÑrspiel. die tonaufnahmen fû¥r ãbombus terrestrisã kamen auf unterschiedliche weise zustande. die stereomikrofone wurden an verschiedenen stellen um oder im nest placiert. die dadurch entstandenen verschiedenen soundqualitûÊten habe ich û¥bergangslos aneinander, aber nicht û¥bereinander montiert (Hartmut Geerken). |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 20.03.2015
Datum: 20.03.2015Länge: 01:18:32 Größe: 71.91 MB |
||
| Raoul Schrott: Erste Erde Epos: VIII. Steinernes Meer - 14.03.2015 | ||
|
Mit Tobias Lelle, Bibiana Beglau, Jens Harzer, Dagmar Manzel, Katja Bû¥rkle, Kathi Angerer / Regie: Michael Farin / BR 2015 / LûÊnge: 49?41 // "Nie zuvor gab es so viel an Wissen û¥ber den Menschen und das Universum - doch je mehr Daten und Details angehûÊuft werden, desto weniger verstehen wir im Grunde. Wir wissen zwar, dass die alten Mythen nicht mehr stimmig sind - eine andere Geschichte, die uns und die Welt erklûÊrt, gibt es jedoch nicht." Raoul Schrott Der Urknall unserer Welt ist die Entstehung der Erde ã die sich in Vulkanen, LavastrûÑmen und ersten Grabenbrû¥chen im Meer auszubilden begann. Das erst vor 20 Millionen Jahren û¥ber den atlantischen Rû¥cken gehobene Island ist ein Modell solcher Landgewinnungsprozesse. Anschaulich wird dies dank einem Vulkanologen, der in Stykkisholmur ein Museum errichtet hat, in dem all die Lebensformen ausgestellt sind, die das Mineralische in ihrem Namen tragen: von der Bernsteinmakrele û¥ber den Kaisergranat oder den Kupferstecher bis zu SchwefelblûÊschen. Es wird augenfûÊllig, dass alles Organische aus dem Anorganischen entstand ã und auch das das Leben seinerseits diesen mineralischen Urgrund verûÊnderte. Denn ohne Leben bestû¥nde das Gestein der Erde nur aus etwa 1.500 Arten von Mineralien: durch dessen Einfluss aber verdreifachte sich diese Zahl ã bis hin zu den Halbedelsteinen. Und selbst das Leben bildet Steinernes in sich: Es scheidet es aus als Narrengold. Bakterien etwa bilden Magnetit und Zinnkraut lagert Silica ein. ErzûÊhlt wird dies alles von einer hollûÊndischen Biochemikerin, die gerade erfahren muûte, dass sie Brustkrebs hat, und vor dem Beginn ihrer Chemotherapie Island bereist. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 14.03.2015
Datum: 14.03.2015Länge: 00:49:38 Größe: 45.44 MB |
||
| Mariola Brillowska/Gû¥nter Reznicek: Radio Las Vegas - 13.03.2015 | ||
| Mit Mariola Brillowska, Gû¥nter Reznicek, Gloria Brillowska, Jû¥rgen Hall, Jan Holtmann, Gû¥nter Kordas, Felix Kubin, Jan MûÑller, Cecile Noldus, Jacques Palminger, Michael RûÑhrenbach, Anka Lea Sarstedt, Luca Scardovelli, Simone Scardovelli, Richard von der Schulenburg, Gert Stein, Gavin Weiss / Komposition: Gû¥nter Reznicek / Realisation: Mariola Brillowska, Gû¥nter Reznicek / BR 2015 / LûÊnge: 58'06 // Radio Las Vegas war eine performative Sendereihe der Kû¥nstlerin Mariola Brillowska und des Musikers Gû¥nter Reznicek aka Nova Huta, die in den Jahren 1998-2000 auf der Frequenz des unabhûÊngigen und selbst und minimal aus Anteilen der Rundfunkgebû¥hren finanzierten Stadtradios Freies Sender Kombinat in Hamburg ausgestrahlt wurde. Mit befreundeten Autoren, Musikern und Kû¥nstlern improvisierten sie live einmal im Monat ab 23 Uhr open end eine anarchische Radio Late Night Show. Fû¥r den BR/HûÑrspiel und Medienkunst haben sie diese wieder aufleben lassen und Aufnahmen aus dem eigenen Archiv aufbereitet und neu montiert. Aus dem Material ist ein Episoden-HûÑrspiel entstanden, das seinen HûÑrern eine Radiosendung bietet, in der von der Demontage des Senderstudios bis zu einem BrateiergerûÊuschkonzert alles mûÑglich ist, in der Protagonisten auftreten, die Nachhaltigkeit erzeugen, egal ob sie von ihrer Geschlechtsumwandlung oder Hyperventilation berichten. Radio Las Vegas ist eine unberechenbare Show ã wenn sie nach einigen Startschwierigkeiten û¥berhaupt anfangen kann, da der Studioschlû¥ssel verlegt ist und die Moderatoren in ihr Studio einbrechen mû¥ssen. Dann tauchen geladene und ungeladene GûÊste auf, Anrufer schalten sich ein, Gedichte werden vorgetragen, Songs gecovert, Kinder gezeugt, getauft, in den Schlaf gesungen. Die Stimmung der Show schwankt zwischen lyrisch und hysterisch, unterstû¥tzt von Stimmenverfremdung, live HûÑrspielaktionen und exklusiv komponiertem Sound Design. Das Private wird ûÑffentlich, das ûÑffentliche ûrgernis salonfûÊhig. Vor allem aber findet eine radiokû¥nstlerische Auseinandersetzung mit Formatfreiheit statt: Radio Las Vegas hat die StûÑrung, den Exhibitionismus, den Zufall auf dem Programm, die Montage des Archivmaterials 2014 dokumentiert ein ungewûÑhnliches Stû¥ck Radiogeschichte. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 13.03.2015
Datum: 13.03.2015Länge: 00:58:13 Größe: 53.30 MB |
||
| Erste Erde Forum: XI. Definitionen von Leben und erste Lebensformen - Mit Joachim Reiter - 07.03.2015 | ||
| Raoul Schrott (Dichter) im GesprûÊch mit dem Geobiologen Prof. Joachim Reitner: Definitionen von Leben und erste Lebensformen | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 07.03.2015
Datum: 07.03.2015Länge: 00:39:48 Größe: 36.45 MB |
||
| Raoul Schrott: Erste Erde Epos: VII. Autopoiesis - 07.03.2015 | ||
|
Mit Tobias Lelle, Bibiana Beglau, Jenz Harzer, Dagmar Manzel, Raoul Schrott / Regie: Michael Farin / BR 2015 / LûÊnge: 43'14 // "Nie zuvor gab es so viel an Wissen û¥ber den Menschen und das Universum - doch je mehr Daten und Details angehûÊuft werden, desto weniger verstehen wir im Grunde. Wir wissen zwar, dass die alten Mythen nicht mehr stimmig sind - eine andere Geschichte, die uns und die Welt erklûÊrt, gibt es jedoch nicht." Raoul Schrott Der Musenbrunnen der Hippokrene auf dem griechischen Berg Helikon gilt seit jeher als inspirativer Quell der Poesie. Ob beim allerersten europûÊischen Dichter Hesiod, bei den RûÑmern Vergil und Ovid oder in der Renaissance: wer dichten wollte, hatte vom Wasser dieses Brunnens trinken. Auch Lukrez, dessen naturwissenschaftliches Lehrgedicht DE RERUM NATURA dem ERSTE ERDE EPOS Pate stand, berief sich auf den Gang zu dieser Quelle. Ihm im Wortsinn folgend, stellt Autopoiesis eine autopoetische Selbstvergewisserung dar. Das Wasser des Musenquells wird dabei aus seinem alten symbolischen Kontext gehoben und zu jener Substanz, in der sich die allerersten Lebensformen bildeten. Die Musen werden dabei zu Figurationen dessen, wie Leben aus Stein, Erde und Wasser entstehen konnte. Die unterschiedlichen, nie vûÑllig û¥berzeugenden Definitionen von Leben lassen sich auf diese Weise mit dem abgleichen, was ein Gedicht auch ist ã eine Zelle von Worten, die das Auûen in ein Innen verwandelt: Dichtung, die Welt verarbeitet und dabei den Menschen in ihr lebendig hûÊlt. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 07.03.2015
Datum: 07.03.2015Länge: 00:43:19 Größe: 39.67 MB |
||
| Ernst Kreuder: Die Gesellschaft vom Dachboden - 28.02.2015 | ||
|
Mit Manfred Zapatka, Thomas Thieme, Bernhard Schû¥tz, Stefan Wilkening, Michael Habeck, Tanja Schleiff / Komposition und Regie: Klaus Buhlert / BR 2003 / LûÊnge: 81'25 // Auf dem Dachboden eines deutschen Kleinstadthauses beginnt ein VerschwûÑrermûÊrchen: Sechs hûÑchst eigenwillige MûÊnner haben es satt, ihr Leben trû¥bsinnig-rechtschaffen und in ordentlicher kleinbû¥rgerlicher Manier zu vergeuden. Unter dem Motto "jeder sein eigener Phantast" grû¥nden sie als vehemente Absage an die moderne Industriegesellschaft zwischen abgestellten Kisten, ausrangierten KûÑrben und VogelkûÊfigen eine Gegenwelt: den Geheimbund wider die Dummheit. Der Dachboden wird von GeschûÊftemachern ãbesetztã, die Geheimbû¥ndler heben einen Schatz, werden verstreut und finden sich am Ende auf der ãAlten Liebeã, einem ausgemusterten Fluss-Dampfer, wieder. Sie haben gelobt, in einer Welt der ruhelos Tû¥chtigen als ãVerborgeneã zu û¥berleben ã getreu ihren 7 Programmpunkten: Aufrichtigkeit, AnhûÊnglichkeit, Beharrlichkeit, Barmherzigkeit, ûberschwenglichkeit, Friedfertigkeit und Wandelbarkeit.
ãDie Gesellschaft vom Dachbodenã wurde 1946 von der Kritik als ãZaubergarten skurriler deutscher TrûÊumereiã bezeichnet, ãbizarre Phantastik, verhaltene Heiterkeit und grotesker ûberschwangã machten es zu einem international beachteten Buch deutscher Nachkriegsliteratur. 1953 wurde Ernst Kreuder der Georg-Bû¥chner-Preis verliehen, aber bereits in den sechziger Jahren gehûÑrte er in Deutschland zu den vergessenen Autoren. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 28.02.2015
Datum: 28.02.2015Länge: 01:21:34 Größe: 74.69 MB |
||
| Christoph Lindenmeyer: "mensch jandl". Ein GesprûÊch mit dem Dichter - 27.02.2015 | ||
| BR 1995 / LûÊnge: 43'45 // ûber Europa, ûsterreich, Antisemitismus, NS-Zeit, Judenverfolgung, Religion, Jazz, die eigene Biografie und die Angst des Schriftstellers vor dem Verstummen. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 27.02.2015
Datum: 27.02.2015Länge: 00:43:49 Größe: 40.13 MB |
||
| Stereo Total: Patty Hearst - Princess and Terrorist - 20.02.2015 | ||
|
Mit FranûÏoise Cactus, Brezel GûÑring, Gina D'Orio, Khan Oral, Patric Catani, Annika Trost, Julia Wilton, Eric D. Clark, Pascal Schiller u.a. / Komposition und Realisation: FranûÏoise Cactus/Brezel GûÑring / BR 2007 / LûÊnge: 53'48 // Eine 19-jûÊhrige Millionenerbin wird von der Terroristengruppe SLA entfû¥hrt. Sie schlieût sich ihnen an, verliebt sich in einen der Entfû¥hrer, raubt Banken aus und wird im Vietnamkriegs-Amerika der 70er Jahre zur revolutionûÊren Ikone. Stereo Total erzûÊhlen diese authentische Geschichte als HûÑrspiel-Musical mit StargûÊsten. Wir hûÑren Lieder û¥ber Bankraub, Volksspeisung und das Stockholmsyndrom. Nach ihrer Verhaftung behauptet Patty Hearst, einer GehirnwûÊsche unterzogen worden zu sein. Das Urteil lautet auf sieben Jahre GefûÊngnis, doch bald darauf wird sie begnadigt und 2001 von PrûÊsident Clinton gûÊnzlich rehabilitiert. Andere Mitglieder der SLA werden aufgrund des Patriot Acts nach mehr als 30 Jahren als Terroristen verurteilt.
Zwischen Soundeffekten und Toncollagen geht es nicht nur um die Verwandlung der Patty Hearst vom High-Society-Girl zur BankrûÊuberin und wieder zurû¥ck, sondern auch um die trostlose Geschichte eines Medienspektakels ã mit ebenso radikalen wie subjektiven Statements aller Beteiligten, die so nur im Rahmen eines Musicals erlaubt sind und unter den HûÊnden von Stereo Total zu bunten Pop-Songs werden. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 20.02.2015
Datum: 20.02.2015Länge: 00:53:54 Größe: 49.36 MB |
||
| Robert Hû¥ltner: Schenja - 11.02.2015 | ||
| Mit Brigitte Hobmeier, Florian Karlheim, Robert Giggenbach, Michael A. Grimm, Ercan Karacayli, Wowo Habdank, Winfried Frey, Susanne Schroeder, Andreas Borcherding, Barbara Maria Messner, Tom Kreû, Markus Langer, Christiane Blumhoff, Lukas Turtur, Florian Fischer, Zhanna Kalantay, Arthur Galiandin, Thomas Birnstiel, Stefanie Ramb, Beate Himmelstoû / Komposition: zeitblom / Regie: Ulrich Lampen / BR 2015 / LûÊnge: 53'20 // Lange sah es danach aus, als habe der Lohner-Hof vor den Toren der Stadt keine Zukunft mehr. Dann aber schien der als unbeholfen und schû¥chtern geltende Hoferbe doch noch sein Glû¥ck gefunden zu haben. Davon, dass dies nicht alle in seiner Familie begrû¥ût hatten, weil seine Angetraute aus Osteuropa kam, lieû sich das junge Paar nicht stûÑren. Bis die junge Frau eines Morgens tot aufgefunden wird. Obduktion und Spurensicherung lassen bald keinen Zweifel mehr zu, dass sie durch einen Stromschlag zu Tode gekommen ist. Fû¥r einen Unfall spricht, dass die Elektroinstallation des uralten Hofs nicht mehr die modernste ist. Den Ehemann trifft das Unglû¥ck schwer. Zwar erwûÊgt die Kripo auch ein Fremdverschulden, tut sich jedoch schwer, dafû¥r Beweise zu finden. Doch dann erinnert man sich auf der Polizeiinspektion von Bruck am Inn daran, dass vor einiger Zeit eine SchlûÊgerei geschlichtet werden musste, an der der Schwager der GetûÑteten und ein junger OsteuropûÊer beteiligt waren. Der jûÊhzornige Angreifer hatte dem AuslûÊnder vorgeworfen, mit der Frau seines Bruders ein VerhûÊltnis gehabt zu haben. Obwohl sich dies als haltlos erwiesen hatte, blieb unklar, was den Fremden nach Bruck am Inn gefû¥hrt haben kûÑnnte. Bis sich herausstellt, dass er und die GetûÑtete doch mehr Gemeinsamkeiten gehabt haben mussten. Da sich mittlerweile der Verdacht auf Mord erhûÊrtet hat, wûÊchst auch der Verdacht gegen ihn. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 11.02.2015
Datum: 11.02.2015Länge: 00:53:26 Größe: 48.93 MB |
||
| ûdûÑn von HorvûÀth: Der ewige Spieûer (4/4) - 08.02.2015 | ||
| Mit Peter Simonischek, Stephan Zinner, Johannes Silberschneider, Brigitte Hobmeier, Stefan Leonhardsberger, Irina Wanka, Andrea Wenzl, Oliver Scheffel, Jens Atzorn, Andreas Wimberger, Felix Hellmann / Bearbeitung: Katarina Agathos/Bernadette Sonnenbichler / Komposition: Georg Glasl / Regie: Bernadette Sonnenbichler / BR 2015 // "Es soll nun versucht werden, in Form eines Romans einige BeitrûÊge zur Biologie dieses werdenden Spieûers zu liefern. Der Verfasser wagt natû¥rlich nicht zu hoffen, daû er durch diese Seiten ein gesetzmûÊûiges Weltgeschehen beeinflussen kûÑnnte, jedoch immerhin." Es sind Wandlungsgeschichten unter dem Einfluss der Zeit, die ûdûÑn von HorvûÀth in seinem dreiteiligen Roman Der ewige Spieûer erzûÊhlt. Im Mû¥n-chen des Jahres 1929 ist der Erste Weltkrieg noch nicht lange vorbei. Die Wirt-schaftskrise macht sich im Alltag bemerkbar und radikale rechte wie linke Ideologien breiten sich aus. Dazwischen Durchschnittsmenschen wie Alfons Kobler, Anna Pollinger und Josef Reithofer. Teil 1: Herr Kobler wird PaneuropûÊer. Als er im Schel-lingsalon seinen Freunden von einer Reise zur Weltausstellung in Barcelona erzûÊhlt, hat Alfons Kobler noch keine klare Vorstellung von der paneuropûÊischen Idee. Und auch die Begegnung mit dem geschwûÊtzigen Wiener Journalisten Schmitz auf der langen Zugreise bleibt diesbezû¥glich eher theoretisch. Erst als Kobler in Barcelona seine mû¥hsam eroberte Geliebte an den kapitalen Mister A. Kaufmann verliert, ist er restlos û¥berzeugt, dass es gilt, Grenzen zu û¥berwinden. Im europûÊischen Zusammenschluss gegen die rohe amerikanische ûbermacht liegt die Zukunft. Nicht nur in Liebesdingen. Ein wenig diffus noch ist diese neue Perspektive und vielleicht doch auch gegen den unbestreitbar konservativen Kern der eigenen Seele sprechend, jedoch immerhin. Teil 2: FrûÊulein Pollinger wird praktisch. Weil sie ihre Arbeit verliert, bleibt ihr nichts anderes û¥brig, wird ihr gesagt. Beim nûÊchsten Rendezvous, einer Autofahrt an den Starnberger See, sagt Anna Pollinger vor dem ersten Kuss also ãUmsonst gibt es nichts!ã und verhandelt. Sie hat dann zwar keine Gefû¥hle dabei, jedoch immerhin. Danach hûÊlt sie ein Fû¥nfmarkstû¥ck in der Hand. Teil 3: Herr Reithofer wird selbstlos. Obwohl er ein Mistvieh ist und im Arbeitsamt in der Thalkirchener Straûe mit Anna Pollinger auf ein ebensolches trifft, muss doch auch einmal etwas Gutes getan werden in diesen schlimmen Zeiten. Als Josef Reithofer Anna, die ihn noch kurz vorher ausnehmen wollte, eine Stelle als NûÊherin vermitteln kann, tut er es. Reithofer ist jetzt ein selbstloses Mistvieh, immerhin! Groûe Wirkungen haben bekanntlich kleine Ursachen. Und groûe Ideen auch. In seiner ersten selbstûÊndigen ProsaverûÑffentlichung aus dem Jahr 1930 ist ûdûÑn von HorvûÀth scharfer Beobachter eines neuen Menschentyps. Kleinbû¥rger, die lernen, zu û¥berleben, sich anzupassen, Privates und Politisches zusammen zu denken, auch wenn dabei so manche gedankliche Schieflage entsteht. In ihrer zwischen Dialekt und angelesenen Floskeln changierenden Sprache entlarven sie ihre Orientierungslosigkeit ebenso, wie sie ihr so leicht von auûen beeinflussbares Bewusstsein demaskieren. ûdûÑn von HorvûÀth ging es mit dem Roman aber nicht um Parodie oder beiûende Satire. Vielmehr hoffte auch er auf die bekanntlich groûen Wirkungen durch kleine Ursachen. Und weil er dabei im werdenden Spieûer zugleich den ewigen Spieûer erkannte, hat so manche Charakterisierung im Roman bis heute nichts an AktualitûÊt verloren. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 08.02.2015
Datum: 08.02.2015Länge: 00:53:21 Größe: 48.86 MB |
||
| ûdûÑn von HorvûÀth: Der ewige Spieûer (3/4) - 01.02.2015 | ||
| Mit Peter Simonischek, Stephan Zinner, Johannes Silberschneider, Constanze WûÊchter / Bearbeitung: Katarina Agathos/Bernadette Sonnenbichler / Komposition: Georg Glasl / Regie: Bernadette Sonnenbichler / BR 2015 // "Es soll nun versucht werden, in Form eines Romans einige BeitrûÊge zur Biologie dieses werdenden Spieûers zu liefern. Der Verfasser wagt natû¥rlich nicht zu hoffen, daû er durch diese Seiten ein gesetzmûÊûiges Weltgeschehen beeinflussen kûÑnnte, jedoch immerhin." Es sind Wandlungsgeschichten unter dem Einfluss der Zeit, die ûdûÑn von HorvûÀth in seinem dreiteiligen Roman Der ewige Spieûer erzûÊhlt. Im Mû¥n-chen des Jahres 1929 ist der Erste Weltkrieg noch nicht lange vorbei. Die Wirt-schaftskrise macht sich im Alltag bemerkbar und radikale rechte wie linke Ideologien breiten sich aus. Dazwischen Durchschnittsmenschen wie Alfons Kobler, Anna Pollinger und Josef Reithofer. Teil 1: Herr Kobler wird PaneuropûÊer. Als er im Schel-lingsalon seinen Freunden von einer Reise zur Weltausstellung in Barcelona erzûÊhlt, hat Alfons Kobler noch keine klare Vorstellung von der paneuropûÊischen Idee. Und auch die Begegnung mit dem geschwûÊtzigen Wiener Journalisten Schmitz auf der langen Zugreise bleibt diesbezû¥glich eher theoretisch. Erst als Kobler in Barcelona seine mû¥hsam eroberte Geliebte an den kapitalen Mister A. Kaufmann verliert, ist er restlos û¥berzeugt, dass es gilt, Grenzen zu û¥berwinden. Im europûÊischen Zusammenschluss gegen die rohe amerikanische ûbermacht liegt die Zukunft. Nicht nur in Liebesdingen. Ein wenig diffus noch ist diese neue Perspektive und vielleicht doch auch gegen den unbestreitbar konservativen Kern der eigenen Seele sprechend, jedoch immerhin. Teil 2: FrûÊulein Pollinger wird praktisch. Weil sie ihre Arbeit verliert, bleibt ihr nichts anderes û¥brig, wird ihr gesagt. Beim nûÊchsten Rendezvous, einer Autofahrt an den Starnberger See, sagt Anna Pollinger vor dem ersten Kuss also ãUmsonst gibt es nichts!ã und verhandelt. Sie hat dann zwar keine Gefû¥hle dabei, jedoch immerhin. Danach hûÊlt sie ein Fû¥nfmarkstû¥ck in der Hand. Teil 3: Herr Reithofer wird selbstlos. Obwohl er ein Mistvieh ist und im Arbeitsamt in der Thalkirchener Straûe mit Anna Pollinger auf ein ebensolches trifft, muss doch auch einmal etwas Gutes getan werden in diesen schlimmen Zeiten. Als Josef Reithofer Anna, die ihn noch kurz vorher ausnehmen wollte, eine Stelle als NûÊherin vermitteln kann, tut er es. Reithofer ist jetzt ein selbstloses Mistvieh, immerhin! Groûe Wirkungen haben bekanntlich kleine Ursachen. Und groûe Ideen auch. In seiner ersten selbstûÊndigen ProsaverûÑffentlichung aus dem Jahr 1930 ist ûdûÑn von HorvûÀth scharfer Beobachter eines neuen Menschentyps. Kleinbû¥rger, die lernen, zu û¥berleben, sich anzupassen, Privates und Politisches zusammen zu denken, auch wenn dabei so manche gedankliche Schieflage entsteht. In ihrer zwischen Dialekt und angelesenen Floskeln changierenden Sprache entlarven sie ihre Orientierungslosigkeit ebenso, wie sie ihr so leicht von auûen beeinflussbares Bewusstsein demaskieren. ûdûÑn von HorvûÀth ging es mit dem Roman aber nicht um Parodie oder beiûende Satire. Vielmehr hoffte auch er auf die bekanntlich groûen Wirkungen durch kleine Ursachen. Und weil er dabei im werdenden Spieûer zugleich den ewigen Spieûer erkannte, hat so manche Charakterisierung im Roman bis heute nichts an AktualitûÊt verloren. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 01.02.2015
Datum: 01.02.2015Länge: 00:53:27 Größe: 48.94 MB |
||
| Josef Anton Riedl/Michael Lentz: grûÑûer minus grûÑûer - Lautkomposition aus Collagen von Herta Mû¥ller - 30.01.2015 | ||
| Mit Michael Hirsch, Michael Lentz / Realisation: Michael Lentz/Josef Anton Riedl / BR 2014 / LûÊnge: 40`51 // Anders als in Riedls frû¥heren Lautkompositionen û¥berwiegt in "grûÑûer minus grûÑûer" die improvisatorische Ausgestaltung des ausgewûÊhlten Materials. Unter der Regie von Josef Anton Riedl und Michael Lentz modulierten die beiden Sprecher Michael Hirsch und Michael Lentz bislang unverûÑffentlichte Collagen-Gedichte von Herta Mû¥ller artikulatorisch in Lautgedichte: Einzelne WûÑrter, SûÊtze und ganze Gedichte wurden zerdehnt, extrem beschleunigt, in Silben und Einzellaute ,zerpflû¥cktã, in Vokal- und Konsonantenreihen zerlegt, zu rhythmischen Figuren gruppiert, semantisch und phonetisch variiert, gestottert, repetiert, neu kombiniert. Vorgegeben waren jeweils bestimmte Haltungen, Affekte, rhythmische Muster und anzuzielende Vorstellungen der klanglichen Realisation wie zum Beispiel: ãsingendã, ohne zu singen; mit ganz tiefer Stimme; mit der Stimme eine Geschichte erzûÊhlen; so schnell wie mûÑglich; so langsam wie mûÑglich; auf einer StimmtonhûÑhe; dialogisch; die Zeilen abtasten, ohne sie vorzulesen; den anderen û¥berbietend; den anderen begleitend; flû¥stern; ohne Stimmton; fast nicht hûÑrbar; mit permanent wechselnder StimmtonhûÑhe. Die jahrzehntelangen Erfahrungen der Sprecher in der Auffû¥hrung von Riedls Lautgedichten und Lautkompositionen wirkten auf die solchermaûen gelenkten Improvisationen maûgebend ein, es bildeten sich fû¥r Riedl stilbildende Strukturen, Rhythmen und Reihungen heraus. Auf diese Weise entstanden Soli, Duette und ã durch die ûberlagerung auch unterschiedlicher Duett-Versionen ã Quartette, teils auf der Grundlage desselben simultan artikulierten Collagen-Gedichts, teils wurden zwei oder mehrere verschiedene Gedichte auf die beschriebenen Weisen in einer Sequenz gesprochen. Die Aufnahmen fû¥r grûÑûer minus grûÑûer sind vom 06. bis zum 10. Oktober 2013 im Haus von Josef Anton Riedl in Murnau entstanden und Ende November von Lentz, nach gemeinsamen Strukturvorgaben von ihm und Riedl im Bayerischen Rundfunk zur vorliegenden Lautkomposition verarbeitet worden. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 30.01.2015
Datum: 30.01.2015Länge: 00:40:57 Größe: 37.50 MB |
||
| ûdûÑn von HorvûÀth: Der ewige Spieûer (2/4) - 25.01.2015 | ||
| Mit Peter Simonischek, Stephan Zinner, Johannes Silberschneider, Marie Theres Futterknecht, Johannes Meier, Hannes Ringlstetter, Markus BûÑker, Peter FrûÑhlich, Norman Hacker / Bearbeitung: Katarina Agathos/Bernadette Sonnenbichler / Komposition: Georg Glasl / Regie: Bernadette Sonnenbichler / BR 2015 // "Es soll nun versucht werden, in Form eines Romans einige BeitrûÊge zur Biologie dieses werdenden Spieûers zu liefern. Der Verfasser wagt natû¥rlich nicht zu hoffen, daû er durch diese Seiten ein gesetzmûÊûiges Weltgeschehen beeinflussen kûÑnnte, jedoch immerhin." Es sind Wandlungsgeschichten unter dem Einfluss der Zeit, die ûdûÑn von HorvûÀth in seinem dreiteiligen Roman Der ewige Spieûer erzûÊhlt. Im Mû¥n-chen des Jahres 1929 ist der Erste Weltkrieg noch nicht lange vorbei. Die Wirt-schaftskrise macht sich im Alltag bemerkbar und radikale rechte wie linke Ideologien breiten sich aus. Dazwischen Durchschnittsmenschen wie Alfons Kobler, Anna Pollinger und Josef Reithofer. Teil 1: Herr Kobler wird PaneuropûÊer. Als er im Schel-lingsalon seinen Freunden von einer Reise zur Weltausstellung in Barcelona erzûÊhlt, hat Alfons Kobler noch keine klare Vorstellung von der paneuropûÊischen Idee. Und auch die Begegnung mit dem geschwûÊtzigen Wiener Journalisten Schmitz auf der langen Zugreise bleibt diesbezû¥glich eher theoretisch. Erst als Kobler in Barcelona seine mû¥hsam eroberte Geliebte an den kapitalen Mister A. Kaufmann verliert, ist er restlos û¥berzeugt, dass es gilt, Grenzen zu û¥berwinden. Im europûÊischen Zusammenschluss gegen die rohe amerikanische ûbermacht liegt die Zukunft. Nicht nur in Liebesdingen. Ein wenig diffus noch ist diese neue Perspektive und vielleicht doch auch gegen den unbestreitbar konservativen Kern der eigenen Seele sprechend, jedoch immerhin. Teil 2: FrûÊulein Pollinger wird praktisch. Weil sie ihre Arbeit verliert, bleibt ihr nichts anderes û¥brig, wird ihr gesagt. Beim nûÊchsten Rendezvous, einer Autofahrt an den Starnberger See, sagt Anna Pollinger vor dem ersten Kuss also ãUmsonst gibt es nichts!ã und verhandelt. Sie hat dann zwar keine Gefû¥hle dabei, jedoch immerhin. Danach hûÊlt sie ein Fû¥nfmarkstû¥ck in der Hand. Teil 3: Herr Reithofer wird selbstlos. Obwohl er ein Mistvieh ist und im Arbeitsamt in der Thalkirchener Straûe mit Anna Pollinger auf ein ebensolches trifft, muss doch auch einmal etwas Gutes getan werden in diesen schlimmen Zeiten. Als Josef Reithofer Anna, die ihn noch kurz vorher ausnehmen wollte, eine Stelle als NûÊherin vermitteln kann, tut er es. Reithofer ist jetzt ein selbstloses Mistvieh, immerhin! Groûe Wirkungen haben bekanntlich kleine Ursachen. Und groûe Ideen auch. In seiner ersten selbstûÊndigen ProsaverûÑffentlichung aus dem Jahr 1930 ist ûdûÑn von HorvûÀth scharfer Beobachter eines neuen Menschentyps. Kleinbû¥rger, die lernen, zu û¥berleben, sich anzupassen, Privates und Politisches zusammen zu denken, auch wenn dabei so manche gedankliche Schieflage entsteht. In ihrer zwischen Dialekt und angelesenen Floskeln changierenden Sprache entlarven sie ihre Orientierungslosigkeit ebenso, wie sie ihr so leicht von auûen beeinflussbares Bewusstsein demaskieren. ûdûÑn von HorvûÀth ging es mit dem Roman aber nicht um Parodie oder beiûende Satire. Vielmehr hoffte auch er auf die bekanntlich groûen Wirkungen durch kleine Ursachen. Und weil er dabei im werdenden Spieûer zugleich den ewigen Spieûer erkannte, hat so manche Charakterisierung im Roman bis heute nichts an AktualitûÊt verloren. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 25.01.2015
Datum: 25.01.2015Länge: 00:53:17 Größe: 48.78 MB |
||
| ûdûÑn von HorvûÀth: Der ewige Spieûer (1/4) - 18.01.2015 | ||
|
Mit Peter Simonischek, Stephan Zinner, Brigitte Hobmeier, Irina Wanka, Marie Theres Futterknecht, Oliver Scheffel, Wowo Habdank, Ulla Geiger, Hannes Ringlstetter, Markus BûÑker, Peter FrûÑhlich, Norman Hacker, Felix Hellmann / Bearbeitung: Katarina Agathos/Bernadette Sonnenbichler / Komposition: Georg Glasl / Regie: Bernadette Sonnenbichler / BR 2015 // "Es soll nun versucht werden, in Form eines Romans einige BeitrûÊge zur Biologie dieses werdenden Spieûers zu liefern. Der Verfasser wagt natû¥rlich nicht zu hoffen, daû er durch diese Seiten ein gesetzmûÊûiges Weltgeschehen beeinflussen kûÑnnte, jedoch immerhin." Es sind Wandlungsgeschichten unter dem Einfluss der Zeit, die ûdûÑn von HorvûÀth in seinem dreiteiligen Roman Der ewige Spieûer erzûÊhlt. Im Mû¥n-chen des Jahres 1929 ist der Erste Weltkrieg noch nicht lange vorbei. Die Wirt-schaftskrise macht sich im Alltag bemerkbar und radikale rechte wie linke Ideologien breiten sich aus. Dazwischen Durchschnittsmenschen wie Alfons Kobler, Anna Pollinger und Josef Reithofer. Teil 1: Herr Kobler wird PaneuropûÊer. Als er im Schel-lingsalon seinen Freunden von einer Reise zur Weltausstellung in Barcelona erzûÊhlt, hat Alfons Kobler noch keine klare Vorstellung von der paneuropûÊischen Idee. Und auch die Begegnung mit dem geschwûÊtzigen Wiener Journalisten Schmitz auf der langen Zugreise bleibt diesbezû¥glich eher theoretisch. Erst als Kobler in Barcelona seine mû¥hsam eroberte Geliebte an den kapitalen Mister A. Kaufmann verliert, ist er restlos û¥berzeugt, dass es gilt, Grenzen zu û¥berwinden. Im europûÊischen Zusammenschluss gegen die rohe amerikanische ûbermacht liegt die Zukunft. Nicht nur in Liebesdingen. Ein wenig diffus noch ist diese neue Perspektive und vielleicht doch auch gegen den unbestreitbar konservativen Kern der eigenen Seele sprechend, jedoch immerhin. Teil 2: FrûÊulein Pollinger wird praktisch. Weil sie ihre Arbeit verliert, bleibt ihr nichts anderes û¥brig, wird ihr gesagt. Beim nûÊchsten Rendezvous, einer Autofahrt an den Starnberger See, sagt Anna Pollinger vor dem ersten Kuss also ãUmsonst gibt es nichts!ã und verhandelt. Sie hat dann zwar keine Gefû¥hle dabei, jedoch immerhin. Danach hûÊlt sie ein Fû¥nfmarkstû¥ck in der Hand. Teil 3: Herr Reithofer wird selbstlos. Obwohl er ein Mistvieh ist und im Arbeitsamt in der Thalkirchener Straûe mit Anna Pollinger auf ein ebensolches trifft, muss doch auch einmal etwas Gutes getan werden in diesen schlimmen Zeiten. Als Josef Reithofer Anna, die ihn noch kurz vorher ausnehmen wollte, eine Stelle als NûÊherin vermitteln kann, tut er es. Reithofer ist jetzt ein selbstloses Mistvieh, immerhin! Groûe Wirkungen haben bekanntlich kleine Ursachen. Und groûe Ideen auch. In seiner ersten selbstûÊndigen ProsaverûÑffentlichung aus dem Jahr 1930 ist ûdûÑn von HorvûÀth scharfer Beobachter eines neuen Menschentyps. Kleinbû¥rger, die lernen, zu û¥berleben, sich anzupassen, Privates und Politisches zusammen zu denken, auch wenn dabei so manche gedankliche Schieflage entsteht. In ihrer zwischen Dialekt und angelesenen Floskeln changierenden Sprache entlarven sie ihre Orientierungslosigkeit ebenso, wie sie ihr so leicht von auûen beeinflussbares Bewusstsein demaskieren. ûdûÑn von HorvûÀth ging es mit dem Roman aber nicht um Parodie oder beiûende Satire. Vielmehr hoffte auch er auf die bekanntlich groûen Wirkungen durch kleine Ursachen. Und weil er dabei im werdenden Spieûer zugleich den ewigen Spieûer erkannte, hat so manche Charakterisierung im Roman bis heute nichts an AktualitûÊt verloren. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 18.01.2015
Datum: 18.01.2015Länge: 00:53:38 Größe: 49.11 MB |
||
| Tina Klopp: Mit dem Hackenporsche die Revue fû¥r postheroisches Management tanzen oder Mit Kinderpflastern Daten visualisieren oder Mit der Bastelanleitung fû¥r Energiesparlampen beim LiquiditûÊtspoker gewinnen oder Mit geliehenen BauklûÑtzen fû¥r die Transnationale demonstrieren - 11.01.2015 | ||
| Mit Thomas Schmauser, Michaela Steiger sowie zehn Anrufern, einem Hochhaus-Bewohner, einer HûÑrspieldramaturgin, zwei Menschen im Supermarkt, einem Busfahrer, einem Musiker, einem Galeristen / Komposition: Michael Hoffmann / Realisation: Tina Klopp / BR 2014 / LûÊnge: 53'44 // Mit der Welt verhûÊlt es sich ein bisschen so wie mit dem Wetter - eigentlich ist sie ganz okay. Nur die Menschen darin kûÑnnten ein bisschen freundlicher gucken. Sie, also die Kû¥nstlerin, will daran zunûÊchst auch gar nichts ûÊndern. Sie will nur ein wenig Aufmerksamkeit, vielleicht auch: gemocht werden. So fûÊngt sie an, die Stadt mit ihren Handlungsanweisungen zu û¥berziehen. Sie schleust ihre Botschaften heimlich ins Radioprogramm, jubelt sie ahnungslosen Flohmarktbesuchern unter oder versteckt sie in Form von BilderrûÊtseln hinter den groûen Fensterscheiben von Erdgeschosswohnungen diverser GroûstûÊdte. Und ob sie nun zum Krieg auf deutschen KinderspielplûÊtzen aufruft, Religionsversicherungen anbietet oder die Kollegen im Groûraumbû¥ro zu Umfragezwecken anstiftet, ihr Haar mit Pfirsichshampoo zu waschen und einen roten Pullover zu tragen ã irgendwie nimmt das Unterfangen langsam Formen an, die einmal theoretisch û¥berdacht gehûÑrten. Einziges Problem: Die Frau ist nicht nur vûÑllig unscheinbar, sie ist auch noch voller ZerstûÑrungswut, Phobien und Aversionen. Zum Glû¥ck findet sich ein alter Bekannter, der den Spaû nicht nur von Anfang an beobachtet hat, sondern sich auch noch einbildet, ein bisschen Ahnung von Kunstgeschichte zu haben. Und der jetzt bereit war, darû¥ber zu sprechen. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 11.01.2015
Datum: 11.01.2015Länge: 00:53:49 Größe: 49.27 MB |
||
| Eran Schaerf: 1001 Wirklichkeit. Fortsetzungen eines unabgeschlossenen Romans - 09.01.2015 | ||
| Aufzeichnung eines Live-HûÑrspiels aus dem Haus der Kulturen der Welt vom 30.05.2014 / Mit Pauline Boudry, Matthias Haase, Elfriede Jelinek, Christoph JûÑde, Lara KûÑrte, Leonhard Koppelmann, Bettina Lieder, Stephanie Metzger, Eva Meyer, Jonas Minthe, Uriel Orlow, Janina Sachau, Samuel Streiff, Katja Strippel / Realisation: Eran Schaerf / BR HûÑrspiel und Medienkunst / Berlin Documentary Forum, Haus der Kulturen der Welt 2014 / LûÊnge: 114'18 // Tamra ist jû¥discher Herkunft, in Indien geboren, besitzt einen britischen Pass und landet als Teenager im kolonisierten Kairo der 1930er Jahre, wo ihr Vater GeschûÊfte macht. Marcel Proust und George Sand sollen sie beflû¥geln, ja trûÑsten, z.B. darû¥ber, dass sie mit Khadri eine Liebe, aber keine Zukunft haben kann - weil er ûgypter muslimischer Herkunft ist? Und was ist Tamra? Kolonisatorin oder Kolonisierte? Tamra wû¥rde sagen: weder das eine noch das andere; Sie vielleicht: sowohl das eine wie das andere. Jacqueline Kahanoff (1917- 79) hat den Roman "Tamra" nicht abgeschlossen, vielleicht, weil er sich immer wieder in die Wirklichkeit fortgesetzt hat. Auf der Straûe und im Buch, in Kairo und in Paris, in der Bibel und im Fernsehen - wie Tamra ist Kahanoff zwischen nahen und fernen Wirklichkeiten zerrissen. Was im Roman erfunden erscheint, wirkt in narrativen Essays und journalistischen Arbeiten der Autorin biografisch und dokumentarisch. Im Sprung zwischen ErzûÊhlformaten entwickelt Kahanoff das Modell einer Gesellschaft von MinoritûÊten, fû¥r den sie den Begriff Levantinismus, an dem die Erinnerung der historischen Kolonialgewalt haftet, wiederaneignet. Die kulturelle Verflechtung der Einwanderungsgesellschaft ist Kern des levantinischen Modells, dessen ErzûÊhlung die Weltereignisse nicht allein nach Abraham "oder" nach Jesus "oder" nach Mohammed datiert ... "wenn Gott nur ein bisschen eine Frau wûÊre." Die levantinische ZuhûÑrerin Kahanoff gehûÑrt mehreren Gemeinschaften an und kann nur im ûberqueren der Grenzen zwischen Generationen, Klassen, Geschlechtern, Medien und staatlichen Territorien, Bericht erstatten. Dem Bild des Nationalstaats, der - so schreibt sie 1968 - durch Einwanderungen in Folge des Untergangs des "Empires" ohnehin bereits dabei ist, sich zu levantisieren, hûÊlt sie das Bild eines so definierten levantinischen Gesellschaftsmodells entgegen. Orson Welles' fiktive Live Sendung "War of the Worlds" (1938) bewirkte in den USA neben Verwirrung û¥ber den Wahrheitsgehalt von Nachrichten und HûÑrspiel auch Vorschriften, die Live-Formate im HûÑrspiel verbieten. Demnach wûÊren HûÑrspiele der inszenierten Fiktion und Nachrichten der Dokumentation verpflichtet. "hûÑr!spiel!art.mix" ist ein 2-stû¥ndiges, mit HûÑrspiel, LivebeitrûÊgen und ohne Unterbrechung fû¥r die stû¥ndlichen Nachrichten programmiertes Format. Welches ErzûÊhlformat dokumentiert eine bestehende Gesellschaftsform, welche bringt eine neu hervor? Mit dieser Frage wird "Tamra" in "1001 Wirklichkeit"fortgesetzt, um die Relevanz von Kahanoffs levantinischem Modell im postkolonialen Europa zu proben. Mit GastbeitrûÊgen aus Kunst, Literatur, Journalismus und Geschichte. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 09.01.2015
Datum: 09.01.2015Länge: 01:55:17 Größe: 105.55 MB |
||
| Jan Peters: Wie ich mich dem Ereignishorizont annûÊherte - 21.12.2014 | ||
|
Mit Jan Peters, Pit Przygodda, Cecile Lapoire, Michael Layton, Neal Hartman / Komposition: Pit Przygodda / Realisation: Jan Peters / BR in Zusammenarbeit mit arts@CERN 2014 / LûÊnge: 53'46 // Immer noch ist der Filmemacher und HûÑrspielautor Jan Peters auf der Suche nach Antworten auf die wirklich groûen Fragen: nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Mit dem Eindruck, es schon an vielen Stellen versucht und dabei wenig Neues entdeckt zu haben, hat er sich als "artist in residence" an einem Ort beworben, der fû¥r die Entwicklung neuer Ideen bekannt ist: am CERN, der europûÊischen Organisation fû¥r Kernforschung in Genf, wo Wissenschaftler aus aller Welt auch auf der Suche nach Antworten auf wirklich groûe Fragen sind. Sie suchen die Weltformel, die alle bekannten physikalischen PhûÊnomene erklûÊren und verknû¥pfen soll. Dazu haben sie einen gigantischen Teilchenbeschleuniger gebaut, den Large Hadron Collider, ein 100 Meter unter der Erde liegender, 27 km langer Ring, in dem auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigte Protonen zur Kollision gebracht werden, um die Situation im Universum wenige Nanosekunden nach dem Urknall zu simulieren.
Im Rahmen eines Stipendiums ab September 2013 konnte Jan Peters an dieser Grundlagenforschung teilnehmen und ist mit dem CERN-Ingenieur und nebenberuflichen Filmemacher Neal Hartman zum Forschungsteam um den Pixel- Detektor am ATLAS-Experiment im CERN gestoûen. Der Pixel-Detektor ist nur wenige Zentimeter von dem Ort entfernt, an dem die auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigten Protonen kollidieren, er hûÊlt die Spuren der Teilchen fest, die in den Kollisionen entstehen. Zum Zeitpunkt des Stipendiums ist am ATLAS- Experiment gerade eine mehrmonatige Betriebspause, die dazu genutzt wird, den Pixel-Detektor aus- und umzubauen. Jan Peters hat wûÊhrend seines Stipendiums das Team um den Pixel-Detektor beim Wiedereinbau begleitet und zugesehen (und manchmal sogar mit angefasst), wie mehr als 24.000 Datenkabel erneut verbunden, durchgemessen und getestet wurden, wie Stickstoff in unzûÊhlige Rohre gepumpt wurde, um diese auf Lecks zu testen, wie das Strahlenschutzteam mit Staubsaugern auf dem Rû¥cken zum Anschleifen von Klebestellen hinzugeholt wurde und vieles, vieles mehr. Im HûÑrspiel Wie ich mich dem Ereignishorizont annûÊherte erzûÊhlt Jan Peters aus der Zeit seines Aufenthalts am CERN, wobei er sich tief in das Forschungsprojekt hineinbegibt, dabei aber eine kritische Distanz nicht verliert, den ZuhûÑrer mit Selbstironie zum Lachen bringt und immer wieder eine Verbindung zwischen Physik und Kunst, zwischen Philosophie und Politik herstellt. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 21.12.2014
Datum: 21.12.2014Länge: 00:53:48 Größe: 49.27 MB |
||
| ARD Radio Tatort: Robert Hû¥ltner: Winterliebe - 10.12.2014 | ||
| Mit Florian Karlheim, Brigitte Hobmeier, Barbara de Koy, Robert Giggenbach, Sigi Zimmerschied, Johannes Silberschneider, Wolfgang Maria Bauer, Markus BûÑker, Susanne Schroeder, Felix Hellmann, Genoveva Mayer, Marcus Huber, Sabine Kastius, Christiane Blumhoff, Rosetta Pedone, Markus Brandl, Heide Ackermann / Komposition: zeitblom / Regie: Ulrich Lampen / BR 2014 / LûÊnge: 53'14 // RûÊtselraten im winterlichen Bruck am Inn: Was ist nur mit Nanni los? Immer hûÊufiger findet man im Kiosk am Stadtplatz statt der beliebten Ladnerin eine ungeschickte Aushilfe vor. Sofort machen Gerû¥chte die Runde. TatsûÊchlich wirkt Nanni seit einiger Zeit wie ausgewechselt. Als der Gemeindearbeiter Harti zufûÊllig Zeuge wird, wie sie in den Wagen eines attraktiven Unbekannten steigt, scheint die Sache klar: Nanni hat eine spûÊte Liebe gefunden. WûÊhrenddessen hat die Brucker Polizei ganz andere Sorgen. Vor wenigen Tagen wurde in einer benachbarten Stadt die Leiche eines Erfrorenen entdeckt. Die Obduktion ergibt keine Hinweise auf Fremdverschulden, der Mann war offenbar schwer betrunken, gestû¥rzt und hatte die eisige Nacht nicht û¥berlebt. Das Opfer trug nicht nur seine Papiere mit sich, sondern auch Belege, die die Ermittler nach Bruck am Inn fû¥hren. WûÊhrend die Kripo rûÊtselt, was der Norddeutsche im tiefsten Winter in Bruck gesucht haben kûÑnnte, kommen sich Nanni und ihr Verehrer immer nûÊher. Sie ist vom Charme und der WeltlûÊufigkeit des Mannes hingerissen. Auch wenn Gemeindearbeiter Harti, ein Freund Nannis aus fernen Jugendtagen, ihr vehement sein Misstrauen gegen den feinen Herrn zum Ausdruck bringt. Senta und Rudi wiederum haben vor allem û¥bereinstimmende Gefû¥hle, was die Ermittlungen der Kripo angeht. Sie glauben, die Kollegen haben den Tod des auswûÊrtigen Besuchers zu schnell als Unglû¥cksfall eingestuft. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 10.12.2014
Datum: 10.12.2014Länge: 00:53:20 Größe: 48.84 MB |
||
| Felicia Zeller: Die Welt von hinten wie von vorne - 05.12.2014 | ||
|
Mit Andreas Grothgar, Tanja Schleiff, Ekkehard Freye, Sascha Nathan, Merle Wasmuth / Komposition: Peter Harsch / Regie: Leonhard Koppelmann / BR 2014 / LûÊnge: 53'14 // Sie machen Kampagnen, die Zukunft gestalten. Kampagnen fû¥r Produkte, Parteien und Initiativen. Kampagnen gegen Aids und fû¥r Atomkraft. Kampagnen aus Leidenschaft und fû¥r Geld. Herzkampagnen und brain campaigns. Sie sind Deutschlands grûÑûte PR-Agentur, die kreativsten KûÑpfe des Landes, ein Power-Team mit dem Mut zum Wahnsinn. Jetzt planen sie eine Kampagne, die alles Vor- und Herstellbare û¥bersteigt. Eine GûÊnsehaut-Kampagne. Eine Graswurzel-Kampagne, die jeden angeht. Alle KrûÊfte mû¥ssen gebû¥ndelt werden, der volle Einsatz aller ist erforderlich. Das funktioniert am besten in einer KreativatmosphûÊre mit innovativer Farbzonenaufteilung im Bû¥ro: Meetings- und Entscheidungsbereich lila, Chill-Zone orange, Kuschelecken grû¥n. Eine inspirierende ArbeitsatmosphûÊre, in der nicht gearbeitet, sondern Zukunft gestaltet wird. Ohnehin kommen die besten Ideen in informellen GesprûÊchen zustande, die alle laufend von sogenannten memory-boxen mitgeschnitten werden. Nur einmal, als die Direktorin fû¥r Kreation und Strategie Sandra ein GesprûÊch mit ihrem Mitarbeiter Dirk fû¥hrt, wird die memory-box ausgeschaltet. Dirk hatte selbst gesagt, es grenzt an ein Verbrechen, ãNeinã zur Arbeit an der Kampagne zu sagen, und Sandra findet, man sollte nicht zûÑgern, verkrustete Strukturen aufzubrechen. Sich von verkrusteten Mitarbeitern zu trennen. Dirk kann ja auch einfach die Seiten wechseln und auch Klaus, der GeschûÊftsfû¥hrer betont: Man muss Widersprû¥che aushalten kûÑnnen.
In Felicia Zellers HûÑrspiel Die Welt von hinten wie von vorne wird kein einziger Satz ausformuliert, die SûÊtze werden zu Phrasen, die einfach abbrechen, kollabieren zwischen Aufbruch und Zerfall, wie auch die Protagonisten in ihrem Eifer. Es ist das Misslingen von Kommunikation, das Felicia Zeller hier auf die Spitze treibt und ausstellt, der glatte und totalitûÊre Sound einer Gesellschaft, die sich nur noch in Claims mitteilen kann, einer Gesellschaft, die nur noch so viel wert ist, wie die Kampagnen ihrer Vermarktung erfolgreich sind. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 05.12.2014
Datum: 05.12.2014Länge: 00:53:19 Größe: 48.83 MB |
||
| Bruno Latour: Kosmokoloss. Eine TragikomûÑdie û¥ber das Klima und den Erdball - 21.11.2014 | ||
| Mit Wolfgang Pregler, Gabriel Raab, Marie Seiser, Kathrin von Steinburg, Steven Scharf, Helmut Stange, Hans Kremer, Wolfgang Hinze, Stefan Hunstein, Sylvana Krappatsch / Trompete: Micha Acher / Aus dem FranzûÑsischen von Margit Rosen / Bearbeitung: Margit Rosen / Komposition: Saam Schlamminger / Regie: Ulrich Lampen / BR/ZKM 2013 / LûÊnge: 64'03 // Die Bewohner der Erde schlafen ruhig, denn sie wissen kaum etwas û¥ber den Planeten, auf dem sie sich befinden. Sie begreifen nicht, wie sehr das, was sie fû¥r den festen Rahmen ihrer Existenz halten, ins Taumeln geraten ist. Sie weigern sich zu sehen, dass ihre Art, die Erde zu bewohnen, zu einer ûÑkologischen Krise gefû¥hrt hat, die vielleicht nur ein kleiner Teil der Menschheit û¥berleben wird. "Kosmokoloss. Eine TragikomûÑdie û¥ber das Klima und den Erdball" thematisiert diese Kluft: die Diskrepanz zwischen der GrûÑûe der Krise und der FûÊhigkeit der Menschen, sie wahrzunehmen und zu verstehen. Die Kontroverse û¥ber den Zustand des Planeten entfaltet sich, als die Erdbewohner aus ihren TrûÊumen erwachen und sich auf den Weg zu einer Baustelle machen, wo sich der Umriss einer riesigen Arche gegen den Himmel abzeichnet: Gab es nicht schon immer feuchte Sommer und milde Winter? Oder haben wir die Rû¥ckkoppelungsmechanismen der ErdoberflûÊche unwiderruflich destabilisiert, und Gaia wird uns ertrûÊnken wie kleine KûÊtzchen? Wie sollen wir mit den Monstern umgehen, die wir erschaffen haben? Warum kommt die wissenschaftliche Debatte zu keinem Abschluss? Sollen wir auch ohne absolute Gewissheit handeln? "Kosmokoloss" zeigt die Welt des "AnthropozûÊn": eine Welt, die von einer Spezies bewohnt und beschûÊdigt wurde, die nun zusehen muss, wie ihr drohendes Ende durch bunte PowerPoint-PrûÊsentationen verkû¥ndet wird. "Kosmokoloss" ist das erste Theaterstû¥ck des franzûÑsischen Philosophen und Anthropologen Bruno Latour. Auf der Suche nach einer "neuen Eloquenz" des Politischen ist das Theater eine mûÑgliche Form, um dem MissverhûÊltnis zwischen der Bedeutung der aktuellen Ereignisse und dem schmalen Repertoire der Empfindungen und Gefû¥hle, mit denen wir auf sie reagieren, zu begegnen. Die franzûÑsische Originalversion des Theaterstû¥cks entstand 2011 in Zusammenarbeit mit Frûˋdûˋrique Aû₤t-Touati und Chloûˋ Latour im Rahmen des Forschungs- und Theaterprojekts "Gaû₤a Global Circus". | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 21.11.2014
Datum: 21.11.2014Länge: 01:05:42 Größe: 60.16 MB |
||
| Mira Alexandra Schnoor: "Ich muss den Roman fertig kriegen! Jetzt! Jetzt!" Michail Bulgakow und sein Jahrhundertwerk "Meister und Margarita" - 21.09.2014 | ||
| Mit Beate Himmelstoû, Martin Umbach, Johannes Hitzelberger, Katja Schild, Benedikt Schregle / Realisation: Mira Alexandra Schnoor / BR 2014 / LûÊnge: 53'45 // Michail Bulgakow begann 1928 mit seinem Hauptwerk, dem Roman "Meister und Margarita"; zu einem Zeitpunkt, an dem er in der Sowjetunion massiv in seiner Arbeit als Schriftsteller behindert wurde: seine Prosatexte wurden nicht gedruckt, seine Theaterstû¥cke nicht aufgefû¥hrt, sogar seine Tagebû¥cher hatte die Geheimpolizei beschlagnahmt. Bulgakow, 1891 als Sohn eines Dozenten fû¥r Theologie in Kiew geboren, ein ausgebildeter Arzt, bis zum Verbot seiner Stû¥cke erfolgreicher Dramatiker, ein Autor brillanter satirischer ErzûÊhlungen, war ein unabhûÊngiger Geist, der sich den Parteidoktrinen und dem sowjetischen Kulturapparat widersetzte, der sich weigerte, Agitations- oder Propagandastû¥cke zu verfassen. In den 12 Jahren zwischen 1928 und 1940 schrieb Bulgakow nachts und in seiner spûÊrlichen freien Zeit an seinem Roman "Meister und Margarita". Seinen Lebensunterhalt musste er mehr schlecht als recht als Regieassistent und Librettist an Moskauer Theatern verdienen. Die zweite HûÊlfte der 1930er Jahre war die Zeit des ãGroûen Terrorsã in der Sowjetunion. Zahlreiche Menschen, Kû¥nstler, Arbeiter, Bolschewiki, Unpolitische, wurden grundlos verhaftet, gefoltert, verurteilt, getûÑtet, in Lager verbannt. Die AtmosphûÊre dieser Jahre prûÊgte nicht nur Bulgakows Leben, sondern auch seinen Roman. Als unangepasster Autor war er gefûÊhrdet, zudem litt er an einer vererbten schweren Nierenkrankheit, an der er 1940 im Alter von noch nicht 49 Jahren starb. Die letzten Fassungen des Romans diktierte er vom Krankenbett aus. ãErst fertigschreiben, dann sterbenã steht als verzweifeltes Motto und als Durchhalteparole auf einer dieser Fassungen. Seiner Frau Jelena, dem Vorbild der Margarita des Romans, ist es zu verdanken, dass der maschinengetippte Roman die Jahre des Krieges und der Nachkriegszeit û¥berstand. Aber erst 1966/1967, fast dreiûig Jahre nach dem Tod Bulgakows, erschien "Meister und Margarita" zum ersten Mal in einer zensierten und gekû¥rzten Fassung in der Sowjetunion. Die VerûÑffentlichung war eine Sensation, in Russland entdeckte man einen der wichtigsten Romane der Literatur des 20. Jahrhunderts. "Meister und Margarita" avancierte in der Sowjetunion und auch im Westen zum Kultbuch, dessen Faszination bis heute anhûÊlt. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 21.09.2014
Datum: 21.09.2014Länge: 00:53:50 Größe: 49.30 MB |
||
| Katharina TeichgrûÊber: "Brecht reichte mir flû¥chtig die Hand" - Peter Weiss und die Kampfsignale der Intelligenz - 29.08.2014 | ||
| Mit Thomas Palzer, Henriette Kaiser, Thomas Lang / Realisation: Katharina TeichgrûÊber / BR 2007 / LûÊnge: 46'22 // Seinerzeit gehûÑrte 'Die ûsthetik des Widerstands' zu den ganz wenigen umfangreichen Romanen, in denen man nicht verschwinden konnte: lesend fiel man auf sich selbst zurû¥ck, nahm quasi an GesprûÊchen und Auseinandersetzungen des Buchs teil, gab dem einen Recht und schû¥ttelte den Kopf û¥ber den anderen, staunte û¥ber die neuartige Deutung einiger klassischer Kunstwerke, die sozusagen absichtlich nicht objektiv war. Das ist doch kein Roman mehr! dachte man vielleicht ã aber wo wûÊren eigentlich die Grenzen des Romans? 30 Jahre sind vergangen und der Zeitgeist ist ein anderer. Die Perspektiven, die sich jetzt erûÑffnen auf diese monumentale literarische Skulptur, kûÑnnten sich weiterentwickelt haben. Denn hinter diesem Romanprojekt steckt eine unmûÑgliche Absicht und Herausforderung: Peter Weiss hat eine ûsthetik entwickelt, die sich gegen Unterdrû¥ckung jeder Art richtet und diese ûsthetik zugleich selber realisiert. Manch neidischer Blick gilt dieser Zeit vor den groûen Dekonstruktionen. Als habe man sich mit Wichtigerem befasst als mit Medien und mit dem ja auch KrûÊfte verzehrenden Ausbalancieren eigener ãIdentitûÊtã. Immer interessant ist die Erforschung der Wirklichkeit anhand von Theorien oder Lieblingsvorstellungen. Und der Prozess, in dem sich daraus formulierbare Erfahrungen gewinnen lassen. WûÊre sogesehen die ûÊsthetische Methode des Peter Weiss heute noch anwendbar? Ein Laborbericht. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 29.08.2014
Datum: 29.08.2014Länge: 00:46:28 Größe: 42.55 MB |
||
| Alfred Jarry: Heldentaten und Lehren des Dr. Faustroll (Pataphysiker) - 24.08.2014 | ||
| Mit Dirk von Lowtzow, Lars Rudolph, Alice Dwyer, Hans Jochen Wagner, Blake Worrell, Hitomi Makino / ûbersetzung aus dem FranzûÑsischen: Irmgard Hartwig/Klaus VûÑlker / Bearbeitung, Komposition und Realisation: zeitblom / BR 2014 / LûÊnge: 50'50 // Der Roman Die Heldentaten und Lehren des Dr. Faustroll (Pataphysiker) des franzûÑsischen Schriftstellers und Bohû´mien Alfred Jarry ist Parodie einer Heldenreise, Ansammlung wissenschaftlich-mathematischer Traktate, neowissenschaftlicher Roman und vor allem Grû¥ndungsdokument der 'Pataphysikã, der "Wissenschaft von den imaginûÊren LûÑsungen", mit der Jarry zahlreiche Kû¥nstler und Theoretiker des 20. Jahrhunderts beeinflusste. Zwischen 1898 und 1903 in diversen Zeitschriften fragmentarisch erschienen, wurde die erste Gesamtausgabe von Die Heldentaten und Lehren des Dr. Faustroll erst 1911 postum verûÑffentlicht. Die im Deutschen vorliegende Fassung erschien 1968 und wurde aus verschiedenen handschriftlichen Quellen erstellt. Narrativer Kern des von Paradoxie und Irrwitz geprûÊgten Textes ist die Reise des Pataphysikers Dr. Faustroll in seinem Boot As ãZu Wasser von Paris nach Parisã, also eine Schiffsreise auf festem Land. In Begleitung des Gerichtsvollziehers und ErzûÊhlers Panmuffel sowie des Pavians Backenbuckel vollzieht Dr. Faustroll eine Irrfahrt durch surreale Kopf- und Traumwelten. Daneben setzt sich der Roman aus Abhandlungen, Briefen und mathematischen Formeln zusammen, allesamt Bestandteile der Lehren des Pataphysikers Dr. Faustroll. GeprûÊgt von û¥berbordender IntertextualitûÊt, lustvollem Sprachspiel und Bezû¥gen auf diverse theoretische Diskurse ist Die Heldentaten und Lehren des Dr. Faustroll nicht nur ein Text û¥ber die Pataphysik, sondern zugleich deren Vollzug. Im Gedankenkosmos Jarrys und Faustrolls ist die Pataphysik die Wissenschaft von der Vorstellungskraft, ihr liegt alles zugrunde. In dieser Wissenschaft jenseits von Physik und Metaphysik sind die Ausnahmen die Regel und alle Dinge vom Zufall bestimmt. ãDie von ihrem Ursprung unendlich nach auûen strebende Spirale ist Symbol dieser Wissenschaft, diente schon in Jarrys KûÑnig Ubu als Leitmotiv und bildet eine gliedernde Struktur des spûÊteren Romans. Ganz im Sinne dieser Konzeption wird auch das HûÑrstû¥ck zu einer Odyssee der akustischen Verschiebungen und Halluzinationen, eine elektroakustische Neo-Radio-Oper die sich irrend und wirrend im Sog der Spirale durch dystopisch futuristische Soundscapes, verschwommene Texturen, sinistren Dub, Mikro Loops, verdrehte Algorithmen und Lo-Fi ûsthetik bewegt. Bruchstû¥ckhafte und unkonzentrierte Loop Poesie, eine Art Kammerspiel im Raum der Groûstadt Paris. Man meint Bekanntem zu begegnen, doch man erkennt nichts, kein Zeitgefû¥hl, man verirrt sich, es ist dunkel. Die Pataphysik ist das Ende aller Enden. Erste und letzte Instanz. Faustroll stirbt in dem Alter, in dem er geboren wurde. ãJenseits der Pataphysik ist nichts; sie ist die letzte Instanz.ãã (zeitblom) | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 24.08.2014
Datum: 24.08.2014Länge: 00:50:55 Größe: 46.63 MB |
||
| Andreas Ammer: Kaiser Wilhelm Overdrive - Original-Sound-Fragmente vom deutschen Weltkrieg 1914 - 22.08.2014 | ||
|
Mit Detlef Kû¥gow, Lars Kurz / Realisation: Andreas Ammer / BR 1991 / LûÊnge: 20'21 // DEUTSCHLAND 1914, der Phonograph brû¥llt: "Jeder Schuû ein Ruû! Jeder Stoû ein Franzos'! Jeder Tritt ein Britã'!". KammersûÊnger Caruso und Kaiser Wilhelm schreien Schalltrichter an, damit ihre Befehle leben fû¥r alle Zeiten. Grammophone halten Wacht am Rhein. Das Rauschen der Apparate programmiert den nationalen Rausch. Fû¥r die Klang-Speicher werden Schlachten in Echtzeit simuliert. Niemand wird nachher sagen kûÑnnen er habe nichts gehûÑrt. Und das Medium ist das Messer im Ohr der Massen - "HURRA!" DEUTSCHLAND ECHTZEIT, Klangverarbeitung: modernste Technologien tanzen in Vielspur auf dem Weltkrieg herum: Der "Kaiser Wilhelm Overdrive" koppelt sich in den akustischen Cyberspache zurû¥ck. Simultanhistorie. Phonographenphantasie. Soundstrukturalismus. Der "Kaiser Wilhelm Overdrive" verarbeitet nur wirklich echte TûÑne, die ein Dreivierteljahrhundert lang gespeichert wurden - Krieg ist Klang, bis Hirne nichts als SOUND sind. DEUTSCHLAND 1914, der Phonograph brû¥llt: ãJeder Schuû ein Ruû! Jeder Stoû ein Franzosã! Jeder Tritt ein Britã!ã. KammersûÊnger Caruso und Kaiser Wilhelm schreien Schalltrichter an, damit ihre Befehle leben fû¥r alle Zeiten. Grammophone halten Wacht am Rhein. Das Rauschen der Apparate programmiert den nationalen Rausch. Fû¥r die Klang-Speicher werden Schlachten in Echtzeit simuliert. Niemand wird nachher sagen kûÑnnen, er habe nichts gehûÑrt. Und das Medium ist das Messer im Ohr der Massen ã ãHURRAH!ã
DEUTSCHLAND ECHTZEIT, Klangverarbeitung: modernste Technologien tanzen in Vielspur auf dem Weltkrieg herum: Der Kaiser Wilhelm Overdrive koppelt sich in den akustischen Cyberspace zurû¥ck. Simultanhistorie. Phonographenphantasie. Soundstrukturalismus. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 22.08.2014
Datum: 22.08.2014Länge: 00:20:41 Größe: 14.24 MB |
||
| Raoul Schrott: Tristan da Cunha oder Die HûÊlfte der Erde (3/3): Die Vierte Welt - 17.08.2014 | ||
| Mit Friedhelm Ptok, Christian Redl, Jens Harzer, Sophie von Kessel, Kathrin Angerer / Bearbeitung: Michael Farin / Komposition:Helga Pogatschar / Regie: Ulrich Lampen / BR 2003 / LûÊnge: 57'32 // Kein Ort der Welt ist weiter entfernt von jeder menschlichen Siedlung als Tristan da Cunha, ein Vulkan mitten im Atlantik, im Dreieck zwischen Brasilien, der Antarktis und Sû¥dafrika. Und dennoch wird diese Insel, die gerade einmal zehn Kilometer Durchmesser hat, zur "Mitte der Zeit" und zur "Mitte der Welt" fû¥r vier Personen, deren Schicksale sich hier û¥ber Jahrhunderte hinweg kreuzen. Noomi Morholt, eine sû¥dafrikanische Wissenschaftlerin, die im Jahr 2003 unterwegs ist zu ihrer Forschungsstation im arktischen Eis. Edwin Heron Dodgson, ein anglikanischer Priester - Bruder des Schriftstellers Lewis Carroll -, der am Ende des 19. Jahrhunderts die Inselbewohner missionieren soll. Christian Reval, der im 2. Weltkrieg als Funker auf Tristan da Cunha stationiert war und die Insel zum ersten Mal vermessen hat, auf dem Weg in die Antarktis aber unter ungeklûÊrten UmstûÊnden stirbt. Der Briefmarkensammler Mark Thompson, der anhand seiner Briefmarken die Entdeckung der Insel und ihre Geschichte rekonstruiert - und zugleich die Geschichte seiner gescheiterten Ehe: ãAch Marah; was versteht er von dieser unserer Insel? Was weiû er um ihre Utopie? Glaubst du wirklich, van Houten hûÊtte dort etwas von diesem Nachmittag gesehen, der immer û¥ber diesem Land liegt, der Nacht, die vor meinen Augen hoch û¥ber den Horizont gebannt scheint, dem Wasserfall, der wie vom Wind abwûÊrts gedrû¥ckter Rauch û¥ber der Klippe hûÊngt und noch im Fallen innezuhalten scheint? Den VûÑgeln wie eine Erinnerung an eine Schrift der Luft; ein dunkler blauer Himmel û¥ber einer blau dunklen See.ã Raoul Schrott hat mit ãTristan da Cunhaã ein vielschichtiges ErzûÊhlwerk geschaffen, in dem sich schroffe Landschaften mit Geschichten von Menschen verknû¥pfen, die versuchen, ganz verschiedene Vorstellungen von Liebe zu verwirklichen - inmitten des Sturms, der alle Jahrhunderte einmal die Insel verwû¥stet. EigenstûÊndige ErzûÊhlstrûÊnge fû¥gen sich zu einem vierstimmigen Kanon: Eine Komposition, in der sich Fiktion und Historie verbinden, Figuren und ihre Sehnsû¥chte im Licht des Mythos von Tristan und Isolde. Mit Blick auf die fernste Insel der Welt entwirft Raoul Schrott eine Geschichte der Welt - und zeichnet dabei, wie zufûÊllig, ein umfassendes Bild des menschlichen Lebens. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 17.08.2014
Datum: 17.08.2014Länge: 00:56:36 Größe: 51.83 MB |
||
| Raoul Schrott: Tristan da Cunha oder Die HûÊlfte der Erde (2/3): Die Mitte der Zeit - 10.08.2014 | ||
| Mit Friedhelm Ptok, Christian Redl, Jens Harzer, Sophie von Kessel, Kathrin Angerer / Bearbeitung: Michael Farin / Komposition:Helga Pogatschar / Regie: Ulrich Lampen / BR 2003 / LûÊnge: 57'56 // Kein Ort der Welt ist weiter entfernt von jeder menschlichen Siedlung als Tristan da Cunha, ein Vulkan mitten im Atlantik, im Dreieck zwischen Brasilien, der Antarktis und Sû¥dafrika. Und dennoch wird diese Insel, die gerade einmal zehn Kilometer Durchmesser hat, zur "Mitte der Zeit" und zur "Mitte der Welt" fû¥r vier Personen, deren Schicksale sich hier û¥ber Jahrhunderte hinweg kreuzen. Noomi Morholt, eine sû¥dafrikanische Wissenschaftlerin, die im Jahr 2003 unterwegs ist zu ihrer Forschungsstation im arktischen Eis. Edwin Heron Dodgson, ein anglikanischer Priester - Bruder des Schriftstellers Lewis Carroll -, der am Ende des 19. Jahrhunderts die Inselbewohner missionieren soll. Christian Reval, der im 2. Weltkrieg als Funker auf Tristan da Cunha stationiert war und die Insel zum ersten Mal vermessen hat, auf dem Weg in die Antarktis aber unter ungeklûÊrten UmstûÊnden stirbt. Der Briefmarkensammler Mark Thompson, der anhand seiner Briefmarken die Entdeckung der Insel und ihre Geschichte rekonstruiert - und zugleich die Geschichte seiner gescheiterten Ehe: ãAch Marah; was versteht er von dieser unserer Insel? Was weiû er um ihre Utopie? Glaubst du wirklich, van Houten hûÊtte dort etwas von diesem Nachmittag gesehen, der immer û¥ber diesem Land liegt, der Nacht, die vor meinen Augen hoch û¥ber den Horizont gebannt scheint, dem Wasserfall, der wie vom Wind abwûÊrts gedrû¥ckter Rauch û¥ber der Klippe hûÊngt und noch im Fallen innezuhalten scheint? Den VûÑgeln wie eine Erinnerung an eine Schrift der Luft; ein dunkler blauer Himmel û¥ber einer blau dunklen See.ã Raoul Schrott hat mit ãTristan da Cunhaã ein vielschichtiges ErzûÊhlwerk geschaffen, in dem sich schroffe Landschaften mit Geschichten von Menschen verknû¥pfen, die versuchen, ganz verschiedene Vorstellungen von Liebe zu verwirklichen - inmitten des Sturms, der alle Jahrhunderte einmal die Insel verwû¥stet. EigenstûÊndige ErzûÊhlstrûÊnge fû¥gen sich zu einem vierstimmigen Kanon: Eine Komposition, in der sich Fiktion und Historie verbinden, Figuren und ihre Sehnsû¥chte im Licht des Mythos von Tristan und Isolde. Mit Blick auf die fernste Insel der Welt entwirft Raoul Schrott eine Geschichte der Welt - und zeichnet dabei, wie zufûÊllig, ein umfassendes Bild des menschlichen Lebens. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 10.08.2014
Datum: 10.08.2014Länge: 00:56:36 Größe: 51.83 MB |
||
| Raoul Schrott: Tristan da Cunha oder Die HûÊlfte der Erde (1/3): Die Insel - 03.08.2014 | ||
|
Mit Friedhelm Ptok, Christian Redl, Jens Harzer, Sophie von Kessel, Kathrin Angerer / Bearbeitung: Michael Farin / Komposition:Helga Pogatschar / Regie: Ulrich Lampen / BR 2003 / LûÊnge: 54'02 // Kein Ort der Welt ist weiter entfernt von jeder menschlichen Siedlung als Tristan da Cunha, ein Vulkan mitten im Atlantik, im Dreieck zwischen Brasilien, der Antarktis und Sû¥dafrika. Und dennoch wird diese Insel, die gerade einmal zehn Kilometer Durchmesser hat, zur "Mitte der Zeit" und zur "Mitte der Welt" fû¥r vier Personen, deren Schicksale sich hier û¥ber Jahrhunderte hinweg kreuzen. Noomi Morholt, eine sû¥dafrikanische Wissenschaftlerin, die im Jahr 2003 unterwegs ist zu ihrer Forschungsstation im arktischen Eis. Edwin Heron Dodgson, ein anglikanischer Priester - Bruder des Schriftstellers Lewis Carroll -, der am Ende des 19. Jahrhunderts die Inselbewohner missionieren soll. Christian Reval, der im 2. Weltkrieg als Funker auf Tristan da Cunha stationiert war und die Insel zum ersten Mal vermessen hat, auf dem Weg in die Antarktis aber unter ungeklûÊrten UmstûÊnden stirbt. Der Briefmarkensammler Mark Thompson, der anhand seiner Briefmarken die Entdeckung der Insel und ihre Geschichte rekonstruiert - und zugleich die Geschichte seiner gescheiterten Ehe: ãAch Marah; was versteht er von dieser unserer Insel? Was weiû er um ihre Utopie? Glaubst du wirklich, van Houten hûÊtte dort etwas von diesem Nachmittag gesehen, der immer û¥ber diesem Land liegt, der Nacht, die vor meinen Augen hoch û¥ber den Horizont gebannt scheint, dem Wasserfall, der wie vom Wind abwûÊrts gedrû¥ckter Rauch û¥ber der Klippe hûÊngt und noch im Fallen innezuhalten scheint? Den VûÑgeln wie eine Erinnerung an eine Schrift der Luft; ein dunkler blauer Himmel û¥ber einer blau dunklen See.ã
Raoul Schrott hat mit ãTristan da Cunhaã ein vielschichtiges ErzûÊhlwerk geschaffen, in dem sich schroffe Landschaften mit Geschichten von Menschen verknû¥pfen, die versuchen, ganz verschiedene Vorstellungen von Liebe zu verwirklichen - inmitten des Sturms, der alle Jahrhunderte einmal die Insel verwû¥stet. EigenstûÊndige ErzûÊhlstrûÊnge fû¥gen sich zu einem vierstimmigen Kanon: Eine Komposition, in der sich Fiktion und Historie verbinden, Figuren und ihre Sehnsû¥chte im Licht des Mythos von Tristan und Isolde. Mit Blick auf die fernste Insel der Welt entwirft Raoul Schrott eine Geschichte der Welt - und zeichnet dabei, wie zufûÊllig, ein umfassendes Bild des menschlichen Lebens. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 03.08.2014
Datum: 03.08.2014Länge: 00:54:10 Größe: 49.59 MB |
||
| Christoph Buggert: Der blaue Vogel - 27.07.2014 | ||
| Mit Matthias Fuchs, Cordula Trantow, Ulrich Beiger, Wolf Ackva, Claudia Bethge, Alois Maria Giani, Karl Michael Vogler u.a. / Regie: Hermann Wenninger / BR 1961 / LûÊnge: 48'06 // Was ist an dem Abend, als Ulrich und Winnie sich am Strand voneinander verabschiedet haben passiert? Warum ist Winnie an jenem Abend ins Meer hinaus geschwommen und nie wieder zurû¥ckgekehrt? Das UnerklûÊrbare und das Unwissen û¥ber die Motive von Winnie treiben sowohl Ulrich in den Wahnsinn, als auch sein Umfeld in ein RûÊtsel, dass sie hilflos aufzulûÑsen versuchen. Ulrich hatte die dûÊnische Schû¥lerin Winnie in einem Landheim an der Ostsee kennengelernt. Die beiden fû¥hlen sich schnell zueinander hingezogen, verlieben sich bei GesprûÊchen am Strand ineinander. Nach dem rûÊtselhaften Abend verliert Ulrich, der von der Polizei zunûÊchst verdûÊchtigt wird, û¥ber den Tod seiner Freundin den Verstand: Er entwickelt paranoide Phantasien, wird von ûrzten bedrûÊngt und schlieûlich in ein Sanatorium eingeliefert. Dort lernt er den MûÑrder Gottfried Rahn kennen, der sein Freund und Vertrauter wird, aber in der Klinik Selbstmord begeht. Ein Zeichen fû¥r Ulrich, dem Wahn zu entfliehen. Ein irreales ZwiegesprûÊch zwischen Ulrich und Winnie wird zur Chance, das Erlebte noch einmal aufleben zu lassen und vielleicht trotz aller Unklarheit û¥ber die Wahrheit Heilung zu finden. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 27.07.2014
Datum: 27.07.2014Länge: 00:48:42 Größe: 44.59 MB |
||
| Sung Hwan Kim: Howl bowel owl - 18.07.2014 | ||
| Mit Yoonjin Kim, David Michael DiGregorio, Sung Hwan Kim, Kim Geum Hwa / Komposition und Realisation:Sung Hwan Kim/David Michael DiGregorio / BR 2013/ LûÊnge: 33'58 // Typisch fû¥r die intermedialen Arbeiten Sung Hwan Kims, die oft in Zusammenarbeit mit dem Musiker David Michael DiGregorio alias dogr entstehen, ist es, unterschiedliche Kunstgattungen und Medien - Performance, Video, Zeichnung, Installation und HûÑrspiel - miteinander zu verbinden, und dabei jeden Schritt der Erstellung eines Werkes selbst zu vollziehen : als Regisseur, Cutter, Darsteller, Komponist, ErzûÊhler und Autor. Am Anfang eines Prozesses, der ein neues Werk entstehen lûÊsst, kûÑnnen ein Wort, eine Geschichte, eine Erfahrung, ein Gedanke stehen. Fast immer gibt es Bezû¥ge zu frû¥heren Arbeiten, z.B. werden Ton- oder Bildaufnahmen zum Ausgangspunkt fû¥r neue Werke. Fû¥r "Howl bowel Owl" nennt Sung Nachahmung, Wiederholung, Reim und Rhythmus als konzeptionelle Stilmittel und bezieht sich u. a. auf Gedichte Rainer Maria Rilkes, namentlich auf ûbung am Klavier, Zehnte Elegie sowie Leichen-WûÊsche. Zu der BeschûÊftigung mit Rilke kam er vor einigen Jahren durch die Lektû¥re der Poetik des Raums des Philosophen Gaston Bachelard. Zentral fû¥r Bachelards Poetik ist das Bild des Erinnerungsraums im menschlichen Bewuûtsein. Mit Rilke teilt Sung das Interesse fû¥r TrûÊume, Geschichten, Mythen und fû¥r deren Transformation in Sprache und Form. "Howl bowel owl" ist das zweite HûÑrspiel, das der koreanische Kû¥nstler Sung Hwan Kim zusammen mit dem Musiker David Michael DiGregorio alias dogr fû¥r den BR produziert hat. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 18.07.2014
Datum: 18.07.2014Länge: 00:33:58 Größe: 31.10 MB |
||
| Oskar Panizza: Das Liebeskonzil (2/2) - 11.07.2014 | ||
|
Mit Ravael Jovûˋ, Josef Ostendorf, Peter Simonischek, Graham F. Valentine / Komposition: Daniel Dickmeis / Realisation: Ulrich Gerhardt / BR 2014/ LûÊnge: 75'07 // Nachdem Gott von den menschlichen Sû¥nden auf Erden erfahren hat, verhandelt er mit dem Teufel einen Pakt. In diesem hat der Teufel das Recht auf ein prûÊchtiges Portal fû¥r die heruntergekommene HûÑlle, unangemeldete Sprechstunden mit Gott und vor allem die Freiheit, seine Gedanken zu verbreiten. Im Gegenzug solle er jedoch eine grausame Strafe fû¥r die Auswû¥chse auf Erden erfinden. Der Teufel erschafft eine Krankheit, die sich Schritt fû¥r Schritt auf der Welt ausbreitet: die Syphilis.
Noch im Erscheinungsjahr 1894 musste sich Oskar Panizza wegen des antikatholischen Stû¥ckes vor Gericht verantworten und wurde in 99 FûÊllen der GotteslûÊsterung fû¥r schuldig befunden und zu einem Jahr Freiheitsentzug verurteilt. Daraufhin fand Das Liebeskonzil kaum Verbreitung. Erst 1913 erschien eine auf 50 Exemplare limitierte Privatausgabe fû¥r die ãGesellschaft der Mû¥nchner Bibliophilenã. Doch an eine uneingeschrûÊnkte Verbreitung war auch nach der Aufhebung der Zensur nicht zu denken, da sich Panizzas Familie weigerte, die Urheberrechte fû¥r Neuauflagen freizugeben. Das HûÑrspiel beruht auf der ungekû¥rzten Textfassung. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 11.07.2014
Datum: 11.07.2014Länge: 01:15:13 Größe: 68.87 MB |
||
| Oskar Panizza: Das Liebeskonzil (1/2) - 04.07.2014 | ||
|
Mit Ravael Jovûˋ, Josef Ostendorf, Peter Simonischek, Graham F. Valentine / Komposition: Daniel Dickmeis / Realisation: Ulrich Gerhardt / BR 2014/ LûÊnge: 68'47 // Nachdem Gott von den menschlichen Sû¥nden auf Erden erfahren hat, verhandelt er mit dem Teufel einen Pakt. In diesem hat der Teufel das Recht auf ein prûÊchtiges Portal fû¥r die heruntergekommene HûÑlle, unangemeldete Sprechstunden mit Gott und vor allem die Freiheit, seine Gedanken zu verbreiten. Im Gegenzug solle er jedoch eine grausame Strafe fû¥r die Auswû¥chse auf Erden erfinden. Der Teufel erschafft eine Krankheit, die sich Schritt fû¥r Schritt auf der Welt ausbreitet: die Syphilis.
Noch im Erscheinungsjahr 1894 musste sich Oskar Panizza wegen des antikatholischen Stû¥ckes vor Gericht verantworten und wurde in 99 FûÊllen der GotteslûÊsterung fû¥r schuldig befunden und zu einem Jahr Freiheitsentzug verurteilt. Daraufhin fand Das Liebeskonzil kaum Verbreitung. Erst 1913 erschien eine auf 50 Exemplare limitierte Privatausgabe fû¥r die ãGesellschaft der Mû¥nchner Bibliophilenã. Doch an eine uneingeschrûÊnkte Verbreitung war auch nach der Aufhebung der Zensur nicht zu denken, da sich Panizzas Familie weigerte, die Urheberrechte fû¥r Neuauflagen freizugeben. Das HûÑrspiel beruht auf der ungekû¥rzten Textfassung. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 04.07.2014
Datum: 04.07.2014Länge: 01:08:52 Größe: 63.06 MB |
||
| Raoul Schrott: Erste Erde Epos: VI. Letztes Bombardement - 28.06.2014 | ||
| Mit Kathrin Angerer, Bibiana Beglau, Jens Harzer, Tobias Lelle, Martin Umbach, Hanns Zischler / Komposition: Saam Schlamminger / Regie: Michael Farin / BR 2014 / LûÊnge: 39'06 // "Nie zuvor gab es so viel an Wissen û¥ber den Menschen und das Universum - doch je mehr Daten und Details angehûÊuft werden, desto weniger verstehen wir im Grunde. Wir wissen zwar, dass die alten Mythen nicht mehr stimmig sind - eine andere Geschichte, die uns und die Welt erklûÊrt, gibt es jedoch nicht." Raoul Schrott Bis lange nach der Entstehung ersten Lebens wurde die Erde immer wieder von Asteroiden- und Kometenschauern getroffen, die deren OberflûÊche mit Metallen anreicherte und die Wasser mit sich brachten. Spuren dieses "Letzten Groûen Bombardements" finden sich in den Mondkratern. Aus nûÊchster NûÊhe gesehen wurden sie erstmals 1968, von den Astronauten der Mission Apollo 8, die die tote Leere des Mondes zutiefst beeindruckte. Eine MûÑglichkeit, sich diese gewaltigen EinschlûÊge vorzustellen, bietet der Bericht des Gervasius zur Sonnwende 1178. In seiner Chronik schildert er, wie seine Mitbrû¥der und er beim Bau der Kathedrale von Canterbury einen solchen Impakt auf dem Mond zu beobachten glaubten. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 28.06.2014
Datum: 28.06.2014Länge: 00:39:12 Größe: 35.90 MB |
||
| Erste Erde Forum: VIII. Sternenbildung, kollabierende Wolken und Supernova - Mit Achim Gandorfer - 28.06.2014 | ||
| Raoul Schrott (Dichter) im GesprûÊch mit dem Astrophysiker Dr. Achim Gandorfer: Sternenbildung, kollabierende Wolken und Supernova | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 28.06.2014
Datum: 28.06.2014Länge: 01:06:20 Größe: 60.74 MB |
||
| Erste Erde Forum: VII. Himmelsmechanik, exzentrische Erdbahnen, Sonnensystem - Mit Ulrich R. Christensen - 21.06.2014 | ||
| Raoul Schrott (Dichter) im GesprûÊch mit dem Geophysiker und Sonnensystemforscher Prof. Dr. Ulrich R. Christensen: Himmelsmechanik, exzentrische Erdbahnen, Sonnensystem | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 21.06.2014
Datum: 21.06.2014Länge: 01:01:16 Größe: 56.10 MB |
||
| Raoul Schrott: Erste Erde Epos: V. Erste Erde - 21.06.2014 | ||
| Mit Bibiana Beglau, Jens Harzer, Anne Ratte-Polle, Martin Umbach / Komposition: Saam Schlamminger / Regie: Michael Farin / LûÊnge: 50'08 / "Nie zuvor gab es so viel an Wissen û¥ber den Menschen und das Universum - doch je mehr Daten und Details angehûÊuft werden, desto weniger verstehen wir im Grunde. Wir wissen zwar, dass die alten Mythen nicht mehr stimmig sind - eine andere Geschichte, die uns und die Welt erklûÊrt, gibt es jedoch nicht." Raoul Schrott Eine Reise in die kanadischen Northwestern Territories: zuerst nach Yellowknife, der nûÑrdlichsten Stadt, dann mit einem Wasserflugzeug weiter in die Taiga unterhalb des Polarkreises. Im Kanu und mit einem Inuit als Fû¥hrer geht es den Fluss Acasta hinunter. In einer Stromschnelle gehen Ausrû¥stung, Essen, Karten und Gewehr verloren. Das Ziel wird dennoch erreicht: die ûÊltesten erhaltenen Gesteinsschichten ã 4,01 Milliarden Jahre alt ã ûberreste des allerersten Landes, das sich im Ozean der frû¥hen Erde bildete. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 21.06.2014
Datum: 21.06.2014Länge: 00:50:15 Größe: 46.01 MB |
||
| Erste Erde Forum: VI. Geologische Zeitrechnung, Magma und kontinentale Kruste - Mit Elis Hoffmann - 14.06.2014 | ||
| Raoul Schrott (Dichter) im GesprûÊch mit dem Geochemiker Dr. rer. nat. J. Elis Hoffmann: Geologische Zeitrechnung, Magma und kontinentale Kruste | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 14.06.2014
Datum: 14.06.2014Länge: 00:50:35 Größe: 46.31 MB |
||
| Raoul Schrott: Erste Erde Epos: IV. Erster Himmel - 14.06.2014 | ||
| Mit Bibiana Beglau, Raoul Schrott, Martin Umbach / Komposition: Saam Schlamminger / Regie: Michael Farin / BR 2014 / LûÊnge: 54'47 / "Nie zuvor gab es so viel an Wissen û¥ber den Menschen und das Universum - doch je mehr Daten und Details angehûÊuft werden, desto weniger verstehen wir im Grunde. Wir wissen zwar, dass die alten Mythen nicht mehr stimmig sind - eine andere Geschichte, die uns und die Welt erklûÊrt, gibt es jedoch nicht." Raoul Schrott Sylvester: Ein Vater erklûÊrt seiner Tochter anhand einer im Schnee erloschenen Rakete wie das Sonnensystem entstand und welche Figuren man im Mond sieht: chinesische Hasen etwa oder altgriechische Totenfelder. ErzûÊhlt wird auch von der Besteigung des Erta Alûˋ, eines aktiven Vulkans in der ûÊthiopischen Danakil-Wû¥ste, und dass sich an ihm veranschaulichen lûÊsst, wie der Mond entstand: Wenige Millionen Jahre, nachdem die Erde sich aus der Staubwolke um die Sonne bildete, prallte sie mit einem marsgrossen "Theia" genannten Planeten zusammen, der in ihr aufging. Aus der Materie, die dabei in den Raum geschleudert wurde, formte sich der Mond, der der Erde in ihrer Frû¥hzeit weit nûÊher war als heute. Damals im Hadaikum, ihrer "HûÑllenzeit", waren beide schwarz, denselben vulkanischen Prozessen unterworfen. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 14.06.2014
Datum: 14.06.2014Länge: 00:54:54 Größe: 50.27 MB |
||
| Ergo Phizmiz: Hollywood: A Bestiary - 06.06.2014 | ||
|
Live-Studioperformance. Audio-Mitschnitt am 06.06.2014. Mit Kathrin von Steinburg, Sebastian Weber, Ergo Phizmiz / Klavier: Robert Lee / Komposition und Realisation: Ergo Phizmiz / BR 2014 // ãIm Innersten gehûÑrt das Kino zur Kosmetikindustrie, zur Industrie der Masken, die ihrerseits nur eine winzige Filiale der Lû¥genindustrie istã, erkannte Jean-Luc Godard, der schon 1967 das Kino tot gesagt hatte. Bezugnehmend auf diese Worte sammelt Phizmiz Tierlegenden der frû¥hen Jahre Hollywoods in einem Bestiarium, dokumentiert in alphabetischer Reihenfolge die damit verbundenen Lû¥gen und Wahrheiten einer Unterhaltungsindustrie und lûÊsst zugleich spielerisch den Mythos Hollywood wieder aufleben: Mit dem immens groûen Elefant aus Pappmachûˋ des Kinopioniers D.W. Griffith oder Laurel & Hardy, die sich vor einem LûÑwen mit Namen MGM auf ein Klavier retten. Phizmiz entwirft eine phantastische Welt, in der schielende SchildkrûÑten als Orakel fû¥r potentielle Filmproduktionen genauso ihren Platz finden wie Charles Gemora, Hollywoods ãking of the gorilla menã.
Ergo Phizmiz beschûÊftigt sich in seinen Arbeiten vielfach mit den Mythologien vergangener Epochen und der dû¥nnen Linie zwischen Wahrheit und Fiktion. Er behauptet, von der Vorstellung besessen zu sein, Bilder in Klang zu verwandeln und damit etwas UnmûÑgliches heraufzubeschwûÑren. Phizmiz weiû die Suggestiv-KrûÊfte und Traditionen des Radios zu nutzen, er spielt mit den Elementen des Dialogs, der Collage, der musikalischen Komposition und des Sounddesigns und schafft zahlreiche Querverweise zwischen Film und akustischen Medien. Ausgestattet mit einem Plattenspieler, Megaphon, drei Mikrofonen und einem Klavier, wirft Phizmiz ã als Regisseur, Darsteller, MC, DJ ã in der Live Performance von Hollywood: A Bestiary die Illusionsmaschine an und geht der Frage Godards nach, was von der Traumfabrik geblieben ist, inwieweit Hollywood nur die Erinnerung an einen abgenutzten Traum ist, der nur noch in den schwarz-weiû Filmen des frû¥hen amerikanischen Kinos zu finden ist. Neben der deutschen und der englischen Sprache, lûÊsst Phizmiz Fakt und Fiktion des frû¥hen 20. Jahrhunderts verschmelzen. Nicht zuletzt, weil er die alten Hollywoodsoundtracks neu komponiert hat, die er dann in der Radio-Show auflegt. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 06.06.2014
Datum: 06.06.2014Länge: 00:46:08 Größe: 42.25 MB |
||
| Robert Lax: sun ra notes & numbers - 23.05.2014 | ||
|
Mit Robert Lax / BR 1999 / LûÊnge: 50'31 // 1984 spielten Sun Ra und sein Arkestra in Athen. Das Konzert fand am 27. Februar im Orpheus Theater statt. Es ist, wie der Sun Ra-Discograph Hartmut Geerken feststellte, das einzige Konzert des Arkestra, das vollstûÊndig bis zur letzten Note auf drei Vinylplatten festgehalten wurde. Lax, der bisher den Musiker nur von Platten und aus ErzûÊhlungen von Geerken kannte, kam extra fû¥r dieses Konzert von seiner Insel aufs Festland. Er lieû keine MûÑglichkeit aus, mit Sun Ra und seinen 12 Musikern zusammenzusitzen, sie zu fotografieren und sich Notizen zu machen, die quasi fotorealistisch oft winzige Begebenheiten zum Gegenstand haben. "I asked him: when did you first start thinking about outer space. S R: when I went there. (then he told me the story".
Sun Ra war nicht nur Komponist, Pianist und afroamerikanischer Bandleader. Seine SpiritualitûÊt, die nicht an eine der Weltreligionen gebunden war, unterscheidet ihn von anderen Jazzmusikern. Diese Art von SpiritualitûÊt ist es wohl auch, die ihn mit Robert Lax verbindet, beiden gemeinsam ist auch der folgerichtige Rû¥ckzug aus dieser Welt. Lax lebte fast vierzig Jahre als Eremit auf den Inseln Lesbos, Kalymnos und Patmos. Sun Ra sah sich seit Mitte der 50er Jahre ebenso nicht mehr als Teil dieser Welt und zog sich zurû¥ck in einen omniversalen Mythos: "this planet is not my home". |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 23.05.2014
Datum: 23.05.2014Länge: 00:50:10 Größe: 45.94 MB |
||
| Michaela MeliûÀn: IN A MIST - 16.05.2014 | ||
|
HûÑrstû¥ck zum Theatertext Fritz Bauer / Von W. Selichowa und Natalia Saz, Moskau 1929 / Mit Stefan Hunstein, Edmund TelgenkûÊmper, Wiebke Puls, Thomas Schmauser, Annette Paulmann, Hans Kremer, Wolfgang Pregler, ûigdem Teke, Peter Brombacher, Angelika Krautzberger, Oliver Mallison, Juno Meinecke, Marina Lindemann, Caroline Ebner, Stefan Hunstein, Stefan Merki, Felix Raeithel / Komposition und Realisation: Michaela MeliûÀn / BR/HûÑrspiel und Medienkunst in Zusammenarbeit mit den Mû¥nchner Kammerspielen und dem Badischen Kunstverein Karlsruhe 2014 / LûÊnge: 107.39 // Ausgangspunkt fû¥r das Audioprojekt IN A MIST ist das Theaterstû¥ck Fritz Bauer, das 1928/1929 in Moskau von einer Gruppe von revolutionûÊren Kû¥nstlern (Natalia Saz, W.A. Selichowa, Georgi Golts und Dr. Bernhard Reich) geschrieben und inszeniert wurde. Dem Stû¥ck war als Bû¥hnenanweisung vorangestellt: ãDie Handlung spielt in Bayern zu unserer Zeit.ã Nach der Urauffû¥hrung 1929 hatte das Moskauer Theater fû¥r Kinder das Theaterstû¥ck drei Jahre lang auf seinem Spielplan, in dieser Zeit wurde es 311-mal innerhalb der Sowjetunion aufgefû¥hrt, seither nicht mehr.
Fritz Bauer ist laut Natalia Saz das erste Stû¥ck des Moskauer Theaters fû¥r Kinder, das auf die internationale Erziehung von Kindern im ãmittleren und fortgeschrittenen Pionieralterã ausgerichtet war. Aus der sowjetischen Perspektive soll der Klassenkampf in Deutschland gezeigt werden, die schweren Bedingungen, unter denen die Arbeiterfamilien leben: Der kommunistische Arbeiter Karl Bauer ist wegen der Planung eines Streiks gezwungen, in die IllegalitûÊt zu gehen, da ihn die Polizei sucht. Seine Familie bleibt ohne Existenzgrundlage zurû¥ck. Mit allen Mitteln versucht die Gendarmerie von seinem Sohn Fritz Bauer das Versteck seines Vaters zu erfahren. Viele im Stû¥ck angesprochenen Themen sind auch heute virulent, etwa prekûÊre BeschûÊftigungsverhûÊltnisse oder ungerechte Bildungschancen. IN A MIST entsteht vor diesem Hintergrund als eine Musik- und Sprachcollage unter Verwendung von aktuellen Tonquellen verschiedenster Provenienz, Musik, GerûÊusch, Klang und Sprache, die formal anknû¥pfen soll an die akustischen utopischen Modelle (Musik fû¥r die Zukunft), wie sie in den 1920erJahren in Russland entwickelt wurden. Gleichzeitig beinhaltet der Titel IN A MIST auch eine westliche Referenz ã an eine Swingkomposition von Bix Beiderbecke, die Ende der 1920er Jahre entstand. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 16.05.2014
Datum: 16.05.2014Länge: 01:47:45 Größe: 98.66 MB |
||
| ARD Radio Tatort: Robert Hû¥ltner: Wallfahrt - 07.05.2014 | ||
| Mit Florian Karlheim, Brigitte Hobmeier, Michael A. Grimm, Robert Giggenbach, Richard Oehmann, Wowo Habdank, Winfried FreyStephan Zinner, Ercan Karacayli, Hanns Meilhamer, Robert Joseph Bartl, Sepp Schauer, Klaus Stiglmeier, Markus Boniberger, Matthias Kupfer, Harry TûÊschner, Sebastian Edtbauer / Komposition: zeitblom / Regie: Ulrich Lampen / BR 2014 / LûÊnge: 53'18 // Wohlwollend wird in Bruck am Inn die Absicht eines bisher eher belûÊchelten Traditionsvereins diskutiert, die in Vergessenheit geratene Wallfahrt zu einem in einem idyllischen Waldtal gelegenen Kirchlein wieder aufleben zu lassen. Geschichten von verblû¥ffenden Heilungen machen bereits die Runde. Da erhalten Rudi und Senta vom skeptischen Luk den Hinweis, dass in dieser Kapelle ein hûÑchst suspekter MûÊrtyrer verehrt wû¥rde. Bald wird bekannt, dass auch der Bauunternehmer Blocher der Initiative des frommen Vereins nahe steht und mit der Erhebung zum Wallfahrtsort nicht unerhebliche Baumaûnahmen verbunden wûÊren. AufgeklûÊrte Bû¥rger mokieren sich û¥ber die Angelegenheit, doch ein alter Mann, Besitzer eines kleinen TrûÑdelgeschûÊfts, bekommt regelrecht den Volkszorn zu spû¥ren, als er ã vehement und auûer sich ã protestiert. Er sucht Hilfe bei Rudi und Senta. Doch niemand scheint die Wahrheit û¥ber die Legende und die lang zurû¥ckliegende Vergangenheit wissen zu wollen. Jetzt geraten auch der alte TrûÑdler und Luk in hûÑchste Gefahr. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 07.05.2014
Datum: 07.05.2014Länge: 00:53:24 Größe: 48.90 MB |
||
| Andreas Ammer/Console: Ludwig Wittgenstein: Tractatus logico-philosophicus. Das HûÑrspiel - 25.04.2014 | ||
| Mit Oswald Wiener, Moritz Eickworth, Lars Freikorn / Musik und Realisation: Andreas Ammer/Console / ZusûÊtzliche Kompositionen: Nu / BR 2014 / LûÊnge: 65'23 // Vor gut 100 Jahren beendete der freiwillig in den Krieg gezogene Industriellenerbe Ludwig Wittgenstein mit einem Handstreich ein paar Jahrtausende Philosophiegeschichte. Der letzte Satz seines Buches Tractatus logico-philosophicus lautet: "Wovon man nicht sprechen kann, darû¥ber muû man schweigen." Wittgenstein hat sich daran gehalten. Er hat Zeit seines Lebens kein weiteres Buch, sondern das ûÑffentliche Schweigen vorgezogen. Er ist erst Volksschullehrer geworden und hat auch als Professor in Cambridge weiter ûÑffentlich geschwiegen. Von Stille hingegen hat Wittgenstein, der passionierte Klarinettist, nichts gesagt. So bleibt immer noch die Musik, das Medium des Unsagbaren, die in Ammer & Consoles HûÑrspiel in ihre Rechte tritt, wo angesichts der Wahrheit alle Worte (auûer die von Wittgenstein natû¥rlich) schweigen mû¥ssen. Andreas Ammer & Console haben in ihrer HûÑrspielvertonung von Wittgensteins Hauptwerk zur Philosophie Musik gemacht, die sich aus Stimmen erzeugen lûÊsst, ohne Sprache zu sein. Denn: ãAlle Philosophie ist ãSprachkritikã.ã Die Frage von Ammer & Console, den Klangphilosophen, lautet: Wie klingt es, wenn man schweigen muss? ã Oder wie Wittgenstein es ausdrû¥ckt: ãWenn sich eine Frage û¥berhaupt stellen lûÊût, so kann sie auch beantwortet werden.ã ã Aber wie? LûÊsst sie sich tanzen oder sind die Gewissheiten Wittgensteins, die von dem Wiener Aktionisten und Wittgenstein-Nachfolger Oswald Wiener (Die Verbesserung von Mitteleuropa) vorgetragen werden, dann doch mûÊchtiger? ã Wittgenstein selbst hat die Musik in seinem Werk jedenfalls der Sprache an die Seite gestellt: ãDie Grammophonplatte, der musikalische Gedanke, die Notenschrift, die Schallwellen, stehen alle in jener abbildenden internen Beziehung zueinander, die zwischen Sprache und Welt besteht.ã Ludwig Wittgenstein: Tractatus logico-philosophicus. Das HûÑrspiel ist sozusagen die bislang fehlende Grammophonplatte, die zwischen der Sprache Wittgensteins und der Welt ãjene abbildende interne Beziehungã herstellt. Oder wie der Philosoph es ausdrû¥cken wû¥rde: ãDie LûÑsung eines Problems merkt man am Verschwinden dieses Problemsã. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 25.04.2014
Datum: 25.04.2014Länge: 01:05:29 Größe: 59.96 MB |
||
| Kathrin RûÑggla: LûÊrmkrieg - 13.04.2014 | ||
| Mit Eva Brunner, Kirsten Hartung, Martin Molitor, Henning Bochert, Ulrich Peltzer, Hanns Zischler, Dorothee Metz, Jû¥rgen Wink, Matthias Breitenbach, Nele Rosetz, Jan Uplegger / Komposition: Bo Wiget / Regie: Leopold von Verschuer / BR 2014 / LûÊnge: 53'05 // Groûbaustellen wie der Ausbau des Frankfurter Flughafens: Es gibt sehr unterschiedliche Sichtweisen darauf, und die verschiedenen Versionen werden jeweils mit ûÊuûerster Vehemenz vorgetragen. Ein Verkehrsinfrastrukturwahnsinn, der den Geist der Finanzkrise in sich trûÊgt, sagen die einen. Ein Wachstumsmotor und somit Wohltat fû¥r die Allgemeinheit, sagen die anderen. Kathrin RûÑggla untersucht in ihrem neuen HûÑrspiel eine Gesellschaft der Betroffenen und findet sich unversehens in einem Krieg mit verhûÊrteten Fronten wieder, einem LûÊrmkrieg, deren Linien jedoch asymmetrisch verlaufen. Fû¥r sie ist der Protest gegen den Frankfurter Flughafen exemplarisch fû¥r das, was in ganz Deutschland geschieht: Schlieûlich hat der Wutbû¥rger û¥berall die Bû¥hne betreten. ãWir sind hier, wir sind laut, weil Fraport uns die Ruhe klaut!ã, skandiert er unter anderem. RûÑggla hat mit Neubetroffenen gesprochen ã die sich sorgfûÊltig von den Altbetroffenen unterscheiden ã, die nur noch in der Zivilgesellschaft ihre HandlungsmûÑglichkeit sehen und demokratiemû¥de und ernû¥chtert bis entsetzt û¥ber das Vorgehen ãihrerã Partei sich nicht mehr vertreten fû¥hlen. Doch wer sind die Protagonisten û¥berhaupt, die auf die Barrikaden gehen? VerhinderungspersûÑnlichkeiten? Opfer? | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 13.04.2014
Datum: 13.04.2014Länge: 00:53:11 Größe: 48.70 MB |
||
| Eran Schaerf: FM-Scenario - Benutzerinnen-Montagen aus dem Online-Studio - 11.04.2014 | ||
| Mit Pauline Boudry, Peter Veit, Samuel Streiff, Franziska Ball / Montage: Transmedia-Figaro, cut 1, Jean, im bild, bastian_996, still searching, Curation compilation, drawn person / Realisation: Eran Schaerf / BR 2014 / LûÊnge: 37'47 // FM-Scenario ist ein intermediales Projekt, das sich û¥ber Website, Sendungen, Ausstellungen und Publikationen realisiert. Eine Kooperation von: BR HûÑrspiel und Medienkunst; A Production e. V., Berlin; HartwareMedienKunstVerein, Dortmund; Haus der Kulturen der Welt, Berlin; Les Complices*, Zû¥rich; Museum fû¥r Konkrete Kunst, Ingolstadt; ZKM, Karlsruhe. GefûÑrdert durch die Kulturstiftung des Bundes. Seit Januar 2013 ist "FM-Scenario.net" online. Das ûÑffentlich zugûÊngliche Online-Studio bietet Benutzerinnen an, Fragmente aus Eran Schaerfs HûÑrspielarbeit zu neuen ErzûÊhlungen zusammenzustellen. Kennzeichnend fû¥r diese ErzûÊhlungen ist ihre Kombinatorik, die sich die Kombinatorik vorhandener Medienlandschaften aneignet, um Begriffe wie 'aktuell', 'live', oder 'Ereignis' in Frage zu stellen. Um die Kombinatorik des Radios und das mit ihr einhergehende Montageprinzip der Wirklichkeit zu verstehen, genû¥gt es, zwei aufeinander folgende Nachrichtensendungen zu hûÑren. Bei der zweiten Sendung kommt bald das Gefû¥hl auf, einen Teil davon in der Sendung davor bereits gehûÑrt zu haben. Die wiederholte Meldung aktualisiert die erste, stellt zugleich das besprochene Ereignis in den Kontext anderer Meldungen und - je nach Tageszeit - anderer Sendungen. Folgte am Vormittag auf die Nachricht eine Verkehrsinfo, so ist es abends eher ein Konzert. Der Reihenfolge von Sendungen liegt ein abstrakter Montagebegriff zugrunde, da sie in Unkenntnis ihres konkreten Inhalts festgelegt werden - sie sind Programm. Da der VerûÑffentlichungskontext einer Meldung Teil der Meldung ist, nehmen Programmleiter an der Autorschaft jedes gesendeten Inhalts teil. Diesen Montagebegriff, der mit Programmgestaltung zusammenfûÊllt und jede Autorin eine Co-Autorin werden lûÊsst, fû¥hrt das Projekt "FM-Scenario" wieder auf. Wenn HûÑrerinnen auf "FM-Scenario.net" Fragmente aus unterschiedlichen (fiktiven) Sendungen in eine Reihenfolge setzen, sind sie Programmgestalterinnen. Eran Schaerf geht es dabei um das narrative Potential, das in der Kombination von Sendeformaten und in der Co-Autorschaft voneinander unbekannten Autorinnen und HûÑrerinnen liegt. Die dabei entstehenden Montagen kûÑnnen als RadioerzûÊhlungen bezeichnet werden. Nicht weil sie von dem fiktiven Radiosender "Die Stimme des HûÑrers" erzûÊhlen oder von einem weniger fiktiven Sender wie dem Bayerischen Rundfunk gesendet werden, sondern weil der Montagebegriff des Radios diesen ErzûÊhlungen immanent ist. Nach "FM-Scenario" heiût RadiohûÑren nicht diese oder jene Sendung hûÑren, sondern û¥ber Sendungen hinaus und in andere hinein hûÑren. Die von der Nutzerin bastian_996 im Online-Studio von FM-Scenario auf www.fm-scenario.net erstellte Audio-Montage diente Eran Schaerf als Skript fû¥r die Ausstellung FM-Scenario: Armchair ã Attention ã Life Signal bei Les Complices* in Zû¥rich (10.4.-10.5.2014). Weitere englisch- und deutschsprachigen Benutzerinnen-Montagen dieser Sendung wurden im Online-Studio zusammengestellt von Transmedia-Figaro, cut 1, Jean, im bild, still searching, Curation compilation und drawn person. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 11.04.2014
Datum: 11.04.2014Länge: 00:37:53 Größe: 34.69 MB |
||
| Karl Bruckmaier (Hg.): Auf dem Dach der Welt: Frei nach Alexander Kluge - 04.04.2014 | ||
| Mitwirkende und Realisation: Sven-û ke Johansson, Alexander Kluge, Michaela MeliûÀn, Greie Gut Fraktion, Peter BrûÑtzmann & Otomo Yoshihide, David Grubbs, Maja S. K. Ratkje & POING, Zwanie Jonson & Maurice Summen, Sophie Rois, alva noto, Elliott Sharp, Andrea Neumann und Helge Schneider / BR/intermedium rec. 2012 / LûÊnge: 62'02 // So wie sich oft in Kluges Texten mehrere Welten begegnen kûÑnnen, so reiben sich auch in dieser als Tribut konzipierten Sendung unterschiedlichste Musiken und Musiker aneinander - die jedoch eines gemeinsam haben: ein originûÊres Interesse an der Arbeit Alexander Kluges, dessen fû¥nf Jahrzehnte wûÊhrende PrûÊsenz in Literatur, Fernsehen und Film ihre Spuren hinterlassen hat. David Grubbs etwa hat an der Uni Seminare û¥ber Kluges FernsehbeitrûÊge besucht, Maurice Summen und Gudrun Gut kûÑnnen wie alle seit den 80er Jahren in der Bundesrepublik Herangewachsenen gar nicht anders, als von der ûsthetik der nûÊchtlichen DTCP-ûberfûÊlle auf das Privatfernsehen geprûÊgt zu sein, Michaela MeliûÀn hat bereits kû¥nstlerisch zu Kluge gearbeitet, Helge Schneider gibt fû¥r Kluge gern den Eulenspiegel im TV und wenn Sophie Rois sagt, mit dem Mann verbinde sie eine Liebesgeschichte, dann wird das in ihrem Beitrag zu "Auf dem Dach der Welt" wohl auch zu hûÑren sein. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 04.04.2014
Datum: 04.04.2014Länge: 01:02:09 Größe: 56.90 MB |
||
| BjûÑrn Bicker: Urban Prayers - 02.03.2014 | ||
| Mit Wiebke Puls, Steven Scharf und Edmund TelgenkûÊmper / Komposition: Pollyester / Realisation: BjûÑrn Bicker / BR 2014 / LûÊnge: 53'29 // Es spricht der Chor der glûÊubigen Bû¥rger. Doch kaum fûÊngt einer an zu reden, da fûÊllt ihm der andere schon ins Wort. Der Chor findet keine gemeinsame Sprache und doch ist es ein Chor, der ein Gegenû¥ber kennt: die UnglûÊubigen. Globalisierung, Migration und der gleichzeitige Verlust religiûÑser Bindungen haben aus unseren StûÊdten Orte der religiûÑsen und weltanschaulichen Vielheit gemacht. Muslime, Buddhisten, Hindus und Juden sowie christliche Glaubensgemeinschaften aus der ganzen Welt ã Pfingstler, Evangelikale, Katholiken, Protestanten und Orthodoxe ã machen unsere StûÊdte zu religiûÑsen Megacities. Welche Sprache versteht ihr Gott? Welche Kirchen, GebetsrûÊume, Tempel besuchen sie? Glauben die Menschen, dass ihr Glaube Privatsache ist? Glauben die Menschen, dass ihr Glaube politisch ist? Glauben die Menschen an die Freiheit der Anderen? Glauben die Menschen an eine bessere Welt? Wie beeinflussen sie das soziale und politische Leben der Stadt? Welche Erwartungen haben die GlûÊubigen an Demokratie und Rechtsstaat? Welche Erwartungen hat der Staat an sie? Aus einer langen Recherche im religiûÑsen Leben Mû¥nchens ist ein Text entstanden, der fû¥r die Vielstimmigkeit des urbanen, religiûÑsen Lebens einen ebenso poetischen wie politischen Resonanzraum geschaffen hat. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 02.03.2014
Datum: 02.03.2014Länge: 00:53:36 Größe: 49.08 MB |
||
| Thomas von Steinaecker: Meine TonbûÊnder sind mein Widerstand - 23.02.2014 | ||
| Aufnahme, Rû¥ckspultaste, Wiedergabe. Klaus Hofer ist einer, der sein BandgerûÊt immer dabei hat, der die Gegenwart mitschneidet und in die Vergangenheit zurû¥ckspult um herauszufinden, ob ihm etwas entgangen ist, ob er vielleicht etwas û¥berhûÑrt hat - und wie alles in Wirklichkeit war: ein besessener EinzelgûÊnger, fû¥r den es keine Grenze gibt zwischen Leben und HûÑrspiel. //Mit Oliver Stritzel, Philipp Grimm, Christiane Rossbach, Wolfgang Pregler, Oliver Mallison, Hans Kremer, Peter Veit / Komposition: Samuel Schaab / Regie: Bernadette Sonnenbichler / BR 2007 / LûÊnge: 58'18 Die Beziehung zu seiner Freundin Petra, die ihn fû¥r ein Genie hûÊlt und trotzdem verlûÊsst, dokumentiert er auf seinen TonbûÊndern ebenso wie die VerschwûÑrungstheorien des Unfallchirurgen Pontus, der Hauptfigur einer Krimiserie, die als einzige von Hofers HûÑrspielarbeiten zu seinen Lebzeiten im Radio lûÊuft. EnttûÊuscht von der Kulturindustrie, die ihn nicht wahrnimmt, kommt er zu der ûberzeugung: Wer die RealitûÊt ablehnt, muss sie als Material betrachten. Das letzte Projekt des Klaus Hofer, sein unvollendetes Hauptwerk, ist der Versuch, auf den unzûÊhligen BûÊndern, die sich in seiner Wohnung stapeln, die Muster zu finden, nach denen sein Leben ablief ã der akustische Zusammenschnitt einer gescheiterten Existenz. Das fiktive Feature feiert die Entdeckung des unbekannten HûÑrspiel-Pioniers Klaus Hofer, mit Ausschnitten aus seinen HûÑrstû¥cken, dem Tontagebuch und seinem "Klanglexikon der Gefû¥hle", Werke, die Hofer zu einer der groûen Entdeckungen in der Geschichte des deutschen HûÑrspiels machen. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 23.02.2014
Datum: 23.02.2014Länge: 00:58:34 Größe: 40.26 MB |
||
| Ludwig Thoma: Waldfrieden - 21.02.2014 | ||
| Mit Michl Lang, Franz FrûÑhlich, Hans Stadtmû¥ller, Paula Braend / Regie: Olf Fischer / BR 1955 / LûÊnge: 26'06 // Zwei alte Freunde treffen sich in einer Jagdhû¥tte. Xaver hat eine "Feine" geheiratet, die Freund-Freundschaft von Korbi und Xaver hat daran gelitten. Fû¥r Korbi ist Xaver ein "Lappdierl". Korbi geht und Xaver zu seinem "feinen Mausi". Die alte MûÊnnerfreundschaft ist zerbrochen. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 21.02.2014
Datum: 21.02.2014Länge: 00:26:12 Größe: 24.00 MB |
||
| Arno Schmidt: Nobodaddy's Kinder - Brand's Haide - 01.02.2014 | ||
| Mit Ulrich Wildgruber, Juliane KûÑhler, Jacqueline Macaulay / Bearbeitung und Regie: Klaus Buhlert / BR 1998 / LûÊnge 71'20 // In dem 1951 entstandenen Prosatext Brand's Haide kehrt der Soldat Schmidt aus der Kriegsgefangenschaft zurû¥ck. In Blakenhof, in der Lû¥neburger Heide, versucht er, sein Leben neu einzurichten. Der Heimkehrer besitzt nur die Kleidung, die er am Leibe trûÊgt, und einige Bû¥cher. Liebevoll gedenkt er der Gaben der EnglûÊnder: einer Rasierklinge und Seife. Schmidt konzentriert sich auf ein groûes Projekt, eine Biografie des romantischen Schriftstellers Fouquûˋ, dessen Werk er schûÊndlich vernachlûÊssigt sieht. Brand's Haide ist der Name eines dû¥steren Waldreviers im Hohen FlûÊming in Brandenburg, das der Knabe Fouquûˋ oft durchqueren musste. Schmidt û¥bertrûÊgt den Namen auf die WûÊlder um Blakenhof. Schmidt wird in eine Baracke eingewiesen, in der die MûÊdchen Lore und Grete hausen. Er verliebt sich in Lore, die seine Liebe erwidert, ihn jedoch verlûÊsst, um einen ungeliebten, aber wohlhabenden Mann in Mexiko zu heiraten. Der Protagonist bleibt in ebenso selbst verschuldeter wie gewûÊhlter Einsamkeit zurû¥ck: "Als junger Mensch: 16 war ich, bin ich aus Eurem Verein ausgetreten." | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 01.02.2014
Datum: 01.02.2014Länge: 01:11:23 Größe: 65.36 MB |
||
| Arno Schmidt: Nobodaddy's Kinder - Aus dem Leben eines Fauns - 25.01.2014 | ||
| Mit Ulrich Wildgruber / Bearbeitung und Regie: Klaus Buhlert / BR 1998 / LûÊnge: 86'40 // Aus dem Leben eines Fauns, 1952/53 entstanden, schildert das Leben des kleinen Beamten Dû¥ring in der Lû¥neburger Heide wûÊhrend der NS-Zeit. Seine Haltung beschreibt er so: "Nur schade, dass ich, ein Sehender, das Blinde-Kuh-Spiel werde mitmachen mû¥ssen." Dû¥ring fû¥hrt ein Doppelleben: Ehe, Beruf, Familie und Politik werden nur pro forma wahrgenommen. Dû¥rings eigentliches Leben spielt sich zum einen in der Phantasie und in der Lektû¥re ab, zum anderen in einer Hû¥tte im Schilfwald, die ein Deserteur aus der Napoleonischen Armee 1813 errichtet hat. Der Wind, der Mond, die Heidelandschaft, die Romantiker bilden eine Gegenwelt, die vom Nationalsozialismus nicht erfasst werden kann. Dû¥rings Versuch, die Existenz des desertierten Fauns nachzuleben, scheitert. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 25.01.2014
Datum: 25.01.2014Länge: 01:26:45 Größe: 79.43 MB |
||
| Arno Schmidt: Nobodaddy's Kinder - Schwarze Spiegel - 18.01.2014 | ||
| Mit Corinna Harfouch, Ulrich Wildgruber / Bearbeitung: Klaus Buhlert/Herbert Kapfer / Komposition und Regie: Klaus Buhlert / BR 1997 / LûÊnge: 86'03 // Schmidt erschienen die frû¥hen fû¥nfziger Jahre wie eine Zwischenkriegszeit, ein kurzes Atemholen vor dem Dritten Weltkrieg. "Atombomben und Bakterien hatten ganze Arbeit geleistet." Der utopische Prosatext Schwarze Spiegel wurde erstmals 1951 publiziert. Arno Schmidt legte den als Niederschrift eines namenlosen Ich-ErzûÊhlers konzipierten Text in die nahe Zukunft, in den Zeitraum vom 1. Mai 1960 bis Ende August 1961. Fû¥nf Jahre nach einem atomaren Krieg bewegt sich der ErzûÊhler, der sich fû¥r den einzigen ûberlebenden hûÊlt, mit dem Fahrrad û¥ber zerbrûÑckelte Straûen in der Lû¥neburger Heide. Das Experiment Mensch, analysiert er, ist gescheitert. Mit der Brechstange in der Hand und mit zwei umgehûÊngten Waffen fû¥hlt er sich als Herr der Welt. Doch er lebt mit der stûÊndigen Angst, anderen Menschen zu begegnen. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 18.01.2014
Datum: 18.01.2014Länge: 01:26:08 Größe: 78.87 MB |
||
| Herta Mû¥ller: Zeit ist ein spitzer Kreis - 12.01.2014 | ||
| Mit Herta Mû¥ller, Michael Lentz / Realisation: Michael Lentz / BR 2014 LûÊnge: 24'33 // 39 neue, unverûÑffentlichte Text-Bild-Collagen von Herta Mû¥ller bilden das Ausgangsmaterial des HûÑrstû¥cks. "Ich muss auch da in Kû¥rzestform immer etwas erzûÊhlen", so die Autorin û¥ber ihre Collagen: "Der Rhythmus der SûÊtze muss da sein. Man muss es laut lesen kûÑnnen, ohne mit der Zunge zu stolpern. Und ich muss das Bild der SûÊtze im Kopf gesehen haben, um sie auf ihre PlausibilitûÊt zu prû¥fen. Das ist mit den Collagen genauso wie in der Prosa." Die bedrû¥ckende AtmosphûÊre, die Mû¥llers Romane bestimmen, verdichtet sich in den Collagen auf surreale Weise. Das HûÑrstû¥ck zeichnet den Weg einer Bedrohung nach, der sich ein Ich ausgesetzt sieht. Jemand muss es verleumdet haben, das weiû schon der Wind, û¥ber den wiederholt gesagt wird, er sei so frisch wie Milch, so alt wie Lehm. Die KrûÊfte arbeiten im Verborgenen. Kaum aber wird es Tag, wird der, der aufrecht "Ich" sagt, abgeholt. Eine Fahrt, wohin? Ein VerhûÑr. Und vermeintliche Freiheit. Die Bedrohung ist nun û¥berall. Die Akteure der HûÑrcollage sind zwei Stimmen und die Stille. Die Stimmen erzûÊhlen, und die Stille schweigt nicht: Auch das Nichtgesagte kann gehûÑrt werden. Es haust in den Stimmen und fûÊrbt die WûÑrter. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 12.01.2014
Datum: 12.01.2014Länge: 00:24:39 Größe: 22.58 MB |
||
| Herta Mû¥ller/Herbert Kapfer: Die WûÑrter aus den Schubladen - 12.01.2014 | ||
| Herta Mû¥ller im GesprûÊch mit Herbert Kapfer / BR 2014 / LûÊnge: 19'18 | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 12.01.2014
Datum: 12.01.2014Länge: 00:19:24 Größe: 17.77 MB |
||
| Klaus Reichert/Katarina Agathos: Ein ErgûÊnzungsparallelogramm, das nicht fortgefû¥hrt wird - 31.12.2013 | ||
| Klaus Reichert (Joyce-Herausgeber) im GesprûÊch mit Katarina Agathos / BR 2012 / LûÊnge: 46'10 | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 31.12.2013
Datum: 31.12.2013Länge: 00:47:00 Größe: 43.03 MB |
||
| Ulrich Lampen/Annegret Arnold: Inszenierung als Spiel mit Strukturen, nicht mit Charakteren - 29.12.2013 | ||
| Ulrich Lampen (Dubliner-Regisseur) im GesprûÊch mit Annegret Arnold / BR 2012 / LûÊnge: 13'35 | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 29.12.2013
Datum: 29.12.2013Länge: 00:13:56 Größe: 12.77 MB |
||
| Hartmut Geerken: hexenring - 20.12.2013 | ||
|
Mit Hartmut Geerken, Famoudou Don Moye / Realisation: Hartmut Geerken / BR 1994 / LûÊnge 70'15 // technik isoliert das gesellige wesen mensch, obwohl sie kommunikation verspricht, sogar globale. zum beispiel so: einer sitzt in seinem zimmer & schaltet das radio an. er hûÑrt eine stimme. er kann einen dialog versuchen, aber die stimme aus dem lautsprecher kû¥mmert das nicht. er kann gegen das radio anschreien, aber die stimme aus dem lautsprecher bleibt sachlich oder freundlich oder leise oder unverbindlich oder angenehm. oder: einer in seiner stube nimmt den telefonhûÑrer ab & wûÊhlt eine nummer, auf der anderen seite des planeten meldet sich eine stimme. ein dialog entsteht. die beiden kommunikationsmedien radio & telefon werden in ãhexenringã vernetzt. das radio steht mit bestimmten hûÑrern (autoren, musiker, kû¥nstler, freunde) per telefon in kontakt, d.h. hûÑrer kûÑnnen in das geschehen dieses hûÑrspiels eingreifen, hûÑrer im sendebereich kûÑnnen sogar auf das gehûÑrte reagieren. bestimmte hûÑrer haben demokratischen anteil daran, was û¥berhaupt wûÊhrend der sendezeit dieses hûÑrspiels gehûÑrt & gespielt wird. die kommunikation û¥ber die hilfsmittel radio & telefon wird nicht leicht & ungebunden sein wie etwa mit einem leiblichen partner, sondern eher roboterartig, aus der vereinzelung heraus. wûÊhrend der gesamten dauer des hûÑrspiels spielen/sprechen famadou don moye (art ensemble of chicago) & hartmut geerken unabhûÊngig von den telefonanrufen im hûÑrspielstudio. moye & geerken haben die mûÑglichkeit, auf die ankommenden telefonanrufe zu reagieren. eine regiemûÊûige ordnung der hûÑrerbeitrûÊge ist nicht beabsichtigt. die hûÑrerbeitrûÊge organisieren sich selbst in dissipativen strukturen. ein offenes ungleichgewichtiges system drûÊngt vorwûÊrts. ãein hexenring ist in der mykologie die kreisfûÑrmige anordnung hûÑherer pilze. treten keine hindernisse auf, wachsen die fruchtkûÑrper in kreisen, die inneren teile des systems sterben ab, die ûÊuûeren wachsen kreisfûÑrmig weiter.ã
"hexenring" wurde 1994 mit dem Karl-Sczuka-Preis fû¥r HûÑrspiel als Radiokunst ausgezeichnet. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 20.12.2013
Datum: 20.12.2013Länge: 01:10:10 Größe: 64.24 MB |
||
| Dietmar Dath/Mareike Maage: Antilopenverlobung - 13.12.2013 | ||
|
Mit Cathlen Gawlich, Eva Verena Mû¥ller, Marc Hosemann, Andreas Grothgar, Frank Genser, Edda Fischer, Sigrid Burkholder, JûÑrg Hartmann und Stephanie Eidt / Regie: Leonhard Koppelmann / BR 2013 / LûÊnge: 65'06 // "Das Tier schaut uns an und wir stehen nackt vor ihm. Und vielleicht fûÊngt das Denken an genau dieser Stelle an" konstatierte Jacques Derrida nicht nur fû¥r das VerhûÊltnis zu seiner Katze, sondern fû¥r eine mûÑgliche Beziehung zwischen Tier und Mensch, bei der der Blick des Tieres zum produktiven Spiegel fû¥r menschliche Selbsterkenntnis wird. Ein Vorgang, der Mut und FûÊhigkeit zum erwidernden Blick voraussetzt, aber nicht selbstverstûÊndlich ist, kûÑnnte der Mensch ja vor dem zurû¥ckschrecken, was er da im Spiegel erblickt. Jedenfalls kommen die beiden lesbischen Antilopen Mava und Nora zu diesem Schluss, als sie Torben Pfeiffer einen Abschiedsgruû mit nach Hause geben. Er ist zusammen mit seiner Kollegin Andrea Sturm von einer Stiftung beauftragt worden, das Forschungsprojekt der Panlinguistin Jutta Villinger zu begutachten, das darin besteht, die menschliche Sprache zur Grundlage der tierischen Kommunikation zu machen. Mit Hilfe eines neu entwickelten Computerprogramms haben die Tiere im von Jutta Villinger betreuten und von der Stiftung subventionierten Forschungspark zwar Worte gelernt, sie sprechen aber doch ihre jeweils eigene Sprache. MissverstûÊndnisse sind also unvermeidlich, vor allem die zwischen Mensch und Tier, weil es eben nicht reicht, dieselbe Sprache zu sprechen. Entgegen der Meinung von Jutta Villinger ãalles lebt ein bisschen, und alles spricht ein bisschen, der Rest ist nur eine Frage der angemessenen VerstûÊrkerã, scheint Torben Pfeiffer, ein Kritiker des Projektes, lûÊngst zu wissen, dass man ohnehin nicht versteht, was man sich gegenseitig sagt, und dass erst einmal das ZuhûÑren Forschungsaufgabe genug wûÊre. So hat sich auch die langjûÊhrige Mitarbeiterin Silke aus dem Projekt verabschiedet, weil sie es verurteilt, die Sprache als Machtinstrument und Mittel der Gefangennahme der Tiere zu gebrauchen.
Die Antilopenverlobung zeigt auf sprachspielerische, unterhaltsame und politische Art ein Szenario, in dem das tierische Miteinander dem menschlichen ein Stû¥ck weit voraus ist. Am Ende, so scheint es, haben nûÊmlich die beiden Antilopen Mava und Nora im liebenden Blick auf den Anderen und ganz unabhûÊngig von irgendeinem sprachgestû¥tzten Ritus ihre Verlobung lûÊngst vollzogen. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 13.12.2013
Datum: 13.12.2013Länge: 01:05:12 Größe: 59.70 MB |
||
| Michael Lentz: Hiddensea - 22.11.2013 | ||
|
Mit Michael Lentz, Sophia Siebert, Valeri Scherstjanoi / Komposition: Gunnar Geisse / Realisation: Michael Lentz / BR 2013 / LûÊnge: 72'37 // Eine Hymne auf/an Hiddensee. Eine Wanderung durch und mit Stimmen. Eine Neuerfindung bis zur Wiedererkennbarkeit. Eine erfundene Dokumentation. Eine Sozialstudie. Ein akustisches MûÊrchen. Ein Gesang auf die SchûÑnheit. Merkwû¥rdige Fische wollen nicht verzehrt werden. BûÊume stehen hier anders. Das Meer. Hier ist es. Der weltberû¥hmte Hiddenseer Hase (ãHahaseã) gibt die Haken/Sprû¥nge vor. Hiddensea ist der unwiderrufliche Beweis, dass Ahlbeck nicht auf Hiddensee liegt. Ahlbeck kommt trotzdem vor in diesem HûÑrspiel. Als Deutschland. Used Om. In Ahlbeck gibt es Sonnenbrillen mit sehr dunklen GlûÊsern. Der sehr vielen leibigen Leute wegen, die sich am Strand robben und keinen Fuû ins Wasser setzen und einfach immer weiter essen. In Ahlbeck hûÑren die Leute nicht mehr auf zu reden. Hiddensea trûÊgt der Rede Rechnung. Auf Hiddensee redet kein Mensch. Hiddensee hat kein Peenemû¥nde. Hiddensee ist die Zukunft.
Der frische Wind und einige GesprûÊche wurden auf Hiddensee aufgenommen. Siebert weiû da bestens Bescheid. Peenemû¥nde spricht Peenemû¥nde. Lenz war in Ahlbeck. Lentz und Scherstjanoi kûÑnnen viele lautpoetische Lieder davon singen, Hiddenseer Luftoden. Geisse spû¥rt den Fischen, den Stimmen und der Hiddenseer AtmosphûÊre nach. Zuhause, im Studio von Lentz, wird sich dann erinnert. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 22.11.2013
Datum: 22.11.2013Länge: 01:12:43 Größe: 66.59 MB |
||
| ARD Radio Tatort: Robert Hû¥ltner: Wasser bis zum Hals - 13.11.2013 | ||
| Mit Florian Karlheim, Brigitte Hobmeier, Michael A. Grimm, Robert Giggenbach, Richard Oehmann, Jû¥gen Tonkel, Alexander Duda, Winfried Frey, Wowo Habdank, Susanne Schroeder, Gisela Schneeberger, Stephan Zinner, Gabriel Ascanio-Hecker, Sigi Zimmerschied, Martin Feifel, Christian Buse, Wolfram Kunkel, Rainer Haustein, Friedrich Schloffer, Heinz Peter, Matthias Ransberg, Mira Dietl / Komposition: zeitblom / Regie: Ulrich Lampen / BR 2013 / LûÊnge: 53'59 // Ausnahmezustand in Bruck am Inn: Wie in jedem Frû¥hjahr schwillt der Fluss an, droht die Stadt zu û¥berfluten. Verstimmung und Ratlosigkeit herrschen auch in der ûÑrtlichen Polizeiinspektion. Denn es bahnt sich ûrger an, da Kollege Richard Veitl vor einigen Tagen bei einer harmlosen Verkehrskontrolle urplûÑtzlich ausrastete und vom Opfer deshalb angezeigt wurde. Auch an Nannis Kiosk brodelt die Gerû¥chtekû¥che. Doch mehr noch als die Spekulation um Richards Probleme beschûÊftigt die Brucker die Frage, ob der Inn-Damm dem vorausgesagten Hochwasser standhûÊlt. Gemeindearbeiter Harti wehrt zwar vehement alle Befû¥rchtungen ab, doch dann zucken Blitze vom Himmel, ohrenbetûÊubendes Donnergrollen folgt. Eine Flutwelle ungeahnten Ausmaûes bahnt sich ihren Weg durch die idyllische Kleinstadt. Die Wassermassen hinterlassen nicht nur erhebliche SchûÊden, û¥berschwemmte Keller, Schlamm und GerûÑll, sie spû¥len auch entsetzliche ûberraschungen ans Tageslicht. Neben Nazirelikten, wie Mutterkreuzen, Stahlhelmen und Uniformresten: eine Leiche. Die herbeigerufene Kripo gibt sich zu deren IdentitûÊt zunûÊchst auffallend bedeckt. Dann aber lûÊsst es sich nicht mehr verheimlichen: Das Opfer war ein V-Mann, der in Sachen Drogenhandel und GeldwûÊsche in der ãFischermû¥hleã, einer zwielichtigen Spelunke vor den Toren der Stadt, ermittelte. Obwohl Senta und Rudi Hinweise finden, dass der Mord in direkter Umgebung der Kneipe geschehen sein muss, lûÊsst sich dem Besitzer der Spelunke nichts nachweisen. Nur Richard scheint mehr zu wissen. Und hat Rudi nicht bemerkt, wie in sich gekehrt Senta in letzter Zeit wirkt? Wie steht sie eigentlich mittlerweile zu Richard? | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 13.11.2013
Datum: 13.11.2013Länge: 00:54:05 Größe: 49.53 MB |
||
| Inga Helfrich: Ich Wir Ihr Sie - 15.09.2013 | ||
|
Mit Laura Maire, Ulla Geiger, Bibiana Beglau, Stefan Merki, Benedict Lû¥ckenhaus, Florian Decker / Realisation: Inga Helfrich / BR 2013 / LûÊnge: 51'36 // Jeder hatte mal einen, jeder kann (schlecht) û¥ber sie mitreden, keine Berufsgruppe scheint besser be- und verkannt: Lehrer stehen von vornherein unter Generalverdacht. Als Beamtenstatusnutznieûer mit zu viel Ferienzeit und Sicherheit. Als fantasielose Lehrplandurchpeitscher. Als staatlich genormte Routinemenschen. Dabei kann ihre Bedeutung fû¥r unsere Gesellschaft gar nicht hoch genug eingeschûÊtzt werden: Lehrer sind buchstûÊblich Grundausbilder, Trainer im Basiscamp fû¥r die Zukunft, sie liefern unseren Kindern das Rû¥stzeug fû¥rs Leben. ãDas oberste Bildungsziel ist der mû¥ndige Menschã, so steht es in den Schulordnungen. Das groûe Ideal: Nicht fû¥r die Schule, sondern fû¥r das Leben lernen wir ãÎ
Die RealitûÊt sieht leider anders aus. Nicht etwa, weil die Lehrer alle so katastrophal wûÊren, sondern weil der ãApparat Schuleã so viel Angst, Konkurrenz und Druck erzeugt. Ausgerechnet der Ort, an dem die Generation Zukunft das Denken lernen soll, erscheint in seinen Strukturen bû¥rokratischer und rû¥ckstûÊndiger als jeder andere Betrieb. Die vier Lehrer, die in Ich Wir Ihr Sie zu Wort kommen, geben Einblick nicht nur in das Schulsystem, sondern auch in ihr Seelenleben: Was Schule mit einem macht. Welche ûngste und Reflexe sie erzeugt. Aus Interviews mit gut einem Dutzend Lehrern und Lehrerinnen hat Inga Helfrich vier Prototypen herausgeschûÊlt. Da ist die Junge, der es wichtig ist, von den Schû¥lern gemocht zu werden. Dann die Mittvierzigerin, die sich als ãAlleinunternehmerinã fû¥hlt und manchmal schier verzweifelt an der Kluft zwischen Anspruch und Pflicht-Wirklichkeit. Die 62-JûÊhrige wiederum, die schon immer ãwas mit Kindern machenã wollte, zieht den Job jetzt ãprofessionellã durch bis zur Rente. Und der Alt-68er, dem das Ideal vom ãpûÊdagogischen Erosã noch nicht abhandengekommen ist, hat nach all den Jahren im Beruf noch immer ein ãmulmiges Gefû¥hlã, wenn er morgens in die Schule radelt. Sie alle erzûÊhlen von Selbstzweifeln, Deformationen, Ticks. Von TrûÊumen ã sofern sie noch welche haben ã und den Zumutungen des Systems. Von der Herausforderung, Lehrer zu sein. Vom oft betriebsblinden Dahinstrampeln. Von dem Dreieck, das Lehrer, Schû¥ler und Eltern bilden. Ein Dreieck, das im besseren Fall eine Zweckgemeinschaft, im schlimmeren Fall eine Zwangsgemeinschaft sein kann, in der immer die anderen Schuld an den MissstûÊnden haben. Und doch blitzt in den Aussagen der Lehrer immer wieder Hoffnung auf: in der Reflektion der eigenen Rolle, im Annehmen von Verantwortung, in der Suche nach SolidaritûÊt. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 15.09.2013
Datum: 15.09.2013Länge: 00:51:39 Größe: 47.30 MB |
||
| Eran Schaerf: FM-Scenario - Vielleicht-IdentitûÊt - Darstellerlose Auffû¥hrung - 13.09.2013 | ||
| Mit Franziska Ball, Achim Bogdahn, Pauline Boudry, Marina Marosch, Silvie Sperlich, Peter Veit / Montage: Peter Steckroth / Realisation: Eran Schaerf / BR 2013 / LûÊnge: 58'09 // FM-Scenario ist ein intermediales Projekt, das sich û¥ber Website, Sendungen, Ausstellungen und Publikationen realisiert. Eine Kooperation von: BR HûÑrspiel und Medienkunst; A Production e. V., Berlin; HartwareMedienKunstVerein, Dortmund; Haus der Kulturen der Welt, Berlin; Les Complices*, Zû¥rich; Museum fû¥r Konkrete Kunst, Ingolstadt; ZKM, Karlsruhe. GefûÑrdert durch die Kulturstiftung des Bundes. Im Englischen wird die Bû¥hne im Theater gewûÑhnlich vom Standpunkt des Zuschauers beschrieben, im FranzûÑsischen vom Standpunkt des Schauspielers. Wenn beide Beschreibungskonventionen im Spiel sind, wie im fm-scenario, entsteht ein Konflikt: ãDer Bû¥hnenraum kann nicht dargestellt werden ã er entstehtã, sagt Peter Steckroth am Ende eines Interviews mit Eran Schaerf, das so begann: Auf der Website fm-scenario.net bist du mit û¥ber 200 Audiofragmenten konfrontiert. Daraus hast du 27 gewûÊhlt und dieses HûÑrspiel zusammengestellt. Wie bist du bei der Auswahl vorgegangen? - Zuerst einmal chaotisch. Ich lieû mich treiben und verbrachte Stunden beim HûÑren. Dann ergab sich der Zufall, dass ich auf Module stieû, die ich bereits gehûÑrt hatte. So begann ich mich mit dem einen oder anderen Modul anzufreunden. Mich trieb der Gedanke an, dass die Kombination von Modulen nicht nur den Charakter einer mûÑglichen Narration versprach, sondern ich mich plûÑtzlich selbst in der unvorhersehbaren aktiven Rolle wiederfand, als HûÑrer und Sprecher zugleich. - Hatte diese HûÑrer-Sprecher-Rolle Einfluss darauf, wie du dir ein Thema vorgenommen hast? - Ein Thema wûÊre eine Sackgasse. Die Sprache der fm-scenario-Module funktioniert eher û¥ber Verweise, wie die Orientierung in einer Stadt û¥ber Merkmale. Du wirst nach deiner IdentitûÊt gefragt, deinem Aufenthaltsort oder ob du ãin der Sendung wohnenã mûÑchtest. - Stadt, Bû¥hne, Sendung ... Beim ZuhûÑren wandert man in deiner Montage durch RûÊume und Standpunkte. Kann man von einem Ort des Geschehens sprechen? - Ich denke da an die Bû¥hne im FranzûÑsischen und Englischen und hûÑre die Module aus zwei unterschiedlichen Perspektiven. Das lûÊsst den Wechsel von Kartografie û¥ber Verortung zu IdentitûÊtsfragen zu. Der Raumwechsel ist das Geschehen. Wenn auf die Ullsteinhaus-Reportage Larissa Reissners, die die Mechanismen der Illustrierten offenlegt, ein nicht darstellbarer Raum folgt, entsteht ein VerhûÊltnis zwischen der Raumkonstruktion in Illustrierten und dem Raum des HûÑrers. Ist die Illustrierte die Bû¥hne, oder steht der HûÑrer ebenfalls darauf? | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 13.09.2013
Datum: 13.09.2013Länge: 00:58:13 Größe: 53.30 MB |
||
| Andreas Ammer: GOTT - 30.08.2013 | ||
|
Mit Katharina Franck, Andreas Ammer, Carl-Ludwig Reichert / Komposition:Console / NU / Karl Ivar Refseth / Regie: Andreas Ammer / BR 2013 / LûÊnge: 53'57 // Philosophische Forschungen haben Ende des vorvergangenen Jahrhunderts ergeben, dass Gott gestorben sein kûÑnnte. Wer aber tot ist und wer ehemals berû¥hmt und mûÊchtig war, dem gebû¥hrt als letztes noch ein Eintrag im Lexikon. Und so geschah es zu der Zeit auch mit Gott, dem vormals AllmûÊchtigen. Das mûÊchtigste, das grûÑûte jemals erschienene Lexikon des Abendlandes aber ist die Allgemeine EncyclopûÊdie der Wissenschaften und Kû¥nste von Johann Samuel Ersch und Johann Gottfried Gruber: ein ãRiesen- und Ehrenwerk teutscher Grû¥ndlichkeit und teutschen Fleiûesã: Ihr Vorsatz war selbst fast gûÑttlichen Ausmaûes: ãUnsere EnzyklopûÊdie soll alle FûÊcher des menschlichen Wissens und KûÑnnens vollstûÊndig umfassen.ã ûber sieben Jahrzehnte lang schrieben derart û¥ber 400 Wissenschaftler an dem ãRiesen- und Ehrenwerkã, bevor die Unternehmung 1889 nach 168 TeilbûÊnden mit dem Schlagwort ãPhyxiusã endgû¥ltig fû¥r immer unvollendet eingestellt wurde. (Andreas Ammer)
In einer der vielen Bibliotheken, die dieses zumeist staubverfangene Mammutwerk stolz und ungelesen auf vielen sich biegenden Regalbrettern im Lesesaal fû¥hren, ist Andreas Ammer Anfang des 21. Jahrhunderts dergestalt ãGottã in Gestalt des 84-seitigen diesbezû¥glichen Lexikoneintrages am Ende des 75. Teilbandes der EnzyklopûÊdie (ãGOSA-GRAAFã) erschienen. Der Text des Lexikoneintrages ãGottã aus dem Ersch/Gruber bildet die Grundlage fû¥r das HûÑrspiel GOTT, das jenes versunkene Wissen um das verstorbene Wesen in einen unendlichen Trauermarsch formiert, zu dem Console, NU und der Vibraphonist Karl Ivar Refseth die Musik geliefert haben. Oder wie der Autor der EnzyklopûÊdie es unmiss- aber nicht ganz leicht verstûÊndlich formuliert: "Gott ist, was er ist, fû¥r die allgemeine Menschenvernunft, die in aller Wissenschaft, auch in der theologischen, wenn sie echter Art ist, das Wort fû¥hren muû, er ist, sagen wir, das, was er ist, nur dadurch, daû er ..." |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 30.08.2013
Datum: 30.08.2013Länge: 00:53:33 Größe: 49.03 MB |
||
| Schuldt: Deutschland aufsagen, Deutschland nachsagen - 23.08.2013 | ||
| Mit Gabor Altorjay, Louis Jean Bouchard, Dorothee Brodowsky, Daniel Brû¥cher, Ernst Brû¥cher, Katharina Brû¥cher, Nikolaus Brû¥cher, Christoph Caskel, Margarita de Delas u.a. / Realisation: Schuldt / Autorenproduktion 1970 / LûÊnge: 37'29 // "Deutschland aufsagen, Deutschland nachsagen ist 1970 entstanden. Der Titel ist langatmig aber wahrheitsliebend: kein Wort ist von mir, alles abgeschrieben : Stellenanzeigen, Speisekarte, Schlagertexte, Wetterbericht fû¥r Nordseefischer, Preisliste vom Friseur, Ladennamen... Das HûÑrspiel ist primitiv. So musste es auch sein. HûÊtte ich nach SchûÑnheit und ûÊsthetischem Rang gestrebt, wûÊre etwas Anderes daraus geworden: perfekter, voll gedrûÑhnt mit Raffinessen wie Echo Nachhall Mischung Musik. Irrefû¥hrender Glanz hûÊtte sich û¥ber den heiseren Stacheldraht der Stimmen gelegt. Das wollte ich nicht." (Schuldt) | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 23.08.2013
Datum: 23.08.2013Länge: 00:37:29 Größe: 34.33 MB |
||
| Raoul Schrott: Erste Erde Epos: III. Erste Materie - 29.06.2013 | ||
|
Mit Ulrich Noethen, Samuel Finzi, Axel Milberg / Regie: Michael Farin / BR 2013/ LûÊnge: 70'22 // ôÇ"Nie zuvor gab es so viel an Wissen û¥ber den Menschen und das Universum - doch je mehr Daten und Details angehûÊuft werden, desto weniger verstehen wir im Grunde. Wir wissen zwar, dass die alten Mythen nicht mehr stimmig sind - eine andere Geschichte, die uns und die Welt erklûÊrt, gibt es jedoch nicht." Raoul Schrott Neujahrsmorgen auf einem Berggipfel in der Atacama-Wû¥ste: Ein deutscher Astronom erzûÊhlt von Meteoriten und dem seltsamen Klang, der sich ringsum auszubreiten scheint, wenn sie am Himmel verglû¥hen. Ihre brûÑckelige Kohle stellt die erste Materie dar, die im glû¥henden Sonnennebel entstand, winzige Rubine und Olivine darin. Aus ihnen ballte sich einst unsere Erde zusammen; sie sind das ûlteste, was wir in die Hand nehmen und betasten kûÑnnen, Greifbares vom Anbeginn des Universums. Seit jeher sind Meteoriten mit Symbolik beladen: ob im Mittelalter, wo ein im Elsaû einschlagender Meteorit dem Kaiser Maximilian als Zeichen des Krieges galt, ob in den 1960er Jahren, als ein in Mexiko niedergehender Feuerball als Warnung intergalaktischer VûÑlker vor der Mondlandung gedeutet wurde. Es ist die Suche nach diesen Meteoriten, von der dieser deutsche Astronom erzûÊhlt, vom Anfang der Welt und von seiner kleinen Tochter, der er einen dieser schwarzen Brocken mitbringen will. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 29.06.2013
Datum: 29.06.2013Länge: 01:10:31 Größe: 64.57 MB |
||
| Erste Erde Forum: V. Unsichtbare Astronomie, Radiostrahlung, zerstrahlende Materie - Mit Torsten Enûlin - 29.06.2013 | ||
| Raoul Schrott im GesprûÊch mit dem Astrophysiker Dr. Torsten Enûlin / BR 2013 / LûÊnge: 39'53 | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 29.06.2013
Datum: 29.06.2013Länge: 00:39:53 Größe: 36.53 MB |
||
| Jan St. Werner: miscontinuum - 28.06.2013 | ||
| Mit Kathy Alberici und Taigen Kawabe / Libretto: Markus Popp / Komposition und Realisation: Jan St. Werner / BR/Kunstverein Mû¥nchen 2013/ LûÊnge: 45'56 // Elektronische Oper von Jan St. Werner nach dem Libretto von Markus Popp. Mit den Musikern Kathy Alberici und Taigen Kawabe. Mitschnitt aus dem k.m Kunstverein Mû¥nchen vom 18. Juni 2013. Ununterbrochen rinnt die Zeit: das Vorher wird zum Nachher, das Jetzt zur abgeschlossenen Vergangenheit. Doch es gibt Augenblicke, in denen die Zeit ihre Flieûrichtung zu verlieren scheint. PlûÑtzlich steht sie still und rast zugleich, sie dehnt sich in alle Richtungen aus, bleibt offen und verûÊnderlich. Dieser Zustand der verdichteten Zeitwahrnehmung ist der Ausgangs- und Endpunkt von miscontinuum, das im Rahmen der von Jan St. Werner konzipierten vierteiligen Veranstaltungsreihe Das Asymmetrische Studio im Kunstverein Mû¥nchen e.V. uraufgefû¥hrt wird. Der Protagonist des Stû¥ckes tritt aus seinem alltûÊglichen Leben heraus und erkennt, dass er ã von der LinearitûÊt der Zeit befreit ã nicht nur die Gegenwart, sondern auch seine eigene Vergangenheit verûÊndern und modulieren kann. Vor ihm erûÑffnet sich ein Feld unendlicher MûÑglichkeiten, ein Zeit-Raum, in dem sich KlûÊnge, Worte und Bilder neu verknû¥pfen und wechselseitig kommentieren. Und so, wie stets in der Schwebe bleibt, ob dieser Zustand tatsûÊchlich nur eine Sekunde oder ein ganzes Leben andauern kann, bleibt auch bis kurz vor der Urauffû¥hrung im Kunstverein Mû¥nchen offen, wie lange das Stû¥ck letztlich dauern soll. Indem miscontinuum aus kleinsten Fragmenten besteht, die je nach Auffû¥hrungskontext variiert und neu zusammengesetzt werden kûÑnnen, entsteht ein zeitlich flexibler, multisensueller Wahrnehmungsraum: Abstrakte, unendlich variierte Muster erscheinen als Projektionen auf den WûÊnden des Kunstvereins, elektroakustische KlûÊnge und GerûÊusche fluktuieren frei im Raum umher, verdichten sich zeitweise zu mikroskopischen Fragmenten, um sich schlieûlich wieder auszudehnen und ins Unermessliche anzuwachsen. Dabei oszillieren die Kompositionen zwischen den Kategorien Rhythmus und Harmonie, zwischen Krach und Struktur; sie gleichen einer ûffnung, durch die man einen Zeit-Raum betreten kann, in dem die HûÑrer gûÊnzlich vom Klang umfangen und durchdrungen werden. Musikalische Bezû¥ge und Assoziationen sind unter anderem bei der Spektralen und Konkreten Musik zu finden. Menschliche Stimmen haben keine erzûÊhlerische Funktion, sondern werden wie Instrumente eingesetzt. Dennoch besitzt miscontinuum wie in einer klassischen Oper ein Libretto, wenn dieses auch nicht gesungen, sondern vorgelesen wird. So findet in dieser dekonstruierten Idee der Oper, wie auch in der daraus entstehenden radiophonen Neukomposition von miscontinuum nicht das PompûÑse und Monumentale einen Raum, sondern die Konzentration und Reduktion auf den momentanen Ausbruch aus dem Kontinuum der Zeit. // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 28.06.2013
Datum: 28.06.2013Länge: 00:46:04 Größe: 42.19 MB |
||
| Erste Erde Forum: IV. Antigravitation, Expansion, dunkle Energie - Mit Gerhard BûÑrner - 22.06.2013 | ||
| Raoul Schrott im GesprûÊch mit dem Astrophysiker Gerhard BûÑrner vom Max-Planck-Institut / BR 2013 / LûÊnge: 48'21 | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 22.06.2013
Datum: 22.06.2013Länge: 00:48:21 Größe: 44.27 MB |
||
| Raoul Schrott: Erste Erde Epos: II. Erste Sonnen - 22.06.2013 | ||
| Mit Samuel Finzi / Regie: Michael Farin / BR 2013/ LûÊnge: 57'01 // "Nie zuvor gab es so viel an Wissen û¥ber den Menschen und das Universum - doch je mehr Daten und Details angehûÊuft werden, desto weniger verstehen wir im Grunde. Wir wissen zwar, dass die alten Mythen nicht mehr stimmig sind - doch eine andere Geschichte, die uns und die Welt erklûÊrt, gibt es nicht." (Raoul Schrott) MûÊnner auf einem Berggipfel der Atacamawû¥ste. Einer von ihnen, ein aus Taiwan stammender Astronom, zieht Bilanz, erzûÊhlt von den politischen Konflikten, die sein Leben bestimmt haben, und der Liebe, die er auf der anderen Seite der Meerenge verloren hat. Er erzûÊhlt von einem Asteroidengû¥rtel, der Planetenbildung und einem SternenwûÊrter im Peking des 11. Jahrhunderts, der im Laufe seines Lebens die 'Gaststerne' von gleich zwei Supernovae beobachten konnte, die die scheinbar ewige Ordnung des Kosmos stûÑrten. Wo aber ist unser Ort? Und wo wûÊre ein Gott? Fassbar von der Welt ã ob von der privaten oder dem Kosmos ã sind stets nur Bruchstû¥cke und Spuren. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 22.06.2013
Datum: 22.06.2013Länge: 00:57:09 Größe: 52.34 MB |
||
| Eran Schaerf: FM-Scenario - szenischer Alltag - Geschlecht - RotkûÊppchen - RealitûÊtswettlauf - 21.06.2013 | ||
|
Mit Achim Bogdahn, Pauline Boudry, Marina Marosch, Silvie Sperlich, Peter Veit / Montage: Margit Rosen / Realisation: Eran Schaerf / BR 2013/ LûÊnge: 36'23 // // FM-Scenario ist ein intermediales Projekt, das sich û¥ber Website, Sendungen, Ausstellungen und Publikationen realisiert. Eine Kooperation von: BR HûÑrspiel und Medienkunst; A Production e. V., Berlin; HartwareMedienKunstVerein, Dortmund; Haus der Kulturen der Welt, Berlin; Les Complices*, Zû¥rich; Museum fû¥r Konkrete Kunst, Ingolstadt; ZKM, Karlsruhe. GefûÑrdert durch die Kulturstiftung des Bundes. Das HûÑrspiel bildet gleichzeitig den Ausgangspunkt fû¥r Eran Schaerfs Ausstellung im ZKM, Karlsruhe (22. Juni bis 4. August 2013).
Eine HûÑrerin (kann auch ein HûÑrer sein) loggt sich bei der Stimme des HûÑrers ein ã einem Radiosender fû¥r HûÑreranrufe, der von einem automatischen Moderator betrieben wird. Um die Registrierung erfolgreich abzuschlieûen, fehlt dem Programm noch die Angabe zum Geschlecht. ãZeit û¥berschrittenã, meldet das Programm, ãSie haben sich weder mit mûÊnnlichem noch mit weiblichem Geschlecht registriert. Wollen Sie fû¥r ein neutrales Objekt gehalten werden? Ja. Nein. Weiter.ã Lange kann der automatische Moderator auf die Angabe nicht warten ã wir sind auf Sendung und auf Sendung gilt: pausenlos. Die Angabe aber lûÊsst auf sich warten. Dass jemand lûÊnger als soundso viele Sekunden brauchen wû¥rde, um das eigene Geschlecht anzugeben, war bei der Programmierung des Moderators offenbar nicht vorgesehen. Ihm bleibt nichts anderes û¥brig, als auf Sendersuche zu gehen. So wurde er fû¥r den Fall programmiert, dass sich kein HûÑrer meldet: er sucht den Empfangsbereich nach Sendungen ab und sendet sie mit. Das ist zwar illegal, aber in der Fiktion noch gestattet. Es folgen Nachrichten (Charaktertrainer des BND sagt vor Gericht aus), Anrufe weiterer HûÑrer (ûberprû¥fen Sie Ihren Zugriff auf die Welt) oder das GesprûÊch zwischen Mutter und Kind (Mama, warum hast du mich als RotkûÊppchen verkleidet?). Wû¥rde der Moderator verstehen, was er zur Sendung bringt, wû¥rde er auch verstehen, dass Geschlecht keine Sache der Angabe ist, sondern Auffû¥hrung von Rollen. Gelegentlich handelt es sich dabei um eine publikumslose Auffû¥hrung. Die Welt ist vielleicht eine Bû¥hne, doch fû¥r so manche Auffû¥hrung werden die Eintrittskarten nie gedruckt (das wû¥rden der Charaktertrainer und RotkûÊppchens Mutter auch gar nicht wollen). Der Moderator versteht nicht die Welt, die er zu moderieren programmiert wurde. Das ermûÑglicht ihm, seine Macht û¥ber die HûÑrerin 126 auszuû¥ben, die ihn samt seiner Geschlechtskategorien los zu werden versucht. Dazu kann er nur sagen: dafû¥r bin ich nicht programmiert. WûÊhrend "Die Stimme des HûÑrers" eine Fiktion bleibt, in der die Montage der Wirklichkeit durch die Massenmedien wiederaufgefû¥hrt wird, bietet das Online-Studio fm-scenario.net Nutzerinnen die MûÑglichkeit, narrative Module aus Eran Schaerfs HûÑrspielarbeit zu ihrer eigenen Version der Stimme des HûÑrers zusammenzustellen. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 21.06.2013
Datum: 21.06.2013Länge: 00:36:31 Größe: 33.44 MB |
||
| Raoul Schrott: Erste Erde Epos: I. Erstes Licht - 15.06.2013 | ||
| Mit Sibylle Canonica, Axel Milberg, Ulrich Noethen / Regie: Michael Farin / BR 2013/ LûÊnge: 63'36 // "Nie zuvor gab es so viel an Wissen û¥ber den Menschen und das Universum - doch je mehr Daten und Details angehûÊuft werden, desto weniger verstehen wir im Grunde. Wir wissen zwar, dass die alten Mythen nicht mehr stimmig sind - doch eine andere Geschichte, die uns und die Welt erklûÊrt, gibt es nicht." (Raoul Schrott) Der letzte mû¥ndliche WeltschûÑpfungsmythos entstand um 1850 und stammt von den Maori. Der ideale Ort, um ihn sich zu erzûÊhlen, sind die HûÑhlen von Waitomo, wo Glû¥hwû¥rmchen unterirdische Universen aufleuchten lassen. ã Am anderen Ende der Welt, in der Atacama-Wû¥ste, wird in der Sû¥dsternwarte ein Monitor aufgebaut, mit dem geprû¥ft werden soll, ob sich der Gipfel des Cerro Armazones als Standort fû¥r das weltgrûÑûte Spiegelteleskop eignet ã und grundlegende Sondierungen des Universums. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 15.06.2013
Datum: 15.06.2013Länge: 01:03:45 Größe: 58.37 MB |
||
| Raoul Schrott: Erste Erde Epos: Prolog: Trost und Trotz - Raoul Schrott û¥ber Erste Erde Epos - 14.06.2013 | ||
| Mit Raoul Schrott / GesprûÊch und Montage: Michael Farin / BR/SWR 2013 / LûÊnge: 35'26 // "Nie zuvor gab es so viel an Wissen û¥ber den Menschen und das Universum - doch je mehr Daten und Details angehûÊuft werden, desto weniger verstehen wir im Grunde. Wir wissen zwar, dass die alten Mythen nicht mehr stimmig sind - eine andere Geschichte, die uns und die Welt erklûÊrt, gibt es jedoch nicht." (Raoul Schrott ) | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 14.06.2013
Datum: 14.06.2013Länge: 00:35:26 Größe: 32.44 MB |
||
| Erste Erde Forum - Von der Metapher in die Poesie - Mit Raoul Schrott - 14.06.2013 | ||
| Raoul Schrott (Autor) im GesprûÊch mit Annegret Arnold û¥ber "Erste Erde Epos": Von der Metapher in die Poesie | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 14.06.2013
Datum: 14.06.2013Länge: 00:21:10 Größe: 19.39 MB |
||
| Thomas Palzer: Ministerium des Innern - 09.06.2013 | ||
| Mit Knut Cordsen, Eva Gosciejewicz, Paul Herwig, Stefan Merki, Philipp Moog, Thorsten Nindel, Heiko Ruprecht / Regie: Ulrich Lampen / BR 2003 / LûÊnge: 54'33 // Im Ministerium des Innern tut sich was. Das Radio lûÊuft, Beethoven spielt bei Aldi und irgendwo kann man tûÊglich eine Million gewinnen. Eine Auffû¥hrung des ganz AlltûÊglichen findet in Thomas Palzers Sprechstû¥ck statt. Dafû¥r lûÊsst der Autor das beobachtende und erzûÊhlende Ich in einer Vielzahl von Stimmen fû¥r sich sprechen. Eine Auffû¥hrung des ganz AlltûÊglichen findet in Thomas Palzers Sprechstû¥ck statt. Dafû¥r lûÊsst der Autor das beobachtende und erzûÊhlende Ich in einer Vielzahl von Stimmen fû¥r sich sprechen. Mit der Methode der Bricolage entsteht eine Sprachkomposition fû¥r den Dativ, Narrativ, Perspektiv, Subjektiv, Imperativ. Musik ohne Musik. Der Komponist: das Selbst, die Komposition: das Ich. "Wie finde ich meine Erinnerungen wieder?" ist die an die Ichs gestellte Frage. Beim Hantieren mit vorgefundenen Materialien, mit GedûÊchtnisspuren, Beobachtungen, Wahrnehmungen und Erinnerungen an Wahrnehmungen fû¥hren Antworten sowohl mitten in deutsche Feuilletondebatten wie in deutsche Amtsstuben. // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 09.06.2013
Datum: 09.06.2013Länge: 00:54:40 Größe: 50.06 MB |
||
| Ingeborg Lû¥scher/Peter Moritz Pickshaus: Auressio - 10.05.2013 | ||
| Mit Franz Rueb, Katja Bû¥rkle, Ingeborg Lû¥scher / Komposition: Dirk Leyers / Bearbeitung und Regie: Nikolai von Koslowski / BR 2010 / LûÊnge: 51'31 // Auressio - so heiût der Ort im Tessin, in dessen NûÊhe der Schweizer Einsiedler Armand Schulthess gelebt hat. Die junge Kû¥nstlerin Ingeborg Lû¥scher erlebt Schulthess wie ein scheues Tier, als sie erstmalig sein Terrain erkundet. Auf dem SteilgelûÊnde seines Areals verknotet Schulthess Zweige zu GelûÊndern und baut aus Sperrmû¥ll, BaumstûÊmmen und Altreifen abenteuerliche Stege und Aussichtspunkte. Dazwischen hûÊngt er Hunderte von Schrifttafeln und GegenstûÊnde in die BûÊume seines Kastanienwalds und offeriert dem unerbetenen Besucher sein enzyklopûÊdisches Wissen, genauer, ein einzigartiges Ordnungssystem des Weltwissens in einer Art Freiluft-EnzyklopûÊdie. Als Schulthess 1972 starb, wurde sein wildwuchernder Garten des Wissens plattgewalzt. Mit Peter Moritz Pickshaus suchte Lû¥scher im Jahr 2007 noch einmal das Areal auf, wo sich einst der Wunderwald des Armand Schulthess befand. Das HûÑrspiel Auressio fokussiert die Begegnung zwischen ihr und Schulthess. // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 10.05.2013
Datum: 10.05.2013Länge: 00:51:40 Größe: 47.31 MB |
||
| Arthur Schnitzler: FrûÊulein Else - 03.05.2013 | ||
| Mit Elisabeth Bergner / Regie: Heinz-Gû¥nter Stamm / BR (Aufzeichnung am 28.10.1949 im Lessingtheater Nû¥rnberg) / LûÊnge: 68'08 // Ein Eilbrief reiût die 19jûÊhrige Else, Tochter eines jû¥dischen Advokaten in Wien, aus der beschaulichen Ruhe eines Kurortes in den italienischen Dolomiten. Sie soll den KunsthûÊndler Dorsday, der sich gerade im selben Kurort aufhûÊlt, um ein kurzfristiges Darlehen von dreiûigtausend Gulden bitten. Elses Vater ist in BedrûÊngnis. Ihm wird vorgeworfen, Gelder unterschlagen zu haben, und nun droht ihm neben Bankrott und gesellschaftlichem Skandal auch die Inhaftierung. Dorsday willigt dem Wechsel unter einer Bedingung ein: er will Else unbekleidet betrachten dû¥rfen. Angewidert verschiebt diese die Entscheidung auf den nûÊchsten Abend. In der Zwischenzeit treffen jedoch neue Nachrichten ein: plûÑtzlich werden fû¥nfzigtausend Gulden benûÑtigt. Else sieht sich gezwungen, auf die Forderungen Dorsdays einzugehen und begibt sich, nur mit einem schwarzen Abendmantel bekleidet, auf die Suche nach ihm. Arthur Schnitzlers Roman FrûÊulein Else von 1924 gilt nach dem 1922 erschienenen Ulysses von James Joyce als das erste deutsche Beispiel eines konsequent prûÊsentierten inneren Monologes. // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 03.05.2013
Datum: 03.05.2013Länge: 01:08:08 Größe: 62.39 MB |
||
| Klaus Buhlert: Walter Ruttmann Weekend Remix - production memory Remix - 05.04.2013 | ||
| Mit Klaus Buhlert / BR 1998 / LûÊnge: 10'34 // Walter Ruttmann hatte nach den Erfahrungen mit seinen Filmen Berlin - Die Sinfonie der Groûstadt (1927) und Melodie der Welt (1929/1930) ganz bewusst nach MûÑglichkeiten gesucht, einen HûÑrfilm als Beitrag fû¥r das Radio zu produzieren. "Alles HûÑrbare der Welt wird Materialã, schrieb er 1929 in einem Manifest. TûÑne und KlûÊnge sollten fû¥r sich allein stehen und wurden fû¥r Weekend als zufûÊllige und gewollte Elemente auf der Tonspur eines Lichttonfilms aufgenommen. Erstmals wurde damit eine kû¥nstlerische Radioproduktion realisiert, deren Material montiert und nach rhythmischen, musikalischen Prinzipien gestaltet werden konnte. "Mir ist diese Geschichte sehr wertvoll, ich mûÑchte sie in den StrûÊngen von Ruttmann, auch mit den GerûÊuschen von Ruttmann erzûÊhlen, ich mûÑchte ein paar RûÊume aufmachen und sie mit meiner Arbeit der letzten Jahre als Hommage an Ruttmann umarbeiten und habe dazu Musiken und HûÑrspielsequenzen aus meiner Arbeit der letzten Jahre eingeflochten. Aus einem monophonen Ruttmann-Take der 1930er Jahre entsteht dann plûÑtzlich ein Raum der 1990er." (Klaus Buhlert) | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 05.04.2013
Datum: 05.04.2013Länge: 00:10:34 Größe: 9.69 MB |
||
| Michaela MeliûÀn: FûÑhrenwald - 29.03.2013 | ||
|
MeliûÀn erzûÊhlt die wechselvolle Geschichte der gleichnamigen, 1937 in den Isarauen gebauten Mustersiedlung. Diese diente als geschlossenes Lager fû¥r Zwangsarbeiter, nach dem Zweiten Weltkrieg als Auffanglager fû¥r Displaced Persons - europûÊische, meist polnische Juden, ûberlebende des Holocaust, die als heimatlose AuslûÊnder auf eine Ausreise nach Israel oder Amerika hofften. // Mit Philip GûÑtz, Leonie Hofmann, Gabriel Hecker, Marion Breckwoldt, Peter Brombacher, Eva Gosciejewicz, Hans Kremer, Anna Barbara Kurek, Stefan Merki, Stefan Zinner / Komposition: Michaela MeliûÀn/Carl Oesterhelt / Realisation: Michaela MeliûÀn / BR/kunstraum muenchen 2005/ LûÊnge: 55'12 Ab 1955 hatte FûÑhrenwald erstmals freiwillige Bewohner, Heimatvertriebene, die sich Siedler nannten. Der Text des HûÑrspiels verwendet u.a. transkribierte Interviews und Aufzeichnungen der damaligen Bewohner, die Komposition basiert auf KlûÊngen ã oft nur dem Rauschen und Kratzen alter Schellackplatten. Diese TontrûÊger wurden in den Jahren 1931-35 von Schallplattenfirmen, die mit dem ãJû¥dischen Kulturbundã assoziiert waren, verlegt.
Michaela MeliûÀn wurde im Mai 2005 fû¥r FûÑhrenwald mit dem 55. HûÑrspielpreis der Kriegsblinden ausgezeichnet. In der Begrû¥ndung der Jury heiût es: ãDas Lager ã eine Metapher fû¥r das zwanzigste Jahrhundert. Michaela MeliûÀn setzt sich mit einem bedeutenden Thema auseinander, das sie mit groûer Kunst stimmig aufarbeitet. Sehr verdichtet ist der Wechsel von Zeit und Bedeutung zusammengefasst in dem lakonisch zitierten Wechsel der Straûennamen in FûÑhrenwald: Adolf-Hitler-Platz ã Independence Place ã Kolpingplatz. Bei diesem aus persûÑnlichen Berichten und historischen Quellen gestalteten HûÑrspiel wû¥rdigt die Jury sowohl die sorgfûÊltige und ergebnisreiche Recherche wie die kû¥nstlerische Darstellung. Die Erlebnisberichte werden nicht von den Zeitzeugen selbst, sondern von Schauspielern gesprochen. Dadurch werden sie vom PersûÑnlichen abgelûÑst und auf eine andere Ebene gehoben. Durch die sparsam gewûÊhlten Mittel entsteht eine konzentrierte Ruhe, die den HûÑrer bannt. Dem rhythmischen Wechsel der Stimmen, in dem das individuelle Schicksal immer wieder durch virtuos gesetzte ZûÊsuren als ein gebrochenes dargestellt wird, steht die flieûende HûÑrspielmusik gegenû¥ber. In dieser Musik wird Zeit als ein unaufhaltsamer Fluss der Geschichte vertont, der gleichgû¥ltig û¥ber Einzelschicksale hinweggeht. Auf diese Weise setzt MeliûÀn historische Allgemeingû¥ltigkeit mit individuell Erlebtem in Beziehung und bereichert das Genre des HûÑrspiels um einen akustischen Ausdruck fû¥r erinnerndes Bewusstsein.ã |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 29.03.2013
Datum: 29.03.2013Länge: 00:55:31 Größe: 50.84 MB |
||
| JûÑrg Albrecht: Hell of Fame - 24.03.2013 | ||
|
Mit Sebastian Weber, Jule Ronstedt, Ferdinand Schmidt-Modrow, Wiebke Puls, Ilona Grandke, Oliver Mallison, Martin Umbach, Johannes Zinner, Claudia-Sophie Jelinek / Komposition: Jakob Suske / Regie: Bernadette Sonnenbichler / BR 2013 / LûÊnge: 54'08 // Den Forever 27-Club hat er nicht mehr geschafft, aber 31 ist auch noch frû¥h: Der Autor JûÑrg Albrecht ist gestorben, und ein Feature widmet sich diesem kurzen, abgebrochenen Leben. Freunde und Kollegen des Verstorbenen treten auf und ab. Lieblingsfilme werden anzitiert, Schnipsel aus Leben und Werk ineinander geblendet, VerschwûÑrungstheorien û¥ber den Tod gestrickt. War es die Arbeit, die ihn umgebracht hat, oder der Versuch, ein mûÑglichst gutes Leben zu fû¥hren? Wer weiû besser darû¥ber Bescheid: der Literaturwissenschaftler, die Agentin oder die Wahrsagerin? Und muû man den Toten û¥berhaupt nachrufen, um sie zum Reden zu bringen? Mit Hell Of Fame schreibt JûÑrg Albrecht einen Nachruf auf sich selbst. Was anfangs wie die Chronik eines einzelnen Lebens aussieht, gleitet ab, û¥berschlûÊgt sich, wird zur Darstellung einer global ausgeweiteten urban-medialen SphûÊre, in der die Bilder so stark geworden sind, dass sie die Subjekte, die sie abbilden sollen, lûÊngst abgedrûÊngt haben. Aber wohin? Dorthin, wo man, aus Feigheit davor, û¥ber ordentliche Honorare zu streiten, mit dem Kurator nur Kaffee trinkt? Ist das Problem, dass niemand mehr hinter die Bilder schauen kann, oder dass es kein kohûÊrentes Bild mehr gibt? Auch im aufpolierten Image des Autors, den niemand versteht, blitzt schon genug auf, zum Beispiel eine Vielzahl prekûÊrer Existenzen in dieser einen Existenz.
Immer wieder fragt der Nachruf auch, was ein Nachruf û¥berhaupt sein kann, wenn er schon seit Monaten, manchmal Jahren oder gar Jahrzehnten fertig in der Schublade liegt. Oder, andersrum gefragt: Wenn die Bilder, die man erfû¥llen will, das Leben schon danach abtasten, was nach dem Tod davon bleibt, was heiût es dann noch, zu leben? Hat die MûÑglichkeit, dass alles ãlarger than lifeã sein kann, endgû¥ltig ausgedient? Oder mû¥ssen wir û¥berhaupt aufhûÑren, û¥ber Leben zu sprechen und eher eine andere Kategorie finden fû¥r das, was wir tun, jeden Tag? // |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 24.03.2013
Datum: 24.03.2013Länge: 00:54:14 Größe: 49.66 MB |
||
| Jan St. Werner: transaxûˋlectroacoustique - 22.03.2013 | ||
| Konzert mit Jan St. Werner/Black Manual (Valdir Jovenal, Juninho Quebradeira, Leo Leandro). Live-Mitschnitt aus dem k.m Kunstverein Mû¥nchen am 18.03.2013 / Konzeption und Realisation: Jan St. Werner/Black Manual / BR/Kunstverein Mû¥nchen 2013 / LûÊnge: 50'50 // In den RûÊumen des Kunstvereins, wie auch in der daraus entstehenden radiophonen Ursendung, zerflieûen die Grenzen zwischen Weltlichem und Auûerweltlichem, verbinden sich Dynamiken der Lautsprecherkompositionen mit der live gespielten Instrumentalmusik, bûÊumen sich KlûÊnge auf, zerflieûen Rhythmen zu GerûÊuschen und lassen dabei mit den improvisatorischen Mitteln einer Live-Performance zwischen Konzert, Soundinstallation und Zeremonie Material fû¥r ein Radiostû¥ck entstehen. "Der Ort, an dem getanzt wird", "Haus der Initiation", oder "Versammlung" ã dem Wort Candomblûˋ werden zahlreiche Bedeutungen zugesprochen. Zuallererst ist Candomblûˋ jedoch eine Religion, die sich verbreitete, als afrikanische Sklaven, vor allem der Ethnie der Yoruba, nach Brasilien verschleppt wurden. Eine Religion, die bis in die 1970er Jahre in Brasilien verboten war, die von der katholischen Kirche lange Zeit als Teufelswerk verurteilt wurde, auch oder gerade weil sie Elemente des Katholizismus integriert. Zugleich ist Candomblûˋ tief im Profanen verwurzelt ã eine weltliche Religion, die in ihrer Wirkung auf das Auûerweltliche zielt, das Transzendente aufrufen will, in der die Grenze zwischen Ritus und Alltag zwar existiert, aber nicht fest fixiert ist. Man kûÑnnte auch sagen: Candomblûˋ ist ein multimediales Kunstwerk, das aus TûÊnzen, Musik, besonderem Essen und rituellen Gesten besteht; eine Form der Zusammenkunft und Gemeinschaft, eine Kraft und Dynamik (axûˋ), die vermehrt werden mûÑchte, gerade auch durch die Atabaques ã rituelle Fasstrommeln ã die "sprechen" kûÑnnen (a fala dos atabaques) und û¥ber eigene KrûÊfte verfû¥gen. Jan St. Werners abstrakte Soundgebilde û¥bersetzten die Candomblûˋ-Musiker direkt in ihre musikalische Sprache, lernten sie auswendig und generierten daraus eigene Texturen. Nach einer ersten gemeinsamen Performance, die mehr als vier Stunden dauerte, finden die Musiker als Black Manual nun ein zweites Mal im Rahmen der vierteiligen, von Jan St. Werner konzipierten Veranstaltungsreihe "Das Asymmetrische Studio" im Kunstverein Mû¥nchen e.V. zusammen. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 22.03.2013
Datum: 22.03.2013Länge: 00:50:57 Größe: 46.66 MB |
||
| Ernst Horn: Walter Ruttmann Weekend Remix - Sympathie fû¥r Schulze Remix - 15.03.2013 | ||
| Realisation: Ernst Horn / BR 1998 / LûÊnge: 11'21 // Weekend von Walter Ruttmann (1887-1941) ist eine Pionierleistung aus den frû¥hen Tagen des Rundfunks. In einer 11 Minuten 10 Sekunden langen Collage von Worten, Musikfetzen und KlûÊngen prûÊsentierte der Filmemacher und Medienkû¥nstler Walter Ruttmann am 13. Juni 1930 eine avantgardistische und radikal innovative Radioarbeit: ein akustisches Bild einer Berliner Wochenend-Stadtlandschaft. 68 Jahre nach der Entstehung des Originals lud die Redaktion HûÑrspiel und Medienkunst internationale Kû¥nstler zu Walter Ruttmann Weekend Remix-Versionen fû¥r den Bayerischen Rundfunk ein. "Je ûÑfter ich das angehûÑrt habe, desto mehr kam da ein naiver frûÑhlicher zukunftsfreudiger Charme raus, ein spielerischer Futurismus, dem ich mich nicht entziehen konnte. Ich machte also keine harten Schnitte, die Ruttmann verwendet hat, sondern hab in meinen Samples kleine Szenen mit weichen Blenden zusammengefasst." (Ernst Horn) | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 15.03.2013
Datum: 15.03.2013Länge: 00:11:21 Größe: 10.41 MB |
||
| Michael Lentz: Klinik - 08.03.2013 | ||
| Mit Michael Lentz, Sophia Siebert / Komposition: Ernst Horn / Regie: Michael Lentz / BR 2008 / LûÊnge: 69'18 // Ein Mann rasiert sich. Das Telefon lûÊutet. Eine Frau teilt ihm mit, etwas im Briefkasten hinterlegt zu haben. Sie scheint sich verwûÊhlt zu haben. Die Frau ruft wieder an. Sie gibt vor, den Mann zu kennen. Immer wieder ruft sie an, meistens ganz frû¥h am Morgen, wenn der Mann noch schlûÊft. Warum hat er sein Handy nicht ausgeschaltet? Die Frau erzûÊhlt von sich. Er hûÑrt ihr zu. Sie sagt, sie liebe ihn. Und sie sagt, sie sei seit Wochen in der Psychiatrie. Von sich erzûÊhlt der Mann ihr nichts. Sie scheint auch nicht wirklich etwas von ihm wissen zu wollen. Eine Art Phasenverschiebung kommt in Gang. Ruft die Frau einmal nicht an, fehlt sie ihm. Wer nutzt wen aus? Die Verzweiflung der Frau scheint von Tag zu Tag zuzunehmen, immer merkwû¥rdigere Dinge erzûÊhlt sie. Sie wird zudringlich, er mûÑchte sie sich vom Leib halten, aber nicht ihre Stimme. Unfreiwillig wird der Mann zum Mitwisser bedrohlicher VorgûÊnge. Unfreiwillig? Und die VerschwûÑrung, von der die Frau erzûÊhlt, die sie so eindringlich vor Augen stellt, wenn nun doch etwas daran wûÊre? Eines Tages bekommt der Mann tatsûÊchlich einen Brief. Wenig spûÊter ein Paket. Die Sache nimmt Konturen an. Und sollte so schnell wie mûÑglich beendet werden. // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 08.03.2013
Datum: 08.03.2013Länge: 01:09:27 Größe: 63.59 MB |
||
| Ulrike Haage: alles, aber anders - 12 Miniaturen û¥ber Eva Hesse - 01.03.2013 | ||
| Mit Anna Lena Zû¥hlke, Cristin KûÑnig, Ingo Hû¥lsmann, Myra Davies / Realisation: Ulrike Haage / BR 2009 / LûÊnge: 53'47 // Eva Hesse zûÊhlt heute zu den wichtigsten bildenden Kû¥nstlerinnen des zwanzigsten Jahrhunderts. Geboren 1936 in Hamburg, gestorben 1970 in New York: ihr kurzes, intensives Leben ist von so vielen traumatischen Erlebnissen geprûÊgt, das es mehrere Biografien ausfû¥llen kûÑnnte. Im Alter von zwei Jahren wird sie mit ihrer Schwester Helen auf dem Bahnhof Altona von den Eltern getrennt, die Emigration der jû¥dischen Familie gelingt nur, da die Eltern die TûÑchter alleine vorschicken und fû¥r Monate in einem niederlûÊndischen Kinderheim unterbringen. SpûÊter wird die Familie in New York wieder vereint. Die Mutter, die ihre eigenen Eltern im Holocaust verliert, kommt mit der neuen Lebenssituation im fremden Land nicht klar und springt von einem Hochhaus, als Eva zehn Jahre alt ist. ãMein Vater war Strafverteidiger und meine Mutter war die schûÑnste Frau der Welt. Sie sah aus wie Ingrid Bergmann, und sie war depressivã schreibt Eva Hesse spûÊter û¥ber ihre Familie. Ihr Vater heiratet wieder. Mit der Stiefmutter wird Eva Hesse zeit ihres Lebens nicht warm. Nach der Schule beginnt sie ein Studium der Grafik, wirft dieses aber hin, da es ihr mit zu vielen Normen behaftet scheint. Sie beschlieût, Kû¥nstlerin zu werden, da es das einzige zu schein scheint, das ihr leicht fûÊllt. ãVielleicht stellen Worte die beste MûÑglichkeit zu kommunizieren dar, aber ich war nicht in der Lage das zu erreichen. Ich habe mehr Praxis im Visuellen. Ich weiû mehr darû¥ber, und ich habe mehr Vertrauen zum Visuellen. Aber ich wû¥rde das alles gerne mit Worten erreichenã schrieb Eva Hesse in eines ihrer Tagebû¥cher. Anfang der sechziger Jahre erhûÊlt sie wesentliche Impulse durch die Arbeit von Marcel Duchamp. Doch bald verfolgt sie einen eigenstûÊndigen kû¥nstlerischen Ansatz: ãNicht-Kunst, nicht assoziativ, nicht anthropomorph, nicht geometrisch, nicht Nichts. Alles, aber anders, als Vision von einem ganz anderen Referenzpunkt.ã Sie wendet sich Objekten und Skulpturen zu, experimentiert mit Stoffen, Latex, Seilen, Polyesterharz, Fiberglas und mit sich zersetzenden Materialien. Sie lebt fû¥r ihre Kunst und versucht mithilfe ihrer Kunst am Leben zu bleiben. Als ihr mit 33 Jahren ein Gehirntumor diagnostiziert wird, und sie sich operieren lassen muss, arbeitet sie weiter. 1970 stirbt sie, gerade mal 34 Jahre alt. Ihr VerhûÊltnis zum Schreiben ist trotz ihrer Selbstzweifel ausgeprûÊgt vorhanden. Es erscheint in Form von Notizen, Listen, Stichwortsammlungen, AufzûÊhlungen und nicht zuletzt in Form von Titeln, die sie ihren Werken gibt. Textgrundlage des HûÑrspiels bildet eine Auswahl unkommentierter Zitate aus ihren Aufzeichnungen und Interviews. Die Produktion folgt den Grundgedanken und der Materialbesessenheit Eva Hesses und transformiert die Sinnlichkeit ihrer Skulpturen und ihrer Materialien unmittelbar ins Akustische. // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 01.03.2013
Datum: 01.03.2013Länge: 00:53:55 Größe: 49.37 MB |
||
| Eran Schaerf: fm-scenario - Sendesprache - verdeckte Operation - Ansage - Fehler - 22.02.2013 | ||
|
Mit Peter Veit, Franziska Ball, Pauline Boudry, Achim Bogdahn, Marina Marosch / Montage: Inke Arns / Realisation: Eran Schaerf / BR 2013 / LûÊnge: 42'43 // FM-Scenario ist ein intermediales Projekt, das sich û¥ber Website, Sendungen, Ausstellungen und Publikationen realisiert. Eine Kooperation von: BR HûÑrspiel und Medienkunst; A Production e. V., Berlin; HartwareMedienKunstVerein, Dortmund; Haus der Kulturen der Welt, Berlin; Les Complices*, Zû¥rich; Museum fû¥r Konkrete Kunst, Ingolstadt; ZKM, Karlsruhe. GefûÑrdert durch die Kulturstiftung des Bundes. Die Montage FM-Scenario - Sendesprache - verdeckte Operation - Ansage - Fehler der Kuratorin Inke Arns bildet gleichzeitig den Ausgangspunkt der FM-Scenario Ausstellung im Hartware MedienKunstVerein (16.2.-1.4.2013).
ãBekannt fû¥r seine HûÑreranrufe, die von einem automatischen Moderator moderiert werden, bietet Die Stimme des HûÑrers seinen HûÑrern die MûÑglichkeit, eigene Nachrichten zu generieren. Wer sich dafû¥r noch auf der einen oder anderen Pressekonferenz informieren will, aber keinen Presseausweis besitzt, kann sich durch eine Programmfunktion namens Maske einen Zugangscode erstellen und unbemerkt dabei sein. ãEs handelt sich um eine Art Radio-Ticker des Bû¥rgerjournalismusã, sagt ein Sprecher des Verbands EuropûÊischer Nachrichtenagenturen, der nicht genannt werden mûÑchte. ãDas ist in Zeiten der Krise der Nachrichtenmedien durchaus sinnvoll. Fragwû¥rdig ist jedoch, dass Die Stimme des HûÑrers keinerlei Hierarchie zwischen Informationsquellen anstrebt. HûÑrer werden Berichterstatter und umgekehrt ã jeder hat Zugang zu dem Cloud Server des Senders, kann sich dort bedienen, eigene Berichte verfassen und ist bereits wûÊhrend seiner Suche auf Sendung.ããDas hûÑrt sich wie Demokratie an. Sie scheitert spûÊtestens, wenn sie Programm wird und von dem automatischen Moderator eine Stimme erhûÊlt: ãIch verstehe Sie nicht. Sie sprechen in einem unbekannten Format. Sie haben das Format Nachrichten eingestellt und sprechen von sich. Oder wollten Sie eine private Nachricht verfassen?ã WûÊhrend Die Stimme des HûÑrers eine Fiktion bleibt, in der die Montage der Wirklichkeit durch die Massenmedien wiederaufgefû¥hrt wird, bietet das Online-Studio fm-scenario.net Nutzerinnen die MûÑglichkeit, narrativer Module aus Eran Schaerfs HûÑrspielarbeit zu ihrer eigenen Version der Stimme des HûÑrers zusammenzustellen. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 22.02.2013
Datum: 22.02.2013Länge: 00:42:51 Größe: 39.24 MB |
||
| Die Quellen sprechen. Teil 4: Polen September 1939 - Juli 1941 - 16.02.2013 | ||
|
Mit Bibiana Beglau, Matthias Brandt und den Zeitzeugen Bea Green, Helga Verleger, Natan Grossmann, Marcel Reich-Ranicki, Salo Wolf / Bearbeitet von Klaus-Peter Friedrich / Mitarbeit: Andrea LûÑw / Skript HûÑredition: Michael Farin / Regie: Ulrich Gerhardt BR HûÑrspiel und Medienkunst in Zusammenarbeit mit dem Institut fû¥r Zeitgeschichte/Edition 'Judenverfolgung 1933 - 1945ã, 2013 / LûÊnge: 112'08 // Die Quellen sprechen. Die Verfolgung und Ermordung der europûÊischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933-1945. Eine dokumentarische HûÑredition. Nirgendwo in Europa lebten so viele Juden wie in Polen; an die zwei Millionen von ihnen fielen nach dem Einmarsch der Wehrmacht am 1. September 1939 unter deutsche Herrschaft. Fû¥nf Jahre spûÊter lebten nur noch 10 Prozent von ihnen.
Der vierte Teil konzentriert sich auf die antijû¥dische Politik der Deutschen in den besetzten polnischen Gebieten vom Kriegsbeginn 1939 bis zum Einmarsch in die Sowjetunion im Sommer 1941. Die Quellen berichten von den Umsiedlungs- und Deportationsvorhaben, der aggressiven Propaganda und den erweiterten, kriegsbedingten FreirûÊumen der Machthaber; sie dokumentieren die Verzweiflung der polnischen Juden, die ambivalente Rolle der JudenrûÊte und die ZustûÊnde in den û¥berfû¥llten Ghettos. Einen Tag vor dem Abschluss des deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakts hatte Hitler am 22. August 1939 auf dem Obersalzberg seinen GenerûÊlen gegenû¥ber verkû¥ndet: ãVernichtung Polens im Vordergrund. Ziel ist die Beseitigung der lebendigen KrûÊfte, nicht die Erreichung einer bestimmten Linie. [...] Herz verschlieûen gegen Mitleid. Brutales Vorgehen. 80 Millionen Menschen mû¥ssen ihr Recht bekommen.ã Nachdem sich im Oktober 1939 die letzten polnischen Truppen ergeben hatten, wurde Polen zwischen Deutschland und der Sowjetunion aufgeteilt. Die westlichen Provinzen wurden dem Deutschen Reich zugeschlagen. Das restliche besetzte Areal, das ãGeneralgouvernementã, sollte als Reservoir billiger ArbeitskrûÊfte dienen, in das man ãunerwû¥nschte Elementeã abschieben konnte. Dort lebten 12 Millionen Menschen, darunter etwa 1,5 Millionen Juden. In Polen zûÑgerten die Besatzer nicht lange mit der Anordnung, die im Reich erst im September 1941 eingefû¥hrt wurde: die Kennzeichnung der jû¥dischen BevûÑlkerung. Die Bildung der ersten Ghettos wurde noch Ende 1939 befohlen. Im Warschauer Ghetto drûÊngten sich ungefûÊhr 445.000 Menschen auf vier Quadratkilometern zusammen. Etwa ein Viertel der Bewohner verhungerte oder starb an Typhus, Tuberkulose oder Schwindsucht. Das Massensterben begann bereits lange vor dem Einmarsch der Erschieûungskommandos nach Ostpolen und dem Angriff auf die Sowjetunion im Juni 1941. // |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 16.02.2013
Datum: 16.02.2013Länge: 01:52:16 Größe: 102.80 MB |
||
| Die Quellen sprechen. Zeitzeugen: Helga Verleger und Henny Brenner - 11.02.2013 | ||
| Zusammenstellung: Kirsten BûÑttcher / BR 2013 / LûÊnge: 53'56 // An der dokumentarischen HûÑredition "Die Quellen sprechen. Die Verfolgung und Ermordung der europûÊischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933 - 1945" beteiligten sich viele Holocaust-ûberlebende. Sie gaben Opferdokumenten ihre Stimme. WûÊhrend der Aufnahmen zur HûÑredition fû¥hrte Regisseur Ulrich Gerhardt auch GesprûÊche mit den Zeitzeugen, bei denen sie von ihren eigenen Erfahrungen berichteten. Weitere GesprûÊche finden sich auf der Webseite die-quellen-sprechen.de | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 11.02.2013
Datum: 11.02.2013Länge: 00:53:56 Größe: 49.39 MB |
||
| Die Quellen sprechen. Teil 3: Deutsches Reich und Protektorat September 1939 - September 1941 - 09.02.2013 | ||
|
Mit Bibiana Beglau, Matthias Brandt und den Zeitzeugen Helga HoéÀkovûÀ-WeissovûÀ, Ruth Klû¥ger, Arno Hamburger, Walter Joelsen, Pavel StrûÀnskû§ / Bearbeitet von Andrea LûÑw / Skript HûÑredition: Katarina Agathos / Regie: Ulrich Gerhardt BR HûÑrspiel und Medienkunst in Zusammenarbeit mit dem Institut fû¥r Zeitgeschichte/Edition 'Judenverfolgung 1933 - 1945ã, 2013 / LûÊnge: 112'46 // Die Verfolgung und Ermordung der europûÊischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933-1945. Eine dokumentarische HûÑredition. Mit Kriegsbeginn am 1. September 1939 verschlechterte sich die Lage der Juden drastisch. Gesellschaftlich isoliert, systematisch enteignet und mit rigiden Einreisebestimmungen mûÑglicher ZiellûÊnder konfrontiert, scheiterten die meisten Emigrationsbemû¥hungen der deutschen, ûÑsterreichischen und tschechischen Juden. Die nationalsozialistische Politik ging von einer forcierten Auswanderung und Drangsalierung der jû¥dischen BevûÑlkerung zum Massenmord û¥ber. Die ausgewûÊhlten Quellen dokumentieren die frû¥hen Versuche der deutschen BehûÑrden, die Juden an die Randzonen ihres Machtgebietes zu deportieren und belegen die antijû¥dische Politik im sogenannten Protektorat BûÑhmen und MûÊhren. Es wurden vor allem Maûnahmen ergriffen, die bereits im Altreich und in ûsterreich erprobt waren. Die Regierung des besetzten Landes kooperierte. Seit Juni 1939 galten auch hier die ãNû¥rnberger Gesetzeã. Von Oktober 1939 an wurden in fû¥nf Transporten etwa 5.000 Juden aus Wien, MûÊhrisch-Ostrau und Kattowitz in das Gebiet um Nisko am San bei Lublin im deutsch besetzten Teil Polens verschleppt. Doch sowohl der Plan, die Juden ins polnische Generalgouvernement abzuschieben, als auch das Projekt, die europûÊischen Juden nach Madagaskar zu deportieren, scheiterten. Die Grundidee aber, alle Juden innerhalb des deutschen Einflussgebiets in eine abgelegene Region zu sperren, lieû die Planer nicht mehr los. Mit dem Angriff auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 war ein Wendepunkt erreicht: Es wurde ein Vernichtungskrieg. Mit der Berechtigung des Sicherheitsdienstes, ãExekutivmaûnahmenã treffen zu kûÑnnen, mit dem ãKriegsgerichtsbarkeitserlassã und dem spûÊteren Befehl Heydrichs, sûÊmtliche jû¥dische Kriegsgefangene zu erschieûen, wurde im besetzten Gebiet ein rechtsfreier Raum geschaffen. Wochen spûÊter wurden Massenerschieûungen an jû¥dischen MûÊnnern, Frauen und Kindern verû¥bt. In dieser Phase stimmte Hitler der Kennzeichnungspflicht der Juden zu: Seit September 1941 mussten alle deutschen und im Protektorat lebenden Juden, die û¥ber sechs Jahre alt waren, einen gelben Stern tragen. // |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 09.02.2013
Datum: 09.02.2013Länge: 01:52:55 Größe: 103.39 MB |
||
| Die Quellen sprechen. Zeitzeugen : Abba Naor und Walter Joelsen - 04.02.2013 | ||
| Zusammenstellung: Kirsten BûÑttcher / BR 2013 / LûÊnge: 51'30 // An der dokumentarischen HûÑredition "Die Quellen sprechen. Die Verfolgung und Ermordung der europûÊischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933 - 1945" beteiligten sich viele Holocaust-ûberlebende. Sie gaben Opferdokumenten ihre Stimme. WûÊhrend der Aufnahmen zur HûÑredition fû¥hrte Regisseur Ulrich Gerhardt auch GesprûÊche mit den Zeitzeugen, bei denen sie von ihren eigenen Erfahrungen berichteten. Weitere GesprûÊche finden sich auf der Webseite die-quellen-sprechen.de | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 04.02.2013
Datum: 04.02.2013Länge: 00:51:30 Größe: 47.16 MB |
||
| Die Quellen sprechen. Teil 2: Deutsches Reich 1938-August 1939 - 02.02.2013 | ||
|
Mit Bibiana Beglau, Matthias Brandt und den Zeitzeugen Henny Brenner, Inge Lammel, Abba Naor, Ari Rath, Uri Siegel / Bearbeitet von Susanne Heim / Skript HûÑredition: Susanne Heim / Regie: Ulrich Gerhardt BR HûÑrspiel und Medienkunst in Zusammenarbeit mit dem Institut fû¥r Zeitgeschichte/Edition 'Judenverfolgung 1933 - 1945ã, 2013 / LûÊnge: 105'22 // Die Quellen sprechen. Die Verfolgung und Ermordung der europûÊischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933-1945. Eine dokumentarische HûÑredition. In der immer aggressiveren antijû¥dischen Politik im Deutschen Reich setzt der Novemberpogrom 1938 die entscheidende ZûÊsur vor dem Beginn der Deportationen. Die sich anschlieûende, enthemmte "Arisierung" und die radikalere Vertreibungspolitik gegen die jû¥dische BevûÑlkerung gehen Hand in Hand mit dem NS-Rû¥stungsplan und der Expansion des Deutschen Reichs. In den zwanzig Monaten zwischen Januar 1938 und dem 31. August 1939 annektierte Deutschland im MûÊrz ûsterreich, im Oktober das Sudetenland. Im MûÊrz 1939 "û¥bergab" Litauen das Memelland an die NS-Regierung. Eine Woche zuvor war die Wehrmacht in Prag einmarschiert, am 1. September fiel sie in Polen ein.
In seiner Reichstagsrede vom 30. Januar 1939 gab Hitler dem ãinternationalen Finanzjudentumã die Schuld an einem mûÑglichen neuen Weltkrieg und fû¥gte an, dass das Ergebnis ãdie Vernichtung der jû¥dischen Rasse in Europaã sein werde. Einen konkreten Plan zum Genozid hatte er aber noch nicht. Doch tauchten in den Zeitungen vermehrt Begriffe auf wie ãendgû¥ltige LûÑsung der Judenfrageã. SpûÊtestens seit dem Novemberpogrom herrschte fû¥r Juden in Deutschland Lebensgefahr. Im Jahr 1938 verfû¥nffachte sich die Zahl der Flû¥chtlinge: Aus dem Altreich emigrierten etwa 40.000 Juden und an die 60.000 aus ûsterreich. Allerdings wurden sie nirgendwo mit offenen Armen empfangen. Dokumente des 2. Teils u. a.: ein Tagebuchauszug eines jû¥dischen Wiener Arztes, der den von den ûsterreichern bejubelten Einmarsch der Deutschen am 11. MûÊrz 1938 beschreibt und von Hetzjagden auf jû¥dische GeschûÊfte berichtet, die ãliquidiertã oder ãarisiertã werden; Eichmanns Brief an seinen Vorgesetzten Hagen û¥ber seine Methoden, die ûÑsterreichischen Juden zur Auswanderung zu zwingen; auslûÊndische Presseberichte, die internationale Proteste gegen die Massenverhaftungen in Deutschland fordern; Heydrichs Fernschreiben zur Durchfû¥hrung des Novemberpogroms; Bittbrief eines Vaters an eine Londoner Hilfsorganisation um einen Kindertransportplatz fû¥r seine Tochter; ein anonymer Bericht, der das Flû¥chtlingschaos an den deutschen Grenzen schildert. // |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 02.02.2013
Datum: 02.02.2013Länge: 01:45:31 Größe: 96.60 MB |
||
| Die Quellen sprechen. Zeitzeugen: Ursula Beyrodt und Salo Wolf - 28.01.2013 | ||
| Zusammenstellung: Kirsten BûÑttcher / BR 2013 / LûÊnge: 49'54 // An der dokumentarischen HûÑredition "Die Quellen sprechen. Die Verfolgung und Ermordung der europûÊischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933 - 1945" beteiligten sich viele Holocaust-ûberlebende. Sie gaben Opferdokumenten ihre Stimme. WûÊhrend der Aufnahmen zur HûÑredition fû¥hrte Regisseur Ulrich Gerhardt auch GesprûÊche mit den Zeitzeugen, bei denen sie von ihren eigenen Erfahrungen berichteten. Weitere GesprûÊche finden sich auf der Webseite die-quellen-sprechen.de | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 28.01.2013
Datum: 28.01.2013Länge: 00:49:54 Größe: 45.70 MB |
||
| Die Quellen sprechen. Teil 1: Deutsches Reich 1933-1937 - 26.01.2013 | ||
|
Mit Bibiana Beglau, Matthias Brandt und den Zeitzeugen Ursula Beyrodt, Henry G. Brandt, Ernst Grube, Anita Lasker-Wallfisch, Max Mannheimer / Bearbeitet von Wolf Gruner / Skript HûÑredition: Katarina Agathos/Michael Farin / Regie: Ulrich Gerhardt / BR HûÑrspiel und Medienkunst in Zusammenarbeit mit dem Institut fû¥r Zeitgeschichte/ Edition 'Judenverfolgung 1933 - 1945ã, 2013 / LûÊnge: 101'59 // Die Quellen sprechen. Die Verfolgung und Ermordung der europûÊischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933-1945. Eine dokumentarische HûÑredition. Der erste Teil der HûÑredition dokumentiert chronologisch die deutsche Judenpolitik bis 1937.
Dreiûig historische Schriftstû¥cke zeugen davon, wie die deutschen Juden mit allen Mitteln ã durch neu geschaffene Verordnungen oder durch rohe Gewalt ã drangsaliert, entrechtet und aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Die Masse der BevûÑlkerung reagierte darauf passiv. Fû¥nf jû¥dische ûberlebende des Holocaust sowie zwei Schauspieler geben den historischen Dokumenten ihre Stimme. Sie berichten von den Massenentlassungen jû¥discher Beamter, von reichsweiten antijû¥dischen Boykotts, von Misshandlungen im ersten offiziellen KZ in Dachau, und von der VerdrûÊngung der Juden aus dem ûÑffentlichen Dienst, den Schulen, aus der Wirtschaft und von der Entrechtung mittels der Durchsetzung des ãArierparagraphenã und der ãNû¥rnberger Gesetzeã. Als Goebbels Ende 1937 die ãBeseitigungã der Juden aus dem deutschen Kulturleben verkû¥ndete, hatten mehr als 125.000 Juden Deutschland verlassen. // |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 26.01.2013
Datum: 26.01.2013Länge: 01:42:08 Größe: 93.51 MB |
||
| to rococo rot: Walter Ruttmann Weekend Remix - Berlin 98 Version - 18.01.2013 | ||
| Realisation: to rococo rot / BR 1998 // LûÊnge: 10'06 // Die einzige HûÑrspielarbeit des Filmemachers Walter Ruttmann, entstanden 1930, schrieb Rundfunkgeschichte: Weekend. In diesem 'Tonfilm ohne Bilder' zeichnet Ruttmann mit GerûÊuschen und Satzfetzen das akustische Bild eines Groûstadtwochenendes. Die Produktion, die den Charakter eines Sampling avant la lettre hat, galt lange als verschollen. Erst 1978 wurde in New York eine Kopie entdeckt. 20 Jahre spûÊter diente Ruttmanns O-Ton-Collage als Vorlage fû¥r das Projekt Walter Ruttmann Weekend Remix. Sechs Musiker und DJs konfrontierten den HûÑrspielklassiker mit den MûÑglichkeiten und Methoden von Mix und Remix. Die 11-Minuten-LûÊnge des historischen Originals war dabei die einzige Vorgabe. Jede Remixversion erûÑffnet eine neue ûÊsthetische Perspektive und macht HûÑrspiel gelegentlich auch tanzbar. "Laut des Schnittplans ist Weekend ja sehr musikalisch geschnitten, mit verschiedenen Taktmassen, beim Freitagabend zum Beispiel, wo die ganze Freitagsarbeits- und Maschinenwelt nach ô¥ Noten, nach 1/16 Noten geschnitten ist und das haben wir grob beachtet, fû¥r heute gings eher darum, rauszufinden und zu hûÑren, wie heute ein Wochenende in TûÑnen funktioniert, so als unser Leitfaden."( to rococo rot) | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 18.01.2013
Datum: 18.01.2013Länge: 00:10:18 Größe: 9.44 MB |
||
| Julian Doepp: Fotos vom guten Leben - 13.01.2013 | ||
| Mit Tom Schilling, Maria Magdalena Wardzinska, Axel Werner, Mathilde Bundschuh, Jeremy Mockridge, Susanne Hoss, Janna Horstmann / Komposition: Matthias Grû¥bel / Regie: Julian Doepp / BR 2013 / LûÊnge: 55'42 // Jeder will Teil einer Geschichte sein. Aram, erfolgloser Fotograf in NeukûÑlln, erzûÊhlt von einem falschen Frû¥hling. Von Elena, seiner Jugendliebe, die seit der Schulzeit mit seinem besten Freund zusammen ist. Und vom Jahr der Krise, als Elena ihren Job verliert und der Freund beim Frû¥hstû¥ck im Cafûˋ mit ihr Schluss macht. Was tun, wenn die Erfolgsgeschichte stockt? Aram will Elena helfen ã und zugleich herausfinden, was es mit dem guten Leben auf sich hat. Mit den Leuten, die immer schon wissen, wo es lang geht. Wie die Schû¥ler im Park vor seinem Haus, deren Rituale Aram beobachtet. Bis sie ihn plûÑtzlich ansprechen. Oder wie der alternde Filmproduzent, der eines Tages bei Elena anruft. Auf einem Gutshof tief in der Uckermark soll sie fû¥r ihn arbeiten. Doch Elena versagt. Und Aram macht sich auf den Weg, sie zu retten. "Fotos vom guten Leben" kreist um die Panik in der Groûstadt, um Zweifel und versagende Selbstbilder. Momentaufnahmen des prekûÊren Alltags werden zum Material fû¥r Arams Suche nach einer ErzûÊhlung, die nur ihm gehûÑrt. So realistisch wie mûÊrchenhaft, so sprunghaft wie intensiv, folgt das HûÑrspiel seinem Versuch, Liebe und Selbst neu zu erfinden ã als Entwicklungsroman zwischen Kammerspiel und Cinemascope, zwischen Abgesang und Mutprobe. // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 13.01.2013
Datum: 13.01.2013Länge: 00:55:50 Größe: 51.13 MB |
||
| Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften. Remix (20/20) - 04.01.2013 | ||
| Mit Manfred Zapatka, Ulrich Matthes, Susanne Wolff, Wolf Bachofner, Ulli Maier, Angela Winkler, Josef Bierbichler, Ignaz Kirchner, Wolfgang Hû¥bsch, Sunnyi Melles, Achim Buch, Nadine Geyersbach, Michael Rotschopf, Peter Fricke, Dorothee Hartinger, Jens Wawrczeck, Gottfried Breitfuû, Oliver Stern, Felix von Manteuffel / Konzept: Katarina Agathos, Herbert Kapfer / Skript: Katarina Agathos, Klaus Buhlert, Herbert Kapfer / Regie: Klaus Buhlert / Wissenschaftliche Beratung: Walter Fanta / BR 2004 / LûÊnge: 50'14 // 20 Stunden Weltliteratur. Die sich weit verzweigende Handlung, immer wieder von essayistischen Exkursen unterbrochen, ist in der ûÑsterreichisch-ungarischen k.u.k. Monarchie kurz vor dem ersten Weltkrieg angesiedelt. Der Zugriff auf das gesamte Mann ohne Eigenschaften-Konvolut, das sich aus VerûÑffentlichungen, aus Druckfahnen und Entwû¥rfen in unterschiedlichen Textstufen zusammensetzte, aber auch Musils essayistische und vielstimmige ErzûÊhlweise und die Unabgeschlossenheit des Romans fû¥hrten zu der ûberlegung HûÑr- und Gedankenspiele zu produzieren und eine auditive ErzûÊhlform mit inszenierten Textpassagen und nacherzûÊhlenden bzw. reflexiven Originaltonsequenzen zu entwickeln. // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 04.01.2013
Datum: 04.01.2013Länge: 00:50:34 Größe: 34.76 MB |
||
| Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften. Remix (19/20) - 04.01.2013 | ||
| Mit Manfred Zapatka, Ulrich Matthes, Susanne Wolff, Wolf Bachofner, Ulli Maier, Angela Winkler, Josef Bierbichler, Ignaz Kirchner, Wolfgang Hû¥bsch, Sunnyi Melles, Achim Buch, Nadine Geyersbach, Michael Rotschopf, Peter Fricke, Dorothee Hartinger, Jens Wawrczeck, Gottfried Breitfuû, Oliver Stern, Felix von Manteuffel / Konzept: Katarina Agathos, Herbert Kapfer / Skript: Katarina Agathos, Klaus Buhlert, Herbert Kapfer / Regie: Klaus Buhlert / Wissenschaftliche Beratung: Walter Fanta / BR 2004 / LûÊnge: 59'41 // 20 Stunden Weltliteratur. Die sich weit verzweigende Handlung, immer wieder von essayistischen Exkursen unterbrochen, ist in der ûÑsterreichisch-ungarischen k.u.k. Monarchie kurz vor dem ersten Weltkrieg angesiedelt. Der Zugriff auf das gesamte Mann ohne Eigenschaften-Konvolut, das sich aus VerûÑffentlichungen, aus Druckfahnen und Entwû¥rfen in unterschiedlichen Textstufen zusammensetzte, aber auch Musils essayistische und vielstimmige ErzûÊhlweise und die Unabgeschlossenheit des Romans fû¥hrten zu der ûberlegung HûÑr- und Gedankenspiele zu produzieren und eine auditive ErzûÊhlform mit inszenierten Textpassagen und nacherzûÊhlenden bzw. reflexiven Originaltonsequenzen zu entwickeln. // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 04.01.2013
Datum: 04.01.2013Länge: 01:01:50 Größe: 42.50 MB |
||
| Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften. Remix (18/20) - 04.01.2013 | ||
|
Mit Manfred Zapatka, Ulrich Matthes, Susanne Wolff, Wolf Bachofner, Ulli Maier, Angela Winkler, Josef Bierbichler, Ignaz Kirchner, Wolfgang Hû¥bsch, Sunnyi Melles, Achim Buch, Nadine Geyersbach, Michael Rotschopf, Peter Fricke, Dorothee Hartinger, Jens Wawrczeck, Gottfried Breitfuû, Oliver Stern, Felix von Manteuffel / Konzept: Katarina Agathos, Herbert Kapfer / Skript: Katarina Agathos, Klaus Buhlert, Herbert Kapfer / Regie: Klaus Buhlert / Wissenschaftliche Beratung: Walter Fanta / BR 2004 / LûÊnge: 57'05 // 20 Stunden Weltliteratur. Die sich weit verzweigende Handlung, immer wieder von essayistischen Exkursen unterbrochen, ist in der ûÑsterreichisch-ungarischen k.u.k. Monarchie kurz vor dem ersten Weltkrieg angesiedelt. Der Zugriff auf das gesamte Mann ohne Eigenschaften-Konvolut, das sich aus VerûÑffentlichungen, aus Druckfahnen und Entwû¥rfen in unterschiedlichen Textstufen zusammensetzte, aber auch Musils essayistische und vielstimmige ErzûÊhlweise und die Unabgeschlossenheit des Romans fû¥hrten zu der ûberlegung HûÑr- und Gedankenspiele zu produzieren und eine auditive ErzûÊhlform mit inszenierten Textpassagen und nacherzûÊhlenden bzw. reflexiven Originaltonsequenzen zu entwickeln. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 04.01.2013
Datum: 04.01.2013Länge: 00:57:25 Größe: 39.47 MB |
||
| Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften. Remix (17/20) - 04.01.2013 | ||
| Mit Manfred Zapatka, Ulrich Matthes, Susanne Wolff, Wolf Bachofner, Ulli Maier, Angela Winkler, Josef Bierbichler, Ignaz Kirchner, Wolfgang Hû¥bsch, Sunnyi Melles, Achim Buch, Nadine Geyersbach, Michael Rotschopf, Peter Fricke, Dorothee Hartinger, Jens Wawrczeck, Gottfried Breitfuû, Oliver Stern, Felix von Manteuffel / Konzept: Katarina Agathos, Herbert Kapfer / Skript: Katarina Agathos, Klaus Buhlert, Herbert Kapfer / Regie: Klaus Buhlert / Wissenschaftliche Beratung: Walter Fanta / BR 2004 LûÊnge: 59'54 // 20 Stunden Weltliteratur. Die sich weit verzweigende Handlung, immer wieder von essayistischen Exkursen unterbrochen, ist in der ûÑsterreichisch-ungarischen k.u.k. Monarchie kurz vor dem ersten Weltkrieg angesiedelt. Der Zugriff auf das gesamte Mann ohne Eigenschaften-Konvolut, das sich aus VerûÑffentlichungen, aus Druckfahnen und Entwû¥rfen in unterschiedlichen Textstufen zusammensetzte, aber auch Musils essayistische und vielstimmige ErzûÊhlweise und die Unabgeschlossenheit des Romans fû¥hrten zu der ûberlegung HûÑr- und Gedankenspiele zu produzieren und eine auditive ErzûÊhlform mit inszenierten Textpassagen und nacherzûÊhlenden bzw. reflexiven Originaltonsequenzen zu entwickeln. // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 04.01.2013
Datum: 04.01.2013Länge: 01:05:24 Größe: 44.94 MB |
||
| Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften. Remix (16/20) - 04.01.2013 | ||
| Mit Manfred Zapatka, Ulrich Matthes, Susanne Wolff, Wolf Bachofner, Ulli Maier, Angela Winkler, Josef Bierbichler, Ignaz Kirchner, Wolfgang Hû¥bsch, Sunnyi Melles, Achim Buch, Nadine Geyersbach, Michael Rotschopf, Peter Fricke, Dorothee Hartinger, Jens Wawrczeck, Gottfried Breitfuû, Oliver Stern, Felix von Manteuffel / Konzept: Katarina Agathos, Herbert Kapfer / Skript: Katarina Agathos, Klaus Buhlert, Herbert Kapfer / Regie: Klaus Buhlert / Wissenschaftliche Beratung: Walter Fanta / BR 2004 LûÊnge: 58'51 // 20 Stunden Weltliteratur. Die sich weit verzweigende Handlung, immer wieder von essayistischen Exkursen unterbrochen, ist in der ûÑsterreichisch-ungarischen k.u.k. Monarchie kurz vor dem ersten Weltkrieg angesiedelt. Der Zugriff auf das gesamte Mann ohne Eigenschaften-Konvolut, das sich aus VerûÑffentlichungen, aus Druckfahnen und Entwû¥rfen in unterschiedlichen Textstufen zusammensetzte, aber auch Musils essayistische und vielstimmige ErzûÊhlweise und die Unabgeschlossenheit des Romans fû¥hrten zu der ûberlegung HûÑr- und Gedankenspiele zu produzieren und eine auditive ErzûÊhlform mit inszenierten Textpassagen und nacherzûÊhlenden bzw. reflexiven Originaltonsequenzen zu entwickeln. // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 04.01.2013
Datum: 04.01.2013Länge: 00:59:11 Größe: 40.67 MB |
||
| Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften. Remix (15/20) - 04.01.2013 | ||
| Mit Manfred Zapatka, Ulrich Matthes, Susanne Wolff, Wolf Bachofner, Ulli Maier, Angela Winkler, Josef Bierbichler, Ignaz Kirchner, Wolfgang Hû¥bsch, Sunnyi Melles, Achim Buch, Nadine Geyersbach, Michael Rotschopf, Peter Fricke, Dorothee Hartinger, Jens Wawrczeck, Gottfried Breitfuû, Oliver Stern, Felix von Manteuffel / Konzept: Katarina Agathos, Herbert Kapfer / Skript: Katarina Agathos, Klaus Buhlert, Herbert Kapfer / Regie: Klaus Buhlert / Wissenschaftliche Beratung: Walter Fanta / BR 2004 / LûÊnge: 58'21 // 200420 Stunden Weltliteratur. Die sich weit verzweigende Handlung, immer wieder von essayistischen Exkursen unterbrochen, ist in der ûÑsterreichisch-ungarischen k.u.k. Monarchie kurz vor dem ersten Weltkrieg angesiedelt. Der Zugriff auf das gesamte Mann ohne Eigenschaften-Konvolut, das sich aus VerûÑffentlichungen, aus Druckfahnen und Entwû¥rfen in unterschiedlichen Textstufen zusammensetzte, aber auch Musils essayistische und vielstimmige ErzûÊhlweise und die Unabgeschlossenheit des Romans fû¥hrten zu der ûberlegung HûÑr- und Gedankenspiele zu produzieren und eine auditive ErzûÊhlform mit inszenierten Textpassagen und nacherzûÊhlenden bzw. reflexiven Originaltonsequenzen zu entwickeln. // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 04.01.2013
Datum: 04.01.2013Länge: 00:58:40 Größe: 40.33 MB |
||
| Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften. Remix (14/20) - 04.01.2013 | ||
| Mit Manfred Zapatka, Ulrich Matthes, Susanne Wolff, Wolf Bachofner, Ulli Maier, Angela Winkler, Josef Bierbichler, Ignaz Kirchner, Wolfgang Hû¥bsch, Sunnyi Melles, Achim Buch, Nadine Geyersbach, Michael Rotschopf, Peter Fricke, Dorothee Hartinger, Jens Wawrczeck, Gottfried Breitfuû, Oliver Stern, Felix von Manteuffel / Konzept: Katarina Agathos, Herbert Kapfer / Skript: Katarina Agathos, Klaus Buhlert, Herbert Kapfer / Regie: Klaus Buhlert / Wissenschaftliche Beratung: Walter Fanta / BR 2004 / LûÊnge: 58'33 // 20 Stunden Weltliteratur. Die sich weit verzweigende Handlung, immer wieder von essayistischen Exkursen unterbrochen, ist in der ûÑsterreichisch-ungarischen k.u.k. Monarchie kurz vor dem ersten Weltkrieg angesiedelt. Der Zugriff auf das gesamte Mann ohne Eigenschaften-Konvolut, das sich aus VerûÑffentlichungen, aus Druckfahnen und Entwû¥rfen in unterschiedlichen Textstufen zusammensetzte, aber auch Musils essayistische und vielstimmige ErzûÊhlweise und die Unabgeschlossenheit des Romans fû¥hrten zu der ûberlegung HûÑr- und Gedankenspiele zu produzieren und eine auditive ErzûÊhlform mit inszenierten Textpassagen und nacherzûÊhlenden bzw. reflexiven Originaltonsequenzen zu entwickeln. // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 04.01.2013
Datum: 04.01.2013Länge: 00:58:53 Größe: 40.47 MB |
||
| Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften. Remix (13/20) - 04.01.2013 | ||
| Mit Manfred Zapatka, Ulrich Matthes, Susanne Wolff, Wolf Bachofner, Ulli Maier, Angela Winkler, Josef Bierbichler, Ignaz Kirchner, Wolfgang Hû¥bsch, Sunnyi Melles, Achim Buch, Nadine Geyersbach, Michael Rotschopf, Peter Fricke, Dorothee Hartinger, Jens Wawrczeck, Gottfried Breitfuû, Oliver Stern, Felix von Manteuffel / Konzept: Katarina Agathos, Herbert Kapfer / Skript: Katarina Agathos, Klaus Buhlert, Herbert Kapfer / Regie: Klaus Buhlert / Wissenschaftliche Beratung: Walter Fanta / BR 2004 / LûÊnge: 59'45 // 20 Stunden Weltliteratur. Die sich weit verzweigende Handlung, immer wieder von essayistischen Exkursen unterbrochen, ist in der ûÑsterreichisch-ungarischen k.u.k. Monarchie kurz vor dem ersten Weltkrieg angesiedelt. Der Zugriff auf das gesamte Mann ohne Eigenschaften-Konvolut, das sich aus VerûÑffentlichungen, aus Druckfahnen und Entwû¥rfen in unterschiedlichen Textstufen zusammensetzte, aber auch Musils essayistische und vielstimmige ErzûÊhlweise und die Unabgeschlossenheit des Romans fû¥hrten zu der ûberlegung HûÑr- und Gedankenspiele zu produzieren und eine auditive ErzûÊhlform mit inszenierten Textpassagen und nacherzûÊhlenden bzw. reflexiven Originaltonsequenzen zu entwickeln. // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 04.01.2013
Datum: 04.01.2013Länge: 01:05:36 Größe: 45.09 MB |
||
| Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften. Remix (12/20) - 04.01.2013 | ||
| Mit Manfred Zapatka, Ulrich Matthes, Susanne Wolff, Wolf Bachofner, Ulli Maier, Angela Winkler, Josef Bierbichler, Ignaz Kirchner, Wolfgang Hû¥bsch, Sunnyi Melles, Achim Buch, Nadine Geyersbach, Michael Rotschopf, Peter Fricke, Dorothee Hartinger, Jens Wawrczeck, Gottfried Breitfuû, Oliver Stern, Felix von Manteuffel / Konzept: Katarina Agathos, Herbert Kapfer / Skript: Katarina Agathos, Klaus Buhlert, Herbert Kapfer / Regie: Klaus Buhlert / Wissenschaftliche Beratung: Walter Fanta / BR 2004 / LûÊnge: 59'52 // 20 Stunden Weltliteratur. Die sich weit verzweigende Handlung, immer wieder von essayistischen Exkursen unterbrochen, ist in der ûÑsterreichisch-ungarischen k.u.k. Monarchie kurz vor dem ersten Weltkrieg angesiedelt. Der Zugriff auf das gesamte Mann ohne Eigenschaften-Konvolut, das sich aus VerûÑffentlichungen, aus Druckfahnen und Entwû¥rfen in unterschiedlichen Textstufen zusammensetzte, aber auch Musils essayistische und vielstimmige ErzûÊhlweise und die Unabgeschlossenheit des Romans fû¥hrten zu der ûberlegung HûÑr- und Gedankenspiele zu produzieren und eine auditive ErzûÊhlform mit inszenierten Textpassagen und nacherzûÊhlenden bzw. reflexiven Originaltonsequenzen zu entwickeln. // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 04.01.2013
Datum: 04.01.2013Länge: 01:12:54 Größe: 50.11 MB |
||
| Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften. Remix (11/20) - 04.01.2013 | ||
| Mit Manfred Zapatka, Ulrich Matthes, Susanne Wolff, Wolf Bachofner, Ulli Maier, Angela Winkler, Josef Bierbichler, Ignaz Kirchner, Wolfgang Hû¥bsch, Sunnyi Melles, Achim Buch, Nadine Geyersbach, Michael Rotschopf, Peter Fricke, Dorothee Hartinger, Jens Wawrczeck, Gottfried Breitfuû, Oliver Stern, Felix von Manteuffel / Konzept: Katarina Agathos, Herbert Kapfer / Skript: Katarina Agathos, Klaus Buhlert, Herbert Kapfer / Regie: Klaus Buhlert / Wissenschaftliche Beratung: Walter Fanta / BR 2004 / LûÊnge: 58'15 // 20 Stunden Weltliteratur. Die sich weit verzweigende Handlung, immer wieder von essayistischen Exkursen unterbrochen, ist in der ûÑsterreichisch-ungarischen k.u.k. Monarchie kurz vor dem ersten Weltkrieg angesiedelt. Der Zugriff auf das gesamte Mann ohne Eigenschaften-Konvolut, das sich aus VerûÑffentlichungen, aus Druckfahnen und Entwû¥rfen in unterschiedlichen Textstufen zusammensetzte, aber auch Musils essayistische und vielstimmige ErzûÊhlweise und die Unabgeschlossenheit des Romans fû¥hrten zu der ûberlegung HûÑr- und Gedankenspiele zu produzieren und eine auditive ErzûÊhlform mit inszenierten Textpassagen und nacherzûÊhlenden bzw. reflexiven Originaltonsequenzen zu entwickeln. // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 04.01.2013
Datum: 04.01.2013Länge: 00:58:35 Größe: 40.27 MB |
||
| Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften. Remix (10/20) - 04.01.2013 | ||
| Mit Manfred Zapatka, Ulrich Matthes, Susanne Wolff, Wolf Bachofner, Ulli Maier, Angela Winkler, Josef Bierbichler, Ignaz Kirchner, Wolfgang Hû¥bsch, Sunnyi Melles, Achim Buch, Nadine Geyersbach, Michael Rotschopf, Peter Fricke, Dorothee Hartinger, Jens Wawrczeck, Gottfried Breitfuû, Oliver Stern, Felix von Manteuffel / Konzept: Katarina Agathos, Herbert Kapfer / Skript: Katarina Agathos, Klaus Buhlert, Herbert Kapfer / Regie: Klaus Buhlert / Wissenschaftliche Beratung: Walter Fanta / BR 2004 / LûÊnge: 56'59 20 Stunden Weltliteratur. Die sich weit verzweigende Handlung, immer wieder von essayistischen Exkursen unterbrochen, ist in der ûÑsterreichisch-ungarischen k.u.k. Monarchie kurz vor dem ersten Weltkrieg angesiedelt. Der Zugriff auf das gesamte Mann ohne Eigenschaften-Konvolut, das sich aus VerûÑffentlichungen, aus Druckfahnen und Entwû¥rfen in unterschiedlichen Textstufen zusammensetzte, aber auch Musils essayistische und vielstimmige ErzûÊhlweise und die Unabgeschlossenheit des Romans fû¥hrten zu der ûberlegung HûÑr- und Gedankenspiele zu produzieren und eine auditive ErzûÊhlform mit inszenierten Textpassagen und nacherzûÊhlenden bzw. reflexiven Originaltonsequenzen zu entwickeln. // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 04.01.2013
Datum: 04.01.2013Länge: 00:57:19 Größe: 39.40 MB |
||
| Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften. Remix (09/20) - 04.01.2013 | ||
| Mit Manfred Zapatka, Ulrich Matthes, Susanne Wolff, Wolf Bachofner, Ulli Maier, Angela Winkler, Josef Bierbichler, Ignaz Kirchner, Wolfgang Hû¥bsch, Sunnyi Melles, Achim Buch, Nadine Geyersbach, Michael Rotschopf, Peter Fricke, Dorothee Hartinger, Jens Wawrczeck, Gottfried Breitfuû, Oliver Stern, Felix von Manteuffel / Konzept: Katarina Agathos, Herbert Kapfer / Skript: Katarina Agathos, Klaus Buhlert, Herbert Kapfer / Regie: Klaus Buhlert / Wissenschaftliche Beratung: Walter Fanta / BR 2004 / LûÊnge: 58'47 // 20 Stunden Weltliteratur. Die sich weit verzweigende Handlung, immer wieder von essayistischen Exkursen unterbrochen, ist in der ûÑsterreichisch-ungarischen k.u.k. Monarchie kurz vor dem ersten Weltkrieg angesiedelt. Der Zugriff auf das gesamte Mann ohne Eigenschaften-Konvolut, das sich aus VerûÑffentlichungen, aus Druckfahnen und Entwû¥rfen in unterschiedlichen Textstufen zusammensetzte, aber auch Musils essayistische und vielstimmige ErzûÊhlweise und die Unabgeschlossenheit des Romans fû¥hrten zu der ûberlegung HûÑr- und Gedankenspiele zu produzieren und eine auditive ErzûÊhlform mit inszenierten Textpassagen und nacherzûÊhlenden bzw. reflexiven Originaltonsequenzen zu entwickeln. // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 04.01.2013
Datum: 04.01.2013Länge: 00:59:07 Größe: 40.63 MB |
||
| Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften. Remix (08/20) - 04.01.2013 | ||
| Mit Manfred Zapatka, Ulrich Matthes, Susanne Wolff, Wolf Bachofner, Ulli Maier, Angela Winkler, Josef Bierbichler, Ignaz Kirchner, Wolfgang Hû¥bsch, Sunnyi Melles, Achim Buch, Nadine Geyersbach, Michael Rotschopf, Peter Fricke, Dorothee Hartinger, Jens Wawrczeck, Gottfried Breitfuû, Oliver Stern, Felix von Manteuffel / Konzept: Katarina Agathos, Herbert Kapfer / Skript: Katarina Agathos, Klaus Buhlert, Herbert Kapfer / Regie: Klaus Buhlert / Wissenschaftliche Beratung: Walter Fanta / BR 2004 / LûÊnge: 59'40 // 20 Stunden Weltliteratur. Die sich weit verzweigende Handlung, immer wieder von essayistischen Exkursen unterbrochen, ist in der ûÑsterreichisch-ungarischen k.u.k. Monarchie kurz vor dem ersten Weltkrieg angesiedelt. Der Zugriff auf das gesamte Mann ohne Eigenschaften-Konvolut, das sich aus VerûÑffentlichungen, aus Druckfahnen und Entwû¥rfen in unterschiedlichen Textstufen zusammensetzte, aber auch Musils essayistische und vielstimmige ErzûÊhlweise und die Unabgeschlossenheit des Romans fû¥hrten zu der ûberlegung HûÑr- und Gedankenspiele zu produzieren und eine auditive ErzûÊhlform mit inszenierten Textpassagen und nacherzûÊhlenden bzw. reflexiven Originaltonsequenzen zu entwickeln. // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 04.01.2013
Datum: 04.01.2013Länge: 01:00:37 Größe: 41.66 MB |
||
| Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften. Remix (07/20) - 04.01.2013 | ||
| Mit Manfred Zapatka, Ulrich Matthes, Susanne Wolff, Wolf Bachofner, Ulli Maier, Angela Winkler, Josef Bierbichler, Ignaz Kirchner, Wolfgang Hû¥bsch, Sunnyi Melles, Achim Buch, Nadine Geyersbach, Michael Rotschopf, Peter Fricke, Dorothee Hartinger, Jens Wawrczeck, Gottfried Breitfuû, Oliver Stern, Felix von Manteuffel / Konzept: Katarina Agathos, Herbert Kapfer / Skript: Katarina Agathos, Klaus Buhlert, Herbert Kapfer / Regie: Klaus Buhlert / Wissenschaftliche Beratung: Walter Fanta / BR 2004 / LûÊnge: 58'33 // 20 Stunden Weltliteratur. Die sich weit verzweigende Handlung, immer wieder von essayistischen Exkursen unterbrochen, ist in der ûÑsterreichisch-ungarischen k.u.k. Monarchie kurz vor dem ersten Weltkrieg angesiedelt. Der Zugriff auf das gesamte Mann ohne Eigenschaften-Konvolut, das sich aus VerûÑffentlichungen, aus Druckfahnen und Entwû¥rfen in unterschiedlichen Textstufen zusammensetzte, aber auch Musils essayistische und vielstimmige ErzûÊhlweise und die Unabgeschlossenheit des Romans fû¥hrten zu der ûberlegung HûÑr- und Gedankenspiele zu produzieren und eine auditive ErzûÊhlform mit inszenierten Textpassagen und nacherzûÊhlenden bzw. reflexiven Originaltonsequenzen zu entwickeln. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 04.01.2013
Datum: 04.01.2013Länge: 00:58:46 Größe: 53.82 MB |
||
| Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften. Remix (06/20) - 04.01.2013 | ||
| Mit Manfred Zapatka, Ulrich Matthes, Susanne Wolff, Wolf Bachofner, Ulli Maier, Angela Winkler, Josef Bierbichler, Ignaz Kirchner, Wolfgang Hû¥bsch, Sunnyi Melles, Achim Buch, Nadine Geyersbach, Michael Rotschopf, Peter Fricke, Dorothee Hartinger, Jens Wawrczeck, Gottfried Breitfuû, Oliver Stern, Felix von Manteuffel / Konzept: Katarina Agathos, Herbert Kapfer / Skript: Katarina Agathos, Klaus Buhlert, Herbert Kapfer / Regie: Klaus Buhlert / Wissenschaftliche Beratung: Walter Fanta / BR 2004 / LûÊnge: 58'28 // 20 Stunden Weltliteratur. Die sich weit verzweigende Handlung, immer wieder von essayistischen Exkursen unterbrochen, ist in der ûÑsterreichisch-ungarischen k.u.k. Monarchie kurz vor dem ersten Weltkrieg angesiedelt. Der Zugriff auf das gesamte Mann ohne Eigenschaften-Konvolut, das sich aus VerûÑffentlichungen, aus Druckfahnen und Entwû¥rfen in unterschiedlichen Textstufen zusammensetzte, aber auch Musils essayistische und vielstimmige ErzûÊhlweise und die Unabgeschlossenheit des Romans fû¥hrten zu der ûberlegung HûÑr- und Gedankenspiele zu produzieren und eine auditive ErzûÊhlform mit inszenierten Textpassagen und nacherzûÊhlenden bzw. reflexiven Originaltonsequenzen zu entwickeln. // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 04.01.2013
Datum: 04.01.2013Länge: 00:58:48 Größe: 40.42 MB |
||
| Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften. Remix (05/20) - 04.01.2013 | ||
| Mit Manfred Zapatka, Ulrich Matthes, Susanne Wolff, Wolf Bachofner, Ulli Maier, Angela Winkler, Josef Bierbichler, Ignaz Kirchner, Wolfgang Hû¥bsch, Sunnyi Melles, Achim Buch, Nadine Geyersbach, Michael Rotschopf, Peter Fricke, Dorothee Hartinger, Jens Wawrczeck, Gottfried Breitfuû, Oliver Stern, Felix von Manteuffel / Konzept: Katarina Agathos, Herbert Kapfer / Skript: Katarina Agathos, Klaus Buhlert, Herbert Kapfer / Regie: Klaus Buhlert / Wissenschaftliche Beratung: Walter Fanta / BR 2004 / LûÊnge: 56'17 // 20 Stunden Weltliteratur. Die sich weit verzweigende Handlung, immer wieder von essayistischen Exkursen unterbrochen, ist in der ûÑsterreichisch-ungarischen k.u.k. Monarchie kurz vor dem ersten Weltkrieg angesiedelt. Der Zugriff auf das gesamte Mann ohne Eigenschaften-Konvolut, das sich aus VerûÑffentlichungen, aus Druckfahnen und Entwû¥rfen in unterschiedlichen Textstufen zusammensetzte, aber auch Musils essayistische und vielstimmige ErzûÊhlweise und die Unabgeschlossenheit des Romans fû¥hrten zu der ûberlegung HûÑr- und Gedankenspiele zu produzieren und eine auditive ErzûÊhlform mit inszenierten Textpassagen und nacherzûÊhlenden bzw. reflexiven Originaltonsequenzen zu entwickeln. // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 04.01.2013
Datum: 04.01.2013Länge: 00:56:37 Größe: 38.93 MB |
||
| Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften. Remix (04/20) - 04.01.2013 | ||
| Mit Manfred Zapatka, Ulrich Matthes, Susanne Wolff, Wolf Bachofner, Ulli Maier, Angela Winkler, Josef Bierbichler, Ignaz Kirchner, Wolfgang Hû¥bsch, Sunnyi Melles, Achim Buch, Nadine Geyersbach, Michael Rotschopf, Peter Fricke, Dorothee Hartinger, Jens Wawrczeck, Gottfried Breitfuû, Oliver Stern, Felix von Manteuffel / Konzept: Katarina Agathos, Herbert Kapfer / Skript: Katarina Agathos, Klaus Buhlert, Herbert Kapfer / Regie: Klaus Buhlert / Wissenschaftliche Beratung: Walter Fanta / BR 2004 / LûÊnge: 57'11 // 20 Stunden Weltliteratur. Die sich weit verzweigende Handlung, immer wieder von essayistischen Exkursen unterbrochen, ist in der ûÑsterreichisch-ungarischen k.u.k. Monarchie kurz vor dem ersten Weltkrieg angesiedelt. Der Zugriff auf das gesamte Mann ohne Eigenschaften-Konvolut, das sich aus VerûÑffentlichungen, aus Druckfahnen und Entwû¥rfen in unterschiedlichen Textstufen zusammensetzte, aber auch Musils essayistische und vielstimmige ErzûÊhlweise und die Unabgeschlossenheit des Romans fû¥hrten zu der ûberlegung HûÑr- und Gedankenspiele zu produzieren und eine auditive ErzûÊhlform mit inszenierten Textpassagen und nacherzûÊhlenden bzw. reflexiven Originaltonsequenzen zu entwickeln. // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 04.01.2013
Datum: 04.01.2013Länge: 00:57:31 Größe: 39.53 MB |
||
| Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften. Remix (03/20) - 04.01.2013 | ||
| Mit Manfred Zapatka, Ulrich Matthes, Susanne Wolff, Wolf Bachofner, Ulli Maier, Angela Winkler, Josef Bierbichler, Ignaz Kirchner, Wolfgang Hû¥bsch, Sunnyi Melles, Achim Buch, Nadine Geyersbach, Michael Rotschopf, Peter Fricke, Dorothee Hartinger, Jens Wawrczeck, Gottfried Breitfuû, Oliver Stern, Felix von Manteuffel / Konzept: Katarina Agathos, Herbert Kapfer / Skript: Katarina Agathos, Klaus Buhlert, Herbert Kapfer / Regie: Klaus Buhlert / Wissenschaftliche Beratung: Walter Fanta / BR 2004 / LûÊnge: 56'09 // 20 Stunden Weltliteratur. Die sich weit verzweigende Handlung, immer wieder von essayistischen Exkursen unterbrochen, ist in der ûÑsterreichisch-ungarischen k.u.k. Monarchie kurz vor dem ersten Weltkrieg angesiedelt. Der Zugriff auf das gesamte Mann ohne Eigenschaften-Konvolut, das sich aus VerûÑffentlichungen, aus Druckfahnen und Entwû¥rfen in unterschiedlichen Textstufen zusammensetzte, aber auch Musils essayistische und vielstimmige ErzûÊhlweise und die Unabgeschlossenheit des Romans fû¥hrten zu der ûberlegung HûÑr- und Gedankenspiele zu produzieren und eine auditive ErzûÊhlform mit inszenierten Textpassagen und nacherzûÊhlenden bzw. reflexiven Originaltonsequenzen zu entwickeln. // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 04.01.2013
Datum: 04.01.2013Länge: 00:56:29 Größe: 51.72 MB |
||
| Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften. Remix (02/20) - 04.01.2013 | ||
| Mit Manfred Zapatka, Ulrich Matthes, Susanne Wolff, Wolf Bachofner, Ulli Maier, Angela Winkler, Josef Bierbichler, Ignaz Kirchner, Wolfgang Hû¥bsch, Sunnyi Melles, Achim Buch, Nadine Geyersbach, Michael Rotschopf, Peter Fricke, Dorothee Hartinger, Jens Wawrczeck, Gottfried Breitfuû, Oliver Stern, Felix von Manteuffel / Konzept: Katarina Agathos, Herbert Kapfer / Skript: Katarina Agathos, Klaus Buhlert, Herbert Kapfer / Regie: Klaus Buhlert / Wissenschaftliche Beratung: Walter Fanta / BR 2004 / LûÊnge: 52'19 // 20 Stunden Weltliteratur. Die sich weit verzweigende Handlung, immer wieder von essayistischen Exkursen unterbrochen, ist in der ûÑsterreichisch-ungarischen k.u.k. Monarchie kurz vor dem ersten Weltkrieg angesiedelt. Der Zugriff auf das gesamte Mann ohne Eigenschaften-Konvolut, das sich aus VerûÑffentlichungen, aus Druckfahnen und Entwû¥rfen in unterschiedlichen Textstufen zusammensetzte, aber auch Musils essayistische und vielstimmige ErzûÊhlweise und die Unabgeschlossenheit des Romans fû¥hrten zu der ûberlegung HûÑr- und Gedankenspiele zu produzieren und eine auditive ErzûÊhlform mit inszenierten Textpassagen und nacherzûÊhlenden bzw. reflexiven Originaltonsequenzen zu entwickeln. // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 04.01.2013
Datum: 04.01.2013Länge: 00:52:38 Größe: 36.19 MB |
||
| Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften. Remix (01/20) - 04.01.2013 | ||
| Mit Manfred Zapatka, Ulrich Matthes, Susanne Wolff, Wolf Bachofner, Ulli Maier, Angela Winkler, Josef Bierbichler, Ignaz Kirchner, Wolfgang Hû¥bsch, Sunnyi Melles, Achim Buch, Nadine Geyersbach, Michael Rotschopf, Peter Fricke, Dorothee Hartinger, Jens Wawrczeck, Gottfried Breitfuû, Oliver Stern, Felix von Manteuffel / Konzept: Katarina Agathos, Herbert Kapfer / Skript: Katarina Agathos, Klaus Buhlert, Herbert Kapfer / Regie: Klaus Buhlert / Wissenschaftliche Beratung: Walter Fanta / BR 2004 / LûÊnge: 56'08 // 20 Stunden Weltliteratur. Die sich weit verzweigende Handlung, immer wieder von essayistischen Exkursen unterbrochen, ist in der ûÑsterreichisch-ungarischen k.u.k. Monarchie kurz vor dem ersten Weltkrieg angesiedelt. Der Zugriff auf das gesamte Mann ohne Eigenschaften-Konvolut, das sich aus VerûÑffentlichungen, aus Druckfahnen und Entwû¥rfen in unterschiedlichen Textstufen zusammensetzte, aber auch Musils essayistische und vielstimmige ErzûÊhlweise und die Unabgeschlossenheit des Romans fû¥hrten zu der ûberlegung HûÑr- und Gedankenspiele zu produzieren und eine auditive ErzûÊhlform mit inszenierten Textpassagen und nacherzûÊhlenden bzw. reflexiven Originaltonsequenzen zu entwickeln. // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 04.01.2013
Datum: 04.01.2013Länge: 00:56:28 Größe: 38.81 MB |
||
| Alexander Kluge: Chronik der Gefû¥hle - Der lange Marsch des Urvertrauens - 28.12.2012 | ||
| Mit Alexander Kluge, Wolfgang Hinze, Ilja Richter, Hanns Zischler, Johannes Herrschmann, Peter Fricke, Christian Friedel, Monika Manz, Elfriede Jelinek, Romuald Karmakar, Christoph Englert / Musik: Woog Riots sowie Solisten des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks / Bearbeitung und Regie: Karl Bruckmaier / BR 2009 / LûÊnge: 55'35 // In "Der lange Marsch des Urvertrauens" versammelt Kluge "Entscheidungen vor dem Hintergrund der gesamten Geschichte unseres Planeten, sucht ungenutzte MûÑglichkeiten zum Widerstand". Es geht um die "ZûÊhigkeit, VollstûÊndigkeit, HartnûÊckigkeit und Leidenschaft der Suche." Aus der Anfangszeit des Kinos existiert eine Aufnahme von der ûÑffentlichen elektrischen Hinrichtung eines Elefanten, der auf Coney Island drei WûÊrter getûÑtet hatte. Dieses Material taucht bei Alexander Kluge immer wieder auf, als ErzûÊhlung, als Bild, als Film. Der fû¥r Kluge wichtigste Moment ist dabei der vertrauensvolle Blick des riesigen Tiers, das sich ruhig zu seiner Hinrichtung fû¥hren lûÊsst.Marx nennt Ideologie das notwendige falsche Bewusstsein. Dazu gehûÑrt, dass wir Menschen als SûÊuglinge mit glûÊubigem Blick in die Wirklichkeit schauen und weil die Mutter zurû¥ckblickt, glauben wir, dass die Welt es gut mit uns meint. Das ist ein grundlegender Irrtum, von dem wir leben bis wir sterben. Unsere Welt meint es mit den Menschen nicht gut. Wir kûÑnnen diesen Irrtum aber nicht aufgeben. Freud nennt das das Urvertrauen. (Alexander Kluge) // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 28.12.2012
Datum: 28.12.2012Länge: 00:55:45 Größe: 51.05 MB |
||
| Alexander Kluge: Chronik der Gefû¥hle - Lernprozesse mit tûÑdlichem Ausgang - 21.12.2012 | ||
| Mit Alexander Kluge, Wolfgang Hinze, Ilja Richter, Johannes Herrschmann, Nico Holonics, Peter Fricke, Helmut Stange, Monika Manz, Chorgemeinschaft Friese 2, Elfriede Jelinek, Heinz Tessun, Helmut Haase, Petra Schiessel, Wolfgang Beyer / Musik: Michaela MeliûÀn / Bearbeitung und Regie: Karl Bruckmaier / BR 2009 / LûÊnge: 56'21 // Alexander Kluge sagt, die Lernprozesse seien eine Fortsetzung der Schlachtbeschreibung und eine Art Reinschrift seiner Science-Fiction-Filme "Der groûe Verhau" (1971) und "Willi Tobler und der Untergang der 6. Flotte" (1972). Die Verlagerung der Geschichte ins Weltall gepaart mit der dilettantischen Darstellung der Schlachten - fliegende Schrauben, Transistorteile und anderer Metallschrott vor selbstgebasteltem Sternenhimmel - bietet den vielleicht humorvollsten Zugang zu Kluges Katastrophen-ErzûÊhlungen. Die Ausbeutung sûÊmtlicher Ressourcen und die SelbstzerstûÑrung der Menschheit werden in den fremden Galaxien im Zeitraffer noch einmal durchgespielt. Das Ende bleibt gegen alle Voraussicht offen. FORTSCHRITT OPEN END im Westen der Galaxie. Lebenswille breitet sich aus, als die Erde untergeht. Wie kann der Schwarze Krieg vier Jahre dauern, wenn doch gleich am ersten Tag die Erde vûÑllig zerstûÑrt wurde? Vier Veteranen aus Stalingrad, mehrfach gentechnisch erneuert, setzen sich in den Sektor MorgenrûÑte ab, wo sieô angesichts einer objektiv hoffnungslosen Lage auf bessere Zeiten warten. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 21.12.2012
Datum: 21.12.2012Länge: 00:56:31 Größe: 51.75 MB |
||
| Virginia Woolf: Jacobs Zimmer (4/4) - Griechenland, London - 08.12.2012 | ||
|
Mit Friedhelm Ptok, Britta Hammelstein, Wiebke Puls, Sylvana Krappatsch, Annette Paulmann, Johannes Zirner, Andrea Wenzl, Caroline Ebner, Oliver Losehand, Stefan Merki, Hans Kremer, Georgia Stahl / Aus dem Englischen von Gaby Hartel / Bearbeitung: Gaby Hartel / Komposition: Jakob Diehl / Regie: Katja Langenbach / BR 2012 / LûÊnge: 53'47 // Eine Schriftstellerin um die Vierzig im Prozess, ihren scharfen Blick auf die Welt, deren Politik und innere Mechanik in erfahrungsnaher Literatur darzustellen. Eine untergehende Gesellschaftsform im England der (Vor-)Kriegszeit und ein junger Mann, der im Ersten Weltkrieg stirbt, noch bevor er seine PersûÑnlichkeit voll entfalten konnte. Virginia Woolf, ihr Gegenstand und der Wunsch nach einem neuen, unmittelbaren Ausdruck: Das sind die ûÊuûeren Koordinaten des Romans Jacobs Zimmer, der 1922 erschien und ein wenig bekanntes Meisterwerk der Moderne ist.
Aus der inneren Logik des Romans entsteht eine faszinierende literarische Erfahrung, eine multisensorische Folge von atmosphûÊrischen Ausschnitten, kurzen Einblicken, vielstimmigen EinschûÊtzungen, die lose chronologisch aneinandergereiht sind. Wir begegnen Jacob als Kleinkind am Strand, erhaschen Eindrû¥cke aus seiner Schulzeit, seinem Studentenleben in Cambridge, sehen ihn durchs nûÊchtliche London zu einer Geliebten gehen oder nach Griechenland reisen. Das UnerhûÑrte daran: Jacob selbst spricht nie und genau das war Virginia Woolfs Schlag gegen die viktorianische ErzûÊhlkonvention, in der sie sozialisiert wurde, und deren autoritûÊre Vorgaben sie zeitlebens angriff. Ihre gelungene Romanerfindung arbeitet erstmals mit einer Art fotografischer Schnitttechnik und zeigt, dass Jacob durchaus da ist: heraufbeschworen, nicht aus der AufzûÊhlung von charakterbestimmenden Fakten und gedrechselten SûÊtzen eines allwissenden ErzûÊhlers, sondern auf geisterhafte Weise in Facetten gespiegelt: in den Blicken, Gedanken- und GesprûÊchsfetzen seiner Umgebung. Es ist, als blûÊttere man mit angehaltenem Atem durch das Fotoalbum eines Fremden. So stehen wir heutzutage im Leben, meinte Woolf, so erfahren wir die Welt: Wir gleiten durch eine Abfolge von symbolischen RûÊumen, durch sprechende AtmosphûÊren, angerissene Szenen und GesprûÊchsfetzen, und wenn wir sie lesen lernen, verstehen wir vielleicht ein bisschen besser, wer wir sind. // |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 08.12.2012
Datum: 08.12.2012Länge: 00:53:55 Größe: 49.38 MB |
||
| Virginia Woolf: Jacobs Zimmer (3/4) - London - 08.12.2012 | ||
|
Mit Friedhelm Ptok, Britta Hammelstein, Wiebke Puls, Sylvana Krappatsch, Johannes Zirner, Dominik Kaschke, Michaela Steiger, Julia Loibl, Andrea Wenzl, Caroline Ebner, Sabine Kastius, Oliver Losehand, Stefan Merki, Hans Kremer, Georgia Stahl / Aus dem Englischen von Gaby Hartel / Bearbeitung: Gaby Hartel / Komposition: Jakob Diehl / Regie: Katja Langenbach / BR 2012 / LûÊnge: 53'35 // Eine Schriftstellerin um die Vierzig im Prozess, ihren scharfen Blick auf die Welt, deren Politik und innere Mechanik in erfahrungsnaher Literatur darzustellen. Eine untergehende Gesellschaftsform im England der (Vor-)Kriegszeit und ein junger Mann, der im Ersten Weltkrieg stirbt, noch bevor er seine PersûÑnlichkeit voll entfalten konnte. Virginia Woolf, ihr Gegenstand und der Wunsch nach einem neuen, unmittelbaren Ausdruck: Das sind die ûÊuûeren Koordinaten des Romans Jacobs Zimmer, der 1922 erschien und ein wenig bekanntes Meisterwerk der Moderne ist
Aus der inneren Logik des Romans entsteht eine faszinierende literarische Erfahrung, eine multisensorische Folge von atmosphûÊrischen Ausschnitten, kurzen Einblicken, vielstimmigen EinschûÊtzungen, die lose chronologisch aneinandergereiht sind. Wir begegnen Jacob als Kleinkind am Strand, erhaschen Eindrû¥cke aus seiner Schulzeit, seinem Studentenleben in Cambridge, sehen ihn durchs nûÊchtliche London zu einer Geliebten gehen oder nach Griechenland reisen. Das UnerhûÑrte daran: Jacob selbst spricht nie und genau das war Virginia Woolfs Schlag gegen die viktorianische ErzûÊhlkonvention, in der sie sozialisiert wurde, und deren autoritûÊre Vorgaben sie zeitlebens angriff. Ihre gelungene Romanerfindung arbeitet erstmals mit einer Art fotografischer Schnitttechnik und zeigt, dass Jacob durchaus da ist: heraufbeschworen, nicht aus der AufzûÊhlung von charakterbestimmenden Fakten und gedrechselten SûÊtzen eines allwissenden ErzûÊhlers, sondern auf geisterhafte Weise in Facetten gespiegelt: in den Blicken, Gedanken- und GesprûÊchsfetzen seiner Umgebung. Es ist, als blûÊttere man mit angehaltenem Atem durch das Fotoalbum eines Fremden. So stehen wir heutzutage im Leben, meinte Woolf, so erfahren wir die Welt: Wir gleiten durch eine Abfolge von symbolischen RûÊumen, durch sprechende AtmosphûÊren, angerissene Szenen und GesprûÊchsfetzen, und wenn wir sie lesen lernen, verstehen wir vielleicht ein bisschen besser, wer wir sind. // |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 08.12.2012
Datum: 08.12.2012Länge: 00:53:43 Größe: 49.19 MB |
||
| Virginia Woolf: Jacobs Zimmer (2/4) - Cambridge und das Cornwall - 01.12.2012 | ||
| Mit Friedhelm Ptok, Britta Hammelstein, Wiebke Puls, Sylvana Krappatsch, Johannes Zirner, Dominik Kaschke, Michaela Steiger, Julia Loibl, Andrea Wenzl, Caroline Ebner, Sabine Kastius, Oliver Losehand, Stefan Merki, Hans Kremer/ Aus dem Englischen von Gaby Hartel / Bearbeitung: Gaby Hartel / Komposition: Jakob Diehl / Regie: Katja Langenbach / BR 2012 / LûÊnge: 54'17 // Eine Schriftstellerin um die Vierzig im Prozess, ihren scharfen Blick auf die Welt, deren Politik und innere Mechanik in erfahrungsnaher Literatur darzustellen. Eine untergehende Gesellschaftsform im England der (Vor-)Kriegszeit und ein junger Mann, der im Ersten Weltkrieg stirbt, noch bevor er seine PersûÑnlichkeit voll entfalten konnte. Virginia Woolf, ihr Gegenstand und der Wunsch nach einem neuen, unmittelbaren Ausdruck: Das sind die ûÊuûeren Koordinaten des Romans Jacobs Zimmer, der 1922 erschien und ein wenig bekanntes Meisterwerk der Moderne ist. Aus der inneren Logik des Romans entsteht eine faszinierende literarische Erfahrung, eine multisensorische Folge von atmosphûÊrischen Ausschnitten, kurzen Einblicken, vielstimmigen EinschûÊtzungen, die lose chronologisch aneinandergereiht sind. Wir begegnen Jacob als Kleinkind am Strand, erhaschen Eindrû¥cke aus seiner Schulzeit, seinem Studentenleben in Cambridge, sehen ihn durchs nûÊchtliche London zu einer Geliebten gehen oder nach Griechenland reisen. Das UnerhûÑrte daran: Jacob selbst spricht nie und genau das war Virginia Woolfs Schlag gegen die viktorianische ErzûÊhlkonvention, in der sie sozialisiert wurde, und deren autoritûÊre Vorgaben sie zeitlebens angriff. Ihre gelungene Romanerfindung arbeitet erstmals mit einer Art fotografischer Schnitttechnik und zeigt, dass Jacob durchaus da ist: heraufbeschworen, nicht aus der AufzûÊhlung von charakterbestimmenden Fakten und gedrechselten SûÊtzen eines allwissenden ErzûÊhlers, sondern auf geisterhafte Weise in Facetten gespiegelt: in den Blicken, Gedanken- und GesprûÊchsfetzen seiner Umgebung. Es ist, als blûÊttere man mit angehaltenem Atem durch das Fotoalbum eines Fremden. So stehen wir heutzutage im Leben, meinte Woolf, so erfahren wir die Welt: Wir gleiten durch eine Abfolge von symbolischen RûÊumen, durch sprechende AtmosphûÊren, angerissene Szenen und GesprûÊchsfetzen, und wenn wir sie lesen lernen, verstehen wir vielleicht ein bisschen besser, wer wir sind. // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 01.12.2012
Datum: 01.12.2012Länge: 00:54:25 Größe: 49.83 MB |
||
| Virginia Woolf: Jacobs Zimmer (1/4) - Scarborough und Cambridge - 01.12.2012 | ||
| Mit Friedhelm Ptok, Britta Hammelstein, Wiebke Puls, Sylvana Krappatsch, Annette Paulmann, Benedikt Lû¥ckenhaus, Alexander Lû¥ckenhaus, Andrea Wenzl, Caroline Ebner, Sabine Kastius, Hans Kremer, Johannes Zirner, Stefan Merki / Aus dem Englischen von Gaby Hartel / Bearbeitung: Gaby Hartel / Komposition: Jakob Diehl / Regie: Katja Langenbach / BR 2012 / LûÊnge: 52'09 // Eine Schriftstellerin um die Vierzig im Prozess, ihren scharfen Blick auf die Welt, deren Politik und innere Mechanik in erfahrungsnaher Literatur darzustellen.// Eine untergehende Gesellschaftsform im England der (Vor-)Kriegszeit und ein junger Mann, der im Ersten Weltkrieg stirbt, noch bevor er seine PersûÑnlichkeit voll entfalten konnte. Virginia Woolf, ihr Gegenstand und der Wunsch nach einem neuen, unmittelbaren Ausdruck: Das sind die ûÊuûeren Koordinaten des Romans Jacobs Zimmer, der 1922 erschien und ein wenig bekanntes Meisterwerk der Moderne ist. Aus der inneren Logik des Romans entsteht eine faszinierende literarische Erfahrung, eine multisensorische Folge von atmosphûÊrischen Ausschnitten, kurzen Einblicken, vielstimmigen EinschûÊtzungen, die lose chronologisch aneinandergereiht sind. Wir begegnen Jacob als Kleinkind am Strand, erhaschen Eindrû¥cke aus seiner Schulzeit, seinem Studentenleben in Cambridge, sehen ihn durchs nûÊchtliche London zu einer Geliebten gehen oder nach Griechenland reisen. Das UnerhûÑrte daran: Jacob selbst spricht nie und genau das war Virginia Woolfs Schlag gegen die viktorianische ErzûÊhlkonvention, in der sie sozialisiert wurde, und deren autoritûÊre Vorgaben sie zeitlebens angriff. Ihre gelungene Romanerfindung arbeitet erstmals mit einer Art fotografischer Schnitttechnik und zeigt, dass Jacob durchaus da ist: heraufbeschworen, nicht aus der AufzûÊhlung von charakterbestimmenden Fakten und gedrechselten SûÊtzen eines allwissenden ErzûÊhlers, sondern auf geisterhafte Weise in Facetten gespiegelt: in den Blicken, Gedanken- und GesprûÊchsfetzen seiner Umgebung. Es ist, als blûÊttere man mit angehaltenem Atem durch das Fotoalbum eines Fremden. So stehen wir heutzutage im Leben, meinte Woolf, so erfahren wir die Welt: Wir gleiten durch eine Abfolge von symbolischen RûÊumen, durch sprechende AtmosphûÊren, angerissene Szenen und GesprûÊchsfetzen, und wenn wir sie lesen lernen, verstehen wir vielleicht ein bisschen besser, wer wir sind. // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 01.12.2012
Datum: 01.12.2012Länge: 00:52:17 Größe: 47.88 MB |
||
| Karl Bruckmaier: "Lieber ein alter DûÊmon als ein junger Gott" - John Giorno - 23.11.2012 | ||
| Mit Werner HûÊrtel, John Giorno / Manuskript und Regie: Karl Bruckmaier / BR 2012 / LûÊnge: 60'41 // Mehr als ein halbes Jahrhundert hinkte die Dichtkunst hinter der Bildenden Kunst her, konstatierte einst John Giorno, und nahm die Aufholjagd selbst in die Hand. // Seit 1962 verûÑffentlicht er seine Texte in ungewohnten Formaten und in unerwartetem Umfeld: als GemûÊlde, als Sprû¥che auf Anrufbeantwortern, als Radiosendungen, als Langspielplatte, schlieûlich als Podcast. Inhaltlich und formal verbunden mit den Protagonisten der Beat Generation vernetzte er diese mit den aktuellsten Entwicklungen in New Yorks Kunstgetû¥mmel und dem in den sechziger und siebziger Jahren entstehenden Rock-Underground. Seine "Dial-a-Poem"-Aktion fû¥r das Museum of Modern Art ist Legende; sein Label "Giorno Poetry System" war Plattform fû¥r unerwartete KunstûÊuûerungen quer durch alle Genres. Seit den achtziger Jahren nutzte er seine Reputation, um den Opfern von AIDS beizustehen und trotzdem eine offensive und sensuelle Lebenszugewandtheit zu propagieren. Im Mai 2012 nahm Karl Bruckmaier fû¥r den BR eine Lese-Performance von John Giorno auf und fû¥hrte ein GesprûÊch mit ihm. // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 23.11.2012
Datum: 23.11.2012Länge: 01:00:51 Größe: 55.72 MB |
||
| ARD Radio Tatort: Robert Hû¥ltner: Der Stalker - 14.11.2012 | ||
| Mit Florian Karlheim, Brigitte Hobmeier, Michael A. Grimm, Robert Giggenbach, Richard Oehmann, Hans-Georg Panczak, Peter Rappenglû¥ck, Wowo Habdank, Susanne Schroeder, Ulla Geiger, Stephan Zinner, Stephan Bissmeier, Saskia Vester, Martin Wenzl, Anton Leiss-Huber, Steven Scharf, Rene Dumont / Komposition: zeitblom / Regie: Ulrich Lampen / BR 2012 / LûÊnge: 54'00 // Auf der Brucker Inspektion geht es eher gemûÊchlich zu. Senta und Rudi sind mit der AufklûÊrung von kleineren Delikten und ihren û¥blichen Neckereien befasst, da kommt ein Anruf: Der GeschûÊftsmann Horst Lambert, den Rudi auch privat kennt, ist besorgt û¥ber anonyme Drohbriefe. ZunûÊchst wiegeln die Polizeibeamten ab, doch als sein Auto in Brand steht, laufen die Ermittlungen an. Was hat der Filmvorfû¥hrer des Brucker Kinos damit zu tun? Nachdem ein weiterer Autobrand gemeldet wird, steht fû¥r einige schon fest: Schuld am Vandalismus ist ein AuslûÊnder, der kurz vor der Tatzeit einen Benzinkanister gekauft und sich vor der Kripo versteckt hat. Doch dann kommt es im Hause Lambert zu einer Schieûerei. Fû¥r Senta und Rudi gibt es plûÑtzlich jede Menge zu tun. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 14.11.2012
Datum: 14.11.2012Länge: 00:54:10 Größe: 49.60 MB |
||
| Alexander Kluge: Chronik der Gefû¥hle - LebenslûÊufe - 02.11.2012 | ||
| Mit Alexander Kluge, Wolfgang Hinze, Nico Holonics, Peter Fricke, Helmut Stange, Hannelore Hoger, Elfriede Jelinek, Elisabeth Agte, Luise Richter, Maria Pia Corvino, Elvira Reither, Dr. Luise Kampffmeyer, Rosemarie Dorn, Sigrid Fromm / Musik: Munk sowie die Solisten des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks / Bearbeitung und Regie: Karl Bruckmaier / BR 2009 / LûÊnge: 49'18 // Die LebenslûÊufe (1962) sind Alexander Kluges erste ProsaverûÑffentlichung. In der darin enthaltenen ErzûÊhlung Anita G. stiehlt eine junge Frau einen Pullover und flieht durch die bû¥rokratisch-spieûig-neubû¥rgerliche Bundesrepublik. Kluges Verfilmung des Stoffes - Abschied von gestern - mit seiner Schwester Alexandra in der Hauptrolle, erhielt 1966 als erster deutscher Film nach dem Krieg den Silbernen LûÑwen in Venedig. Der Lebenslauf der Anita G. verlûÊuft û¥ber die Bruchstelle von 1945. Geboren in Leipzig, in der Nazizeit als Jû¥din vom Schulbesuch ausgeschlossen, die Eltern deportiert. Im Westen versucht sie mit aller Unbefangenheit ein neues Leben anzufangen, gerûÊt aber immer wieder in Konflikt mit der jungen BRD. Die Menschen, denen Anita G. begegnet - der Richter, die BewûÊhrungshelferin - sind geformt von ihrer gesellschaftlichen Funktion. Der 'Abschied von gestern' ist nicht von heute auf morgen zu haben. "Uns trennt von gestern kein Abgrund, sondern die verûÊnderte Lage" steht zu Beginn des Filmes auf einem Zwischentitel. Und am Ende: "Jeder ist an allem schuld, aber wenn das jeder wû¥sste, hûÊtten wir das Himmelreich auf Erden". // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 02.11.2012
Datum: 02.11.2012Länge: 00:49:28 Größe: 45.29 MB |
||
| Alexander Kluge: Chronik der Gefû¥hle - Massensterben in Venedig - 26.10.2012 | ||
| Mit Alexander Kluge, Wolfgang Hinze, Johannes Herrschmann, Helmut Stange, Christian Friedel, Monika Manz, Maria Pia Corvino, Elvira Reither, Gudrun Skupin, Wolfgang Beyer / Musik: Bananafishbones sowie Solisten des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks / Bearbeitung und Regie: Karl Bruckmaier / BR 2009 / LûÊnge: 56'51 // Es geht um EinzelkûÊmpfer und ihren "Hunger nach Sinn". Wie entsteht Sinn? Laut Alexander Kluge nicht durch homogenisierte Nachrichten, sondern durch vermischte. Nicht durch Spannungsdramaturgien und durchgehende Handlungen, sondern durch eine "AuffûÊcherung der Dramaturgien", der Mischung von "Facts & Fakes" (Titel einer Fernsehsendung Kluges) und der Produktion von "Erfahrungshorizonten" fû¥r das "VorstellungsvermûÑgen". Realismus ist fû¥r Kluge die Kenntnis von ZusammenhûÊngen. Der Gebrauchswert ist eine "spielerische Kommunikation" im "wirklichen Medium der Erfahrung", dem Publikum. Eine Armada erstklassiger Individualisten in einer Zeit kollektiver KûÊmpfe. Man wird am besten fû¥r seine Tugenden bestraft. Ein Mann vom Verfassungsschutz schieût einem Minister in die Backe um auf Sicherheitslû¥cken aufmerksam zu machen, Altersheim-Bewohner werden in Venedig zu Geiselnehmern und liefern sich einen Showdown mit der Polizei, eine reiche Frau flieht vor dem Dritten Reich û¥ber Paris nach New York. In der Liebe findet sie kein Glû¥ck. // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 26.10.2012
Datum: 26.10.2012Länge: 00:57:02 Größe: 52.22 MB |
||
| Ergo Phizmiz: Conversations with Birds - 19.10.2012 | ||
| Mit Juliane Meckert, Martha Moopette, Ergo Phizmiz u.a. / Komposition und Realisation: Ergo Phizmiz / BR 2012 / LûÊnge: 46'02 // "If you want to learn to fly, first learn to whistle" - Conversations with Birds ist ein ornithologisches Mosaik û¥ber Klang und Sprache der VûÑgel als Tor zur Freiheit. Darû¥ber, wie die Begegnung mit den Tieren, die fliegen kûÑnnen, Welten in Bewegung bringen und darû¥ber wie in der Sehnsucht nach dem Fliegen immer schon seine UnmûÑglichkeit spû¥rbar ist. Eine Vogelschar geht auf die Suche nach dem Geheimnis des Windes und wird dabei ã wie der Wetterhahn ã Opfer ihres fatalen Unterfangens. Der Autor Ergo Phizmiz erzûÊhlt von seinen GesprûÊchen mit einem verkrû¥ppelten Wellensittich und, wie er in der Begegnung mit dem Vater des polnischen Schriftstellers Bruno Schulz die Sprache der VûÑgel erlernte. Fû¥r den britischen Maler Edward Lear (1812-88) und den amerikanischen Kû¥nstler Joseph Cornell (1903-72) werden VûÑgel Zentralgestalten ihres Werkes. Deren Verschwinden entlûÊsst sie in eine traurige Einsamkeit. In der Oper "The Mourning Show" (wûÑrtlich û¥bersetzt: Die Trauer Show) entwickelt Phizmiz mit einer Vogelexpertin eine Poetik des ornithologischen ErzûÊhlens, das sich von der linearen Narration verabschiedet. Und eine Reise durch den Dschungel von Guyana fû¥hrt den Autor zum versteckten KûÑnigreich der Mauersegler, das bisher nur wenige Menschen entdecken konnten. In phantastischen, bildhaft-poetischen Episoden, die auch manch lakonischer Grausamkeit nicht entbehren, verwebt Phizmiz literarische Topoi mit dokumentarischem und autobiografischem Material zu mûÊrchenhaften Geschichten. Es entspinnt sich ein Netz aus wiederkehrenden Motiven und rûÊtselhaften ZusammenhûÊngen, die einem sehr bekannt und zugleich ûÊuûerst befremdlich vorkommen. Mehrsprachig und in der Verbindung von experimentellem Sound und vorgefundenen OriginaltûÑnen entwickelt diese Komposition ein Eigenleben, das die Spur aufnimmt zur Vielfalt und Buntheit einer Welt der VûÑgel, der Freiheit und der Phantasie. // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 19.10.2012
Datum: 19.10.2012Länge: 00:46:13 Größe: 42.31 MB |
||
| Thomas Harlan: Rosa - Die Reise nach Kulmhof (2/2) - 13.10.2012 | ||
| Mit Sabine Kastius, Katja Amberger, Christiane Roûbach, Kornelia Boje, Stephan Rabow, Gû¥nther Maria Halmer / Komposition: Helga Pogatschar / Bearbeitung: Michael Farin / Regie: Bernhard Jugel / BR 2001 / LûÊnge: 77'54 // In den sechziger Jahren stieû Thomas Harlan bei Recherchen û¥ber Kriegsverbrechen auf Gerû¥chte û¥ber das Dorf Kulmhof, an dem die Deutschen die Technologie des Massenmords erprobten. Sein 2000 erschienener Debû¥troman "Rosa"ist das Gegenteil einer Bilanz und alles andere als ein Fazit. Der zeitliche Rahmen erstreckt sich von 1942 bis 1993. Virtuos spielt Thomas Harlan darin mit verschiedenen ErzûÊhlebenen. Dokumente, Briefe, Phonoaufnahmen, Berichte und VerhûÑrprotokolle geben in atemlosem Stakkato ungeheuerliche Geschehnisse preis. Eine Lichtung bei Kulmhof in Polen. Aus der schneeverwehten Ebene wûÑlbt sich das Dach eines Erdhauses, ein Pferd ohne Schweif ist an den rauchenden, klapprigen Schornstein gebunden, der aus dem Boden ragt. In der HûÑhle hausen Rosa Peham und Jû°zef Najman. Rosa ist die ehemalige Verlobte von Franz Maderholz, der Zahlmeister im Vernichtungslager Kulmhof war. Die Asche der Opfer fû¥llt den Boden der Lichtung, die seit Kriegsende Rosas Heimstatt ist. Franz ist verschollen, Rosa hat sich 1948 mit Jû°zef liiert. Auch ihm wird eine dunkle Vergangenheit nachgesagt. Jahrzehnte spûÊter erfahren ein Filmteam und ein Theologe aus alten Akten von den damaligen Ereignissen und spû¥ren den Schicksalen der Beteiligten nach. // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 13.10.2012
Datum: 13.10.2012Länge: 01:17:59 Größe: 71.40 MB |
||
| Thomas Harlan: Rosa - Die Reise nach Kulmhof (1/2) - 06.10.2012 | ||
| Mit Sabine Kastius, Katja Amberger, Christiane Roûbach, Kornelia Boje, Stephan Rabow, Gû¥nther Maria Halmer / Komposition: Helga Pogatschar / Bearbeitung: Michael Farin / Regie: Bernhard Jugel / BR 2001 / LûÊnge: 77'35 // In den sechziger Jahren stieû Thomas Harlan bei Recherchen û¥ber Kriegsverbrechen auf Gerû¥chte û¥ber das Dorf Kulmhof, an dem die Deutschen die Technologie des Massenmords erprobten. Sein 2000 erschienener Debû¥troman "Rosa" ist das Gegenteil einer Bilanz und alles andere als ein Fazit. Der zeitliche Rahmen erstreckt sich von 1942 bis 1993. Virtuos spielt Thomas Harlan darin mit verschiedenen ErzûÊhlebenen. Dokumente, Briefe, Phonoaufnahmen, Berichte und VerhûÑrprotokolle geben in atemlosem Stakkato ungeheuerliche Geschehnisse preis. Eine Lichtung bei Kulmhof in Polen. Aus der schneeverwehten Ebene wûÑlbt sich das Dach eines Erdhauses, ein Pferd ohne Schweif ist an den rauchenden, klapprigen Schornstein gebunden, der aus dem Boden ragt. In der HûÑhle hausen Rosa Peham und Jû°zef Najman. Rosa ist die ehemalige Verlobte von Franz Maderholz, der Zahlmeister im Vernichtungslager Kulmhof war. Die Asche der Opfer fû¥llt den Boden der Lichtung, die seit Kriegsende Rosas Heimstatt ist. Franz ist verschollen, Rosa hat sich 1948 mit Jû°zef liiert. Auch ihm wird eine dunkle Vergangenheit nachgesagt. Jahrzehnte spûÊter erfahren ein Filmteam und ein Theologe aus alten Akten von den damaligen Ereignissen und spû¥ren den Schicksalen der Beteiligten nach. // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 06.10.2012
Datum: 06.10.2012Länge: 01:17:41 Größe: 71.13 MB |
||
| Uwe Dick: "Ich schreibe um mich selbst zu û¥berraschen" - 23.09.2012 | ||
| Uwe Dick (Autor) im GesprûÊch mit Katarina Agathos / BR 2012 / LûÊnge: 51'11 | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 23.09.2012
Datum: 23.09.2012Länge: 00:51:11 Größe: 46.87 MB |
||
| Jan Peters/Marie-Catherine Theiler: Zeitlochbohrversuche - 16.09.2012 | ||
| Komposition: Pit Przygodda / Realisation: Jan Peters/Marie-Catherine Theiler / BR 2011 / LûÊnge: 54'16 // Die beiden Filmemacher Marie-Catherine Theiler und Jan Peters erlebten die Schwangerschaft und Geburt ihres ersten Kindes als eine Zeitenwende, eine Entschleunigung setzte ein. Im Gegensatz dazu steigt nach der Geburt des zweiten Kindes die Zeitverflugsgeschwindigkeit und der Familienrhythmus gerûÊt gûÊnzlich aus dem Takt. Ihr HûÑrspiel dreht sich um die Herausforderungen, die zunehmende Beschleunigung im ohnehin chronisch hektischen Alltag in den Griff zu bekommen. Beide schreiben manisch Listen. To-do-Listen, um Aufgaben zu priorisieren und damit das Chaos im Vorfeld zu ordnen, Logbucheintragungen darû¥ber, was am Tag passiert ist, um das Durcheinander im Nachhinein noch zu strukturieren. In einem Ping-Pong der Dialoge suchen die jungen Eltern Peters und Theiler nach MûÑglichkeiten, dem rasenden Stillstand zu entrinnen, in dem sich alle und alles zu befinden scheinen. Bei ihren Versuchen, LûÑcher in die Zeit zu bohren und anderen Selbstexperimenten treffen sie auf verschiedene Experten, unter anderem Chronobiologen, Neurowissenschaftler, Buddhisten und einen Tischtennisprofi. Zahlreiche DenkanstûÑûe und unterschiedliche Ideen zur Zeitgewinnung und Effizienz werden auf ihre PraktikabilitûÊt û¥berprû¥ft, die von der 66-Sekunden-Minute, û¥ber GeschûÊftigkeitsquartett und Social Jetlag bis zur "Online-Lausung der 5000" reichen. // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 16.09.2012
Datum: 16.09.2012Länge: 00:54:26 Größe: 49.85 MB |
||
| Tina Klopp: Erfolg! - 09.09.2012 | ||
|
Mit Jule Ronstedt, Sebastian Blomberg, Wolfgang Pregler / Komposition: Hendrik Meyer / Regie: Leonhard Koppelmann / BR 2012 / LûÊnge: 54'00 // Alle wollen ihn, aber gleichzeitig haftet an ihm der schlechte Ruf des Charakterverderbers: Was ist Erfolg und wie erreicht man ihn? Warum ist Erfolg ã messbar in Ruhm und Geld ã so erstrebenswert und worû¥ber reden die, die ihn haben, wenn sie unter sich sind?
Ein GesprûÊch in trauter Runde. Ein Spitzenpolitiker, ein Weltstar und ein Topmanager treffen sich in einer Bar, um einander aus ihrem Leben an der Spitze der Gesellschaft zu erzûÊhlen. Ohne Rû¥cksicht auf WûÊhler, Fans oder Kunden analysieren sie die Psychologien der Macht und demontieren die Rechtfertigungsstrategien der Erfolglosen. Denn unmoralisches Verhalten kritisieren kann jeder. Schwerer schon ist auszuhalten, dass am Ende der Erfolg doch immer denjenigen Recht gibt, die ihn erreicht haben. Mutiger als Kapitalismuskritik und die Klage û¥ber Werteverlust scheint da auf einmal das Lob von Anpassertum, Konsumismus und der schûÑnen OberflûÊche. Und letztlich sind Menschen, die in ûkosupermûÊrkten einkaufen oder sich fû¥r die richtige Sache engagieren, vielleicht auch einfach nur die grûÑûeren NervensûÊgen. // |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 09.09.2012
Datum: 09.09.2012Länge: 00:54:10 Größe: 49.60 MB |
||
| Eran Schaerf: FM-Scenario - where palms stand - mask - delay - 31.08.2012 | ||
|
Mit Samuel Streiff, Peter Veit, Achim Bogdahn / Realisation: Eran Schaerf / Montage: Valerie Smith / BR 2012 / LûÊnge: 61'15 // FM-Scenario ist ein intermediales Projekt, das sich û¥ber Website, Sendungen, Ausstellungen und Publikationen realisiert. Eine Kooperation von: BR HûÑrspiel und Medienkunst; A Production e. V., Berlin; HartwareMedienKunstVerein, Dortmund; Haus der Kulturen der Welt, Berlin; Les Complices*, Zû¥rich; Museum fû¥r Konkrete Kunst, Ingolstadt; ZKM, Karlsruhe. GefûÑrdert durch die Kulturstiftung des Bundes. Die Montage der Kuratorin Valerie Smith bildete 2012 das Ausgangsszenario fû¥r eine Installation im Haus der Kulturen der Welt.
Angesiedelt in den Dolmetscherkabinen des Hauptkonferenzraums, einer Architektur, die ûbersetzungsprozesse spiegelt, lûÊsst sie die Grenzen zwischen Fakt und Fiktion, Sender und EmpfûÊnger, Nutzer und Autor verschwimmen. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 31.08.2012
Datum: 31.08.2012Länge: 01:01:25 Größe: 56.24 MB |
||
| Alexander Kluge: Chronik der Gefû¥hle - Unheimlichkeit der Zeit. Der Luftangriff auf Halberstadt - 24.08.2012 | ||
| Mit Alexander Kluge, Wolfgang Hinze, Ilja Richter, Hanns Zischler, Johannes Herrschmann, Nico Holonics, Peter Fricke, Helmut Stange, Christian Friedel, Hannelore Hoger, Sandra Hû¥ller, Monika Manz, Hans Magnus Enzensberger / Musik: Susanne Brokesch sowie Solisten des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks / Bearbeitung und Regie: Karl Bruckmaier / BR 2009 / LûÊnge: 55'33 // Am 8. April 1945 wird Halberstadt durch alliierte Bomber fast vollstûÊndig zerstûÑrt. Zehn Meter neben dem 13-jûÊhrigen Alexander Kluge schlûÊgt eine Sprengbombe ein. Seine dominierenden Gefû¥hle in dieser Situation sind die Vorfreude, den Schulkameraden von der Bombe zu berichten und die Angst um die Scheidung der Eltern. Erst Mitte der Siebziger Jahre ist sein Abstand zu den Ereignissen groû genug, um davon zu erzûÊhlen. Seine Beschreibung stellt einen wichtigen Bezugspunkt in der Darstellung des Luftangriffs auf deutsche StûÊdte und ihre ZivilbevûÑlkerung dar. Laut Kluge sagt eine einfache Wiedergabe der RealitûÊt weniger denn je etwas û¥ber die RealitûÊt aus. "Es muss mûÑglich sein, die RealitûÊt als die geschichtliche Fiktion, die sie ist, auch darzustellen". In diesem Sinne erzûÊhlt Kluge von der ZerstûÑrung des Kinos Capitol, den luftschutzdienstverpflichteten Turmbeobachterinnen Frau Arnold und Frau Zacke und den Ausfû¥hrungen des Bomber-Piloten Anderson: "'Die Ware musste runter auf die Stadt. Es sind ja teure Sachen. Man kann das praktisch auch nicht auf die Berge oder das freie Feld hinschmeiûen, nachdem es mit viel Arbeitskraft zu Hause hergestellt ist.' ã 'Sie konnten wenigstens einen Teil auf freies Feld werfen. Oder in einen Fluss.' ã 'Diese wertvollen Bomben?'". // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 24.08.2012
Datum: 24.08.2012Länge: 00:55:43 Größe: 51.02 MB |
||
| Alexander Kluge: Chronik der Gefû¥hle - Unheimlichkeit der Zeit. Verschrottung durch Arbeit - 17.08.2012 | ||
|
Mit Alexander Kluge, Wolfgang Hinze, Ilja Richter, Helmut Stange, Hannelore Hoger, Joachim Geisthardt, Heinz Tessun, Klaus Plichta, Wolfgang Beyer, Erich Meyer, Siegfried Wieler, Hans-Joachim Klemm, Peter Nier, Reinhold Schuler, Wolfgang Braetsch / Musik: Elliott Sharp sowie Solisten des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks / Bearbeitung und Regie: Karl Bruckmaier / BR 2009 / LûÊnge: 49'13 // Im bereits zerfallenden Dritten Reich wurde 1944 in der NûÊhe von Halberstadt eine Auûenstelle des KZ Buchenwald eingerichtet. Neben einer Untertunnelung des Harzsandsteingebirges fû¥r Rû¥stungsproduktion wurde gezielt "Vernichtung durch Arbeit" betrieben.
WûÊhrend der gesamten Zeit seiner Existenz befanden sich û¥ber 7.000 HûÊftlinge im Lager. UngefûÊhr 2.000 Tote waren bis zur Befreiung des Lagers am 11. April 1945 zu verzeichnen. ûber 2.500 HûÊftlinge starben auf dem "Todesmarsch", auf den die gehfûÊhigen HûÊftlinge des Lagers am 9. April 1945 geschickt worden waren. 1949 wurden am Ort der MassengrûÊber ein Mahnmal und Gedenktafeln eingeweiht, 1976 ein Museum. ã Alexander Kluge ergûÊnzt diese Fakten durch Beschreibungen des "unternehmerischen Umfelds": Organisation und Selbstversorgung des Lagers, Schikanen der SS- Wachfû¥hrer, VerbesserungsvorschlûÊge der HûÊftlinge, Fû¥hrungsproblem der Wachtruppe, Protokoll der AuflûÑsung und Zerstreuung, Denkmalsplanung zu DDR-Zeiten. // |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 17.08.2012
Datum: 17.08.2012Länge: 00:49:24 Größe: 45.23 MB |
||
| Kathrin RûÑggla/Leopold von Verschuer: publikumsberatung - 12.08.2012 | ||
|
Mit Leopold von Verschuer, Franz TrûÑger, Hanns Zischler, Silke Buchholz u.a. / Komposition: Franz TrûÑger / Regie: Leopold von Verschuer / BR 2011 / LûÊnge: 54'25 // Der Referent der live im Radio û¥bertragenen HauptstadtkulturgesprûÊche ist ab-, ein Ersatzreferent kurzfristig eingesprungen. Dieser nutzt seine Chance zu einem unaufhaltsam scheiternden Vortrag und verliert sofort den Faden. Seine Reflexionen mûÊandern von einem ãauf den Hund gekommenen Katastrophenfilmgenreã û¥ber ãAngstschuldenã, zur ãLust am Richtenã, streifen das bislang viel zu wenig beachtete Thema ãStottern im Barockã und gelangen schlieûlich zur Frage: Was ist eigentlich ein erfolgreicher HûÑrer? Der Redakteur des Abends bemû¥ht sich in der Regie vergeblich um Steuerung, doch der Ersatzreferent lûÊsst sich durch nichts abbringen. Auch nicht dadurch, dass sein Mikrofon irgendwann selbst zu sprechen beginnt und das Publikum im Sendesaal EinwûÊnde erhebt oder sogar den Saal verlûÊsst. Das Reale bricht ein in die Fiktion und lûÊsst Ebenen und SinnzusammenhûÊnge verschwimmen. Der HûÑrer wird von Anfang an in Orientierungsnot gebracht. Die publikumsberatung bedient sich aller Tricks des Fingierten, des Spiels im Spiel, und stellt nicht nur die Frage nach den Grenzen des Fiktiven, sondern mit ihrem Geflecht von Diskursschnipseln auch das VerhûÊltnis von Sprache und dem, was sie bezeichnet, auf den Kopf. // |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 12.08.2012
Datum: 12.08.2012Länge: 00:54:35 Größe: 49.98 MB |
||
| Thomas von Steinaecker: Die Entstehung des HûÑrspiels "Umbach muss weg" - 05.08.2012 | ||
|
Fû¥r ein HûÑrspiel fû¥hrt der Autor Thomas von Steinaecker ein Interview mit dem Synchronsprecher Martin Umbach. Lebensstationen ziehen vorbei, das Scheitern als Schauspieler, der Neuanfang und rasante Aufstieg bei der Filmsynchronisation. Nach dem GesprûÊch ist fû¥r von Steinaecker klar, dass er bei seinem HûÑrspiel û¥ber Martin Umbach so authentisch wie mûÑglich vorgehen mûÑchte, am liebsten wûÊre ihm ein HûÑrspiel in Form eines fiktiven Features. Dafû¥r erfindet er seine eigene Stellvertreterfigur: Nicole. An seiner statt begibt nun sie sich auf weitere Recherche û¥ber Umbach. Dabei wird sie jedoch immer wieder von ihrer eigenen schwierigen Situation abgelenkt; befindet sie sich doch an einem Wendepunkt ihres Lebens: Sie steht kurz vor einem wichtigen BewerbungsgesprûÊch, eine feste Stelle bei einer Filmfirma winkt. Aber Nicole hat ein Problem: Sie tut sich immer schwerer, Entscheidungen zu treffen. Und auch Martin Umbach, mit dem sie wegen ihres Features weiter in Kontakt steht, befindet sich in einer Krise. Vor allem privat steuert er unweigerlich auf eine Katastrophe zu: Seit Jahren fû¥hrt er ein heimliches Doppelleben mit seiner jungen Geliebten und dem gemeinsamen Kind in Berlin und mit seiner Familie in Mû¥nchen. // Mit Martin Umbach, Kathrin von Steinburg, Ilona Grandke, Laura Maire, Thomas von Steinaecker, Philipp GûÑtz, Wilfried Hauer, Beate Himmelstoû, Oliver Mallison, Wilhelm Manske, Hemma Sophia Michel, Heinz Peter, Tommi Piper, Jay Rutledge, Silvie Sperlich, Andrea Wenzl / Regie: Bernadette Sonnenbichler / BR 2012 / LûÊnge: 53'09 Lebensstationen ziehen vorbei, das Scheitern als Schauspieler, der Neuanfang und rasante Aufstieg bei der Filmsynchronisation.
Nach dem GesprûÊch ist fû¥r von Steinaecker klar, dass er bei seinem HûÑrspiel û¥ber Martin Umbach so authentisch wie mûÑglich vorgehen mûÑchte, am liebsten wûÊre ihm ein HûÑrspiel in Form eines fiktiven Features. Dafû¥r erfindet er seine eigene Stellvertreterfigur: Nicole. An seiner Statt begibt nun sie sich auf weitere Recherche û¥ber Umbach. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 05.08.2012
Datum: 05.08.2012Länge: 00:53:19 Größe: 48.82 MB |
||
| Carl Einstein: Bebuquin oder die Dilettanten des Wunders (2/2) - 29.07.2012 | ||
| Mit Ingo Hû¥lsmann, Sven Lehmann / Komposition: Daniel Dickmeis / Regie: Ulrich Gerhardt / BR 2012 / LûÊnge: 52'23 // Es sind dilettantische Wunder-Sucher, die Carl Einstein in seinem 1912 gedruckten "Anti-Roman" versammelt. // Ob im Cafûˋ, im Bordell, im Zirkus oder im Kloster prûÊsentieren die 19 Kapitel des Textes schlaglichtartig phantastische Szenen ohne klare Handlung oder eindeutige Charaktere. Vielmehr wird in einer energetischen Mischung aus ErzûÊhlung, Dialog, Lyrik, Pamphlet, Predigt oder Gebet die ûberwindung von Vernunft, Gleichgewicht, Symmetrie und Einheit als MûÑglichkeit eines anderen Denkens und Befreiung der Empfindungen heraufbeschworen. Eine Idee, mit der sich Carl Einstein und die Kû¥nstlerkreise seiner Zeit vor der Folie einer Mechanisierung der Welt und des Verlustes spontaner Erfahrung identifizierten. Analog zur kubistischen Malerei provoziert der Text thematisch und formal andere Blicke auf die Welt, vermischt ohne Scheu zahlreiche Topoi aus Religion und Philosophie und rû¥ttelt dabei auch an den Grenzen der Sprache: als explizite Sprachkritik, als Zitation oder Parodie naturwissenschaftlicher Diktion, religiûÑser Sprechformen, philosophischer Exkurse oder kû¥nstlerischer Traktate. Damit beeinflusste Einsteins Text Expressionisten und Dadaisten genauso, wie er fû¥r diese zur ReibungsflûÊche wurde. In der HûÑrspielproduktion des Bayerischen Rundfunks, die eine akustische Umsetzung des ungekû¥rzten Erstdrucks von 1912 ist, erscheint das Sprachgeschehen der Vorlage als ein Pendeln zwischen zwei Stimmen, als zersetzende Dialogisierung, losgelûÑst von den ursprû¥nglichen Dialogen, als lustvolle Inszenierung maûloser Gedankenspiele. // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 29.07.2012
Datum: 29.07.2012Länge: 00:52:33 Größe: 48.12 MB |
||
| Carl Einstein: Bebuquin oder die Dilettanten des Wunders (1/2) - 22.07.2012 | ||
| Mit Ingo Hû¥lsmann, Sven Lehmann / Komposition: Daniel Dickmeis / Regie: Ulrich Gerhardt / BR 2012 / LûÊnge: 51:07 // Es sind dilettantische Wunder-Sucher, die Carl Einstein in seinem 1912 gedruckten "Anti-Roman" versammelt. // Ob im Cafûˋ, im Bordell, im Zirkus oder im Kloster prûÊsentieren die 19 Kapitel des Textes schlaglichtartig phantastische Szenen ohne klare Handlung oder eindeutige Charaktere. Vielmehr wird in einer energetischen Mischung aus ErzûÊhlung, Dialog, Lyrik, Pamphlet, Predigt oder Gebet die ûberwindung von Vernunft, Gleichgewicht, Symmetrie und Einheit als MûÑglichkeit eines anderen Denkens und Befreiung der Empfindungen heraufbeschworen. Eine Idee, mit der sich Carl Einstein und die Kû¥nstlerkreise seiner Zeit vor der Folie einer Mechanisierung der Welt und des Verlustes spontaner Erfahrung identifizierten. Analog zur kubistischen Malerei provoziert der Text thematisch und formal andere Blicke auf die Welt, vermischt ohne Scheu zahlreiche Topoi aus Religion und Philosophie und rû¥ttelt dabei auch an den Grenzen der Sprache: als explizite Sprachkritik, als Zitation oder Parodie naturwissenschaftlicher Diktion, religiûÑser Sprechformen, philosophischer Exkurse oder kû¥nstlerischer Traktate. Damit beeinflusste Einsteins Text Expressionisten und Dadaisten genauso, wie er fû¥r diese zur ReibungsflûÊche wurde. In der HûÑrspielproduktion des Bayerischen Rundfunks, die eine akustische Umsetzung des ungekû¥rzten Erstdrucks von 1912 ist, erscheint das Sprachgeschehen der Vorlage als ein Pendeln zwischen zwei Stimmen, als zersetzende Dialogisierung, losgelûÑst von den ursprû¥nglichen Dialogen, als lustvolle Inszenierung maûloser Gedankenspiele. // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 22.07.2012
Datum: 22.07.2012Länge: 00:51:16 Größe: 46.94 MB |
||
| Rudolf Herz: Der kalte Sommer 1912 - 20.07.2012 | ||
| Mit Cornelia Meliû n, Sebastian Fuchs, Wolfram Winkel, Leo Gmelch, Markus Muench, 48nord (Ulrich Mû¥ller, Siegfried RûÑssert) / Realisation: 48nord / BR 2012 / LûÊnge: 44'34 // 1912 verbrachte Marcel Duchamp einen kalten Sommer in Mû¥nchen. Am 25. August schrieb er nach Hause: "Hier unaufhûÑrlicher Regen, kalt." // Rudolf Herz erklûÊrt die û¥berlieferten Wetterdaten des meteorologischen Landesamtes zur Partitur, die in einer freien Interpretation von dem Duo 48nord hûÑrbar gemacht wird. Die Phase kû¥nstlerischen Umbruchs und emotionaler Belastung in der Biographie Duchamps wird dabei aufgegriffen und der Spannungszustand zwischen abstrakt-objektivierender Technologie und individuellem Tun ausgehend von den Daten zu Lufttemperatur, Luftdruck, Wind, BewûÑlkung des Sommers 1912 gestaltet. 100 Tage, von 21. Juni bis Ende September 1912 war Duchamp in Mû¥nchen, an dem Ort, den er spûÊter als ãSchauplatz meiner totalen Befreiungã beschreiben sollte. Eingemietet in der Wohnung eines Ingenieurs und technischen Zeichners bahnte sich unter dem Eindruck einer ganz unerwarteten und inspirierenden Begegnung mit der abstrakten Welt der Technik eine Wende im Werk des Kû¥nstlers an. Fortan suchte Duchamp jede persûÑnliche Handschrift zu vermeiden, veranstaltete Experimente mit dem Zufall und entdeckte den Geist der Ironie. Gleichzeit war diese Zeit von einem Psychodrama û¥berschattet. Vor seiner Abreise nach Mû¥nchen hatte Duchamp sich in Gabriella Picabia, die Frau seines besten Freundes, verliebt und erfahren, dass diese Liebe unerwidert blieb. Die Phase kû¥nstlerischen Umbruchs und emotionaler Belastung in der Biographie Duchamps wird in ãDer kalte Sommer 1912ã aufgegriffen. TatsûÊchlich herrschte in Bayern in diesen Monaten auûergewûÑhnlich schlechtes Wetter, wie aus den û¥berlieferten Unterlagen des meteorologischen Landesamtes hervorgeht. Rudolf Herz erklûÊrte das sprûÑde Zahlenwerk der Meteorologen zur Partitur, die in einer freien Interpretation von dem Duo 48nord hûÑrbar gemacht wird. Hierbei wird der Spannungszustand zwischen abstrakt-objektivierender Technologie und individuellem Tun ausgehend von den Wetterdaten des Sommers 1912 gestaltet. Tempo, Melodie und Processing leiten sich von der Temperatur-, Niederschlag- und Luftdruckkurve ab und û¥bernimmt deren formale Proportionen. Auûerdem werden den Wochen, die Duchamp in Mû¥nchen verbrachte, jeweils zwei Satzfragmente aus den Originalbegleittexten zu den Tabellen von 1912 zugeordnet, die die Wetterdaten interpretieren. // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 20.07.2012
Datum: 20.07.2012Länge: 00:44:42 Größe: 40.93 MB |
||
| Alexander Kluge: Chronik der Gefû¥hle - Unheimlichkeit der Zeit. Bilder aus meiner Heimatstadt - 13.07.2012 | ||
| Mit Alexander Kluge, Wolfgang Hinze, Nico Holonics, Helmut Stange, Christian Friedel, Hannelore Hoger, Sandra Hû¥ller sowie Maria Pia Corvino, Erich Meyer, Monika Winkler, Rosemarie Dorn, Dr. Luise Kampffmeyer, Ruth Pfosser, Jasmin SchûÊtz / Musik: Asio Kids sowie Solisten des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks / Bearbeitung und Regie: Karl Bruckmaier / BR 2009 / LûÊnge: 55'57 // "Nachrichten von den Gefû¥hlen." Um Zusammenhang herzustellen, muss Zusammenhang aufgegeben werden. Die Geschichten in Unheimlichkeit der Zeit erschienen erstmals 1977. In 18 Heften sind Bruchstû¥cke aus DDR-, Kriegs- und Vorkriegszeiten versammelt. Zur Zeit der Niederschrift lag Alexander Kluges Vater im Sterben. Kluge hûÊlt Erinnerungen an seine Vorfahren fest. Er beschreibt seine Heimatstadt Halberstadt. Der Vater "sitzt an seinem Schreibtisch mit Ausblick auf den Bismarckplatz, den er so sieht, wie er dort liegt, mit den modernisierten Blumenrabatten der DDR-Gartenverwaltung, abgeholzten Bû¥schen usf., er kann aber, wie auf Knopfdruck, den Platz auch in der Gestalt sehen, die er in den dreiûiger Jahren hatte, oder in der Gestalt von 1916." Den Abschied vom Vater beschreibt Kluge û¥ber den 'Zustand des Gartens': "Zwischen diesem Garten und den HûÊnden, die ihn bearbeitet haben eine unû¥berwindliche Stufenfolge von zehn steinernen Treppenstufen, den Veranda-Vorbau herab, dann die verriegelte Wintergartentû¥r. Ein Winter und das Frû¥hjahr haben ausgereicht, die Bû¥sche und FliederstrûÊucher û¥ber die Gartenpfade wachsen zu lassen. Der Steingarten ist, vom Herbst her, mit Zweigen bedeckt, die nie mehr (von seinen Lebzeiten her gesehen) abgerûÊumt werden." // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 13.07.2012
Datum: 13.07.2012Länge: 00:56:07 Größe: 51.38 MB |
||
| Alexander Kluge: Chronik der Gefû¥hle - Wie kann ich mich schû¥tzen? Was hûÊlt freiwillige Taten zusammen? - 06.07.2012 | ||
| Mit Alexander Kluge, Ilja Richter, Peter Fricke, Christian Friedel, Sandra Hû¥ller, Monika Manz, sowie Merit Bruckmaier, Fleming Bruckmaier, Jasmin SchûÊtz, Moritz Ritzinger / Musik: Hummmel sowie die Solisten des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks / Regie: Karl Bruckmaier / BR 2009 / LûÊnge: 52'00 // "Wir mû¥ssen uns orientieren. Worauf muss ich vertrauen? Was hûÊlt freiwillige Taten zusammen?" Die Grundlage des ErzûÊhlens ist Einfû¥hlung. "Kinder haben einen Traktor in Fahrt gesetzt. Die Eltern wollen retten. Vera F. gelingt es, den Jû¥ngsten wegzustoûen. Sie wird selbst tûÑdlich verletzt." Kleine Schwarz-Weiû-Abbildungen ã Zeitungsfotos und Comicbilder mit Bildunterschriften ã stehen in Alexander Kluges Chronik der Gefû¥hle gleichwertig neben anderen Geschichten. Menschen riskieren ihr Leben, handeln, ohne an die mûÑglichen Konsequenzen zu denken. Auf einer Zeichnung ist ein BûÊr zu sehen, der sich ein Kind ins offene Maul hûÊlt, davor die verzweifelte Mutter, im Hintergrund der fliehende Vater. Ein glû¥cklicher Ausgang ist nicht zu erkennen, wird aber von Kluge behauptet: "WûÊhrend ihr Mann vor einer BûÊrin flieht, packt die an sich sonst ûÊngstliche Gerlinde die Fû¥ûe ihres Kindes. Nicht die Kraft, wohl aber ihr Aufschrei irritierte das Ungetû¥m derart, dass es die Beute fallen lieû und in den Bû¥schen verschwand. Wenn ich einen Moment nachgedacht hûÊtte, sagte Gerlinde spûÊter, hûÊtte der Mut mich verlassen." In "Gefahr und grûÑûter Not" erscheinen mutige Taten, die ausschlieûlich um eines anderen willen geschehen, gefû¥hlsmûÊûig selbstverstûÊndlich. Im Alltag sind sie seltene Glû¥cksmomente. // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 06.07.2012
Datum: 06.07.2012Länge: 00:52:10 Größe: 47.77 MB |
||
| Thomas Meinecke/Michaela MeliûÀn/David Moufang: Konvent - 29.06.2012 | ||
|
Text: Thomas Meinecke / Komposition: David Moufang / Bilder und Projektionen: Michaela MeliûÀn / BR/intermedium 2 2002 / LûÊnge: 29'31 // Gibt es û¥berhaupt eine Art von Sprache, die nicht in stûÊndigen Ein- bzw. Ausschlussverfahren IdentitûÊt konstruiert? Als textliches und visuelles Ausgangsmaterial fû¥r die Kû¥nstler dienen die Protokolle eines Schriftstellertreffens aus dem Jahr 1964 im Literarischen Colloquium Westberlin (Prosaschreiben), bei dem sich sechzehn jû¥ngere Autoren mit arrivierteren, ûÊlteren Autoren darû¥ber austauschten, welche erzûÊhlenden Formen ihnen als aktuell bzw. noch praktikabel erschienen. Als textliches Ausgangsmaterial dienen die Protokolle eines Schriftstellertreffens aus dem Jahr 1964 im Literarischen Colloquium Westberlin, bei dem sich sechzehn jû¥ngere Autoren mit arrivierteren, ûÊlteren Autoren darû¥ber austauschten, welche erzûÊhlenden Formen ihnen als aktuell bzw. noch praktikabel erschienen.
'Konvent' lotet aus, was sich auch jenseits von herkûÑmmlicher Syntax / NarrativitûÊt, als Geflecht, Textur, einen politischen Anspruch transportieren kann: in der sonisch generierten, visuell projizierten und verbal modulierten ErzûÊhlung. // |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 29.06.2012
Datum: 29.06.2012Länge: 00:29:41 Größe: 27.18 MB |
||
| Georg Bû¥chner: Dantons Tod - 15.06.2012 | ||
| Mit Fritz Kortner, Elfriede Kuzmany, Bruno Hû¥bner, Peter Lû¥hr, Marianne Kehlau u.a. / Bearbeitung: Arnold Weiû-Rû¥thd / Komposition: Mark Lothar / Regie: Walter Ohm / BR 1948 / LûÊnge: 104'55 // Ein Ausschnitt aus der SpûÊtphase der FranzûÑsischen Revolution - zehn Tage im MûÊrz und April 1794 - in der sie in Diktatur und blutigen Despotismus umzuschlagen beginnt. Bû¥chner selbst beurteilt die VorgûÊnge nicht unmittelbar. In der Gestalt Dantons schlûÊgt sich jedoch seine Skepsis gegenû¥ber dem Ideal des autonom handelnden Individuums nieder. Sein Protagonist bezeichnet die Geschichte als fatalistischen Prozess, der zu immer neuen Leiden fû¥hrt und der scheinbar vorherbestimmt verlûÊuft. "Puppen sind wir, von unbekannten MûÊchten am Draht gezogen." Das Drama entstand 1835, wûÊhrend Bû¥chner wegen der VerûÑffentlichung seines Revolutionsaufrufes "Der hessische Landbote" steckbrieflich gesucht war. Unmittelbar nach Abschluss des Manuskripts konnte er nur durch schnelle Flucht der Verhaftung entgehen. // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 15.06.2012
Datum: 15.06.2012Länge: 01:44:55 Größe: 96.07 MB |
||
| Georg Glasl / Sabine Reithmaier: Der Zitherspieler - 11.06.2012 | ||
| Mit Mit Rainer Bock / Zither: Georg Glasl / Komposition: Georg Glasl/Peter Kiesewetter / Realisation: Georg Glasl/Arash Safaian/Cornel Franz / BR 2012 / LûÊnge: 51'35 // Am 8. November 1939 versucht Georg Elser einen Anschlag auf Hitler, GûÑring und Goebbels. // Elser wird auf der Flucht festgenommen und am 9. April 1945 im KZ Dachau mit einem Genickschuss ermordet. Seine Familie erfûÊhrt nichts, erst 1950 wird er fû¥r tot erklûÊrt. Elsers mutige Tat wurde erst verurteilt, dann jahrelang nicht verhandelt; sie wurde geleugnet, uminterpretiert und erst spûÊt anerkannt. Da Elser sich weder in Briefen noch Tagebû¥chern zu seiner Tat geûÊuûert hat, stû¥tzt sich das kollektive GedûÊchtnis auf nachtrûÊgliche Erinnerungen von Zeitzeugen, die erst Jahrzehnte spûÊter befragt wurden, und auf die VerhûÑrprotokolle der Gestapo: Quellen, die zwar vorgeben, das zu berichten, was gewesen ist, die aber wenig Rû¥ckschlû¥sse auf die historische Figur zulassen und mûÑglicherweise VerfûÊlschungen enthalten. Wie im Leben bleibt Georg Elser im HûÑrspiel sprachlos. Seine Stimme û¥bernimmt die Zither, jenes Instrument, das er von 1926 an bis zu seinem Tod spielte. Die Textcollage stû¥tzt sich auf Aussagen von Zeitzeugen. Zu Wort kommen unter anderen die Kellnerin Maria Strobl, die am 9. November im Bû¥rgerbrûÊukeller servierte, Ermittler, die Elser verhûÑrten, Beamte, die û¥ber EntschûÊdigungen fû¥r die Familie entschieden, oder die Mutter Elsers, die sich bis zu ihrem Tod 1960 gegen die Darstellung des Theologen Martin NiemûÑllers wehrt, ihr Sohn sei nur ein Werkzeug der Nazis gewesen. Widersprû¥che in den Darstellungenô bleiben bestehen, die Ereignisse wurden unterschiedlich wahrgenommen und bewertet. // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 11.06.2012
Datum: 11.06.2012Länge: 00:51:46 Größe: 47.39 MB |
||
| Nikolai Vogel: Nach der Grenze - 03.06.2012 | ||
| Mit Nikolai Vogel und Peter Veit / Realisation: Nikolai Vogel / BR 2011 / LûÊnge: 49'26 // Zusammen mit der Malerin Silke Markefka suchte Nikolai Vogel zwischen Juli 2008 und Juli 2009 ehemalige Grenzposten zwischen Deutschland und seinen neun NachbarlûÊndern auf. Zwanzig Jahre nach dem Schengener Abkommen, in dem mehrere europûÊische Staaten die Aufgabe der Grenzkontrolle beschlossen haben, erforscht Vogel Stimmung, AtmosphûÊre und persûÑnliche Wahrnehmung dieser Orte. Zwanzig Jahre nach dem Schengener Abkommen, in dem mehrere europûÊische Staaten die Aufgabe der Grenzkontrolle beschlossen haben, erforscht Vogel Stimmung, AtmosphûÊre und persûÑnliche Wahrnehmung dieser Orte. Der Grenzverkehr, die Grenzkontrolle, der Grenzû¥bergang sind prûÊgende Eindrû¥cke unserer Kindheit. Jenseits der Grenzen begann das andere Land, der Urlaub, oft eine andere Sprache und andere WûÊhrung. Was sind sie heute? Lebendige Orte, Orte des Nirgendwo, verlassene PlûÊtze, Niemandsland? Sie verschwinden nach und nach, werden zurû¥ckgebaut oder verwahrlosen einfach, werden Ruinen. ûberkommene Symbole fû¥r den Territorialstaat. Vogel hat mit verschiedensten analogen AufzeichnungsgerûÊten die Grenzsituation akustisch festgehalten und seine Eindrû¥cke in einem assoziativen Text beschrieben. Die dafû¥r benutzten Bandmaschinen, TonbandgerûÊte, DiktiergerûÊte und Kassettenrekorder stammen ebenfalls aus einer verschwindenden Epoche. Wie die Grenzen haben auch diese AufzeichnungsgerûÊte die Zeit ihrer staatstragenden und amtlichen Bedeutung hinter sich. // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 03.06.2012
Datum: 03.06.2012Länge: 00:49:36 Größe: 45.42 MB |
||
| Joseph Roth: Das Spinnennetz (2/2) - 28.05.2012 | ||
| Mit Martin Carnevali, Norman Hacker, Lena Lauzemis, Bernd Moss, Steven Scharf, Thomas Thieme / Komposition: Jakob Diehl / Bearbeitung und Regie: Katja Langenbach / BR 2012 / LûÊnge: 54'00 // Joseph Roths erster Roman "Das Spinnennetz" beschreibt den unaufhaltsamen Aufstieg der Faschisten im Deutschland der 20er Jahre. Als enttûÊuschter Kriegsheimkehrer findet sich der ehemalige Leutnant Theodor Lohse nicht mehr zurecht. Zerbrochen sind seine TrûÊume vom militûÊrischen Triumph und seine Hoffnungen auf eine herausragende gesellschaftliche Bedeutung. Stattdessen lebt er in ûÊrmlichen VerhûÊltnissen als Jurastudent und Hauslehrer bei einem reichen jû¥dischen Juwelier in Berlin. Sein Ehrgeiz treibt ihn schnell in die Arme einer rechtsradikalen Geheimorganisation, fû¥r die er zunûÊchst als einer von vielen Spitzeln arbeitet. Endlich wieder einer klaren Fû¥hrung verpflichtet, geht er û¥ber Leichen, um seine Aufgaben zu erfû¥llen, û¥bereifrig, getrieben von der Angst vor der eigenen UnzulûÊnglichkeit und Kleinheit. Morde und militûÊrische Kameradschaftlichkeit, Denunziation, ideologiefreies Kalkû¥l und Paktieren mit politischen Gegnern sowie die Heirat in den deutschen Adel verschaffen ihm in der Folge eine Machtposition. Doch trotz seines gesellschaftlichen Aufstiegs findet Theodor keine Ruhe und leidet unter Verfolgungswahn. Angst und Selbstzweifel dominieren ihn bis zum Schluss, er wird nicht erlûÑst von dem ihn ewig quûÊlenden Ehrgeiz, unter dem eine groûe innere Leere liegt. Joseph Roth beschreibt mit Theodor Lohse und den ihn umgebenden Menschen die deutsche IdentitûÊtssuche nach dem 1. Weltkrieg. Theodor ist ein Mensch ohne Halt in einer Gesellschaft der radikalen GegensûÊtze zwischen Nationalsozialisten und Kommunisten, Bû¥rgertum, Adel und Proletariat, Hunger und ûberfluss, Militarismus und kultureller Avantgarde, Spitzelwesen und lautstarken nationalen Studentenbewegungen, Antisemitismus und aufkeimender Demokratie, zwischen GewalttûÊtigkeit und Amû¥sierlust, zwischen Fortschritt und Reaktion. In dieser verwirrenden, explosiven gesellschaftlichen Gemengelage glaubt Theodor letztlich an nichts und niemanden ã auûer an sich selbst und sein Emporkommen. Einzig entscheidend ist, auf der Seite der Gewinner zu stehen. So mausert sich Theodor Lohse zum wichtigen FunktionûÊr im sich anbahnenden nationalsozialistischen Deutschland. Das Spinnennetz erschien als Fortsetzungsroman vom 7.Oktober bis 6. November 1923 in der Wiener Arbeiterzeitung und nahm damit die Ereignisse des Hitlerputsches, der sich nur wenige Tage nach dem letzen Abdruck ereignete, auf prophetische Weise vorweg. // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 28.05.2012
Datum: 28.05.2012Länge: 00:54:10 Größe: 49.60 MB |
||
| Joseph Roth: Das Spinnennetz (1/2) - 27.05.2012 | ||
| Mit Martin Carnevali, Norman Hacker, Lena Lauzemis, Bernd Moss, Steven Scharf, Thomas Thieme / Bearbeitung und Regie: Katja Langenbach / BR 2012 / LûÊnge: 53'49 // Joseph Roths erster Roman Das Spinnennetz beschreibt den unaufhaltsamen Aufstieg der Faschisten im Deutschland der 20er Jahre. Als enttûÊuschter Kriegsheimkehrer findet sich der ehemalige Leutnant Theodor Lohse nicht mehr zurecht. Zerbrochen sind seine TrûÊume vom militûÊrischen Triumph und seine Hoffnungen auf eine herausragende gesellschaftliche Bedeutung. Stattdessen lebt er in ûÊrmlichen VerhûÊltnissen als Jurastudent und Hauslehrer bei einem reichen jû¥dischen Juwelier in Berlin. Sein Ehrgeiz treibt ihn schnell in die Arme einer rechtsradikalen Geheimorganisation, fû¥r die er zunûÊchst als einer von vielen Spitzeln arbeitet. Endlich wieder einer klaren Fû¥hrung verpflichtet, geht er û¥ber Leichen, um seine Aufgaben zu erfû¥llen, û¥bereifrig, getrieben von der Angst vor der eigenen UnzulûÊnglichkeit und Kleinheit. Morde und militûÊrische Kameradschaftlichkeit, Denunziation, ideologiefreies Kalkû¥l und Paktieren mit politischen Gegnern sowie die Heirat in den deutschen Adel verschaffen ihm in der Folge eine Machtposition. Doch trotz seines gesellschaftlichen Aufstiegs findet Theodor keine Ruhe und leidet unter Verfolgungswahn. Angst und Selbstzweifel dominieren ihn bis zum Schluss, er wird nicht erlûÑst von dem ihn ewig quûÊlenden Ehrgeiz, unter dem eine groûe innere Leere liegt. Joseph Roth beschreibt mit Theodor Lohse und den ihn umgebenden Menschen die deutsche IdentitûÊtssuche nach dem 1. Weltkrieg. Theodor ist ein Mensch ohne Halt in einer Gesellschaft der radikalen GegensûÊtze zwischen Nationalsozialisten und Kommunisten, Bû¥rgertum, Adel und Proletariat, Hunger und ûberfluss, Militarismus und kultureller Avantgarde, Spitzelwesen und lautstarken nationalen Studentenbewegungen, Antisemitismus und aufkeimender Demokratie, zwischen GewalttûÊtigkeit und Amû¥sierlust, zwischen Fortschritt und Reaktion. In dieser verwirrenden, explosiven gesellschaftlichen Gemengelage glaubt Theodor letztlich an nichts und niemanden ã auûer an sich selbst und sein Emporkommen. Einzig entscheidend ist, auf der Seite der Gewinner zu stehen. So mausert sich Theodor Lohse zum wichtigen FunktionûÊr im sich anbahnenden nationalsozialistischen Deutschland. Das Spinnennetz erschien als Fortsetzungsroman vom 7.Oktober bis 6. November 1923 in der Wiener Arbeiterzeitung und nahm damit die Ereignisse des Hitlerputsches, der sich nur wenige Tage nach dem letzen Abdruck ereignete, auf prophetische Weise vorweg. // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 27.05.2012
Datum: 27.05.2012Länge: 00:53:59 Größe: 49.43 MB |
||
| Thomas Harlan: Veit - 17.05.2012 | ||
|
Mit Thomas Thieme / Regie: Bernhard Jugel / BR 2011 / LûÊnge: 55'15 // "Ich bin der Sohn meiner Eltern. Das ist eine Katastrophe. Die hat mich bestimmt." Diese Aussage von Thomas Harlan, Sohn von Veit Harlan, dem Regisseur des antisemitischen Films "Jud Sû¥ss", fasst kurz und prûÊgnant zusammen, was ihn sein Leben lang bewegte, was ihn quûÊlte: unendliche Schuld und unendliche Scham. Fû¥r die Taten seines Vaters. Fû¥r die Shoah. Bis zu seinem Tod, am 16. Oktober 2010 in Berchtesgaden, hat Thomas Harlan immer aufs Neue versucht, verzweifelt, provokant, bisweilen aber auch bûÑsartig, sich dieses ãseines Erbesã zu entledigen, es analysierend abzustreifen, es von sich zu weisen. Dann aber, vom 31. Mai bis zum 4. Juni 2010, vier Tage ununterbrochen diktierend, sein letzter Brief, ein Brief an den Vater: ãSage, Vater, sage nicht, es kûÑnne niemand die Verantwortung fû¥r die Taten eines Dritten û¥bernehmen. Es kann. Sage, Vater, sage nicht, es kûÑnne niemand die Verantwortung fû¥r die Taten eines Dritten û¥bernehmen, der selbst keine Verantwortung fû¥r seine Taten zu haben denkt. Es kann.ã Thomas Harlans Veit ist ein VermûÊchtnis. Nicht allein sein Leben betreffend. Unser aller. Harlan legt den Finger tief in die deutsche Wunde, es gibt lûÊngst kein Entkommen mehr: ãWenn Du Deine Verantwortung nicht trûÊgst, gestehe ich sie mir ein, ich û¥bernehme sie an Deiner statt, auch wenn Du nicht willst, wenn Du Dich strûÊubst. Vater, strûÊube Dich nicht...ã "Veit" ist ein Klagegesang, ein Lamento, "Veit" ist aber auch Mitgefû¥hl: ãDu hast jahrelang gelitten unter Gewichten, die zu schwer waren fû¥r einen Menschen allein. Du warst ein Mensch allein.ã Und zugleich das unermû¥dliche Pochen auf die Wahrheit, unbarmherzige Bilanz: ãVerzeih, dass ich Dich vergessen hatte, dass ich Dir meine Treue entzog und meine Sohnesliebe, dass ich an Dir entlang ging, als seiest Du nur eine Landschaft, ein Abgrund, als hûÊtte ich verhû¥ten wollen, in ihn zu stû¥rzen, in Dir umzukommen. Ich bin in Dir umgekommen.ã
Wer Thomas Harlans verstûÑrende Romane "Rosa" (2000)und "Heldenfriedhof" (2006) gelesen, wer seinen grandiosen Film "Wundkanal" (1984) und auch "Notre Nazi" (1984) gesehen hat, weiû, dass er sich auch selbst nicht geschont hat: ãIch habe verhû¥tet, gerettet zu werden. Ich wurde nicht gerettet.ã So weit aber ist er noch nie gegangen: ãVater, Du Geliebter, Verstockter, hûÑre doch! Ich habe Deinen Film gemacht. Ich habe einen schrecklichen Film gemacht. Ich habe Jud Sû¥û gemacht. Ich habe das Scheusal Werner Krauss erfunden.ã Und am Ende: ãIch habe Dich geliebt. Lass mich Dein Sohn sein, Dein ûÊltester, lass mich. Dein Sohn.ã SpûÊt eingestanden, nachgetragen ist diese Liebe. Liebe als Hoffnung: denn sie allein verûÊndert die Welt, zum Guten. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 17.05.2012
Datum: 17.05.2012Länge: 00:55:25 Größe: 50.74 MB |
||
| Andreas Ammer/Gerhard Polt: Schliersee - 05.05.2012 | ||
| Mit Gerhard Polt, Andreas Ammer, Marcus Huber / Musik: Console, Nu mit Landlergschwister und Kofelgschroa / Realisation: Andreas Ammer / BR 2012 / LûÊnge: 45'47// Gerhard Polt lebt seit einigen Jahrzehnten am Schliersee und weiû deshalb, was man sah, als man frû¥her im Badehaus durch das Astloch gesehen hat und wo hier der beste Whiskey gebrannt und das grûÑûte Schnitzel serviert wird. LûÊsst sich eine Landschaft erzûÊhlen? Kann man einen See vertonen? Und wieso redet Gerhard Polt, der sein Geld mit reden verdient, eigentlich so ungern? // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 05.05.2012
Datum: 05.05.2012Länge: 00:45:23 Größe: 41.56 MB |
||
| Dieter Kû¥hn/Martin Sperr: Lemsomd - 27.04.2012 | ||
| Mit Therese Giehse / ûbertragung ins Bayerische und Regie: Martin Sperr / BR 1973 / LûÊnge: 45'37 // Therese Giehse mit dem Monolog einer alten Frau. Sie sitzt im Park des Altersheims auf der Bank und wird gesprûÊchig. Sie offenbart ihre EnttûÊuschungen û¥ber das triste Leben im Altersheim, ihr grundsûÊtzliches Misstrauen gegenû¥ber ihrer Umwelt und reflektiert û¥ber gesellschaftliche Fehlentwicklungen. Die Rede der alten Frau auch ein Anreden gegen Einsamkeit, gegen die Ungewissheit der Zukunft und gegen die Angst vor dem Sterben. // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 27.04.2012
Datum: 27.04.2012Länge: 00:45:47 Größe: 41.93 MB |
||
| Hartmut Geerken: fast nûÊchte (Maûnahmen des Verschwindens: Eine Exil-Trilogie) - 20.04.2012 | ||
| Mit Leo Bardischewski, Max Mannheimer, Hartmut Geerken, Heinz-Ludwig Friedlaender, Heinrich August Geerken / Realisation: Hartmut Geerken / BR 1992 / LûÊnge: 76'00 // Nach ungesichteten Schriften aus dem Nachlass von Mynona. Man schreibt die Jahre 1941 bis 1945. Seit Jahren hat Salomo Friedlaender (1872-1946) alias Mynona seine Wohnung nicht mehr verlassen. Stuben-Arrest. Einen ganzen Winter verbringt er im Bett, weil das Heizmaterial fehlt. Aber die Hauptgrû¥nde der Isolation sind seine schlimme asthmatische Verfassung, die dauernde Gefahr der Deportation in ein Vernichtungslager im Osten und die verschlissene Kleidung, in der er nicht mehr unter die Leute will. Die knisternde Monotonie dieser 'Gefangenschaft' ist die eine Stimmung des HûÑrspiels. Die andere ist der Fasching. Kein richtiger Fasching, sondern ein verdrûÊngter, eine groteske, brutale 'Fast Nacht'. So nûÊmlich lautet der Titel einer seiner bitterbûÑsen Geschichten, die im HûÑrspiel ungekû¥rzt von einem ehemaligen Dachauer KZ-HûÊftling (Max Mannheimer) gelesen wird. Die HûÑrspielfassung der Geschichte wurde aus Aufzeichnungen aus dem Nachlass restituiert. In polaristischer Entsprechung zu dem Text 'Fast Nacht' liest ein unverbesserlicher 93jûÊhriger Nazi, es ist der Vater des Autors, Namen von HûÊftlingen, Konzentrationslagern und Listen von HûÊftlingsnummern aus 'Kalendarium der Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau 1939-1945'. // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 20.04.2012
Datum: 20.04.2012Länge: 01:16:08 Größe: 52.32 MB |
||
| Ulrike Ottinger: Unter Schnee (2/2) - 09.04.2012 | ||
| Mit Hanns Zischler, Yumiko Tanaka, Yuko Takemichi, Beate HundsdûÑrfer, Dietmar Herriger, Yoko Tawada, Hiroomi Fukuzawa, Norio Takasugi, Yasutsugu Shichi, Sumio Suga / Komponistin und Interpretin fû¥r Shamisen: Yumiko Tanaka / Regie: Ulrike Ottinger / BR 2012 / LûÊnge: 54'38 // Das HûÑrspiel erzûÊhlt die poetische Geschichte von Takeo und Mako, zweier Studenten, die ihre Neujahrsferien im Schneeland verbringen wollen. Auf ihrer beschwerlichen Reise durch Echigo gelangen sie in ein einsames Haus aus der Edo-Zeit. Da begegnen sie der wunderschûÑnen Schneefrau und dem ebenso schûÑnen Geist einer Fû¥chsin. Yuki-Onna, die Schneefrau, verliebt sich in den hû¥bschen, jungen Studenten Mako und raubt ihm mit ihrem Eishauch das Bewusstsein, um ihn in ihren Schneepalast zu entfû¥hren. Aber die schûÑne Fû¥chsin, die den jungen Gelehrten Takeo begehrt, hat sich des bereits erstarrten KûÑrpers Makos bedient, um sich in eine liebreizende Hofdame der Edo-Zeit zu verwandeln. Am nûÊchsten Morgen beginnen Takeo und die Fû¥chsin ihre Reise durch die Vergangenheit, wobei Ihnen die Gegenwart immer wieder begegnet. Dabei treffen sie Bauern, die ihre DûÊcher mit groûen Schaufeln vom Schnee befreien und Frauen, die aus feinsten FlachsfûÊden lange Bahnen von Krepp weben. Sie hûÑren Geschichten aus vergangenen Tagen und wohnen Ritualen bei, die in Echigo auch heute noch zur gelebten Tradition gehûÑren. Aus gesammelten OriginaltûÑnen und der fiktiven ErzûÊhlung um das Paar aus der Edo-Zeit, musikalisch begleitet von BambusflûÑten, japanischen Trommeln und dem Gesang zum Shamisen-Spiel Yumiko Tanakas, erschafft Ulrike Ottinger eine atmosphûÊrisch dichte Montage. // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 09.04.2012
Datum: 09.04.2012Länge: 00:54:47 Größe: 50.17 MB |
||
| Ulrike Ottinger: Unter Schnee (1/2) - 08.04.2012 | ||
| Mit Hanns Zischler, Yumiko Tanaka, Yuko Takemichi, Beate HundsdûÑrfer, Dietmar Herriger, Yoko Tawada, Hiroomi Fukuzawa, Norio Takasugi, Yasutsugu Shichi, Sumio Suga / Komponistin und Interpretin fû¥r Shamisen: Yumiko Tanaka / Regie: Ulrike Ottinger / BR 2012 / LûÊnge: 52'24 // Das HûÑrspiel erzûÊhlt die poetische Geschichte von Takeo und Mako, zweier Studenten, die ihre Neujahrsferien im Schneeland verbringen wollen. Auf ihrer beschwerlichen Reise durch Echigo gelangen sie in ein einsames Haus aus der Edo-Zeit. Da begegnen sie der wunderschûÑnen Schneefrau und dem ebenso schûÑnen Geist einer Fû¥chsin. Yuki-Onna, die Schneefrau, verliebt sich in den hû¥bschen, jungen Studenten Mako und raubt ihm mit ihrem Eishauch das Bewusstsein, um ihn in ihren Schneepalast zu entfû¥hren. Aber die schûÑne Fû¥chsin, die den jungen Gelehrten Takeo begehrt, hat sich des bereits erstarrten KûÑrpers Makos bedient, um sich in eine liebreizende Hofdame der Edo-Zeit zu verwandeln. Am nûÊchsten Morgen beginnen Takeo und die Fû¥chsin ihre Reise durch die Vergangenheit, wobei Ihnen die Gegenwart immer wieder begegnet. Dabei treffen sie Bauern, die ihre DûÊcher mit groûen Schaufeln vom Schnee befreien und Frauen, die aus feinsten FlachsfûÊden lange Bahnen von Krepp weben. Sie hûÑren Geschichten aus vergangenen Tagen und wohnen Ritualen bei, die in Echigo auch heute noch zur gelebten Tradition gehûÑren. Aus gesammelten OriginaltûÑnen und der fiktiven ErzûÊhlung um das Paar aus der Edo-Zeit, musikalisch begleitet von BambusflûÑten, japanischen Trommeln und dem Gesang zum Shamisen-Spiel Yumiko Tanakas, erschafft Ulrike Ottinger eine atmosphûÊrisch dichte Montage. // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 08.04.2012
Datum: 08.04.2012Länge: 00:52:34 Größe: 48.13 MB |
||
| Alexander Kluge: Chronik der Gefû¥hle - Verwilderte Selbstbehauptung - 30.03.2012 | ||
|
Mit Alexander Kluge, Wolfgang Hinze, Ilja Richter, Hanns Zischler, Nico Holonics, Peter Fricke, Helmut Stange, Christian Friedel, Hannelore Hoger, Sandra Hû¥ller, Monika Manz, Joseph Vogl und Christoph Schlingensief / Musik: Lydia Daher sowie die Solisten des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks / Regie: Karl Bruckmaier / BR 2009 / LûÊnge: 52'03 // Das HûÑrspiel folgt der Struktur der im Jahr 2000 bei Suhrkamp erschienen Chronik der Gefû¥hle - Basisgeschichten und LebenslûÊufe. Jedem Teil steht ein Minutensong voran, in dem ein Kluge-Zitat zu Techno, Electro oder Pop verarbeitet wurde.
"In uns sitzt ETWAS, das will spielen. Noch hûÊlt dieses ETWAS die strenge (und vertrauenswû¥rdige) EINSICHT aus: wir Menschen seien in den Krallen der Vorgeschichte gefangen und der Weg zur Emanzipation fû¥hre durch alle HûÑllen der Vergangenheit. Dieses ETWAS gilt als 'verwildert'. Und es behauptet sich selbst." // |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 30.03.2012
Datum: 30.03.2012Länge: 00:52:14 Größe: 47.82 MB |
||
| Alexander Kluge: Chronik der Gefû¥hle - Schlachtbeschreibung - 23.03.2012 | ||
| Mit Alexander Kluge, Wolfgang Hinze, Ilja Richter, Hanns Zischler, Johannes Herrschmann, Nico Holonics, Peter Fricke, Helmut Stange, Christian Friedel, Hannelore Hoger, Sandra Hû¥ller, Monika Manz, Oskar Negt, sowie Peter Nier, Wolfgang Beyer, Wolfgang Braetsch, Maria Pia Corvino / Musik: Schorsch Kamerun sowie Solisten des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks / Bearbeitung und Regie: Karl Bruckmaier / BR 2009 LûÊnge: 50'31// Die Geschichten in "Schlachtbeschreibung" (1964) beschreiben den organisatorischen Aufbau eines Unglû¥cks: die Katastrophe der 6. Armee in der Schneewû¥ste von Stalingrad. Folgende Einrichtungen und Sammlungen wurden benutzt: Institut fû¥r Zeitgeschichte, Mû¥nchen; Bundesarchiv; Berichte von Rû¥ckkehrern; privat zur Verfû¥gung gestellte Befragungen; Funksprû¥che und Aktenunterlagen. Die Aussagen der Praktiker (Offiziere, Soldaten, ûrzte) entsprechen authentischen Befragungen. Insofern kûÑnnen sie dokumentarisch belegt werden. Die Szenen werden dadurch nicht dokumentarischer. Wer in Stalingrad etwas sah, Aktenvermerke schrieb, Nachrichten durchgab, Quellen schuf, stû¥tzte sich auf das, was zwei Augen sehen kûÑnnen. Ein Unglû¥ck, das eine Maschinerie von 300.000 Menschen betrifft, ist so nicht zu erfassen. Von 300.000 Menschen, die unmittelbar beteiligt waren, gingen etwa 86.000 in Gefangenschaft, nur 5.000 kehrten nach Hause zurû¥ck. Sie wurden wenig befragt. In der Erstausgabe von Schlachtbeschreibung waren sûÊmtliche historischen Namen abgekû¥rzt, z. B. St. = Stalingrad, Hi. = Hitler. Dies war ein Versuch, zu einer Enthierarchisierung der Tatsachen zu gelangen. Wegen des zeitlichen Abstands habe ich inzwischen eine Reihe der Abkû¥rzungen wieder geûÑffnet. Das Schlimmste an einem Unglû¥ck ist, dass es die Nachricht ohne Botschaft mit sich nimmt. (Alexander Kluge) // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 23.03.2012
Datum: 23.03.2012Länge: 00:50:42 Größe: 46.42 MB |
||
| Alexander Kluge: Chronik der Gefû¥hle - Heidegger auf der Krim - 16.03.2012 | ||
| Mit Alexander Kluge, Hanns Zischler und Helmut Stange / Musik: Lali Puna sowie Solisten des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks / Bearbeitung und Regie: Karl Bruckmaier / BR 2009 / LûÊnge: 51'28 // "Das Denken und die Lebenspraxis." Suche nach Auswegen im erfundenen Ernstfall. Eine Gruppe von UniversitûÊtslehrern wird 1941, unmittelbar nach Einnahme der Krim, ins Frontgebiet geflogen. Ihre Aufgabe ist die Sicherung und Bestandserhaltung von Kulturgû¥tern. Mit dabei ist der Philosoph Martin Heidegger: "Ich sehe die (fachmûÊnnisch sehr exakt hergestellte) Exekution, 2. Kompanie der Ohlendorfschen Einheit. Eine ordentlich angetretene Schlange von Menschen. In gewissen zeitlichen AbstûÊnden werden Gruppen von 12 bis 16 dieser Menschen auf Lastkraftwagen verladen und abtransportiert. Dies ist die Exekution. Die Hinrichtung selbst ã wie ich hûÑre, in einer Schlucht in etwa 13 km Entfernung ã vollzieht sich nichtûÑffentlich. Dann ist die Abschreckungswirkung nicht gegeben, sage ich. Eine kleinwû¥chsige, dunkelûÊugige Frau hat eine Kinderhand in meine gelegt und ich habe zugegriffen. Das ist eine peinliche Lage. Zugleich hûÊtte ich es als peinlich empfunden, das Kind einer Wache zu û¥bergeben oder in die Schlange zurû¥ckzufû¥hren." Heidegger betrachtet das ihm anvertraute Kind als "ûbungsfall" und spielt die MûÑglichkeiten seiner Rettung in Gedanken durch. "KûÑnnte der Gelehrte das UnmûÑgliche sichern? KûÑnnte er eingreifen?" // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 16.03.2012
Datum: 16.03.2012Länge: 00:51:39 Größe: 47.29 MB |
||
| Alexander Kluge: Chronik der Gefû¥hle - Basisgeschichten - 09.03.2012 | ||
|
Mit Alexander Kluge, Wolfgang Hinze, Ilja Richter, Hanns Zischler, Johannes Herrschmann, Helmut Stange, Christian Friedel, Hannelore Hoger, Sandra Hû¥ller / Musik: Die Tû¥ren / Bearbeitung und Regie: Karl Bruckmaier / BR 2009 / LûÊnge: 54'10 // "Die Basisgeschichten handeln von Menschen, die nach ihrem Platz in der Welt suchen. Basis der Geschichten sind die zwischenmenschlichen Beziehungen. Die sind nicht immer leicht, sondern oft traurig, tragisch oder tûÑdlich.
Montaigne, Seneca und Heiner Mû¥ller vergleichen das Leben mit einer Schiffsreise. Wo sind StrandrûÊuber zu vermuten? Wo gibt es Leuchtfeuer? Eine Errungenschaft der franzûÑsischen Revolutionsarchitektur war der Entwurf eines Leuchtturms fû¥r Wanderer in der Wû¥ste", schreibt Alexander Kluge. Menschen suchen nach ihrem Platz in der Welt. Wo finden sie Orientierung? Wem kûÑnnen sie vertrauen? Alexander Kluge setzt auf das VerhûÊltnis zwischen Autor und Wirklichkeit: "Bû¥cher, das ist fû¥r mich nicht das bedruckte Papier. Sie sind Landkarten menschlicher Erfahrung. Fû¥r mich selbst sind Bû¥cher die Verbindung zu Autoren, zu deren Texten ich Vertrauen habe ã zu Heiner Mû¥ller, Gottfried Benn, Ingeborg Bachmann, zu Proust, Joyce, Robert Musil, zu Kleist, Montaigne bis hin zu Ovid. Das ist wie ein zweites Gemeinwesen. In einer Zeit, in der wir nicht wissen, wie rissfest die Wirklichkeiten sind, sind Netzwerke û¥ber 2000 Jahre, wie sie die Bû¥cher darstellen, kein Luxus, kein Freizeitbedarf, sondern notwendiges ûberlebensmittel." // |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 09.03.2012
Datum: 09.03.2012Länge: 00:54:20 Größe: 49.75 MB |
||
| Alexander Kluge: Chronik der Gefû¥hle - Verfallserscheinungen der Macht - 02.03.2012 | ||
| Mit Alexander Kluge, Wolfgang Hinze, Ilja Richter, Hanns Zischler, Nico Holonics, Peter Fricke, Helmut Stange, Christian Friedel, Hannelore Hoger, Monika Manz, Volker SchlûÑndorff / Musik: Abe Duque sowie Solisten des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks / Regie: Karl Bruckmaier / BR 2009 / LûÊnge: 53'42 // Das HûÑrspiel folgt der Struktur der im Jahr 2000 bei Suhrkamp erschienen Chronik der Gefû¥hle - Basisgeschichten und LebenslûÊufe. Jedem Teil steht ein Minutensong voran, in dem ein Kluge-Zitat zu Techno, Electro oder Pop verarbeitet wurde. "Was geschieht im Inneren der Menschen, wenn groûe Reiche zusammenbrechen? LebenslûÊufe verlaufen û¥ber solche Bruchstellen. Ein Staat stirbt ab, ein Gemeinwesen nicht." Kluges Motivation ist nicht Theodor W. Adornos Leitsatz "Es gibt kein richtiges Leben im falschen", sondern dessen weniger bekannte Aussage: "Man darf sich weder von der Macht der anderen noch von der eigenen Ohnmacht dumm machen lassen." // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 02.03.2012
Datum: 02.03.2012Länge: 00:53:52 Größe: 49.33 MB |
||
| Alexander Kluge: Chronik der Gefû¥hle - Der Eigentû¥mer und seine Zeit - 24.02.2012 | ||
| Mit Alexander Kluge, Wolfgang Hinze, Ilja Richter, Hanns Zischler, Johannes Herrschmann, Nico Holonics, Christian Friedel, Hannelore Hoger, Sandra Hû¥ller, Wim Wenders / Musik: David Grubbs sowie die Solisten des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks / Bearbeitung und Regie: Karl Bruckmaier / BR 2009 / LûÊnge: 53'19 // "Menschen haben zweierlei Eigentum: ihre Lebenszeit, ihren Eigensinn. Davon handeln die folgenden Geschichten." Kann man ohne Hoffnung irgend etwas finden? Wie lassen sich 0,0001% der Lebenszeit darstellen, oder 500.000 DM Investition auf 1 g KûÑrpergewicht? Es geht um LebensgrundsûÊtze am Schwarzen Freitag, Heiner Mû¥ller und die 'Gestalt des Arbeiters' und GûÑtterdûÊmmerung in Wien: Alexander Kluge lûÊsst Wiens Gauleiter Baldur von Schirach im MûÊrz 1945 ã in aussichtsloser Lage und nachdem die Oper abgebrannt ist ã das Orchester in verschiedenen Luftschutzkellern der Stadt Wagners GûÑtterdûÊmmerung weiterproben. Der Rundfunk Salzburg weigert sich, die aus ungleichen Fragmenten zusammengebaute Aufnahme zu û¥bertragen und spielt bis zur ûbergabe der Stadt nur noch MûÊrsche. Vergessene Filmaufzeichnungen der Orchestergruppen tauchen Jahrzehnte spûÊter wieder auf und begeistern Mitarbeiter der Cahiers du Cinema. Kunst ist fû¥r Alexander Kluge das Finden eines Schatzes von solcher Ausdruckskraft, auch wenn er erfunden ist. Das Kapitel GûÑtterdûÊmmerung in Wien ist dem Dramatiker Heiner Mû¥ller gewidmet und wird mit einem Zitat Mû¥llers zur "grausamen SchûÑnheit einer Opernaufzeichnung" eingeleitet: "Was nicht gebrochen wird, kann nicht gerettet werden." // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 24.02.2012
Datum: 24.02.2012Länge: 00:53:29 Größe: 48.98 MB |
||
| Karl Bruckmaier: Alexander Kluge - ein Portrait - 18.02.2012 | ||
| Mit Alexander Kluge, Gabriel Raab / Realisation: Karl Bruckmaier / BR 2012 / LûÊnge: 73'23 // Mit dem Ich geht er knausrig um - Alexander Kluge, geb. 1932 in Halberstadt. Jurist, Autor, Filmemacher. TrûÊger fast aller wichtigen Film- und Literaturpreise. Zeitgenosse. Sein Ich tritt meist hinter oder neben die Kamera, wendet sich einem Thema oder einem Gast zu, stellt Fragen. Kann Antworten kaum erwarten. DrûÊngelt ein wenig. Nimmt sich wieder zurû¥ck. Ist aber nie im Bild, ist bloû stets im Bilde. Manchmal fû¥llt das Ich eine halbe Seite in einem von Kluges umfangreichen Bû¥chern, muss erzûÊhlen von kaputten Tretautos oder der englischen Verwandtschaft, um ein wenig Entspannung zu generieren, etwas Vertrauen zu schaffen, NûÊhe. Nicht, dass dieses Ich scheu wûÊre, im Gegenteil, kûÊmpferisch und offensiv und hartnûÊckig kann es sein, fordernd ã aber es ist nicht eitel. Das hat dieses Ich nicht nûÑtig. Nun sind im Lauf der fû¥nf Jahrzehnte, in denen Alexander Kluge das ûÑffentliche Leben der Bundesrepublik ûÊsthetisch wie politisch mit gestaltet hat, nicht wenige Versuche unternommen worden, diesem so prûÊsenten und einflussreichen Ich ein klein wenig nûÊher zu kommen. Und Kluge antwortet gern; er versteckt und ziert sich nicht, nicht in Interviews, in Filmen, nicht im Netz. Und doch hat man stets das Gefû¥hl, dass da noch mehr sei ã vielleicht liegt es daran, dass man Alexander Kluge so gerne zuhûÑrt, seiner weichen Stimme mit dem zarten Nachhall seiner Heimat Halberstadt, vielleicht liegt es an seiner Freundlichkeit und an seiner kaum zu bûÊndigenden Neugier, die ansteckend wirkt. Der Regisseur und Autor Karl Bruckmaier hat seit 2009 immer wieder mit Alexander Kluge an inzwischen fast 16 Stunden HûÑrspiel nach Kluges Texten gearbeitet. Dabei wurden GesprûÊche û¥ber inhaltliche Details wie auch Kluges generelle Weltsicht integraler Bestandteil dieser vom BR produzierten HûÑrspiele. Aus dieser langsam gewachsenen GesprûÊchsbeziehung entstand die Idee, entlang kurzer autobiografischer Notizen aus Kluges Werk der gesamten Lebenslinie dieses Mannes zu folgen und Kluge zu ermûÑglichen, ein Selbstportrait von sich zu zeichnen aus Worten und Gefû¥hlen ã und dem HûÑrer die MûÑglichkeit zu geben, dieser gewinnenden Stimme ausgiebig zu lauschen, wenn sie sagt: "Ich". // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 18.02.2012
Datum: 18.02.2012Länge: 01:13:33 Größe: 67.34 MB |
||
| Katharina Franck: Nazarûˋ - nicht die Stadt, die Frau (Eine nicht ganz erfundene Biografie) - 12.02.2012 | ||
|
Mit Katharina Franck / Komposition: Nuno Rebelo / Regie: Katharina Franck / BR 2007 / LûÊnge: 48'59 // Maria de Nazarûˋ Lima Tavares, ein 11jûÊhriges BauernmûÊdchen, kommt als Angestellte in das Haus eines Ministerrates. Dort schuftet sie Tag und Nacht, schlûÊft mit den anderen Bediensteten im Stehen, putzt Bilderrahmen mit Pinseln. Sooft wie mûÑglich leiht sie sich heimlich Bû¥cher in der hauseigenen Bibliothek und liest diese auf der Toilette und kommt dort zu der Erkenntnis, "dass es sich nicht lohnt, fû¥r eine Idee zu sterben, fû¥r eine Liebe, ein Traumhaus im Wert von einer Million." In mehreren HûÊusern dient sie, und so autonom ihre Gedanken klingen, so geborgen fû¥hlt sie sich in der Korrektheit der feinen Familien. Doch das Gedankengut der Revolution in Portugal dringt auch hinter die dicken Mauern der Anwesen und lûÊsst Nazarûˋ nicht unberû¥hrt.
ãNieder mit den Kapitalisten! Den Groûgrundbesitzern! Nieder mit dem Adel! Den Privilegierten! Den verwûÑhnten Bengeln! Und den schnippischen GûÑren! Es lebe die Kommunistische Partei Portugals!ã Aufgerieben zwischen Dienst im Haushalt und Dienst an der Nation endet Nazarûˋs Leben schlieûlich unrevolutionûÊr: ãIch gehe nach Hause. Ich bin mû¥de und mache kein Licht. Ich stolpere û¥ber einen Draht. Eine Granate explodiert. Sie zerreiût mich in Stû¥cke. Peng!ã In "Nazarûˋ ã nicht die Stadt, die Frau" verwebt Katharina Franck erlebte, recherchierte und erfundene Erinnerungen, die in anderen Leben, an anderen Orten und auch gleichzeitig zu passieren beginnen. Die HûÑrspiel-Biografie eines portugiesischen DienstmûÊdchens vor dem Hintergrund der sogenannten Nelkenrevolution von 1974 ist die erste kû¥nstlerische Zusammenarbeit von Katharina Franck mit dem Komponisten Nuno Rebelo. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 12.02.2012
Datum: 12.02.2012Länge: 00:49:18 Größe: 33.89 MB |
||
| Erste Erde Forum: III. Urknall, Gravitationsphysik, Galaxien - Mit Alexander Unzicker - 10.02.2012 | ||
| Raoul Schrott (Dichter) im GesprûÊch mit dem Gehirnforscher und Lehrer Alexander Unzicker | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 10.02.2012
Datum: 10.02.2012Länge: 00:44:53 Größe: 41.10 MB |
||
| Andreas Ammer / Saam Schlamminger: Sehe Dich Istanbul, meine Augen geschlossen - 10.02.2012 | ||
| Mit Feridun Zaimoglu, Sezer Duru, Ahmed Dogan, Sema Moritz, Sû¥ren Asatryan, Birol Topaloglu, Necati Tû¥feng / Komposition und Realisation: Andreas Ammer/Saam Schlamminger / BR 2008 / LûÊnge: 50'13 // Electric Field Recordings. Andreas Ammer und der in Istanbul geborene und in Mû¥nchen lebende, iranischstûÊmmige Musiker Saam Schlamminger haben sich mit ihren AufnahmegerûÊten in die Straûen von Istanbul begeben. Sie haben Musiker getroffen, die Mitte der Welt gefunden und Material nach Hause gebracht, das fern jeder Weltmusik ist. Sie erzûÊhlen von Kindheitserinnerungen an die Stadt, vom Alltagsleben in Istanbul und von dem stûÊndigen GerûÊuschbett, dem man sich nicht entziehen kann. Und sie trafen den tû¥rkischstûÊmmigen Autor Feridun Zaimoglu, der ihnen die Geschichte einer groûen Liebe in Istanbul erzûÊhlte. Ammer und Schlamminger bilden auf ihrer Reise durch Istanbul die LûÊrmkulisse der Stadt in stûÊndiger GerûÊusch- und Musikbegleitung ab. Die Rhythmen Schlammingers mischen sich mit dem PlûÊtschern der Wellen ans Ufer, dem Kreischen der MûÑwen, dem Stimmengewirr auf einem Marktplatz und entsprechen so akustisch der AtmosphûÊre der Stadt. // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 10.02.2012
Datum: 10.02.2012Länge: 00:50:23 Größe: 46.13 MB |
||
| Kathrin RûÑggla: die unvermeidlichen - 05.02.2012 | ||
| Mit Philipp Hauû, Jû¥rgen Wink, Eva Brunner, Felix von Manteuffel, Kirsten Hartung, Bettina Kurth / Realisation: Leopold von Verschuer / Komposition: Bo Wiget / BR 2012 / LûÊnge: 48'59 // Simultanû¥bersetzer. Eingepfercht in kleine Kabinen, abgeriegelt von den konferierenden Massen, einzig bestû¥ckt mit KopfhûÑrer, Mikrofon und RûÊuspertaste. "die finanzkrisenkonferenz, die atomendlagerkonferenz, die erneuerbaren energien, die migrationskonferenz, der klimawandel, die transitfrage, die defizitkonferenz, die sicherheitskonferenz, noch eine sicherheitskonferenz, eine weitere, eine bildungsnotstandskonferenz", alles in nur einer Woche, international und global, da kann schon mal ein Notstand entstehen, ein VerstûÊndigungsnotstand. Wenn in vielen Sprachen gesprochen und das Gesprochene verstanden werden und das Verstandene zu einem Konsens und der Konsens zu einem Ergebnis und das alles fû¥r alle immer und wieder verstûÊndlich sein mussãÎ dann kommt man an ihnen einfach nicht vorbei: Simultanû¥bersetzer. Sechs Dolmetscher sitzen û¥ber dem politischen Einigungsgeschehen, das sie begleiten, ja, erst mûÑglich machen, oder folgen EntscheidungstrûÊgern durch Flure zu sogenannten HinterzimmergesprûÊchen. In "die unvermeidlichen" spiegelt sich in den FlurgesprûÊchen der Simultanû¥bersetzer die Welt der Groûen im Kleinen. Wo die Franzosen ganz gut mit den EnglûÊndern, wo die Russen einzelkûÊmpferisch, aber integrativ und die Chinesen gefûÊhrlicherweise noch immer unterschûÊtzt werden. Wo die Routine der Dauerkonferierenden zur Routine der Dauerû¥bersetzenden wird. Sie alle trûÊumen vom Triumphzug der kompromisslosen Einstimmigkeit û¥ber den ewigen Minimalkonsens. Von einer Konferenz der klaren Ansagen. Stattdessen verfolgen sie eine Konferenz der wachsenden Sprachlosigkeit. Das Fehlen der Sprache zersetzt nach und nach die Wahrnehmung der ûbersetzendenãÎ "kû¥rzlich habe ich einmal gelesen, wie wir und die sicherheitsleute vom protokoll genannt werden ãÎ die unvermeidlichen!" // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 05.02.2012
Datum: 05.02.2012Länge: 00:49:09 Größe: 45.00 MB |
||
| Michael Lentz: Die ganz genaue Erinnerung - 03.02.2012 | ||
|
Mit Uli Winters, Sophia Siebert, Axel Kû¥hn, Michael Lentz / Komposition: Gunnar Geisse/Axel Kû¥hn / Realisation: Michael Lentz / BR 2010 / LûÊnge: 69'25 // Deutschland in den Siebzigern. Oder war es in den Achtzigern? Tatort und Didi Hallervorden. Ein Unfall im SûÊgewerk. Ulis Lebensfreund ringt mit dem Tod: CûÑppecus, eine Plastikfigur aus dem Kaugummiautomaten. Kommt CûÑppecus von KûÑpper, oder hieû der Nachbar so? Grottli, Philipp, der Opa, das Schwein, weitere Helden aus der Schar der Namenlosen. 125 Puppen zûÊhlt der Puppenstaat. Oder 238. RegelmûÊûig werden Wahlen durchgefû¥hrt. Eine Familie in der Familie. Mit eigenen Wohnungen, einem Schrottplatz und besagtem SûÊgewerk. Die mit der Zeit kûÑrperlich allesamt versehrten Puppen û¥bernehmen das Regime. Kein Weg und keine Stimme fû¥hrt mehr an ihnen vorbei. Alle mû¥ssen dauernd essen. Alle haben dauernd etwas zu kommentieren, etwas auszusetzen, alle beanspruchen die ganze Aufmerksamkeit.
Uli nennt seinen Vater immer nur Urmensch, weil er so aussieht. Die Mutter heiût Hund, wegen ihrer Frisur. Ulis Vater ûÊhnelt sehr dem CûÑppecus. Und umgekehrt. Kommuniziert wird meistens û¥ber die Puppen. Und dann wird die ganze Bande in einem hollûÊndischen Restaurant vergessen. Oder nur Grottli, der Troll aus Norwegen? Ein tûÑdlicher Verlust droht. Der Vater zûÑgert: fast 100 Kilometer zurû¥ckfahren? Der Vater zûÑgert û¥berhaupt nicht, sondern fûÊhrt û¥ber 100 Kilometer zurû¥ck. Die Mutter erinnert sich, dass sie daraufhin die OberhûÊupter des Puppenstaats auf Geheiû von Urmensch verschwinden lieû. Uli kann sich das û¥berhaupt nicht vorstellen. Das wûÊre auch jetzt noch, vierzig Jahre spûÊter, ein totaler Vertrauensbruch. Oder dreiûig Jahre spûÊter? Oder ist Uli eine Erinnerung von Grottli und Konsorten? Wie hat CûÑppecus den Unfall erlebt? Die ganz genaue Erinnerung gibt es nur in der Erinnerung. Die jedes Mal eine andere ist. Uli erzûÊhlt seine Geschichte. Aber ist es noch seine Geschichte? Und die Stimmung von damals? Am besten mit Musik. So klingt der Unfall im SûÊgewerk, so klingt Erinnerung. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 03.02.2012
Datum: 03.02.2012Länge: 01:09:44 Größe: 63.89 MB |
||
| Erste Erde Forum: II. Kosmologie, Riesenteleskope und observierende Astronomie - Mit Jochen Liske - 03.02.2012 | ||
| Raoul Schrott (Dichter) im GesprûÊch mit dem Astronom Jochen Liske | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 03.02.2012
Datum: 03.02.2012Länge: 00:52:38 Größe: 48.20 MB |
||
| Katrin Seybold/Michael Farin: Wagnis Weiûe Rose: Ihr Geist lebt weiter - 29.01.2012 | ||
| Mit den Zeugen Lieselotte Dreyfeldt-Hein, Gerda Freise, Valentin Freise, Traute Lafrenz-Page, Marie-Luise Schultze-Jahn, Jû¥rgen Wittenstein sowie Katja Bû¥rkle, Julia Loibl, Tobias Schormann / Komposition: zeitblom / Realisation: Katrin Seybold/Michael Farin / BR 2012 / LûÊnge: 50'15 // Die Weiûe Rose und deren Widerstand in der NS-Zeit werden hûÊufig nur mit den Geschwistern Scholl gleichgesetzt, doch waren Menschen in ganz Deutschland aktiv. Bald nach dem Tod Christoph Probsts und der Geschwister Scholl blieben die FlugblûÊtter in der Welt. Studenten am Mû¥nchner Chemischen Institut vervielfûÊltigten sie, sie gingen von Hand zu Hand. Es folgten weitere Prozesse des Volksgerichtshofs, es gab Tote und Ende 1943 werfen die britischen Flugzeuge Hunderttausende des 6. Flugblatts û¥ber Deutschland ab. Die FlugblûÊtter der Weiûen Rose wurden zumeist, wo immer sie auch auftauchten, weiter gereicht, abgeschrieben, vervielfûÊltigt, und es wurde begeistert darû¥ber diskutiert. Warnungen von Eltern und Lehrern schlugen die Jugendlichen in den Wind. Traute Lafrenz-Page, die Freundin von Hans Scholl, brachte im November 1942 ein Flugblatt nach Hamburg und schickte mit der Post ein anderes nach. Hans Leipelt, Mitglied des Ulmer Freundeskreises und zum Tod verurteilt, brachte Ostern 1943 mit Marie-Luise Schultze-Jahn das sechste und letzte nach Hamburg. Im DokumentarhûÑrspiel Wagnis Weiûe Rose kommen neben Briefen und FlugblûÊttern, gelesen von jungen Schauspielern, vor allem diejenigen Zeugen zu Wort, die FlugblûÊtter weiter verbreiteten, die Gestapohaft und Volksgerichtshof û¥berstanden. Im Zusammenhang mit der Arbeit am Dokumentarfilm Die WiderstûÊndigen / Zeugen der Weiûen Rose von Katrin Seybold wurden mit ihnen in den Jahren 2000 bis 2004 zahlreiche Interviews gefû¥hrt. Es sind Erinnerungen der Beteiligten, nach 60 Jahren, es sind Mosaiksteine, Facetten des Widerstands der Weiûen Rose aus heutiger Sicht. Alle Zeugen sprechen û¥ber ihre Gefû¥hle, ihre ûngste und Taten, stellen den verlogenen Gestapoprotokollen, den widerwûÊrtigen Anklageschriften, die wohlbehalten in unseren Archiven liegen, ihre Sicht der Dinge entgegen. Eine subjektive Sicht, die aber mûÑglicherweise spannender und vorbildhafter ist, als die von BeschûÑnigung, verantwortungslosem Wegschauen und Manipulation geprûÊgten Berichte, mit denen die nachfolgende Generation aufgewachsen ist. Fû¥r ihren Mut und ihre Opferbereitschaft ernteten die meisten der Befragten nichts, bis heute bleibt die Anerkennung der breiten ûffentlichkeit versagt, fast niemand kennt ihre Namen ã es sind bisher ungehûÑrte Stimmen der Weiûen Rose. // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 29.01.2012
Datum: 29.01.2012Länge: 00:53:17 Größe: 48.79 MB |
||
| Erste Erde Forum: I. Poesie und Physik - Mit Markus Kissler-Patig - 27.01.2012 | ||
| Raoul Schrott (Dichter) im GesprûÊch mit dem Astrophysiker Dr. Markus Kissler-Patig | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 27.01.2012
Datum: 27.01.2012Länge: 00:41:00 Größe: 37.54 MB |
||
| Katrin Seybold/Michael Farin: Wagnis Weiûe Rose: Es lebe die Freiheit! - 22.01.2012 | ||
| Mit den Zeugen Lilo Fû¥rst-Ramdohr, Elisabeth Hartnagel, Hans Hirzel, Anneliese Knoop-Graf, Traute Lafrenz-Page, Franz J. Mû¥ller, Dieter Sasse, Erich Schmorell, Herta Siebler-Probst, Birgit Weiû-Huber, Jû¥rgen Wittenstein, Susanne Zeller-Hirzel sowie Katja Bû¥rkle, Julia Loibl, Tobias Schormann / Komposition: zeitblom / Realisation: Katrin Seybold/Michael Farin / BR 2012 / LûÊnge: 51'10 // Ein DokumentarhûÑrspiel aus Briefen der jungen WiderstandskûÊmpfer, FlugblûÊttern der Weiûen Rose und Erinnerungssplittern von Begleitern der Widerstandsarbeit der Mû¥nchner Studenten in den Kriegsjahren 1942/43. GefûÊhrten, Freundinnen und Geschwister, darunter manche, die niemand vorher gefragt hat, sprechen û¥ber die Kerngruppe des Mû¥nchner Freundeskreises: û¥ber Alexander Schmorell, die Geschwister Scholl, Willi Graf, Christoph Probst und Professor Kurt Huber. Sie erzûÊhlen, wie sie Flugblattaktionen unterstû¥tzten, wie sie GestapoverhûÑre und Volksgerichtshof û¥berstanden. Durch ihre Aussagen wird klar, welche Wurzeln, welche Motive und welches Umfeld diese bedeutendste Widerstandsbewegung der Deutschen Studenten ausgemacht haben. Die Zeugen berichten von scheinbar Vergangenem und doch rufen ihre Berichte unausweichlich die Frage nach GegenwûÊrtigem hervor, nach unserem Verhalten heute. Die Interviews wurden im Zusammenhang mit der Arbeit am Dokumentarfilm Die WiderstûÊndigen / Zeugen der Weiûen Rose von Katrin Seybold in den Jahren 2000 bis 2004 gefû¥hrt. Wenn die Zeugen von damals heute sprechen, klingt es so, als erzûÊhlten sie SelbstverstûÊndliches, als hûÊtte jeder so handeln kûÑnnen. Die Befragungen, 60 Jahre danach, erûÑffnen Facetten des Widerstands der Weiûen Rose aus heutiger Sicht. Im Sommer 1942 tauchen in Sû¥ddeutschland FlugblûÊtter der Weiûen Rose auf. Sie prangern zum ersten Mal den Judenmord an, der ãdas fû¥rchterlichste Verbrechen an der Wû¥rde des Menschenã sei. Die Schriften rufen auf zu Widerstand und Sabotage, ãehe die letzten StûÊdte ein Trû¥mmerhaufen sind, gleich KûÑlnã. Sie enthalten Maximen von Aristoteles, Augustinus, Lao-Tse, Goethe, Schiller und Novalis. Die FlugblûÊtter enthalten auch Texte, die in den Leseabenden von Traute Lafrenz, der Freundin von Hans Scholl, eingebracht wurden, und Themen, die der Freundeskreis diskutierte. Sie sind die Widerspiegelung des Gedankenguts der Studenten und Schû¥ler. Sie sind eine Groûtat, in die Politik eingreifend, wie der Oberreichsanwalt Lautz beim Volksgerichtshof an den Reichsminister der Justiz, Dr. Thierack, schreibt: "Es handelt sich... wohl um den schwersten Fall hochverrûÊterischer Flugblattpropaganda, der sich wûÊhrend des Krieges im Altreich ereignet hat." // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 22.01.2012
Datum: 22.01.2012Länge: 00:54:20 Größe: 49.75 MB |
||
| mouse on mars: Abschaffung der Arten. Soundtrack - 13.01.2012 | ||
| Realisation: Jan St. Werner/Andi Thoma / BR 2011 / LûÊnge: 36'47 // Wie klingt das posthumanistische Zeitalter, in der die letzten noch lebenden Menschen "Minderlinge" heiûen und sprechende Tiere, die Gente, mit Wesen wie Kathahomenleandraleal, das nicht Mensch, nicht Tier, nicht Maschine ist, um die Weltherrschaft ringen. Welche Motive komponiert man fû¥r die û¥ber hundert Figuren wie die Eselmutation namens Storikal, der Stromfrosch, die Holzfigur namens St. Oswald, der "Grû¥nderschwarm gescheiterter Insekten", der vielfach seine Gestalt wechselt, um als Dame Livienda mit dem LûÑwen Cyrus Golden, ein LuchsmûÊdchen zur Welt zu bringen, um dann ein Baum zu werden. Welche Musik vertrûÊgt û¥berhaupt eine Techno-Fabel, dessen Protagonisten keine Musik kennen. Und was erzûÊhlt diese Musik û¥ber den Roman "Die Abschaffung der Arten" selbst, den Dietmar Dath eher als "langes Gedicht" bezeichnen wû¥rde, und û¥ber den eine Kritikerin schrieb, ihn zu lesen sei so wie "in die grelle Sonne schauen". | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 13.01.2012
Datum: 13.01.2012Länge: 00:36:57 Größe: 33.84 MB |
||
| Carl-Ludwig Reichert: "Ein Zaubernetz, gewoben aus Witz, Geist und Laune." - E.T.A. Hoffmann und seine Serapions-Brû¥der - 06.01.2012 | ||
| Mit Tobias Lelle, Andreas Neumann, Sabine Kastius, Detlef Kû¥gow, Martin Umbach / Realisation: Carl-Ludwig Reichert / BR 2006 / LûÊnge: 54'50 // Der Essay von Carl-Ludwig Reichert beleuchtet Entstehung, Wirkung und Nachleben der Hoffmannschen Serapions-Brû¥der. // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 06.01.2012
Datum: 06.01.2012Länge: 00:55:02 Größe: 50.39 MB |
||
| E.T.A. Hoffmann: Die Serapions-Brû¥der (12/12) - Die KûÑnigsbraut - 06.01.2012 | ||
|
Mit Manfred Zapatka, Felix von Manteuffel, Stefan Wilkening, Werner WûÑlbern, Bernhard Schû¥tz, Herbert Fritsch / Bearbeitung, Komposition und Regie: Klaus Buhlert / BR 2006 / LûÊnge: 58'10 // Ein wahnsinniger Einsiedler, der im Wald lebt und sich fû¥r den MûÊrtyrer Serapion hûÊlt, wird zum Namensgeber fû¥r ein literarisches Quartett der Fantasten: ZunûÊchst sind es vier, spûÊter sechs Freunde, die sich als Serapions-Brû¥der bei abendlichen Treffen in einer Berliner Stadtwohnung ihre ErzûÊhlungen und MûÊrchen vorlesen. E.T.A. Hoffmann wûÊhlte diese Rahmenhandlung fû¥r eine Sammlung von Texten, die er zwischen 1814 und 1821 schrieb. Die Rahmenhandlung von den Serapions-Brû¥dern nutzte Hoffmann fû¥r ebenso tiefgehende wie ironische Reflexionen û¥ber die Dichtkunst. So ist die ãRegel des Serapionã, auf die sich die Freunde einigen, ein Spiegel seiner eigenen dichterischen Vorgehensweise: ãJeder prû¥fe wohl, ob er auch wirklich das geschaut, was er zu verkû¥nden unternommen, ehe er es wagt, laut damit zu werden.ã Weil die Serapions-Brû¥der ihre eigenen Erfindungen lebendig vor Augen sehen, verliert sich in ihren ErzûÊhlungen die Unterscheidung zwischen Fantasie und Alltag, zwischen dem Vertrauten und dem Unheimlichen ã ein Automat, der Fragen nach der Zukunft beantwortet, tritt ebenso auf wie eine Frau, die sich fû¥r ein Gespenst hûÊlt, ein Nussknacker, der gegen den MausekûÑnig kûÊmpft, der Teufel selbst, verruchte MûÑrder, zweifelhafte ûrzte oder eine KûÑnigsbraut. Fû¥r die HûÑrspielfassung, produziert vom Bayerischen Rundfunk, wurden 12 der insgesamt 27 ErzûÊhlungen akustisch umgesetzt. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 06.01.2012
Datum: 06.01.2012Länge: 00:58:26 Größe: 53.50 MB |
||
| E.T.A. Hoffmann: Die Serapions-Brû¥der (11/12) - Signor Formica - Fortsetzung - 30.12.2011 | ||
|
Mit Manfred Zapatka, Felix von Manteuffel, Stefan Wilkening, Werner WûÑlbern, Bernhard Schû¥tz, Herbert Fritsch / Bearbeitung, Komposition und Regie: Klaus Buhlert / BR 2006 / LûÊnge: 58'15 // Ein wahnsinniger Einsiedler, der im Wald lebt und sich fû¥r den MûÊrtyrer Serapion hûÊlt, wird zum Namensgeber fû¥r ein literarisches Quartett der Fantasten: ZunûÊchst sind es vier, spûÊter sechs Freunde, die sich als Serapions-Brû¥der bei abendlichen Treffen in einer Berliner Stadtwohnung ihre selbst verfassten ErzûÊhlungen und MûÊrchen vorlesen. E.T.A. Hoffmann wûÊhlte diese Rahmenhandlung fû¥r eine Sammlung von Texten, die er zwischen 1814 und 1821 schrieb und unter dem Titel Die Serapions-Brû¥der verûÑffentlichte. Die Rahmenhandlung von den Serapions-Brû¥dern nutzte Hoffmann fû¥r ebenso tiefgehende wie ironische Reflexionen û¥ber die Dichtkunst. So ist die ãRegel des Serapionã, auf die sich die Freunde einigen, ein Spiegel seiner eigenen dichterischen Vorgehensweise: ãJeder prû¥fe wohl, ob er auch wirklich das geschaut, was er zu verkû¥nden unternommen, ehe er es wagt, laut damit zu werden.ã Weil die Serapions-Brû¥der ihre eigenen Erfindungen lebendig vor Augen sehen, verliert sich in ihren ErzûÊhlungen die Unterscheidung zwischen Fantasie und Alltag, zwischen dem Vertrauten und dem Unheimlichen ã ein Automat, der Fragen nach der Zukunft beantwortet, tritt ebenso auf wie eine Frau, die sich fû¥r ein Gespenst hûÊlt, ein Nussknacker, der gegen den MausekûÑnig kûÊmpft, der Teufel selbst, verruchte MûÑrder, zweifelhafte ûrzte oder eine KûÑnigsbraut. Fû¥r die HûÑrspielfassung, produziert vom Bayerischen Rundfunk, wurden 12 der insgesamt 27 ErzûÊhlungen akustisch umgesetzt. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 30.12.2011
Datum: 30.12.2011Länge: 00:58:34 Größe: 53.63 MB |
||
| E.T.A. Hoffmann: Die Serapions-Brû¥der (10/12) - Signor Formica - 30.12.2011 | ||
|
Mit Manfred Zapatka, Felix von Manteuffel, Stefan Wilkening, Werner WûÑlbern, Bernhard Schû¥tz, Herbert Fritsch / Bearbeitung, Komposition und Regie: Klaus Buhlert / BR 2006 / LûÊnge: 58'02 // Ein wahnsinniger Einsiedler, der im Wald lebt und sich fû¥r den MûÊrtyrer Serapion hûÊlt, wird zum Namensgeber fû¥r ein literarisches Quartett der Fantasten: ZunûÊchst sind es vier, spûÊter sechs Freunde, die sich als Serapions-Brû¥der bei abendlichen Treffen in einer Berliner Stadtwohnung ihre selbst verfassten ErzûÊhlungen und MûÊrchen vorlesen. E.T.A. Hoffmann wûÊhlte diese Rahmenhandlung fû¥r eine Sammlung von Texten, die er zwischen 1814 und 1821 schrieb und unter dem Titel Die Serapions-Brû¥der verûÑffentlichte. Die Rahmenhandlung von den Serapions-Brû¥dern nutzte Hoffmann fû¥r ebenso tiefgehende wie ironische Reflexionen û¥ber die Dichtkunst. So ist die ãRegel des Serapionã, auf die sich die Freunde einigen, ein Spiegel seiner eigenen dichterischen Vorgehensweise: ãJeder prû¥fe wohl, ob er auch wirklich das geschaut, was er zu verkû¥nden unternommen, ehe er es wagt, laut damit zu werden.ã Weil die Serapions-Brû¥der ihre eigenen Erfindungen lebendig vor Augen sehen, verliert sich in ihren ErzûÊhlungen die Unterscheidung zwischen Fantasie und Alltag, zwischen dem Vertrauten und dem Unheimlichen ã ein Automat, der Fragen nach der Zukunft beantwortet, tritt ebenso auf wie eine Frau, die sich fû¥r ein Gespenst hûÊlt, ein Nussknacker, der gegen den MausekûÑnig kûÊmpft, der Teufel selbst, verruchte MûÑrder, zweifelhafte ûrzte oder eine KûÑnigsbraut. Fû¥r die HûÑrspielfassung, produziert vom Bayerischen Rundfunk, wurden 12 der insgesamt 27 ErzûÊhlungen akustisch umgesetzt. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 30.12.2011
Datum: 30.12.2011Länge: 00:58:13 Größe: 53.31 MB |
||
| E.T.A. Hoffmann: Die Serapions-Brû¥der (9/12) - Das FrûÊulein von Scuderi - Fortsetzung/Der Baron von B. - 23.12.2011 | ||
|
Mit Manfred Zapatka, Felix von Manteuffel, Stefan Wilkening, Werner WûÑlbern, Bernhard Schû¥tz, Herbert Fritsch / Bearbeitung, Komposition und Regie: Klaus Buhlert / BR 2006 / LûÊnge: 57'58 // Ein wahnsinniger Einsiedler, der im Wald lebt und sich fû¥r den MûÊrtyrer Serapion hûÊlt, wird zum Namensgeber fû¥r ein literarisches Quartett der Fantasten: ZunûÊchst sind es vier, spûÊter sechs Freunde, die sich als Serapions-Brû¥der bei abendlichen Treffen in einer Berliner Stadtwohnung ihre selbst verfassten ErzûÊhlungen und MûÊrchen vorlesen. E.T.A. Hoffmann wûÊhlte diese Rahmenhandlung fû¥r eine Sammlung von Texten, die er zwischen 1814 und 1821 schrieb und unter dem Titel Die Serapions-Brû¥der verûÑffentlichte. Die Rahmenhandlung von den Serapions-Brû¥dern nutzte Hoffmann fû¥r ebenso tiefgehende wie ironische Reflexionen û¥ber die Dichtkunst. So ist die ãRegel des Serapionã, auf die sich die Freunde einigen, ein Spiegel seiner eigenen dichterischen Vorgehensweise: ãJeder prû¥fe wohl, ob er auch wirklich das geschaut, was er zu verkû¥nden unternommen, ehe er es wagt, laut damit zu werden.ã Weil die Serapions-Brû¥der ihre eigenen Erfindungen lebendig vor Augen sehen, verliert sich in ihren ErzûÊhlungen die Unterscheidung zwischen Fantasie und Alltag, zwischen dem Vertrauten und dem Unheimlichen ã ein Automat, der Fragen nach der Zukunft beantwortet, tritt ebenso auf wie eine Frau, die sich fû¥r ein Gespenst hûÊlt, ein Nussknacker, der gegen den MausekûÑnig kûÊmpft, der Teufel selbst, verruchte MûÑrder, zweifelhafte ûrzte oder eine KûÑnigsbraut. Fû¥r die HûÑrspielfassung, produziert vom Bayerischen Rundfunk, wurden 12 der insgesamt 27 ErzûÊhlungen akustisch umgesetzt. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 23.12.2011
Datum: 23.12.2011Länge: 00:58:11 Größe: 53.28 MB |
||
| E.T.A. Hoffmann: Die Serapions-Brû¥der (8/12) - Das FrûÊulein von Scuderi (Fortsetzung) - 23.12.2011 | ||
| Mit Manfred Zapatka, Felix von Manteuffel, Stefan Wilkening, Werner WûÑlbern, Bernhard Schû¥tz, Herbert Fritsch / Bearbeitung, Komposition und Regie: Klaus Buhlert / BR 2006 / LûÊnge: 57'46 // Ein wahnsinniger Einsiedler, der im Wald lebt und sich fû¥r den MûÊrtyrer Serapion hûÊlt, wird zum Namensgeber fû¥r ein literarisches Quartett der Fantasten: ZunûÊchst sind es vier, spûÊter sechs Freunde, die sich als Serapions-Brû¥der bei abendlichen Treffen in einer Berliner Stadtwohnung ihre selbst verfassten ErzûÊhlungen und MûÊrchen vorlesen. E.T.A. Hoffmann wûÊhlte diese Rahmenhandlung fû¥r eine Sammlung von Texten, die er zwischen 1814 und 1821 schrieb und unter dem Titel Die Serapions-Brû¥der verûÑffentlichte. Die Rahmenhandlung von den Serapions-Brû¥dern nutzte Hoffmann fû¥r ebenso tiefgehende wie ironische Reflexionen û¥ber die Dichtkunst. So ist die ãRegel des Serapionã, auf die sich die Freunde einigen, ein Spiegel seiner eigenen dichterischen Vorgehensweise: ãJeder prû¥fe wohl, ob er auch wirklich das geschaut, was er zu verkû¥nden unternommen, ehe er es wagt, laut damit zu werden.ã Weil die Serapions-Brû¥der ihre eigenen Erfindungen lebendig vor Augen sehen, verliert sich in ihren ErzûÊhlungen die Unterscheidung zwischen Fantasie und Alltag, zwischen dem Vertrauten und dem Unheimlichen ã ein Automat, der Fragen nach der Zukunft beantwortet, tritt ebenso auf wie eine Frau, die sich fû¥r ein Gespenst hûÊlt, ein Nussknacker, der gegen den MausekûÑnig kûÊmpft, der Teufel selbst, verruchte MûÑrder, zweifelhafte ûrzte oder eine KûÑnigsbraut. Fû¥r die HûÑrspielfassung, produziert vom Bayerischen Rundfunk, wurden 12 der insgesamt 27 ErzûÊhlungen akustisch umgesetzt. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 23.12.2011
Datum: 23.12.2011Länge: 00:57:56 Größe: 53.05 MB |
||
| E.T.A. Hoffmann: Die Serapions-Brû¥der (7/12) - Nachricht a.d.Leben e.bekannten Mannes/Das FrûÊulein von Scuderi - 23.12.2011 | ||
| Mit Manfred Zapatka, Felix von Manteuffel, Stefan Wilkening, Werner WûÑlbern, Bernhard Schû¥tz, Herbert Fritsch / Bearbeitung, Komposition und Regie: Klaus Buhlert / BR 2006 / LûÊnge: 58'05 // Ein wahnsinniger Einsiedler, der im Wald lebt und sich fû¥r den MûÊrtyrer Serapion hûÊlt, wird zum Namensgeber fû¥r ein literarisches Quartett der Fantasten: ZunûÊchst sind es vier, spûÊter sechs Freunde, die sich als Serapions-Brû¥der bei abendlichen Treffen in einer Berliner Stadtwohnung ihre selbst verfassten ErzûÊhlungen und MûÊrchen vorlesen. E.T.A. Hoffmann wûÊhlte diese Rahmenhandlung fû¥r eine Sammlung von Texten, die er zwischen 1814 und 1821 schrieb und unter dem Titel Die Serapions-Brû¥der verûÑffentlichte. Die Rahmenhandlung von den Serapions-Brû¥dern nutzte Hoffmann fû¥r ebenso tiefgehende wie ironische Reflexionen û¥ber die Dichtkunst. So ist die ãRegel des Serapionã, auf die sich die Freunde einigen, ein Spiegel seiner eigenen dichterischen Vorgehensweise: ãJeder prû¥fe wohl, ob er auch wirklich das geschaut, was er zu verkû¥nden unternommen, ehe er es wagt, laut damit zu werden.ã Weil die Serapions-Brû¥der ihre eigenen Erfindungen lebendig vor Augen sehen, verliert sich in ihren ErzûÊhlungen die Unterscheidung zwischen Fantasie und Alltag, zwischen dem Vertrauten und dem Unheimlichen ã ein Automat, der Fragen nach der Zukunft beantwortet, tritt ebenso auf wie eine Frau, die sich fû¥r ein Gespenst hûÊlt, ein Nussknacker, der gegen den MausekûÑnig kûÊmpft, der Teufel selbst, verruchte MûÑrder, zweifelhafte ûrzte oder eine KûÑnigsbraut. Fû¥r die HûÑrspielfassung, produziert vom Bayerischen Rundfunk, wurden 12 der insgesamt 27 ErzûÊhlungen akustisch umgesetzt. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 23.12.2011
Datum: 23.12.2011Länge: 00:58:16 Größe: 53.35 MB |
||
| Das digital geborene Ich - Zu Jelineks "Neid. Privatroman" - 19.12.2011 | ||
| Mit Eva Meyer, Elfriede Jelinek / BR 2011 / LûÊnge: 50'10 // Neid kann Methode sein, wenn man es will. Und Jelinek will es. Sie will "ich" sagen in ihrem "Privatroman" und das bedeutet: Neid. Aber Achtung: Ihr Ich ist digital geboren. Born digital nennt man digital Entstandenes, das, wenn aus dem Netz genommen, fû¥r immer verloren ist. Archiviert hingegen und von Jelinek jedem Kapitel ihres Romans vorangestellt ist das Bild vom Neid, wie Hieronymus Bosch ihn als eine der sieben Todsû¥nden auf eine Tischplatte gemalt hat. Er versetzt uns in eine Zeit, in der die Prozession der Kreaturen sich auûerhalb aller historischen Kategorien bewegt. Wer da ãichã sagt, will bestimmt nicht auf die Einheit seines Lebens in der Erinnerung abheben. Er stellt sein Ich in das Bild einer Kollektiverfahrung, fû¥r die selbst der Tod als die Grenze jeder individuellen Erfahrung keine Schranke darstellt. ûberdies findet diese schrankenlose Kollektivierung des Privaten nicht in einem Printmedium statt. Sie wird im Internet einem Modernisierungsschub ausgesetzt. Kann schon sein, dass Jelinek damit ihre Haut zu Markte trûÊgt, doch û¥berbietet sie ihn auch und erfreut sich und uns einer neuen Freiheit: ãEin Buch hûÊtten Sie zahlen mû¥ssen und eigens in den Papiermû¥ll schmeiûen, hier kûÑnnen Sie mich total rû¥ckstandslos entfernen, aaah! Ich fû¥hle mich wie neugeboren, weil Sie mich ausgelûÑscht haben". Wollen Sie wissen, wie es weitergeht? Sie bekommen sogar ãzwei Stû¥ck E.J. fû¥r eineã, wenn Jelinek den Unterschied zwischen Wollen und KûÑnnen mit ihrem Joy- nein, Neidstick bearbeitet. Da glauben wir immer, wir wûÊren ganz privat. Und dann stehen wir plûÑtzlich inmitten der ûffentlichkeit. // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 19.12.2011
Datum: 19.12.2011Länge: 00:50:19 Größe: 46.07 MB |
||
| E.T.A. Hoffmann: Die Serapions-Brû¥der (6/12) - Eine Spukgeschichte/Die Automate - 16.12.2011 | ||
|
Mit Manfred Zapatka, Felix von Manteuffel, Stefan Wilkening, Werner WûÑlbern, Bernhard Schû¥tz, Herbert Fritsch / Bearbeitung, Komposition und Regie: Klaus Buhlert / BR 2006 / LûÊnge: 58'25 // Ein wahnsinniger Einsiedler, der im Wald lebt und sich fû¥r den MûÊrtyrer Serapion hûÊlt, wird zum Namensgeber fû¥r ein literarisches Quartett der Fantasten: ZunûÊchst sind es vier, spûÊter sechs Freunde, die sich als Serapions-Brû¥der bei abendlichen Treffen in einer Berliner Stadtwohnung ihre selbst verfassten ErzûÊhlungen und MûÊrchen vorlesen. E.T.A. Hoffmann wûÊhlte diese Rahmenhandlung fû¥r eine Sammlung von Texten, die er zwischen 1814 und 1821 schrieb und unter dem Titel Die Serapions-Brû¥der verûÑffentlichte. Die Rahmenhandlung von den Serapions-Brû¥dern nutzte Hoffmann fû¥r ebenso tiefgehende wie ironische Reflexionen û¥ber die Dichtkunst. So ist die ãRegel des Serapionã, auf die sich die Freunde einigen, ein Spiegel seiner eigenen dichterischen Vorgehensweise: ãJeder prû¥fe wohl, ob er auch wirklich das geschaut, was er zu verkû¥nden unternommen, ehe er es wagt, laut damit zu werden.ã Weil die Serapions-Brû¥der ihre eigenen Erfindungen lebendig vor Augen sehen, verliert sich in ihren ErzûÊhlungen die Unterscheidung zwischen Fantasie und Alltag, zwischen dem Vertrauten und dem Unheimlichen ã ein Automat, der Fragen nach der Zukunft beantwortet, tritt ebenso auf wie eine Frau, die sich fû¥r ein Gespenst hûÊlt, ein Nussknacker, der gegen den MausekûÑnig kûÊmpft, der Teufel selbst, verruchte MûÑrder, zweifelhafte ûrzte oder eine KûÑnigsbraut. Fû¥r die HûÑrspielfassung, produziert vom Bayerischen Rundfunk, wurden 12 der insgesamt 27 ErzûÊhlungen akustisch umgesetzt.
|
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 16.12.2011
Datum: 16.12.2011Länge: 00:58:36 Größe: 53.66 MB |
||
| E.T.A. Hoffmann: Die Serapions-Brû¥der (5/12) - Nussknacker und MausekûÑnig - Fortsetzung - 15.12.2011 | ||
|
Mit Manfred Zapatka, Felix von Manteuffel, Stefan Wilkening, Werner WûÑlbern, Bernhard Schû¥tz, Herbert Fritsch / Bearbeitung, Komposition und Regie: Klaus Buhlert / BR 2006 / LûÊnge: 58'10 // Ein wahnsinniger Einsiedler, der im Wald lebt und sich fû¥r den MûÊrtyrer Serapion hûÊlt, wird zum Namensgeber fû¥r ein literarisches Quartett der Fantasten: ZunûÊchst sind es vier, spûÊter sechs Freunde, die sich als Serapions-Brû¥der bei abendlichen Treffen in einer Berliner Stadtwohnung ihre selbst verfassten ErzûÊhlungen und MûÊrchen vorlesen. E.T.A. Hoffmann wûÊhlte diese Rahmenhandlung fû¥r eine Sammlung von Texten, die er zwischen 1814 und 1821 schrieb und unter dem Titel Die Serapions-Brû¥der verûÑffentlichte. Die Rahmenhandlung von den Serapions-Brû¥dern nutzte Hoffmann fû¥r ebenso tiefgehende wie ironische Reflexionen û¥ber die Dichtkunst. So ist die ãRegel des Serapionã, auf die sich die Freunde einigen, ein Spiegel seiner eigenen dichterischen Vorgehensweise: ãJeder prû¥fe wohl, ob er auch wirklich das geschaut, was er zu verkû¥nden unternommen, ehe er es wagt, laut damit zu werden.ã Weil die Serapions-Brû¥der ihre eigenen Erfindungen lebendig vor Augen sehen, verliert sich in ihren ErzûÊhlungen die Unterscheidung zwischen Fantasie und Alltag, zwischen dem Vertrauten und dem Unheimlichen ã ein Automat, der Fragen nach der Zukunft beantwortet, tritt ebenso auf wie eine Frau, die sich fû¥r ein Gespenst hûÊlt, ein Nussknacker, der gegen den MausekûÑnig kûÊmpft, der Teufel selbst, verruchte MûÑrder, zweifelhafte ûrzte oder eine KûÑnigsbraut. Fû¥r die HûÑrspielfassung, produziert vom Bayerischen Rundfunk, wurden 12 der insgesamt 27 ErzûÊhlungen akustisch umgesetzt.
|
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 15.12.2011
Datum: 15.12.2011Länge: 00:58:30 Größe: 53.57 MB |
||
| E.T.A. Hoffmann: Die Serapions-Brû¥der (4/12) - Die Bergwerke zu Falun/Nussknacker und MausekûÑnig - 15.12.2011 | ||
|
Mit Manfred Zapatka, Felix von Manteuffel, Stefan Wilkening, Werner WûÑlbern, Bernhard Schû¥tz, Herbert Fritsch / Bearbeitung, Komposition und Regie: Klaus Buhlert / BR 2006 / LûÊnge: 58'14 // Ein wahnsinniger Einsiedler, der im Wald lebt und sich fû¥r den MûÊrtyrer Serapion hûÊlt, wird zum Namensgeber fû¥r ein literarisches Quartett der Fantasten: ZunûÊchst sind es vier, spûÊter sechs Freunde, die sich als Serapions-Brû¥der bei abendlichen Treffen in einer Berliner Stadtwohnung ihre selbst verfassten ErzûÊhlungen und MûÊrchen vorlesen. E.T.A. Hoffmann wûÊhlte diese Rahmenhandlung fû¥r eine Sammlung von Texten, die er zwischen 1814 und 1821 schrieb und unter dem Titel Die Serapions-Brû¥der verûÑffentlichte. Die Rahmenhandlung von den Serapions-Brû¥dern nutzte Hoffmann fû¥r ebenso tiefgehende wie ironische Reflexionen û¥ber die Dichtkunst. So ist die ãRegel des Serapionã, auf die sich die Freunde einigen, ein Spiegel seiner eigenen dichterischen Vorgehensweise: ãJeder prû¥fe wohl, ob er auch wirklich das geschaut, was er zu verkû¥nden unternommen, ehe er es wagt, laut damit zu werden.ã Weil die Serapions-Brû¥der ihre eigenen Erfindungen lebendig vor Augen sehen, verliert sich in ihren ErzûÊhlungen die Unterscheidung zwischen Fantasie und Alltag, zwischen dem Vertrauten und dem Unheimlichen ã ein Automat, der Fragen nach der Zukunft beantwortet, tritt ebenso auf wie eine Frau, die sich fû¥r ein Gespenst hûÊlt, ein Nussknacker, der gegen den MausekûÑnig kûÊmpft, der Teufel selbst, verruchte MûÑrder, zweifelhafte ûrzte oder eine KûÑnigsbraut. Fû¥r die HûÑrspielfassung, produziert vom Bayerischen Rundfunk, wurden 12 der insgesamt 27 ErzûÊhlungen akustisch umgesetzt.
|
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 15.12.2011
Datum: 15.12.2011Länge: 00:58:44 Größe: 53.78 MB |
||
| E.T.A. Hoffmann: Die Serapions-Brû¥der (3/12) - Der Artushof - 15.12.2011 | ||
|
Mit Manfred Zapatka, Felix von Manteuffel, Stefan Wilkening, Werner WûÑlbern, Bernhard Schû¥tz, Herbert Fritsch / Bearbeitung, Komposition und Regie: Klaus Buhlert / BR 2006 / LûÊnge: 58'25 // Ein wahnsinniger Einsiedler, der im Wald lebt und sich fû¥r den MûÊrtyrer Serapion hûÊlt, wird zum Namensgeber fû¥r ein literarisches Quartett der Fantasten: ZunûÊchst sind es vier, spûÊter sechs Freunde, die sich als Serapions-Brû¥der bei abendlichen Treffen in einer Berliner Stadtwohnung ihre selbst verfassten ErzûÊhlungen und MûÊrchen vorlesen. E.T.A. Hoffmann wûÊhlte diese Rahmenhandlung fû¥r eine Sammlung von Texten, die er zwischen 1814 und 1821 schrieb und unter dem Titel Die Serapions-Brû¥der verûÑffentlichte. Die Rahmenhandlung von den Serapions-Brû¥dern nutzte Hoffmann fû¥r ebenso tiefgehende wie ironische Reflexionen û¥ber die Dichtkunst. So ist die ãRegel des Serapionã, auf die sich die Freunde einigen, ein Spiegel seiner eigenen dichterischen Vorgehensweise: ãJeder prû¥fe wohl, ob er auch wirklich das geschaut, was er zu verkû¥nden unternommen, ehe er es wagt, laut damit zu werden.ã Weil die Serapions-Brû¥der ihre eigenen Erfindungen lebendig vor Augen sehen, verliert sich in ihren ErzûÊhlungen die Unterscheidung zwischen Fantasie und Alltag, zwischen dem Vertrauten und dem Unheimlichen ã ein Automat, der Fragen nach der Zukunft beantwortet, tritt ebenso auf wie eine Frau, die sich fû¥r ein Gespenst hûÊlt, ein Nussknacker, der gegen den MausekûÑnig kûÊmpft, der Teufel selbst, verruchte MûÑrder, zweifelhafte ûrzte oder eine KûÑnigsbraut. Fû¥r die HûÑrspielfassung, produziert vom Bayerischen Rundfunk, wurden 12 der insgesamt 27 ErzûÊhlungen akustisch umgesetzt.
|
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 15.12.2011
Datum: 15.12.2011Länge: 00:58:47 Größe: 53.82 MB |
||
| E.T.A. Hoffmann: Die Serapions-Brû¥der (2/12) - Rat Krespel - Fortsetzung - 15.12.2011 | ||
|
Mit Manfred Zapatka, Felix von Manteuffel, Stefan Wilkening, Werner WûÑlbern, Bernhard Schû¥tz, Herbert Fritsch / Bearbeitung, Komposition und Regie: Klaus Buhlert / BR 2006 / LûÊnge: 57'55 // Ein wahnsinniger Einsiedler, der im Wald lebt und sich fû¥r den MûÊrtyrer Serapion hûÊlt, wird zum Namensgeber fû¥r ein literarisches Quartett der Fantasten: ZunûÊchst sind es vier, spûÊter sechs Freunde, die sich als Serapions-Brû¥der bei abendlichen Treffen in einer Berliner Stadtwohnung ihre selbst verfassten ErzûÊhlungen und MûÊrchen vorlesen. E.T.A. Hoffmann wûÊhlte diese Rahmenhandlung fû¥r eine Sammlung von Texten, die er zwischen 1814 und 1821 schrieb und unter dem Titel Die Serapions-Brû¥der verûÑffentlichte. Die Rahmenhandlung von den Serapions-Brû¥dern nutzte Hoffmann fû¥r ebenso tiefgehende wie ironische Reflexionen û¥ber die Dichtkunst. So ist die ãRegel des Serapionã, auf die sich die Freunde einigen, ein Spiegel seiner eigenen dichterischen Vorgehensweise: ãJeder prû¥fe wohl, ob er auch wirklich das geschaut, was er zu verkû¥nden unternommen, ehe er es wagt, laut damit zu werden.ã Weil die Serapions-Brû¥der ihre eigenen Erfindungen lebendig vor Augen sehen, verliert sich in ihren ErzûÊhlungen die Unterscheidung zwischen Fantasie und Alltag, zwischen dem Vertrauten und dem Unheimlichen ã ein Automat, der Fragen nach der Zukunft beantwortet, tritt ebenso auf wie eine Frau, die sich fû¥r ein Gespenst hûÊlt, ein Nussknacker, der gegen den MausekûÑnig kûÊmpft, der Teufel selbst, verruchte MûÑrder, zweifelhafte ûrzte oder eine KûÑnigsbraut. Fû¥r die HûÑrspielfassung, produziert vom Bayerischen Rundfunk, wurden 12 der insgesamt 27 ErzûÊhlungen akustisch umgesetzt.
|
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 15.12.2011
Datum: 15.12.2011Länge: 00:58:11 Größe: 53.28 MB |
||
| E.T.A. Hoffmann: Serapions-Brû¥der (1/12) - Der Einsiedler Serapion / Rat Krespel - 15.12.2011 | ||
|
Mit Manfred Zapatka, Felix von Manteuffel, Stefan Wilkening, Werner WûÑlbern, Bernhard Schû¥tz, Herbert Fritsch / Bearbeitung, Komposition und Regie: Klaus Buhlert / BR 2006 / LûÊnge: 57'30 // Ein wahnsinniger Einsiedler, der im Wald lebt und sich fû¥r den MûÊrtyrer Serapion hûÊlt, wird zum Namensgeber fû¥r ein literarisches Quartett der Fantasten: ZunûÊchst sind es vier, spûÊter sechs Freunde, die sich als Serapions-Brû¥der bei abendlichen Treffen in einer Berliner Stadtwohnung ihre selbst verfassten ErzûÊhlungen und MûÊrchen vorlesen. E.T.A. Hoffmann wûÊhlte diese Rahmenhandlung fû¥r eine Sammlung von Texten, die er zwischen 1814 und 1821 schrieb und unter dem Titel Die Serapions-Brû¥der verûÑffentlichte. Die Rahmenhandlung von den Serapions-Brû¥dern nutzte Hoffmann fû¥r ebenso tiefgehende wie ironische Reflexionen û¥ber die Dichtkunst. So ist die ãRegel des Serapionã, auf die sich die Freunde einigen, ein Spiegel seiner eigenen dichterischen Vorgehensweise: ãJeder prû¥fe wohl, ob er auch wirklich das geschaut, was er zu verkû¥nden unternommen, ehe er es wagt, laut damit zu werden.ã Weil die Serapions-Brû¥der ihre eigenen Erfindungen lebendig vor Augen sehen, verliert sich in ihren ErzûÊhlungen die Unterscheidung zwischen Fantasie und Alltag, zwischen dem Vertrauten und dem Unheimlichen ã ein Automat, der Fragen nach der Zukunft beantwortet, tritt ebenso auf wie eine Frau, die sich fû¥r ein Gespenst hûÊlt, ein Nussknacker, der gegen den MausekûÑnig kûÊmpft, der Teufel selbst, verruchte MûÑrder, zweifelhafte ûrzte oder eine KûÑnigsbraut. Fû¥r die HûÑrspielfassung, produziert vom Bayerischen Rundfunk, wurden 12 der insgesamt 27 ErzûÊhlungen akustisch umgesetzt.
|
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 15.12.2011
Datum: 15.12.2011Länge: 00:57:48 Größe: 52.92 MB |
||
| ARD Radio Tatort: Robert Hû¥ltner: Unter Verdacht - 14.12.2011 | ||
| Mit Florian Karlheim, Brigitte Hobmeier, Michael Grimm, Robert Giggenbach, Jû¥rgen Tonkel, Richard Oehmann, Stefan Wilkening, Rainer Bock, Manfred Beierl, Wowo Habdank, Philipp Brammer, Felix Hellmann, Michael Schlenger / Regie: Ulrich Lampen / BR 2011 / LûÊnge: 53'57 Senta Pollinger hat lange auf ihre Fortbildung warten mû¥ssen, aber jetzt sitzt sie endlich in dem Seminar fû¥r Kriminologie und Psychologie in Ainring und punktet bei ihrem Dozenten Dr. Platen. Als dieser sie am Wochenende zu einer kleinen Bergwanderung einlûÊdt, sagt sie gerne zu. Doch als Platen am Montag nicht zum Seminar erscheint und niemand etwas zu seinem Verbleib sagen kann, wird ihr plûÑtzlich mulmig: Ist sie diejenige, die ihn zuletzt gesehen hat? Bald muss Senta schmerzlich erfahren, was es heiût, bei einem VerhûÑr auf der anderen Seite zu sitzen. Die Kollegen in Bruck am Inn kûÑnnen gar nicht glauben, was ihnen da zu Ohren kommt. Vor allem Rudi Egger macht sich Sorgen. Aber so schnell lûÊsst Senta sich nicht einschû¥chtern. Als Rudi nach Ainring fûÊhrt, um Senta abzuholen, ist lûÊngst klar, dass sie den Ort nicht eher verlûÊsst, bis die Sache geklûÊrt ist. Mit Gespû¥r fû¥r die kleinen Ungereimtheiten machen sich die beiden in bewûÊhrtem Teamwork an die Arbeit. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 14.12.2011
Datum: 14.12.2011Länge: 00:54:07 Größe: 49.55 MB |
||
| Ania Mauruschat: "Bis in die Materie selbst hinein ist das WORT handelnd" - Valû´re Novarina im PortrûÊt - 09.12.2011 | ||
| Mit Stefan Merki, Anne-Isabelle Zils, Ania Mauruschat, Detlef Kû¥gow / Realisation: Ania Mauruschat / BR 2011 / LûÊnge: 53'28 // Werkstattbesuch bei dem schweizerisch-franzûÑsischen Gegenwartsdramatiker Valû´re Novarina. Jahrzehnte lang ein literarischer Auûenseiter, hat Novarina, Jahrgang 1947, in Frankreich vor allem in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Anerkennung als Autor und Regisseur erfahren. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 09.12.2011
Datum: 09.12.2011Länge: 00:53:39 Größe: 49.12 MB |
||
| Elfriede Jelinek: Keine Anweisung, keine Auszahlung, kein Betrag, kein Betrug - Ein paar Anmerkungen zu "Neid" - 03.10.2011 | ||
| Mit Elfriede Jelinek / BR 2011 / LûÊnge: 13'58 // Auf ihrer Website verûÑffentlichte die Jelinek diesen Text als eine Art Vorwort. Jelinek nennt Grû¥nde fû¥r ihre Entscheidung, ihren Privatroman "Neid" nicht als Buch zu verûÑffentlichen, sondern in einer flû¥chtigen Form im Netz anzubieten. "Dieser Text gehûÑrt mir, ob Sie wollen oder nicht, ich habe ihn an niemand verkauft, ich behalte ihn, aber Sie kûÑnnen ihn jederzeit haben, wenn Sie wollen und wann Sie wollen. Und noch nicht einmal geliehen. Er gehûÑrt ganz Ihnen, wenn Sie mûÑgen. Und dann ist er wieder weg." | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 03.10.2011
Datum: 03.10.2011Länge: 00:13:58 Größe: 12.79 MB |
||
| Jelineks "Neid" als HûÑrspiel - Der Regisseur Karl Bruckmaier im GesprûÊch mit Herbert Kapfer - 03.10.2011 | ||
| Mit Karl Bruckmaier, Herbert Kapfer / BR 2011 / LûÊnge: 10'50 // Fragen an Karl Bruckmaier, der u.a. auch die Jelinek-HûÑrspiele "Jackie" und "Bambiland" fû¥r den BR produzierte, zum Regiekonzept und zur Regiearbeit. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 03.10.2011
Datum: 03.10.2011Länge: 00:10:58 Größe: 10.05 MB |
||
| Der Roman "Neid" in Jelineks Werk - Die Literaturkritikerin Sigrid LûÑffler im GesprûÊch mit Herbert Kapfer - 03.10.2011 | ||
| Mit Sigrid LûÑffler, Herbert Kapfer / BR 2011 / LûÊnge: 34'02 // In diesem GesprûÊch geht es um die Frage nach dem Stellenwert des Romans Neid im Kontext des erzûÊhlerischen Gesamtwerks von Jelinek. "Allein mittels Sprachkritik hat Elfriede Jelinek, wie der groûe Wiener Satiriker Karl Kraus, die MissstûÊnde aufgezeigt und vorgefû¥hrt, die sie empûÑren: Denkfaulheit, gemû¥tliche BestialitûÊt, Machtmissbrauch und Barbarei", schrieb Sigrid LûÑffler in einem Essay nach dem Nobelpreis an Jelinek. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 03.10.2011
Datum: 03.10.2011Länge: 00:34:10 Größe: 31.29 MB |
||
| Der Privatroman Neid - 36 Antworten von Elfriede Jelinek auf Fragen von Herbert Kapfer - 26.09.2011 | ||
| Mit Elfriede Jelinek, Herbert Kapfer / BR 2011 / LûÊnge: 49'16 // Eine E-mail-Korrespondenz, die nach Abschluss von den beiden Beteiligten in getrennten Studios aufgezeichnet wurde. Warum schlug Elfriede Jelinek eine HûÑrspielfassung von Neid vor und nicht von dem Roman Die Kinder der Toten, der als ihr Hauptwerk gilt? Hat die Entscheidung, Neid nur im Internet und nicht als Buch zu verûÑffentlichen mit den ûÑffentlichen Reaktionen auf die Auszeichnung mit dem Literatur-Nobelpreis zu tun? Als die ersten Kapitel online waren, war der Roman noch nicht abgeschlossen, war es ein Schreibexperiment mit offenem Ausgang? ûber weite ErzûÊhlstrecken wirkt Neid wie in gesprochener Sprache formuliert, tatsûÊchlich ist alles akribisch konstruiert, es hat ja wohl doch mehrere Fassungen gebraucht, um diesen zerstreuten, pseudo-pathologischen Eindruck zu erzeugen - wie lange hat Jelinek an Neid geschrieben, wie viele Fassungen gibt es? Neid vermittelt den Eindruck eines HûÑchstmaûes an narrativer Freiheit und Willkû¥r. Dieser Text darf, wie er immer wieder zu erlûÊutern nicht mû¥de wird, ja eigentlich alles. Oder ist hier der Fragensteller einem TûÊuschungsmanûÑver der Autorin erlegen? ûbt die Autorin bzw. die ErzûÊhlerin mit ihrer Willkû¥r Macht aus? Der Begriff Privatroman suggeriert, der Text gehe niemanden etwas an, selber schuld, wer ihn liest oder darin rumschnû¥ffelt. Der Leser/HûÑrer als Voyeur? Lust, Gier und Neid - das sind die Romane der Todsû¥nden. Gibt es eine Fortsetzung der Todsû¥nden-Serie? | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 26.09.2011
Datum: 26.09.2011Länge: 00:49:25 Größe: 45.25 MB |
||
| Thomas Meinecke/Move D: Lookalikes - 22.07.2011 | ||
| Mit Thomas Meinecke / Komposition und Realisation: Thomas Meinecke/Move D / BR 2011 / LûÊnge: 62'16 // In der fû¥r die Produktionen von Thomas Meinecke und Move D typischen Sampling-Methode inszeniert Lookalikes ein Spiel um (sexuelle) IdentitûÊt. Das PhûÊnomen des DoppelgûÊngertums bzw. sogenannter ãlookalikesã, also von Menschen, die bekannten PersûÑnlichkeiten ûÊhnlich sehen und daraus mehr oder weniger ein GeschûÊft machen, wird zu einem Zustand grundlegender Differenz: ãJosephine Baker, Serge Gainsbourg, Marlon Brando, Elvis Presley, Greta Garbo, Justin Timberlake und Shakira sind Lookalikes. Auf verschiedene Weisen betonen sie ihre ûhnlichkeit mit diesen berû¥hmten NamenstrûÊgern und machen sie produktiv (hin und wieder im selben Atemzug auch die Differenz zu diesen). Sie haben sich bei einschlûÊgigen Agenturen registrieren lassen, flanieren die poshe Dû¥sseldorfer KûÑnigsallee auf und ab, lesen Bû¥cher (auch û¥ber ihre Idole), sehen sich Spielfilme an (und fragen sich: Wie gingen die Regisseure der Nouvelle Vague mit den KûÑrpern der Frauen um?), hûÑren sich Stimmen (vornehmlich queere) auf TontrûÊgern an, jobben in der Galeria Kaufhof, sitzen an akademischen oder journalistischen Texten, haben AffûÊren miteinander (z.B. Josephine Baker und Justin Timberlake), aber auch welche mit Nicht-Lookalikes, sie treffen sich, sie kommunizieren mit Hilfe neuer elektronischer sozialer Netzwerke. Das Ikonenhafte ihrer role-models lûÊsst die Figuren darû¥ber nachdenken, inwiefern MûÊnner und Frauen Gattungswesen sind. Motive aus der Tierwelt werden in den Diskursen der Mode gefunden. Pelze spielen eine gewisse Rolle (auch die PelzmûÊntel des Jacques Lacan, ã der hier mal wieder mit hinein muss: er ist derjenige, an dessen Theoremen sich am besten die Zone markieren lûÊsst, wo das Begreifen aufhûÑrt ã ein Sehnsuchtsort, sozusagen, wie die Musik, die in diesem HûÑrspiel als eine nonverbal Portraitierende vertreten ist).ã (Thomas Meinecke) | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 22.07.2011
Datum: 22.07.2011Länge: 01:02:35 Größe: 57.31 MB |
||
| Raoul Hausmann: HYLE - Ein Traumsein in Spanien - 16.07.2011 | ||
|
Mit Marijam Agischewa, Axel Milberg, Bernhard Schû¥tz, Michû´le Tichawsky / Komposition: zeitblom / Bearbeitung und Regie: Michael Farin / BR 2007 / LûÊnge: 78'22 // Am 28. MûÊrz 1933 trifft Raoul Hausmann auf der Flucht aus Nazi-Deutschland mit Ehefrau Hedwig Mankiewitz und Geliebter Vera Broido auf der Baleareninsel Ibiza ein. ãUnter StûÑssen gegend Windes schwebt schwankend Schiff hebend, senkend zwischen schwarzen langsam steigenden Wasserballen in WasserhûÑhlen abfallender Metallfisch, brû¥llend Schiffschraube û¥berpolternd den Wind, anpressend gegen Anlauf, Aufstauf, unter sternsprenkelnder NachtblûÊue. Mitternachtblau, drin schlingert Dampfer ãCiudad de Mahonã sû¥dlich, der Isla blanca entgegen.ã
Verlassen wird er die Insel, wegen des anbrechenden Spanischen Bû¥rgerkrieges, am 16. September 1936. Das ãTraumsein in Spanienã war mittlerweile zum Alptraum geworden. Multiperspektivisch, fluktuierend erzûÊhlt Hausmanns kaum verhû¥llter Schlû¥sselroman von dieser Zeit. Zunehmend verflû¥chtigt sich dabei die Wirklichkeit, Fiktionalisierung tritt an ihre Stelle: Der eindeutig mit Hausmann zu identifizierende Ich-ErzûÊhler verwandelt sich in den kryptischen ãGalã, Hedwig Hausmann, zweite Gattin des Kû¥nstlers, ist hinter der ãKleinenã erkennbar, Vera Broû₤do, Geliebte der Jahre 1927-34, schlû¥pft in die Figur des Kind-Weibs ãAraã. Mit diesem Hin-und-Her-Gleiten zwischen RealitûÊt und Fiktion wird Hyle zu einer Art ãTraumbuchã und ãautobiographischem Mythosã, wie Hausmann selbst û¥ber sein Buch sagte. Sein Buch und auch die HûÑrspielproduktion sind der Versuch einer ãprogressiven Universalpoesieã, eines ãAnti-Romansã mit romantischer Stoûrichtung. Momente eines Anti-Entwicklungsromans, entstanden aus dem ûberdruss an diesen ãstagnierendenã Geschichten, ãderen letztes Wort man schon kennt, wenn man das erste gelesen hatã, verquicken sich mit einer identitûÊtssuchenden ãExpedition ins eigene Lebenã. Die Handlung beginnt mit dem Aufbruch in eine vûÑllig fremde Welt und entfaltet sich vor der Folie der drei ã laut Hausmann ã Kardinalthemen Liebe, Gemeinschaft und Gesellschaft um Emigrantenschicksal und Naturverbundenheit. An ihrem Ende steht der unwiederbringliche Verlust der Geliebten, das Chaos des spanischen Bû¥rgerkriegs und die neuerliche Flucht. Hyle entwickelt keine Utopie des freien Insel-Daseins, sondern macht das Leben als Geflecht von Tag- und NachttrûÊumen, Wunsch- und AngsttrûÊumen fassbar, im Widerspiel von subjektivem Erkenntnisdrang und objektiver Unerkennbarkeit der Welt. Carlfriedrich Claus, Hausmanns Briefpartner der 1960er Jahre, schrieb û¥ber Hyle: ãDiese Deine ãProsaã ist nicht ausschlieûlich statisch bestimmte, lediglich rindengesteuerte ãSpracheã, sondern sie ist SPRECHEN. Aus dem GESAMTEN Mikrokosmos Mensch, ja, nicht nur ihm, denkendes, empfindendes, wachsendes, auseinanderbrechendes, hindurchdrûÊngendes, bauendes, wirbelndes, erinnerndes, vorspû¥rendes SPRECHEN.ã Die HûÑrspielproduktion verbindet dieses Sprechen mit der Komposition Zeitbloms, mit filigranen Instrumentalspuren, elancholischen Cello-Melodien, fragilem Schlagzeug und kargen Gitarrendetails. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 16.07.2011
Datum: 16.07.2011Länge: 01:18:41 Größe: 72.05 MB |
||
| Kalle Laar: Distar oder Phobophobia - 08.07.2011 | ||
|
Mit Kalle Laar, Karl Jaspers, Louis Grote, Emil Frey, Max Bû¥rger, Paul Martini, Adolf Hottinger, Felix von Mikulicz-Radecki, Arthur Weber, Gerhard Domagk, Walter Brednow, Heinrich Gottron, Karl Heinrich Bauer, Ludwig Heilmeyer, Rudolf Schoen, Franz Bû¥chner, Hans Neuffer, Ernst Derra, Hans-Erhard Bock, Ferdinand Hoff, Hans von Kress, Rudolf Zenker, Hermann Eyer, Wolfgang Schadewaldt, Thomas Schnalke / Realisation: Kalle Laar / BR 2010 / LûÊnge: 51'45 // Ein Fundstû¥ck: Distar - Die Stimme des Arztes, eine Schallplattenserie aus den 1950ern herausgegeben vom Verlag Dr. Edmund Banaschewski, fortgesetzt bis Anfang der 70er Jahre. Ausgehend von Karl Jaspers Vortrag û¥ber ãDie Idee des Arztesã geht es um ãGesundheit und Zivilisationã und ãDie ûÊrztliche Verantwortung in unserer Zeitã. Kalle Laar befragt in seinem HûÑrspiel diese Dokumente als tûÑnendes Archiv der Idee des Heilens. Und begibt sich auf die Suche nach den Archiven der Krankheiten, forscht unter anderem im Medizinhistorischen Museum zu Berlin und im Museum fû¥r Sepulkral-Kultur in Kassel nach den verschiedenen Materialisationsformen der dazugehûÑrigen ûngste. In unserer zunehmend gesundheits-obsessiven Gesellschaft wû¥rde es keiner mehr wagen, nach der ãformenden Kraft der Krankheitã zu fragen wie Walter Brednow es in seinem Vortrag ãDer Kranke und seine Krankheitã tut. Wir nûÊhern uns dem durchgeformten und -genormten KûÑrper, der immer durchsichtiger wird und doch auch stets fremd bleibt. Hilft uns das Raunen dieser scheinbar so verstaubten Archive mûÑglicherweise, unserer ganz persûÑnlichen Angst vor der Angst zu begegnen, sie einzuordnen oder sogar neu zu erfinden? Auch der amerikanische Konzeptkû¥nstler Lawrence Weiner stellte sich seine eigene Diagnose: ãIãve got a case of Deutsche Angstã. Trotzdem handelt es sich mit Sicherheit nicht um einen lokalen Befund, am Beginn einer neuen Hygieneordnung, wo der KûÑrper stets neu vermessen sowie als zu anfûÊllig behandelt werden muss, wo die Pandemie immer schon an der nûÊchsten Ecke lauert und prophylaktisch besiegt werden will. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 08.07.2011
Datum: 08.07.2011Länge: 00:52:04 Größe: 47.68 MB |
||
| Ayako Mogi/Werner Penzel: Nomadomura, Awajishima, 800 km sû¥dlich. Aufzeichnungen nach einer Katastrophe - 01.07.2011 | ||
|
MESSAGE TO ALL OF THE FRIENDS IN JAPAN WITH CHILDREN: If you feel you need to take your children away from areas of existing or possible future radioactive contamination, you are welcome to come to NOMADOMURA on Awajishima. Any time day or night. Am 11. MûÊrz 2011, 14.46 Uhr Ortszeit, erschû¥ttert ein Erdbeben der StûÊrke 9,0 auf der Richterskala die Erde der japanischen Region TûÇhoku. Kurze Zeit darauf zerstûÑrt ein vom Beben ausgelûÑster 10 Meter hoher Tsunami die ûÑstlichen Kû¥stenregionen Japans und es kommt zu massiven UnfûÊllen in mehreren Atomkraftwerken, insbesondere in Fukushima: Die in Japan lebenden Filmemacher Ayako Mogi und Werner Penzel ûÑffnen unter den Eindrû¥cken der dreifachen Katastrophe ein altes Schulhaus auf der Insel Awajishima, 800 km sû¥dlich des Katastrophengebiets, fû¥r Flû¥chtlinge. Hier betreiben sie seit 2009 ein Kulturprojekt namens "Nomadomura", zu Deutsch "Nomadendorf". Jeden Tag treffen vor allem Frauen mit ihren Kindern aus dem Norden Japans ein, das GebûÊude gleicht schnell einer freundschaftlichen Notunterkunft. Die Bewohner der Schule wurden von der Redaktion HûÑrspiel und Medienkunst des Bayerischen Rundfunks gebeten, ihre Erlebnisse zu schildern: in Notizen, Tagebuchaufzeichnungen, Reflexionen, Erfahrungsberichten. Die vielfûÊltigen Blickwinkel und unterschiedlichen Wahrnehmungen in dieser kollektiven ErzûÊhlung konterkarieren auf eindrucksvolle Weise die mediale Berichterstattung, in der die Japaner die Katastrophe vermeintlich gelassen und pragmatisch annehmen. // Sprecher: Katja Schild, Christian Baumann, Franziska Ball, Katja Amberger, Alicia Marx, Annette Wunsch,Julia Franz, Burchard Dabinnus, Beate Himmelstroû, Rainer Buck, Susanne Schroeder / Texte von Kumi Aizawa, Samm Bennett, Haruna Ito, Io Lula Bennett-Ito, Shinobu Ito, Ben Matsuno, Nico Matsuno, Ayako Mogi, Yurie Nagashima, Hitomi Onishi, Takashi Serizawa / Aus dem Japanischen und Englischen von Alex Rû¥hle, Midori Satsutani, Anja Straûberger, Marlene Weiss, Tobias Limbach, Hiroko Limbach-Hashimoto, Carl-Ludwig Reichert / Komposition: Misa Shimomura / Regie: Bernhard Jugel / BR 2011 / LûÊnge: 56'10 We have the space and the resources to accommodate and feed your children and you. More information on our blog: www.nomadomura.net Ayako Mogi, Werner Penzel 11. MûÊrz 2011, 14.46 Uhr Ortszeit. Ein Erdbeben der StûÊrke 9,0 auf der Richterskala erschû¥ttert die Erde der japanischen Region T?hoku. Kurze Zeit darauf zerstûÑrt ein vom Beben ausgelûÑster 10 Meter hoher Tsunami die ûÑstlichen Kû¥stenregionen Japan und es kommt zu massiven UnfûÊllen in mehreren Atomkraftwerken, insbesondere in Fukushima: Die in Japan lebenden Filmemacher Ayako Mogi und Werner Penzel ûÑffnen unter den Eindrû¥cken der dreifachen Katastrophe mit einem Aufruf per Internet ein altes Schulhaus auf der Insel Awaja-Shima, 800 km sû¥dlich des Katastrophengebiets, fû¥r Flû¥chtlinge. Hier betreiben sie seit 2009 ein Kulturprojekt namens ãNomadomuraã, zu Deutsch ãNomadendorfã. Ein Name, der plûÑtzlich eine neue Bedeutung bekommt. Jeden Tag treffen vor allem Frauen mit ihren Kindern aus dem Norden Japans ein, das GebûÊude gleicht schnell einer freundschaftlichen Notunterkunft. Fû¥r Nahrung und einigermaûen komfortable Unterbringung ist gesorgt. Wie aber mit Verwirrung, Angst und Ungewissheit der Ankommenden umgehen? Wie lûÊsst sich reden û¥ber das Erfahrene, das medial permanent prûÊsent aber zuweilen unbeschreiblich ist? Die Bewohner der Schule wurden von der Redaktion HûÑrspiel und Medienkunst des Bayerischen Rundfunks gebeten, von ihren Erlebnissen zu berichten: in Notizen, Tagebuchaufzeichnungen, Reflexionen, Erfahrungsberichten. Einmal sehr nû¥chtern, ein anderes Mal voller û¥berraschender Bilder berichten die Betroffenen von der Erfahrung des Bebens, dem nicht mehr enden wollenden Gefû¥hl des Schwankens, der Angst vor RadioaktivitûÊt, der Unsicherheit û¥ber die VerlûÊsslichkeit der Medien, dem schweren Schritt zu fliehen, Missbilligung durch Verwandte und von dem Gefû¥hl der Ungewissheit darû¥ber, wie es weiter gehen soll. Die vielfûÊltigen Blickwinkel und unterschiedlichen Wahrnehmungen in dieser kollektiven ErzûÊhlung konterkarieren auf eindrucksvolle Weise die mediale Berichterstattung, in der die Japaner die Katastrophe vermeintlich gelassen und pragmatisch annehmen. Sie zeichnen ein eindrû¥ckliches Bild der Ereignisse und Entwicklungen in Japan. ãJapan war vor den Verwû¥stungen wie ein ruhig dahinlebendes, gleichbleibendes Dorf. Ich denke stûÊndig darû¥ber nach. Was wird aus Japan werden? Wie wird die Zukunft Japans aussehen?ã (Nico Matsuno, 9 Jahre) |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 01.07.2011
Datum: 01.07.2011Länge: 00:56:29 Größe: 51.72 MB |
||
| Norbert Lang: Die Perser als bimediale Inszenierung - 24.06.2011 | ||
| BR 2011 / LûÊnge: 47'31 // Werkstattsendung zu "Aischylos: Die Perser" (Regie: Johan Simons, BR HûÑrspiel und Medienkunst/Mû¥nchner Kammerspiele 2011) | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 24.06.2011
Datum: 24.06.2011Länge: 00:47:31 Größe: 43.50 MB |
||
| Andreas Neumeister/Lali Puna: MYA - ûber die Zukunft des Kapitalismus war alles bekannt - 10.06.2011 | ||
|
Mit Valerie Trebeljahr, Andreas Neumeister / Musik: Lali Puna (Christian Heiû/Valerie Trebeljahr/Markus Acher) / Realisation: Christian Heiû, Valerie Trebeljahr, Markus Acher, Andreas Neumeister / BR 2010 / LûÊnge: 44'10 // Das erste Jahrzehnt des fiebrig erwarteten neuen Jahrtausends war natû¥rlich in einem gefû¥hlten knappen Jahr vorbeigerast. In einem derart forcierten Tempo, dass sich wieder einmal grundgrû¥ndlich und minutenlang innehaltend û¥ber den sich rasant wandelnden Zeitbegriff Gedanken gemacht werden musste, sollte und endlich in diesem eng gesteckten Zeitfenster auch durfte. jetzt damals danke nein das Zeitloch, in dem wir leben der Zeitraffer, mit dem wir leben der Zeittunnel, durch den hindurch wir uns im Zeitraffer innerhalb eines gefû¥hlten Zeitlochs bewegen /
Satellitenfotos zeigen die Tagseite der Erde als bunt leuchtende picture disc im All. Satellitenfotos zeigen die Nachtseite der Erde als schwarzes Loch in der Zeit. Das erste Jahrzehnt des fiebrig erwarteten neuen Jahrtausends war natû¥rlich in einem gefû¥hlten knappen Jahr vorbeigerast. In einem derart forcierten Tempo, dass sich wieder einmal grundgrû¥ndlich und minutenlang innehaltend û¥ber den sich rasant wandelnden Zeitbegriff Gedanken gemacht werden musste, sollte und endlich in diesem eng gesteckten Zeitfenster auch durfte. Knappe Stunde unserer alten Zeitrechnung. Purer Luxus. Face. Facetime. Time. DDR for Double Data Rate. Der Beginn unseres guten alten Jahrtausends. A million years ago. ûber die Kapitalisierung des Kapitalmarkts war alles bekannt. Archaische Suchmaschinen waren den meisten von uns erst seit kurzem ein vager Begriff. BYA fû¥r billion years ago. (All times are Central European Time. All times are UTC plus one.) // |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 10.06.2011
Datum: 10.06.2011Länge: 00:44:29 Größe: 40.74 MB |
||
| Eran Schaerf: Die ungeladene Zeugin (Folge #08) - 05.06.2011 | ||
| Realisation: Eran Schaerf / Mit Achim Bogdahn / BR 2011 / LûÊnge: 01'04 | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 05.06.2011
Datum: 05.06.2011Länge: 00:01:04 Größe: 0.99 MB |
||
| Eran Schaerf: Die ungeladene Zeugin (Folge #15a) - 05.06.2011 | ||
| Realistation: Eran Schaerf / Mit Achim Bogdahn / BR 2011 / LûÊnge: 02'16 | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 05.06.2011
Datum: 05.06.2011Länge: 00:02:16 Größe: 2.08 MB |
||
| Eran Schaerf: Die ungeladene Zeugin (Folge #07) - 05.06.2011 | ||
| Realisation: Eran Schaerf / Mit Marina Marosch / BR 2011 / LûÊnge: 01'56 | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 05.06.2011
Datum: 05.06.2011Länge: 00:01:56 Größe: 1.78 MB |
||
| Eran Schaerf: Die ungeladene Zeugin (Folge #03) - 05.06.2011 | ||
| Realisation: Eran Schaerf / Mit Peter Veit / BR 2011 / LûÊnge: 02'40 | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 05.06.2011
Datum: 05.06.2011Länge: 00:02:40 Größe: 2.45 MB |
||
| Eran Schaerf: Die ungeladene Zeugin (Folge #20) - 05.06.2011 | ||
| Realisation: Eran Schaerf / Mit Achim Bogdahn / BR 2011/ LûÊnge: 01'10 | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 05.06.2011
Datum: 05.06.2011Länge: 00:01:10 Größe: 1.08 MB |
||
| Eran Schaerf: Die ungeladene Zeugin - 05.06.2011 | ||
| Mit Marina Marosch, Achim Bogdahn, Silvie Sperlich, Peter Veit / Realisation: Eran Schaerf / BR 2011 / LûÊnge: 42'10 // "Wer? Ein israelischer Aktivist. Internationaler Presse zufolge handelt es sich jedoch um Robin Hood. Was? Ein Versuch, MilitûÊrbulldozer daran zu hindern, HûÊuser von palûÊstinensischen Beduinen zu zerstûÑren, Ausschreitung und Teilnahme an einer verbotenen Versammlung, sagt die Anklage. Wo? In Print- und Onlinemedien, teilweise auch in den von Israel besetzten Gebieten, in einem Distriktgericht in Jerusalem oder an der Grenze zwischen MûÊrchen und Berichterstattung. Wo? In der israelischen Nachrichtenagentur gibt es keine ãbesetzten Gebieteã. Es gibt ãverwaltete Gebieteã, ãJudûÊa und Samariaã, ãdie Gebieteã ã hilfreiche Termini, um die Vorstellung zu bewahren, dass Israelis die Opfer sind und stets in Selbstverteidigung handeln. Wann? Das geht zurû¥ck auf die offiziellen Richtlinien der israelischen RundfunkbehûÑrde, die 1972 zusammengestellt und seitdem dreimal aktualisiert wurden. Darin wurde auch festgelegt, dass der Terminus ãOst-Jerusalemã nicht mehr gebraucht werden darf. Wo? Das frage ich mich auch. Folgt man der israelischen Presse, darf wohl der Aktivist in den besetzten Gebieten nicht agiert haben, folgt man der internationalen Presse, wûÊre er in einem VolksmûÊrchen besser aufgehoben. Wie? Er legte sich vor die Bulldozer auf den Boden. Warum? Nicht aus politischer ûberzeugung, aus Anstandsgefû¥hl, sagt er. Woher? Er kam aus dem Irak nach Israel. Hintergrû¥nde? Die Sprache bedeckt nicht genau den Bereich, den sie bezeichnet ã und stellenweise bedeckt sie ihn mit mehreren Falten. Manche Termini werden gebraucht, um einen Gegenstand zu verschleiern, andere werden nicht gebraucht, um seine Existenz zu leugnen. ZusammenhûÊnge? Perverse Verbindungen zwischen Zensur und Poesie. NûÊhere Einzelheiten? Einen israelischen Aktivisten als ãRobin Hood der Westbankã zu bezeichnen, setzt lediglich jene israelische Politik fort, die die Zukunft der palûÊstinensischen Territorien als VolksmûÊrchen erzûÊhlt, sagt RotkûÊppchen in einem Interview. Wer? RotkûÊppchen, die MûÊrchenfigur. Wann? Nachdem sie begonnen hat, auûerhalb von MûÊrchenformaten zu agieren. Wo? Bereits in einer italienischen Version des RotkûÊppchen-MûÊrchens gelingt es der Protagonistin durch eine List, sich selbst zu retten, statt dem JûÊger û¥berantwortet zu sein. Als bei ihrer Animation fû¥r eine US amerikanische Action-Comedy ein Fehler auftritt, beginnt das MûÊdchen sich in TagesaktualitûÊten einzumischen. Wie? Sie findet Gefallen an der Vorstellung, dass sie die Rolle des Opfers nicht mehr zu spielen hat. Ob sie bei dem Prozess gegen den israelischen Aktivisten die ungeladene Zeugin spielen wird, teilte der Bayerische Rundfunk nicht mit. HûÑrt sich das wie Nachrichten an? Vielleicht ist es ein HûÑrspiel.ã (Eran Schaerf) | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 05.06.2011
Datum: 05.06.2011Länge: 00:42:28 Größe: 38.89 MB |
||
| Michael Farin/zeitblom: Berlin(Frau)Sinfonie - 27.05.2011 | ||
|
Gesang: Nadeshda Brennicke, Alexandra Marisa Wilcke, Joachim Witt / Background Vocals: Liesa van der Aa, Katrin Lohmann, Susanne Franzmeyer / Musik: Ali Askin (Keyboards), Steve Heather (Schlagzeug), Boram Lie (Cello), Martin Siewert (Gitarre), Michael Weilacher (Percussion), zeitblom (Bass) / Komposition: zeitblom / Realisation: Michael Farin/zeitblom / BR 2011 / LûÊnge: 53'46 // Im Herbst 2010 wurden in Berlin mittels Inseraten 19 junge Frauen fû¥r dieses HûÑrspielprojekt gesucht und gefunden. Die Teilnehmerinnen wurden fû¥r ein 20-minû¥tiges GesprûÊch ins Tonstudio gebeten. Die Aussagen werden in Songstrukturen gebracht und von PopsûÊnger(inne)n interpretiert. Ob Zuckerfest oder der Tod des Vaters, ob quûÊlende Einsamkeit in einer fremden unendlich groûen Stadt oder glû¥ckliches Zusammensein mit Freunden, ob Disco-NûÊchte oder zerbrochene Familie: als Song ist alles anders. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 27.05.2011
Datum: 27.05.2011Länge: 00:53:46 Größe: 49.24 MB |
||
| Michael Farin/zeitblom: Berlin(Frau)O-Ton - 20.05.2011 | ||
| Komposition: zeitblom / Realisation: Michael Farin/zeitblom / BR 2011 / LûÊnge: 52'39 // Im Herbst 2010 wurden in Berlin mittels Inseraten in Printmedien und mit AushûÊngen 19 junge Frauen fû¥r dieses HûÑrspielprojekt gesucht und gefunden. Die Teilnehmerinnen wurden fû¥r ein 20-minû¥tiges GesprûÊch in ein Tonstudio gebeten. Von jeder Aufzeichnung wurde ein etwa 3 Minuten langer Originalton ausgewûÊhlt und mit Musik verwoben. Entstehen sollte ein Zeitbild, ein Abbild der LebensrealitûÊt junger Frauen von heute. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 20.05.2011
Datum: 20.05.2011Länge: 00:52:39 Größe: 48.21 MB |
||
| Ferdinand Kriwet: Rotor - 13.05.2011 | ||
| Mit Michael Lentz / Sampling: Gunnar Geisse / Realisation: Michael Lentz / BR 2011 / LûÊnge: 54'00 // In dem HûÑrspiel nach Ferdinand Kriwets 1961 erschienener Prosa Rotor wird der Titel zu einem ûÊsthetischen Prinzip. Der Sprecher Michael Lentz rotiert und mit ihm der ZuhûÑrer. Der gesamte Text wurde von Lentz als û¥ber dreistû¥ndige Lesung aufgenommen. Aus diesem Ton-Material wurde die HûÑrspielfassung realisiert. Es wurden weder Kû¥rzungen vorgenommen noch fremde Sounds oder Soundeffekte verwendet, stattdessen wurde mit extremer Beschleunigung gearbeitet. Der Monolog eines drauflos plappernden Ichs zwischen kataraktartigem Rasen und scheinbar nicht von der Stelle kommendem Stottern versucht zwar, sich dem GeschichtenerzûÊhlen zu verweigern: ãlass mich in ruhe mit geschichten und leuten die geschichten erzûÊhlenã. Allein aber mittels emphatischer Wiederholung und der sich selbst sezierenden Rede werden tausend und eine Geschichte erzûÊhlt. Im Redefluss Angeschwemmtes wie Kindheitserinnerungen, Erinnerungen an Freunde oder Deutschlandbilder wird von diesem Ich sogleich verarbeitet: zerlegt, gedreht, gewendet und neu kombiniert, als ginge es immerfort um Leben und Tod. So werden auch SprichwûÑrter auseinandergenommen, û¥berhaupt wird diesem Ich alles zur Redensart. Es gilt das Prinzip ãdurchredenã ã komme, was wolle: ãauch ein wortweltmeister schafft dichtung auf exã, ãdurchredenã verhindert hoffentlich ãdurchdrehenã, schlieûlich ist ãdurchstehnã ãallesã. Interpunktion erû¥brigt sich. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 13.05.2011
Datum: 13.05.2011Länge: 00:54:19 Größe: 49.74 MB |
||
| Wolfgang Mû¥ller: WûÙsk niwûÀhsen wûÙsk nikahseriiû´:take kanien'kûˋha wa'katûˋweienste oder Learning Mohawk in fifty-five Minutes - 06.05.2011 | ||
| Mit Wolfgang Mû¥ller, Akwiratûˋkha Martin, Claudia Urbschat-Mingues, David Nathan / Realisation: Wolfgang Mû¥ller / BR 2010 / LûÊnge: 51'12 // Im Jahr 2002 begegnet Wolfgang Mû¥ller in ReykjavûÙk Akwiratûˋkha Martin. Sie entdecken dabei ihre gemeinsame Faszination fû¥r Nico, alias Christa Paeffgen, der in Lû¥bbenau an der Spree aufgewachsenen SûÊngerin von Velvet Underground. // Akwiratûˋkha besucht vier Jahre spûÊter Wolfgang Mû¥ller in Berlin-Kreuzberg. Zusammen radeln sie zu Nicos Grab - auf dem Friedhof der Namenlosen in einer Waldlichtung an der Havel. Drei Jahre darauf verabreden sie sich bei Akwiratûˋkha in Kahnwa:ke Mohawk Territory, einer Siedlung am Sû¥dufer des St. Lorenz-Stroms gegenû¥ber Montreal. Akwiratûˋkha erwirbt ein elektrisches Harmonium und û¥bersetzt Nicos Song I'll be your mirror auf Kanien'kûˋha - eine Sprache, die ca. zweitausend û¥berwiegend ûÊltere Menschen beherrschen. Und eine Sprache, die seit einigen Jahren wieder zunehmend jû¥ngere Menschen erlernen. Die Selbstbezeichnung der Mohawk ist Kanien'kehûÀ:ka. Die Sprache der Kanien'kehûÀ:ka nennt sich Kanien'kûˋha. Mohawk lernen in 55 Minuten: Eine transatlantische Spiegelschule, die Raumsynergien erfahren lûÊsst. // | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 06.05.2011
Datum: 06.05.2011Länge: 00:51:10 Größe: 46.85 MB |
||
| Kilian Leypold: Schwarzer Hund. Weiûes Gras - 29.04.2011 | ||
|
Wo der Mensch Lebens- und ZivilisationsrûÊume zerstûÑrt, zieht er ZûÊune hoch und zirkelt Todeszonen ab. Als sich am 26. April 1986 auf dem Gebiet der heutigen Ukraine in Tschernobyl der grûÑûte anzunehmende Unfall in einem Kernkraftwerk ereignet entsteht so eine Zone. Der Film Stalker von 1979 wirkt wie eine ahnungsvolle Prophezeihung dieser Katastrophe. Als der Regisseur Andrej Tarkovskij den Film acht Jahre vor dem Unglû¥ck drehte, entschied er sich unter anderem fû¥r die direkte Umgebung des Atomkraftwerkes Tschernobyl als Drehort fû¥r die Geschichte von drei MûÊnnern, die in ein abgesperrtes Gebiet voller tûÑdlicher Gefahren, genannt "die Zone", eindringen, um dort zu einem geheimnisvollen Raum zu gelangen, der innerste und verborgenste Wû¥nsche ans Licht bringt und zu erfû¥llen vermag. Die zufûÊllige, doch darum nicht weniger rûÊtselhafte Analogie dieser beiden Zonen ist Ausgangspunkt fû¥r das HûÑrspiel Schwarzer Hund. Weiûes Gras, das Elemente aus Tarkovskijs Film aufgreift und mit einer fiktiven Handlung um das Unglû¥ck von Tschernobyl verwebt. Ein ehemaliger Kriegsfotograf, einer der ersten Augenzeugen der Katastrophe, macht sich ein letztes Mal auf den Weg in das verseuchte Gebiet. Die Reise ins Herz der Zone wird zur erneuten Konfrontation mit den Folgen des Unglû¥cks und zugleich zur Suche nach einem Wunder, die erst durch das Zusammentreffen mit Martha beendet wird, der strahlungsgeschûÊdigten Tochter des Stalker. // Mit Vincent Leittersdorf, Maria Kwiatkowsky, Otto Mellies, Kathrin Wehlisch, Lars Rudolph, Julian Mehne, Andreas Leupold, Carl Heinz Choynski / Komposition: Tarwater / Regie: Kai Grehn / BR 2011 / LûÊnge: 54'31 Der Film Stalker von 1979 wirkt wie eine ahnungsvolle Prophezeihung dieser Katastrophe. Als der Regisseur Andrej Tarkovskij den Film acht Jahre vor dem Unglû¥ck drehte, entschied er sich unter anderem fû¥r die direkte Umgebung des Atomkraftwerkes Tschernobyl als Drehort fû¥r die Geschichte von drei MûÊnnern, die in ein abgesperrtes Gebiet voller tûÑdlicher Gefahren, genannt ãdie Zoneã, eindringen, um dort zu einem geheimnisvollen Raum zu gelangen, der innerste und verborgenste Wû¥nsche ans Licht bringt und zu erfû¥llen vermag. Die zufûÊllige, doch darum nicht weniger rûÊtselhafte Analogie dieser beiden Zonen ist Ausgangspunkt fû¥r das HûÑrspiel Schwarzer Hund. Weiûes Gras, das Elemente aus Tarkovskijs Film aufgreift und mit einer fiktiven Handlung um das Unglû¥ck von Tschernobyl verwebt. Ein ehemaliger Kriegsfotograf, einer der ersten Augenzeugen der Katastrophe, macht sich, nachdem er den GAU und seine Folgen û¥ber zwanzig Jahre hinweg dokumentiert hat, ein letztes Mal auf den Weg in das verseuchte Gebiet. Er hat einen Tipp bekommen und ist auf der Jagd nach einem letzten sensationellen Foto. Die Reise ins Herz der Zone wird zur erneuten Konfrontation mit den Folgen des Unglû¥cks und zugleich zur Suche nach einem Wunder, die erst durch das Zusammentreffen mit Martha beendet wird, der strahlungsgeschûÊdigten Tochter des Stalker. Der Aufbruch in die Zone stellt die menschliche Zivilisation in Frage und reflektiert zugleich die Chancen einer kû¥nstlerischen Erfassung vom Wesen und Sinn des Lebens.
Das Stû¥ck ist dem rumûÊnischen Fotografen Igor Kostin gewidmet. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 29.04.2011
Datum: 29.04.2011Länge: 00:54:50 Größe: 50.21 MB |
||
| Michael Farin: Kunst und Schuld - 25.03.2011 | ||
| Mit Michael Farin, Thomas Thieme / BR 2011 / LûÊnge: 09'10 // Einfû¥hrung zu Thomas Harlans HûÑrspielmonolog "Veit" | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 25.03.2011
Datum: 25.03.2011Länge: 00:09:10 Größe: 8.40 MB |
||
| ARD Radio Tatort: Robert Hû¥ltner: Vanitas - 16.03.2011 | ||
| Mit Florian Karlheim, Brigitte Hobmeier, Michael A. Grimm, Peter Rappenglû¥ck, Hans-Georg Panczak, Gisela Schneeberger, Eisi Gulp, Stephan Zinner, Robert Giggenbach, Sigi Zimmerschied, Krista Posch, Wiebke Puls, Christian Lex, Sepp Schauer, Tommi Piper, Michael Schwarzmaier, Wilfried Hauer, Friedrich Schloffer, Christian Baumann, Susanne SchrûÑder, Florian Schrei / Komposition: zeitblom / Regie: Ulrich Lampen / BR 2011 / LûÊnge: 53'56 // Ein Bauer aus dem Umland macht beim Pflû¥gen eine ungewûÑhnliche Entdeckung. Die Beamten der Brucker Polizeiinspektion, denen er seinen Fund zeigt, sind ratlos: Handelt es sich bei dem uralten und verwitterten Objekt um Diebesgut? Oder um ein antikes Schmuckstû¥ck? Das Denkmalamt wird eingeschaltet. Wenig spûÊter trifft eine energische junge ArchûÊologin in Bruck ein, die sofort mit der Untersuchung der Fundstelle beginnt. Bald machen Gerû¥chte von einer wissenschaftlichen Sensation die Runde. Dann aber wird die Grabung durch einen mysteriûÑsen Unfall unterbrochen, der einem Mitarbeiter fast das Leben kostet. Senta und Rudi sind mehr als skeptisch, als die ArchûÊologin die Vermutung ûÊuûert, es kûÑnne sich um einen Anschlag gehandelt haben. Immerhin erfahren die Beamten dabei, welche Sensation sich die Wissenschaftlerin von dieser Grabung verspricht: Mit ihr kûÑnne mûÑglicherweise endlich die Existenz der sagenumwobenen Vaskonen belegt werden, eines Volkes, dessen Kultur einst û¥ber ganz Europa verbreitet gewesen sein soll. Senta und Rudi finden das nicht uninteressant, kûÑnnen darin aber noch immer kein Motiv fû¥r einen Anschlag erkennen. Es gelingt ihnen, die aufgebrachte Grabungsleiterin zunûÊchst zu beruhigen. Doch am û¥bernûÊchsten Morgen ist die Grabungsstelle verwû¥stet, der Container der ArchûÊologin ausgebrannt. Wichtige Unterlagen und Instrumente sind verschwunden. Die Brucker Beamten erkennen, dass sie die Situation falsch eingeschûÊtzt haben. Senta und Rudi beginnen zu ermitteln. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 16.03.2011
Datum: 16.03.2011Länge: 00:53:56 Größe: 49.39 MB |
||
| Franz Kafka: Der Process - Im Dom - 28.01.2011 | ||
| Mit Manfred Zapatka, Rufus Beck, Corinna Harfouch, Samuel Finzi, Jeanette Spassova / Ton: Andreas Meinetsberger / Regie: Klaus Buhlert / BR 2010/ LûÊnge: 64'35 // Josef K. wird der Prozess gemacht. Er weiû nicht wofû¥r, jemand muss ihn verleumdet haben. Die 12-teilige BR-HûÑrspielproduktion von Klaus Buhlert basiert auf Kafkas handschriftlichen Manuskripten und versteht sich als eine Auseinandersetzung mit dem Fragment gebliebenen Werk. Das Konzept, 16 files ohne eine eindeutige Reihenfolge anzubieten, entspricht dem der historisch-kritischen Ausgabe sûÊmtlicher Handschriften, Drucke und Typoskripte zu Franz Kafkas fragmentarischem Werk Der Process, die Roland Reuû und Peter Staengle 1997 im Verlag Stroemfeld/Roter Stern publizierten. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 28.01.2011
Datum: 28.01.2011Länge: 01:05:40 Größe: 60.13 MB |
||
| Franz Kafka: Der Process - Ende - 28.01.2011 | ||
| Mit Thomas Thieme, Corinna Harfouch / Ton: Andreas Meinetsberger / Regie: Klaus Buhlert / BR 2010 / LûÊnge: 16'40 // Josef K. wird der Prozess gemacht. Er weiû nicht wofû¥r, jemand muss ihn verleumdet haben. Die BR-HûÑrspielproduktion von Klaus Buhlert basiert auf Kafkas handschriftlichen Manuskripten und versteht sich als eine Auseinandersetzung mit dem Fragment gebliebenen Werk. Das Konzept, 16 files ohne eine eindeutige Reihenfolge anzubieten, entspricht dem der historisch-kritischen Ausgabe sûÊmtlicher Handschriften, Drucke und Typoskripte zu Franz Kafkas fragmentarischem Werk Der Process, die Roland Reuû und Peter Staengle 1997 im Verlag Stroemfeld/Roter Stern publizierten. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 28.01.2011
Datum: 28.01.2011Länge: 00:17:23 Größe: 15.93 MB |
||
| Franz Kafka: Der Process - Staatsanwalt - 21.01.2011 | ||
| Mit Manfred Zapatka, Jeanette Spassova, Samuel Finzi / Ton: Andreas Meinetsberger / Regie: Klaus Buhlert / BR 2010 / LûÊnge: 16'06 // Josef K. wird der Prozess gemacht. Er weiû nicht wofû¥r, jemand muss ihn verleumdet haben. Die BR-HûÑrspielproduktion von Klaus Buhlert basiert auf Kafkas handschriftlichen Manuskripten und versteht sich als eine Auseinandersetzung mit dem Fragment gebliebenen Werk. Das Konzept, 16 files ohne eine eindeutige Reihenfolge anzubieten, entspricht dem der historisch-kritischen Ausgabe sûÊmtlicher Handschriften, Drucke und Typoskripte zu Franz Kafkas fragmentarischem Werk Der Process, die Roland Reuû und Peter Staengle 1997 im Verlag Stroemfeld/Roter Stern publizierten. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 21.01.2011
Datum: 21.01.2011Länge: 00:16:42 Größe: 15.30 MB |
||
| Franz Kafka: Der Process - Das Haus - 21.01.2011 | ||
| Mit Manfred Zapatka, Milan Peschel / Ton: Andreas Meinetsberger / Regie: Klaus Buhlert / BR 2010 / LûÊnge: 13'08 // Josef K. wird der Prozess gemacht. Er weiû nicht wofû¥r, jemand muss ihn verleumdet haben. Die BR-HûÑrspielproduktion von Klaus Buhlert basiert auf Kafkas handschriftlichen Manuskripten und versteht sich als eine Auseinandersetzung mit dem Fragment gebliebenen Werk. Das Konzept, 16 files ohne eine eindeutige Reihenfolge anzubieten, entspricht dem der historisch-kritischen Ausgabe sûÊmtlicher Handschriften, Drucke und Typoskripte zu Franz Kafkas fragmentarischem Werk Der Process, die Roland Reuû und Peter Staengle 1997 im Verlag Stroemfeld/Roter Stern publizierten. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 21.01.2011
Datum: 21.01.2011Länge: 00:12:30 Größe: 11.46 MB |
||
| Franz Kafka: Der Process - Kaufmann Beck / Kû¥ndigung des Advokaten - 14.01.2011 | ||
| Mit Manfred Zapatka, Corinna Harfouch, Samuel Finzi, Milan Peschel / Ton: Andreas Meinetsberger / Regie: Klaus Buhlert / BR 2010 / LûÊnge: 78'00 // Josef K. wird der Prozess gemacht. Er weiû nicht wofû¥r, jemand muss ihn verleumdet haben. Die BR-HûÑrspielproduktion von Klaus Buhlert basiert auf Kafkas handschriftlichen Manuskripten und versteht sich als eine Auseinandersetzung mit dem Fragment gebliebenen Werk. Das Konzept, 16 files ohne eine eindeutige Reihenfolge anzubieten, entspricht dem der historisch-kritischen Ausgabe sûÊmtlicher Handschriften, Drucke und Typoskripte zu Franz Kafkas fragmentarischem Werk Der Process, die Roland Reuû und Peter Staengle 1997 im Verlag Stroemfeld/Roter Stern publizierten. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 14.01.2011
Datum: 14.01.2011Länge: 01:18:05 Größe: 71.49 MB |
||
| Franz Kafka: Der Process - Fahrt zur Mutter - 07.01.2011 | ||
| Mit Jû¥rgen Holtz, Jeanette Spassova, Samuel Finzi / Ton: Andreas Meinetsberger / Regie: Klaus Buhlert / BR 2010 / LûÊnge: 10'45 // Josef K. wird der Prozess gemacht. Er weiû nicht wofû¥r, jemand muss ihn verleumdet haben. Die BR-HûÑrspielproduktion von Klaus Buhlert basiert auf Kafkas handschriftlichen Manuskripten und versteht sich als eine Auseinandersetzung mit dem Fragment gebliebenen Werk. Das Konzept, 16 files ohne eine eindeutige Reihenfolge anzubieten, entspricht dem der historisch-kritischen Ausgabe sûÊmtlicher Handschriften, Drucke und Typoskripte zu Franz Kafkas fragmentarischem Werk Der Process, die Roland Reuû und Peter Staengle 1997 im Verlag Stroemfeld/Roter Stern publizierten. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 07.01.2011
Datum: 07.01.2011Länge: 00:11:14 Größe: 10.30 MB |
||
| Franz Kafka: Der Process - Zu Elsa - 31.12.2010 | ||
| Mit Samuel Finzi, Manfred Zapatka, Jeanette Spassova / Ton: Andreas Meinetsberger / Regie: Klaus Buhlert / BR 2010 / LûÊnge: 4'25 // Josef K. wird der Prozess gemacht. Er weiû nicht wofû¥r, jemand muss ihn verleumdet haben. Die BR-HûÑrspielproduktion von Klaus Buhlert basiert auf Kafkas handschriftlichen Manuskripten und versteht sich als eine Auseinandersetzung mit dem Fragment gebliebenen Werk. Das Konzept, 16 files ohne eine eindeutige Reihenfolge anzubieten, entspricht dem der historisch-kritischen Ausgabe sûÊmtlicher Handschriften, Drucke und Typoskripte zu Franz Kafkas fragmentarischem Werk Der Process, die Roland Reuû und Peter Staengle 1997 im Verlag Stroemfeld/Roter Stern publizierten. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 31.12.2010
Datum: 31.12.2010Länge: 00:05:04 Größe: 4.64 MB |
||
| Franz Kafka: Der Process - Advokat/Fabrikant/Maler - 31.12.2010 | ||
| Mit Manfred Zapatka, Rufus Beck, Samuel Finzi, Jeanette Spassova / Ton: Andreas Meinetsberger / Regie: Klaus Buhlert / BR 2010 / LûÊnge: 128'19 // Josef K. wird der Prozess gemacht. Er weiû nicht wofû¥r, jemand muss ihn verleumdet haben. Die BR-HûÑrspielproduktion von Klaus Buhlert basiert auf Kafkas handschriftlichen Manuskripten und versteht sich als eine Auseinandersetzung mit dem Fragment gebliebenen Werk. Das Konzept, 16 files ohne eine eindeutige Reihenfolge anzubieten, entspricht dem der historisch-kritischen Ausgabe sûÊmtlicher Handschriften, Drucke und Typoskripte zu Franz Kafkas fragmentarischem Werk Der Process, die Roland Reuû und Peter Staengle 1997 im Verlag Stroemfeld/Roter Stern publizierten. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 31.12.2010
Datum: 31.12.2010Länge: 02:06:14 Größe: 115.57 MB |
||
| Franz Kafka: Der Process - Kampf mit Dir Stellv. - 31.12.2010 | ||
| Mit Manfred Zapatka, Samuel Finzi / Ton: Andreas Meinetsberger / Regie: Klaus Buhlert / BR 2010 / LûÊnge: 13'18 // Josef K. wird der Prozess gemacht. Er weiû nicht wofû¥r, jemand muss ihn verleumdet haben. Die BR-HûÑrspielproduktion von Klaus Buhlert basiert auf Kafkas handschriftlichen Manuskripten und versteht sich als eine Auseinandersetzung mit dem Fragment gebliebenen Werk. Das Konzept, 16 files ohne eine eindeutige Reihenfolge anzubieten, entspricht dem der historisch-kritischen Ausgabe sûÊmtlicher Handschriften, Drucke und Typoskripte zu Franz Kafkas fragmentarischem Werk Der Process, die Roland Reuû und Peter Staengle 1997 im Verlag Stroemfeld/Roter Stern publizierten. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 31.12.2010
Datum: 31.12.2010Länge: 00:13:50 Größe: 12.67 MB |
||
| Franz Kafka: Der Process - Als sie aus dem Teater traten - 31.12.2010 | ||
| Mit Jû¥rgen Holtz, Samuel Finzi / Ton: Andreas Meinetsberger / Regie: Klaus Buhlert / BR 2010 / LûÊnge: 3'00 // Josef K. wird der Prozess gemacht. Er weiû nicht wofû¥r, jemand muss ihn verleumdet haben. Die BR-HûÑrspielproduktion von Klaus Buhlert basiert auf Kafkas handschriftlichen Manuskripten und versteht sich als eine Auseinandersetzung mit dem Fragment gebliebenen Werk. Das Konzept, 16 files ohne eine eindeutige Reihenfolge anzubieten, entspricht dem der historisch-kritischen Ausgabe sûÊmtlicher Handschriften, Drucke und Typoskripte zu Franz Kafkas fragmentarischem Werk Der Process, die Roland Reuû und Peter Staengle 1997 im Verlag Stroemfeld/Roter Stern publizierten. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 31.12.2010
Datum: 31.12.2010Länge: 00:03:42 Größe: 3.39 MB |
||
| Franz Kafka: Der Process - Der Onkel / Leni - 31.12.2010 | ||
| Mit Manfred Zapatka, Jû¥rgen Holtz, Corinna Harfouch, Samuel Finzi, Jeanette Spassova / Ton: Andreas Meinetsberger / Regie: Klaus Buhlert / BR 2010 / LûÊnge: 55'45 // Josef K. wird der Prozess gemacht. Er weiû nicht wofû¥r, jemand muss ihn verleumdet haben. Die BR-HûÑrspielproduktion von Klaus Buhlert basiert auf Kafkas handschriftlichen Manuskripten und versteht sich als eine Auseinandersetzung mit dem Fragment gebliebenen Werk. Das Konzept, 16 files ohne eine eindeutige Reihenfolge anzubieten, entspricht dem der historisch-kritischen Ausgabe sûÊmtlicher Handschriften, Drucke und Typoskripte zu Franz Kafkas fragmentarischem Werk Der Process, die Roland Reuû und Peter Staengle 1997 im Verlag Stroemfeld/Roter Stern publizierten. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 31.12.2010
Datum: 31.12.2010Länge: 00:55:34 Größe: 50.89 MB |
||
| Franz Kafka: Der Process - Jemand musste Josef K. verlûÊumdet haben - 27.12.2010 | ||
| Mit Samuel Finzi, Corinna Harfouch, Jeanette Spassova, Thomas Thieme / Ton: Andreas Meinetsberger / Regie: Klaus Buhlert / BR 2010 / LûÊnge: 73'12 // Josef K. wird der Prozess gemacht. Er weiû nicht wofû¥r, jemand muss ihn verleumdet haben. Die BR-HûÑrspielproduktion von Klaus Buhlert basiert auf Kafkas handschriftlichen Manuskripten und versteht sich als eine Auseinandersetzung mit dem Fragment gebliebenen Werk. Das Konzept, 16 files ohne eine eindeutige Reihenfolge anzubieten, entspricht dem der historisch-kritischen Ausgabe sûÊmtlicher Handschriften, Drucke und Typoskripte zu Franz Kafkas fragmentarischem Werk Der Process, die Roland Reuû und Peter Staengle 1997 im Verlag Stroemfeld/Roter Stern publizierten. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 27.12.2010
Datum: 27.12.2010Länge: 01:14:07 Größe: 67.86 MB |
||
| Franz Kafka: Der Process - B's Freundin - 24.12.2010 | ||
| Mit Manfred Zapatka, Corinna Harfouch, Samuel Finzi, Rufus Beck / Ton: Andreas Meinetsberger / Regie: Klaus Buhlert / BR 2010 / LûÊnge: 21'42 // Josef K. wird der Prozess gemacht. Er weiû nicht wofû¥r, jemand muss ihn verleumdet haben. Die BR-HûÑrspielproduktion von Klaus Buhlert basiert auf Kafkas handschriftlichen Manuskripten und versteht sich als eine Auseinandersetzung mit dem Fragment gebliebenen Werk. Das Konzept, 16 files ohne eine eindeutige Reihenfolge anzubieten, entspricht dem der historisch-kritischen Ausgabe sûÊmtlicher Handschriften, Drucke und Typoskripte zu Franz Kafkas fragmentarischem Werk Der Process, die Roland Reuû und Peter Staengle 1997 im Verlag Stroemfeld/Roter Stern publizierten. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 24.12.2010
Datum: 24.12.2010Länge: 00:21:23 Größe: 19.58 MB |
||
| Franz Kafka: Der Process - Im leeren Sitzungssaal - 24.12.2010 | ||
| Mit Manfred Zapatka, Corinna Harfouch, Milan Peschel, Rufus Beck, Thomas Thieme / Ton: Andreas Meinetsberger / Regie: Klaus Buhlert / BR 2010 / LûÊnge: 71'46 // Josef K. wird der Prozess gemacht. Er weiû nicht wofû¥r, jemand muss ihn verleumdet haben. Die BR-HûÑrspielproduktion von Klaus Buhlert basiert auf Kafkas handschriftlichen Manuskripten und versteht sich als eine Auseinandersetzung mit dem Fragment gebliebenen Werk. Das Konzept, 16 files ohne eine eindeutige Reihenfolge anzubieten, entspricht dem der historisch-kritischen Ausgabe sûÊmtlicher Handschriften, Drucke und Typoskripte zu Franz Kafkas fragmentarischem Werk Der Process, die Roland Reuû und Peter Staengle 1997 im Verlag Stroemfeld/Roter Stern publizierten. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 24.12.2010
Datum: 24.12.2010Länge: 01:01:21 Größe: 56.18 MB |
||
| Franz Kafka: Der Process - Erste Untersuchung - 24.12.2010 | ||
| Mit Milan Peschel, Corinna Harfouch, Samuel Finzi, Manfred Zapatka / Ton: Andreas Meinetsberger / Regie: Klaus Buhlert / BR 2010 / LûÊnge: 41'08 // Josef K. wird der Prozess gemacht. Er weiû nicht wofû¥r, jemand muss ihn verleumdet haben. Die BR-HûÑrspielproduktion von Klaus Buhlert basiert auf Kafkas handschriftlichen Manuskripten und versteht sich als eine Auseinandersetzung mit dem Fragment gebliebenen Werk. Das Konzept, 16 files ohne eine eindeutige Reihenfolge anzubieten, entspricht dem der historisch-kritischen Ausgabe sûÊmtlicher Handschriften, Drucke und Typoskripte zu Franz Kafkas fragmentarischem Werk Der Process, die Roland Reuû und Peter Staengle 1997 im Verlag Stroemfeld/Roter Stern publizierten. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 24.12.2010
Datum: 24.12.2010Länge: 00:40:42 Größe: 37.27 MB |
||
| Franz Kafka: Der Process - Der Prû¥gler - 24.12.2010 | ||
| Mit Thomas Thieme, Corinna Harfouch, Jeanette Spassova/ Ton: Andreas Meinetsberger / Regie: Klaus Buhlert / BR 2010 / LûÊnge: 19'17 // Josef K. wird der Prozess gemacht. Er weiû nicht wofû¥r, jemand muss ihn verleumdet haben. Die BR-HûÑrspielproduktion von Klaus Buhlert basiert auf Kafkas handschriftlichen Manuskripten und versteht sich als eine Auseinandersetzung mit dem Fragment gebliebenen Werk. Das Konzept, 16 files ohne eine eindeutige Reihenfolge anzubieten, entspricht dem der historisch-kritischen Ausgabe sûÊmtlicher Handschriften, Drucke und Typoskripte zu Franz Kafkas fragmentarischem Werk Der Process, die Roland Reuû und Peter Staengle 1997 im Verlag Stroemfeld/Roter Stern publizierten. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 24.12.2010
Datum: 24.12.2010Länge: 00:19:55 Größe: 18.23 MB |
||
| Max Haushofer: Planetenfeuer - 11.12.2010 | ||
| Mit Florian Fischer, Christian Lerch, Tobias Lelle, Caroline Ebner, Mogens von Gadow, Gabriel Hecker, Maria GrûÑbmaier, Martin Otter / Komposition: Christoph Nicolaus / Bearbeitung und Regie: Martin Otter / BR 2010 / LûÊnge: 83'24 // Max Haushofers einziger Roman Planetenfeuer, 1899 erstmals und einmalig erschienen, entwirft Mû¥nchen im Jahr 1999: In Deutschland hat sich der Staatssozialismus seit 100 Jahren bewûÊhrt. Das Land blû¥ht, die Gesellschaft ist hoch entwickelt. Die Groûindustrie ist zum Teil verstaatlicht, die HûÊlfte der BevûÑlkerung besteht aus Staatsdienern und Pensionisten. Phantastische Erfindungen machen allen das Leben leichter. Die elektrische Flugbahn hat das Reisen pfeilschnell gemacht, in der Stadt bewegen sich die Menschen auf Rollschuhen fort. Pantoskope, glûÊnzende Scheiben aus schwarzem Glas, sind das Medium, mit dem die Menschen weltweit in Ton und Bild miteinander kommunizieren. Brillen, die direkt mit dem Gehirn verbunden werden, lassen Blinde wieder sehen. Das Gedankenlesen ist zur erlernbaren Kunst geworden. Eine geheime Gesellschaft von Wissenschaftlern bringt Tote wieder zum Sprechen. Trotz des allgemeinen Wohlstands herrscht in allen BevûÑlkerungsschichten eine nervûÑse Stimmung. Die Menschen berauschen sich mit legalen narkotischen Mitteln und sind von einer grauenhaften Krankheit bedroht, bei der sie sich, von umherirrenden Elektrobû¥ndeln infiziert, auf offener Straûe zu Tode lachen. Die Nachricht einer drohenden Katastrophe versetzt die Welt in endgû¥ltige Aufruhr: Zwei ferne Planeten sind zusammen gestossen und haben ein riesiges Trû¥mmerfeld im All hinterlassen. Die Erde rast unaufhaltsam auf dieses Planetenfeuer zu. Der Weltuntergang droht. In dieser Endzeitstimmung treffen in Mû¥nchen die Freunde Georg Santen und Heinz Ruthardt auf die Freundinnen Ethel Tank und Ortrud von Haag. Sie verbringen die letzten Wochen vor dem Untergang mit gemeinsamen Ausflû¥gen und Diskussionen û¥ber die Vor- und Nachteile der modernen Zeiten, in denen sie leben. Planetenfeuer ist Haushofers VermûÊchtnis und Utopie. Der Roman changiert zwischen verblû¥ffender Hellsichtigkeit und erschreckender Analyse einer mûÑglichen Zukunft, die Licht und Schatten voraus wirft und ist zugleich ein wichtiges Dokument des Fin de siû´cle. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 11.12.2010
Datum: 11.12.2010Länge: 01:23:37 Größe: 76.57 MB |
||
| Martin Otter: An des Daseins Grenzen. Max Haushofer - Dichter und Universalgelehrter - 10.12.2010 | ||
|
Mit Peter Fricke, Silvie Sperlich, Martin Otter / BR 2010 / LûÊnge: 54'37 // An des Daseins Grenzen ist eine AnnûÊherung an den Dichter und Universalgelehrten Max Haushofer und dessen Werk in einer Collage aus persûÑnlichen Gedanken, Briefen und bislang unentdeckten oder unbeachteten Dokumenten, die Martin Otter unter anderem im privaten Familienarchiv in der NûÊhe des Ammersees fand. ãFast am interessantesten von allem ist - sollte manãs glauben! - die NationalûÑkonomie, die der berû¥hmte Professor Haushofer liest. Er faût sie als moderne und moralische Wissenschaft auf, seine VortrûÊge haben oft sehr philosophisch-tiefe Momente.ã Schrieb der junge Thomas Mann, der 1894/95 an der Technischen UniversitûÊt in Mû¥nchen bei Haushofer studierte.
Max Haushofer wurde als Sohn des gleichnamigen Malers 1840 in Mû¥nchen geboren, verbrachte seine Kindheit am Chiemsee und in Prag, wohin sein Vater als Professor an der Kunstakademie berufen wurde. Er ist Verfasser zahlreicher literarischer Werke und war zeitlebens ein angesehener Wissenschaftler. Jahrzehntelang war er Mitglied verschiedener literarischer Vereinigungen in Mû¥nchen wie Die Zwanglosen, die bis heute existieren oder Das Krokodil. Der frû¥he Tod seiner Frau Adele, die ihn als jungen Witwer mit drei Kindern zurû¥cklieû, hat die Auseinandersetzung mit dem Unsterblichkeitsgedanken geprûÊgt, von der sein literarisches Schaffen durchdrungen ist. "Ich ging oft, sehr oft nach dem Friedhof hinaus an ihr Grab. Ich versuchte, FûÊden aufzufinden, unsichtbare FûÊden, durch die ich mich mit ihr in Verbindung setzen kûÑnnte.ã Von der Kirche wandte er sich auf der Suche nach Antworten auf die letzten Dinge enttûÊuscht ab. Spiritistische Umtriebe, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts in Mû¥nchen florierten, beobachtete er allerdings mit Skepsis und kommentierte sie nicht selten mit beiûendem Humor. Auch wenn er sich zeitweise im Umfeld von Albert Schrenk-Notzing bewegte, deren parapsychologische Sitzungen zwanzig Jahre spûÊter auch Thomas Mann besuchte, fand er bei allem Blick fû¥r das Jenseitige seine geistige Heimat in einem aufgeklûÊrten und auf die Zukunft gerichteten Humanismus. In der Wissenschaft war Haushofer ungleich erfolgreicher als in der Literatur. Von der Literaturgeschichte vergessen ist auch der Science Fiction Roman "Planetenfeuer", der aus heutiger Sicht seine interessanteste und phantastischste Arbeit ist. Es war der erste einer von Haushofer geplanten Reihe von Staatsromanen, die jedoch nie realisiert worden ist. Haushofer starb 1097 in Gries bei Bozen. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 10.12.2010
Datum: 10.12.2010Länge: 00:54:57 Größe: 50.31 MB |
||
| Michaela MeliûÀn: Memory Loops Radio Play - 03.12.2010 | ||
| With Peter Brombacher, Caroline Ebner etc. /Realisation: Michaela MeliûÀn / A project by the Municipal Department of Arts and Culture of the City of Munich 'Freie Kunst im ûÑffentlichen Raum' in cooperation with the Bavarian Broadcasting Corporation Radio Play and Media Art Deptartment 2010 / Length of time: 53'30 // Audio tracks on Sites of NS Terror in Munich, 1933-1945. This memory loop deals with the tales of two brothers. Their parents were involved in a Communist organisation; their mother was a Jew. Repression was just a question of time. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 03.12.2010
Datum: 03.12.2010Länge: 00:53:49 Größe: 49.29 MB |
||
| ARD Radio Tatort: Robert Hû¥ltner: Unter sticht Ober - 19.11.2010 | ||
| Mit Florian Karlheim, Brigitte Hobmeier, Michael A. Grimm, Peter Rappenglû¥ck, Hans-Georg Panczak, Gisela Schneeberger, Eisi Gulp, Stephan Zinner, Robert Giggenbach, Stephan Bissmeier, Sigi Zimmerschied, Sergey Kalantay, Beate Himmelstoû, Rudolf Waldemar Brem, Christian Lerch, Christian Hoening, Wilfried Hauer, Demet Gû¥l, Ines Lutz, Caroline Ebner, Saskia Mallison, Julia Fischer, Susanne SchrûÑder, Grigor Veriga, Boyan Groys / Komposition: zeitblom / Regie: Ulrich Lampen / BR 2010 / LûÊnge: 53.58 // Was ist nur los in Bruck am Inn? Nanni sieht ihre Existenz in Gefahr, da ihr Kiosk im Zuge einer Baumaûnahme auf dem Stadtplatz abgerissen werden soll. Und Senta und Rudi sollen sich um eine Rattenplage an der Brucker Grundschule kû¥mmern. Dabei gibt es Wichtigeres zu tun. In einer Arbeiterunterkunft taucht ein junger Bulgare auf und wird wenige Tage spûÊter tot im Auwald aufgefunden. Der junge Mann suchte offenbar jemanden. Die Kripo-Ermittlungen geraten schnell in eine Sackgasse, die SoKo wird verkleinert. Doch Rudi und Senta lûÊsst der Fall keine Ruhe, stehen doch einige Bauunternehmer in dem Ruf, im groûen Stil illegale Arbeiter aus Osteuropa fû¥r sich arbeiten zu lassen. Und da ist noch Aiten, die junge Putzfrau in einer der Arbeiterunterkû¥nfte, die offenbar groûe Angst hat. Gibt es mûÑglicherweise sogar mehr als nur ein Verbrechen? Rudi und Senta kommen nicht weiter, zumal sie sich auch noch mit anderen Problemen herumschlagen mû¥ssen und Nannis Sorgen um ihren Kiosk auch nicht kleiner werden. Die Situation scheint verfahren, bis sich Rudi schlieûlich gemeinsam mit seinem alten Kumpel, dem Gemeindearbeiter Harti, und dem Bau-Polier Zanner, in eine Schafkopfpartie begibt. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 19.11.2010
Datum: 19.11.2010Länge: 00:54:20 Größe: 49.75 MB |
||
| Steffen Kopetzky: Versammlung am Morgen (Deutschland 2089) - 12.11.2010 | ||
| Mit Steffen Kopetzky / BR 2010 / LûÊnge: 13'20 // Die Redaktion HûÑrspiel und Medienkunst lud 17 zeitgenûÑssische deutschsprachige Autorinnen und Autoren ein, sich dem Alltag der û¥bernûÊchsten Generation zu widmen und ein Bild von Deutschland und der Welt in rund 80 Jahren zu entwerfen. Herausgekommen sind 17 individuelle Visionen, die in unterschiedlichen Stilen und Herangehensweisen û¥ber die nahe Zukunft spekulieren ohne Science Fiction-Erwartung im klassischen Sinne zu bedienen und ohne den Bezug zur Gegenwart zu verlieren. Die Texte werden als Autorenlesungen prûÊsentiert. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 12.11.2010
Datum: 12.11.2010Länge: 00:13:20 Größe: 12.21 MB |
||
| Thomas Kapielski: Kleine Ahnung von der Zukunft (Deutschland 2089) - 12.11.2010 | ||
| Mit Thomas Kapielski / BR 2010 / LûÊnge: 17'34 // Die Redaktion HûÑrspiel und Medienkunst lud 17 zeitgenûÑssische deutschsprachige Autorinnen und Autoren ein, sich dem Alltag der û¥bernûÊchsten Generation zu widmen und ein Bild von Deutschland und der Welt in rund 80 Jahren zu entwerfen. Herausgekommen sind 17 individuelle Visionen, die in unterschiedlichen Stilen und Herangehensweisen û¥ber die nahe Zukunft spekulieren ohne Science Fiction-Erwartung im klassischen Sinne zu bedienen und ohne den Bezug zur Gegenwart zu verlieren. Die Texte werden als Autorenlesungen prûÊsentiert. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 12.11.2010
Datum: 12.11.2010Länge: 00:17:53 Größe: 16.38 MB |
||
| Thomas Pletzinger: Death Valley. Disneyland. Death Valley (Deutschland 2089) - 12.11.2010 | ||
| Mit Thomas Pletzinger / BR 2010 / LûÊnge: 23'07 // Die Redaktion HûÑrspiel und Medienkunst lud 17 zeitgenûÑssische deutschsprachige Autorinnen und Autoren ein, sich dem Alltag der û¥bernûÊchsten Generation zu widmen und ein Bild von Deutschland und der Welt in rund 80 Jahren zu entwerfen. Herausgekommen sind 17 individuelle Visionen, die in unterschiedlichen Stilen und Herangehensweisen û¥ber die nahe Zukunft spekulieren ohne Science Fiction-Erwartung im klassischen Sinne zu bedienen und ohne den Bezug zur Gegenwart zu verlieren. Die Texte werden als Autorenlesungen prûÊsentiert. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 12.11.2010
Datum: 12.11.2010Länge: 00:23:27 Größe: 21.47 MB |
||
| Felicia Zeller: Welt ohne Kabel (Deutschland 2089) - 12.11.2010 | ||
| Mit Felicia Zeller / BR 2010 / LûÊnge: 15'49 // Die Redaktion HûÑrspiel und Medienkunst lud 17 zeitgenûÑssische deutschsprachige Autorinnen und Autoren ein, sich dem Alltag der û¥bernûÊchsten Generation zu widmen und ein Bild von Deutschland und der Welt in rund 80 Jahren zu entwerfen. Herausgekommen sind 17 individuelle Visionen, die in unterschiedlichen Stilen und Herangehensweisen û¥ber die nahe Zukunft spekulieren ohne Science Fiction-Erwartung im klassischen Sinne zu bedienen und ohne den Bezug zur Gegenwart zu verlieren. Die Texte werden als Autorenlesungen prûÊsentiert. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 12.11.2010
Datum: 12.11.2010Länge: 00:16:09 Größe: 14.79 MB |
||
| Andreas Neumeister: MYA û¥ber die Zukunft des Kapitalismus war alles bekannt / Kammerversion (Deutschland 2089) - 12.11.2010 | ||
| Mit Andreas Neumeister / BR 2010 / LûÊnge: 19'55 // Die Redaktion HûÑrspiel und Medienkunst lud 17 zeitgenûÑssische deutschsprachige Autorinnen und Autoren ein, sich dem Alltag der û¥bernûÊchsten Generation zu widmen und ein Bild von Deutschland und der Welt in rund 80 Jahren zu entwerfen. Herausgekommen sind 17 individuelle Visionen, die in unterschiedlichen Stilen und Herangehensweisen û¥ber die nahe Zukunft spekulieren ohne Science Fiction-Erwartung im klassischen Sinne zu bedienen und ohne den Bezug zur Gegenwart zu verlieren. Die Texte werden als Autorenlesungen prûÊsentiert. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 12.11.2010
Datum: 12.11.2010Länge: 00:20:14 Größe: 18.53 MB |
||
| FranûÏoise Cactus: KillerschildkrûÑten (Deutschland 2089) - 12.11.2010 | ||
| Mit FranûÏoise Cactus / BR 2010 / LûÊnge: 14'33 // Die Redaktion HûÑrspiel und Medienkunst lud 17 zeitgenûÑssische deutschsprachige Autorinnen und Autoren ein, sich dem Alltag der û¥bernûÊchsten Generation zu widmen und ein Bild von Deutschland und der Welt in rund 80 Jahren zu entwerfen. Herausgekommen sind 17 individuelle Visionen, die in unterschiedlichen Stilen und Herangehensweisen û¥ber die nahe Zukunft spekulieren ohne Science Fiction-Erwartung im klassischen Sinne zu bedienen und ohne den Bezug zur Gegenwart zu verlieren. Die Texte werden als Autorenlesungen prûÊsentiert. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 12.11.2010
Datum: 12.11.2010Länge: 00:14:52 Größe: 13.62 MB |
||
| JûÑrg Albrecht: Green Screen Teen (Deutschland 2089) - 12.11.2010 | ||
| Mit JûÑrg Albrecht / BR 2010 / LûÊnge: 16'46 // Die Redaktion HûÑrspiel und Medienkunst lud 17 zeitgenûÑssische deutschsprachige Autorinnen und Autoren ein, sich dem Alltag der û¥bernûÊchsten Generation zu widmen und ein Bild von Deutschland und der Welt in rund 80 Jahren zu entwerfen. Herausgekommen sind 17 individuelle Visionen, die in unterschiedlichen Stilen und Herangehensweisen û¥ber die nahe Zukunft spekulieren ohne Science Fiction-Erwartung im klassischen Sinne zu bedienen und ohne den Bezug zur Gegenwart zu verlieren. Die Texte werden als Autorenlesungen prûÊsentiert. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 12.11.2010
Datum: 12.11.2010Länge: 00:17:05 Größe: 15.65 MB |
||
| Schorsch Kamerun: Der Wind steht still (Deutschland 2089) - 12.11.2010 | ||
| Mit Schorsch Kamerun / BR 2010 / LûÊnge: 09'07 // Die Redaktion HûÑrspiel und Medienkunst lud 17 zeitgenûÑssische deutschsprachige Autorinnen und Autoren ein, sich dem Alltag der û¥bernûÊchsten Generation zu widmen und ein Bild von Deutschland und der Welt in rund 80 Jahren zu entwerfen. Herausgekommen sind 17 individuelle Visionen, die in unterschiedlichen Stilen und Herangehensweisen û¥ber die nahe Zukunft spekulieren ohne Science Fiction-Erwartung im klassischen Sinne zu bedienen und ohne den Bezug zur Gegenwart zu verlieren. Die Texte werden als Autorenlesungen prûÊsentiert. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 12.11.2010
Datum: 12.11.2010Länge: 00:09:22 Größe: 8.58 MB |
||
| Annett GrûÑschner: Die Stadtfû¥hrerin (Deutschland 2089) - 05.11.2010 | ||
| Mit Annett GrûÑschner / BR 2010 / LûÊnge: 15'56 // Die Redaktion HûÑrspiel und Medienkunst lud 17 zeitgenûÑssische deutschsprachige Autorinnen und Autoren ein, sich dem Alltag der û¥bernûÊchsten Generation zu widmen und ein Bild von Deutschland und der Welt in rund 80 Jahren zu entwerfen. Herausgekommen sind 17 individuelle Visionen, die in unterschiedlichen Stilen und Herangehensweisen û¥ber die nahe Zukunft spekulieren ohne Science Fiction-Erwartung im klassischen Sinne zu bedienen und ohne den Bezug zur Gegenwart zu verlieren. Die Texte werden als Autorenlesungen prûÊsentiert. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 05.11.2010
Datum: 05.11.2010Länge: 00:16:17 Größe: 14.92 MB |
||
| Julia Zange: Agora (Deutschland 2089) - 05.11.2010 | ||
| Mit Julia Zange / BR 2010 / LûÊnge: 10'41 // Die Redaktion HûÑrspiel und Medienkunst lud 17 zeitgenûÑssische deutschsprachige Autorinnen und Autoren ein, sich dem Alltag der û¥bernûÊchsten Generation zu widmen und ein Bild von Deutschland und der Welt in rund 80 Jahren zu entwerfen. Herausgekommen sind 17 individuelle Visionen, die in unterschiedlichen Stilen und Herangehensweisen û¥ber die nahe Zukunft spekulieren ohne Science Fiction-Erwartung im klassischen Sinne zu bedienen und ohne den Bezug zur Gegenwart zu verlieren. Die Texte werden als Autorenlesungen prûÊsentiert. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 05.11.2010
Datum: 05.11.2010Länge: 00:11:03 Größe: 10.12 MB |
||
| Kathrin RûÑggla: kinderkriegen (Deutschland 2089) - 05.11.2010 | ||
| Mit Kathrin RûÑggla / BR 2010 / LûÊnge: 11'48 // Die Redaktion HûÑrspiel und Medienkunst lud 17 zeitgenûÑssische deutschsprachige Autorinnen und Autoren ein, ein Bild von Deutschland und der Welt in rund 80 Jahren zu entwerfen. Herausgekommen sind 17 individuelle Visionen, die in unterschiedlichen Stilen und Herangehensweisen û¥ber die nahe Zukunft spekulieren ohne Science Fiction-Erwartung im klassischen Sinne zu bedienen und ohne den Bezug zur Gegenwart zu verlieren. Die Texte werden als Autorenlesungen prûÊsentiert. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 05.11.2010
Datum: 05.11.2010Länge: 00:12:09 Größe: 11.13 MB |
||
| Georg M. Oswald: Sing (Deutschland 2089) - 05.11.2010 | ||
| Mit Georg M. Oswald / BR 2010 / LûÊnge: 15'55 // Die Redaktion HûÑrspiel und Medienkunst lud 17 zeitgenûÑssische deutschsprachige Autorinnen und Autoren ein, sich dem Alltag der û¥bernûÊchsten Generation zu widmen und ein Bild von Deutschland und der Welt in rund 80 Jahren zu entwerfen. Herausgekommen sind 17 individuelle Visionen, die in unterschiedlichen Stilen und Herangehensweisen û¥ber die nahe Zukunft spekulieren ohne Science Fiction-Erwartung im klassischen Sinne zu bedienen und ohne den Bezug zur Gegenwart zu verlieren. Die Texte werden als Autorenlesungen prûÊsentiert. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 05.11.2010
Datum: 05.11.2010Länge: 00:16:16 Größe: 14.90 MB |
||
| Thomas Palzer: Futur Perfekt (Deutschland 2089) - 05.11.2010 | ||
| Mit Thomas Palzer / BR 2010 / LûÊnge: 6'13 // Die Redaktion HûÑrspiel und Medienkunst lud 17 zeitgenûÑssische deutschsprachige Autorinnen und Autoren ein, sich dem Alltag der û¥bernûÊchsten Generation zu widmen und ein Bild von Deutschland und der Welt in rund 80 Jahren zu entwerfen. Herausgekommen sind 17 individuelle Visionen, die in unterschiedlichen Stilen und Herangehensweisen û¥ber die nahe Zukunft spekulieren ohne Science Fiction-Erwartung im klassischen Sinne zu bedienen und ohne den Bezug zur Gegenwart zu verlieren. Die Texte werden als Autorenlesungen prûÊsentiert. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 05.11.2010
Datum: 05.11.2010Länge: 00:06:35 Größe: 6.03 MB |
||
| Emma Braslavsky: Die Technologie meines Todes (Deutschland 2089) - 05.11.2010 | ||
| Mit Emma Braslavsky / BR 2010 / LûÊnge: 10'56 // Die Redaktion HûÑrspiel und Medienkunst lud 17 zeitgenûÑssische deutschsprachige Autorinnen und Autoren ein, sich dem Alltag der û¥bernûÊchsten Generation zu widmen und ein Bild von Deutschland und der Welt in rund 80 Jahren zu entwerfen. Herausgekommen sind 17 individuelle Visionen, die in unterschiedlichen Stilen und Herangehensweisen û¥ber die nahe Zukunft spekulieren ohne Science Fiction-Erwartung im klassischen Sinne zu bedienen und ohne den Bezug zur Gegenwart zu verlieren. Die Texte werden als Autorenlesungen prûÊsentiert. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 05.11.2010
Datum: 05.11.2010Länge: 00:11:18 Größe: 10.35 MB |
||
| Steffen Popp: Drei Zeugnisse aus dem Deutschen Archiv zum VerstûÊndnis des ersten Jahrhunderts (Deutschland 2089) - 05.11.2010 | ||
| Mit Steffen Popp / BR 2010 / LûÊnge: 14'10 // Die Redaktion HûÑrspiel und Medienkunst lud 17 zeitgenûÑssische deutschsprachige Autorinnen und Autoren ein, sich dem Alltag der û¥bernûÊchsten Generation zu widmen und ein Bild von Deutschland und der Welt in rund 80 Jahren zu entwerfen. Herausgekommen sind 17 individuelle Visionen, die in unterschiedlichen Stilen und Herangehensweisen û¥ber die nahe Zukunft spekulieren ohne Science Fiction-Erwartung im klassischen Sinne zu bedienen und ohne den Bezug zur Gegenwart zu verlieren. Die Texte werden als Autorenlesungen prûÊsentiert. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 05.11.2010
Datum: 05.11.2010Länge: 00:14:31 Größe: 13.30 MB |
||
| Raul Zelik: Marktwirtschaft 3.0 (Deutschland 2089) - 05.11.2010 | ||
| Mit Raul Zelik / BR 2010 / LûÊnge: 12'10 // Die Redaktion HûÑrspiel und Medienkunst lud 17 zeitgenûÑssische deutschsprachige Autorinnen und Autoren ein, sich dem Alltag der û¥bernûÊchsten Generation zu widmen und ein Bild von Deutschland und der Welt in rund 80 Jahren zu entwerfen. Herausgekommen sind 17 individuelle Visionen, die in unterschiedlichen Stilen und Herangehensweisen û¥ber die nahe Zukunft spekulieren ohne Science Fiction-Erwartung im klassischen Sinne zu bedienen und ohne den Bezug zur Gegenwart zu verlieren. Die Texte werden als Autorenlesungen prûÊsentiert. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 05.11.2010
Datum: 05.11.2010Länge: 00:12:31 Größe: 11.46 MB |
||
| Heike Geiûler: Vom Verlassen der Welt (Deutschland 2089) - 05.11.2010 | ||
| Mit Heike Geiûler / BR 2010 / LûÊnge: 11'11 // Die Redaktion HûÑrspiel und Medienkunst lud 17 zeitgenûÑssische deutschsprachige Autorinnen und Autoren ein, sich dem Alltag der û¥bernûÊchsten Generation zu widmen und ein Bild von Deutschland und der Welt in rund 80 Jahren zu entwerfen. Herausgekommen sind 17 individuelle Visionen, die in unterschiedlichen Stilen und Herangehensweisen û¥ber die nahe Zukunft spekulieren ohne Science Fiction-Erwartung im klassischen Sinne zu bedienen und ohne den Bezug zur Gegenwart zu verlieren. Die Texte werden als Autorenlesungen prûÊsentiert. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 05.11.2010
Datum: 05.11.2010Länge: 00:11:32 Größe: 10.57 MB |
||
| Sung Hwan Kim/dogr: One from In the Room - 29.10.2010 | ||
| Mit Sung Hwan Kim, dogr, Byungjun Kwon / Realisation: Sung Hwan Kim/ David Michael DiGregorio / BR 2010 / LûÊnge: 49'39 // Der in Korea aufgewachsene Kû¥nstler Sung Hwan Kim entwickelte seine In the room series als eine Form des GeschichtenerzûÊhlens, das Film, Video, Konzert, Zeichnung und Schreiben zusammen bringt, um zu untersuchen, wie sich das ErzûÊhlen durch das Nebeneinanderstellen von unterschiedlichen Sprachen, Kulturen, Genres, Geschlechtern und Generationen verwandelt. ãIch habe mir einen Raum vorgestellt, der wie eine Schachtel angelegt ist und von dem pulsierend eine Geschichte ausgeht.ã Typisch fû¥r die Arbeiten Sungs ist es, unterschiedliche Kunstgattungen und Medien ã besonders Video und Performancekunst ã miteinander zu verbinden, und dabei jeden Schritt der Erstellung eines Werkes selbst zu vollziehen: als Regisseur, Cutter, Darsteller, Komponist, ErzûÊhler und Dichter. In Zusammenarbeit mit dem ebenfalls in New York arbeitenden Musiker dogr alias David Michael DiGregorio komponiert Sung ein dichtes Geflecht aus û¥bereinander gelegten Stimmen mit unterschiedlichen Effekten und Instrumenten wie Okarina, Sampler, Kazoo, Gitarre oder koreanischen Zimbeln: Stimmliche Harmonien verweben sich mit der ErzûÊhlung und lassen den SûÊnger zu einer Figur der Geschichte werden und die Geschichte wiederum zu Musik. In the room series erzûÊhlt keine linear aufgebaute, kohûÊrente Geschichte, sondern ist als eine traumartige Bewegung mit unterschiedlichen Perspektiven durch einen sich stûÊndig verûÊndernden Raum aufgebaut. Dafû¥r sammelte Sung Szenen, Material und Geschichten aus seinem unmittelbaren Umfeld und verband diese divergierenden Stoffe zu einem Film, auf dessen Grundlage er das HûÑrspiel erarbeitete: ãIch habe angefangen, û¥ber die stûÊndigen Bewohner von RûÊumen nachzudenken. In the Room series rû¥ckt Gefangene (die Gefolterten) ins Blickfeld, eine Schauspielerin, die fû¥r Ihren geheimen Liebhaber in Bereitschaft ist, einen Hund, einen Radiomoderator, einen Reisenden in einer Stadt und so weiter als Bewohner des Raums (und als diejenigen, die die Schwingungen der verborgenen Schachteln erzeugen). Ich wusste, dass mûÊnnliche Buckelwale einer Population wûÊhrend der Brutzeit dasselbe Lied singen ã das sich aber bei jedem Gesang durch Nachahmung und Improvisation verûÊndert. So habe ich mir auch die Performances und Geschichten innerhalb der Performances als unterschiedliche Ausfû¥hrungen von Variationen vorgestellt. Einfache PhûÊnomene sind nicht spannender als sie eigentlich nun mal sind, aber durch ûbertreibung, Weglassung, Betonung, Rhythmus, die Beschaffenheit der Stimme und den Gebrauch von Zeit werden sie zu MûÊrchen, Mythen, Magie, Lû¥gen, Propaganda, Geschichte, oder manchmal: Zu Tatsachen.ã | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 29.10.2010
Datum: 29.10.2010Länge: 00:43:58 Größe: 40.26 MB |
||
| Michaela MeliûÀn: Memory Loops - Tonspuren zu Orten des NS-Terrors in Mû¥nchen 1933-1945 (5/5) - 24.10.2010 | ||
|
Pestalozzistraûe Ettstraûe Brienner Straûe Mariannenbrû¥cke / Mit Peter Brombacher, Anna Clarin, Caroline Ebner, Florian Fischer, Julia Franz, Nicola Hecht, Gabriel Ascanio Hecker, Johannes Herrschmann, Hans Kremer, Laura Maire, Stefan Merki, Wolfgang Pregler, Steven Scharf, Joana Verbeek von Loewis / Musikrealisation: Carl Oesterhelt/Michaela MeliûÀn / Komposition/Realisation: Michaela MeliûÀn / BR HûÑrspiel und Medienkunst in Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt Mû¥nchen/Kulturreferat, Freie Kunst im ûÑffentlichen Raum 2010 / LûÊnge: 58'14 // In dieser Stimmencollage kommt der politische Widerstand zu Wort. ãIch bin hinter meinem Mann auf dem Motorrad drauf gesessen und hab den Rucksack gehabt mit den FlugblûÊttern. Wir sind durch die Arbeiterviertel Sendling, Westend usw. gefahren und ich hab die FlugblûÊtter ausgestreutãÎã WiderstûÊndler aus allen Schichten, vom Arbeiter bis zum Studierenden: Nach der Machtû¥bernahme 1933 wurden sie zuerst in sogenannte Schutzhaft genommen. Viele der Zeitzeugen durchwanderten gleich mehrere GefûÊngnisse im Mû¥nchner Raum: Ettstraûe, Wittelsbacher Palais, Stadelheim, Dachau. Mit raffinierten, aber einfachen Mitteln arbeiteten sie illegal weiter gegen das Regime. Und die berû¥chtigte ãEttstraûe" ã die Polizeidirektion ã war schon seit langem Ausgangspunkt fû¥r stadtweite Razzien gegen Homosexuelle. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 24.10.2010
Datum: 24.10.2010Länge: 00:58:34 Größe: 53.63 MB |
||
| Michaela MeliûÀn: Memory Loops - Tonspuren zu Orten des NS-Terrors in Mû¥nchen 1933-1945 (4/5) - 17.10.2010 | ||
| GûÊrtnerplatz Marsstraûe Promenadeplatz Prinzregentenstraûe / Mit Peter Brombacher, Anna Clarin, Julia Franz, Gabriel Ascanio Hecker, David Herber, Johannes Herrschmann, Julia Loibl, Laura Maire, Stefan Merki, Steven Scharf, Ferdinand von Canstein, Joana Verbeek von Loewis / Musikrealisation: Carl Oesterhelt/Michaela MeliûÀn / Komposition/Realisation: Michaela MeliûÀn / BR HûÑrspiel und Medienkunst in Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt Mû¥nchen/Kulturreferat, Freie Kunst im ûÑffentlichen Raum 2010 / LûÊnge: 57'07 // In diesem Memory Loop bû¥ndeln sich vielfûÊltigste historische Materialien zu einer Stimmencollage, die den Situationen an Orten der Bildung, Kunst und Presse in der NS-Zeit nachspû¥ren. ãIch habe am 19. MûÊrz 1933 noch ein Konzert mit dem damaligen Solo-Cellisten der Mû¥nchner Philharmoniker gegeben. Ich sollte fû¥r den Bayerischen Rundfunk Richard-Strauû-Werke einspielen, aber das Engagement wurde plûÑtzlich kurzfristig abgesagt. Kurz danach kamen die Bestimmungen des Dritten Reiches...ã Die Pianistin bekommt Berufsverbot, eine Malerin darf ihren Kû¥nstlernamen nicht mehr verwenden, eine Kunstgalerie wird arisiert, ãdeutsches Kulturgutã beschlagnahmt. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 17.10.2010
Datum: 17.10.2010Länge: 00:57:26 Größe: 52.59 MB |
||
| Michaela MeliûÀn: Memory Loops - Tonspuren zu Orten des NS-Terrors in Mû¥nchen 1933-1945 (2/5) - 03.10.2010 | ||
|
Prinzregentenplatz Lindwurmstraûe Hauptbahnhof Odeonsplatz / Mit Juno Meinecke, Hans Kremer / Musikrealisation: Carl Oesterhelt/Michaela MeliûÀn / Komposition/Realisation: Michaela MeliûÀn / BR HûÑrspiel und Medienkunst in Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt Mû¥nchen/Kulturreferat, Freie Kunst im ûÑffentlichen Raum 2010 / LûÊnge: 56'14 // Zwei jû¥dische Mû¥nchner erzûÊhlen aus ihrer Kindheit. Wie ihre Ausgrenzung begann, von ihrem Vater, dessen Foto in unseren Geschichtsbû¥chern abgebildet ist und ihrem Leben in England. Zwei jû¥dische Mû¥nchner erzûÊhlen aus ihrer Kindheit. ãAlso hab ich zwei billige Billetten fû¥r den obersten Rang gekauft und so sind wir in den Rigoletto gegangen, meine Cousine und ich, ich war 13 und sie war 17. Obwohl es verboten war. Beim Kartenverkauf wurde ich mit meinen ZûÑpfen nicht gefragt, ob ich Jû¥din binãÎã Damals, ein halbes Jahr nach der Pogromnacht, wurde das 14-jûÊhrige MûÊdchen am Mû¥nchner Hauptbahnhof in den Zug gesetzt, Richtung England, wohin ihr Bruder schon ausgereist war. Die Kindertransporte retteten die Geschwister, es gelang ihnen ein Neuanfang. Sie haben sich gegen den NS-Terror behauptet. Dennoch bleibt Mû¥nchen ihre verlorene Heimat. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 03.10.2010
Datum: 03.10.2010Länge: 00:56:35 Größe: 51.82 MB |
||
| Michaela MeliûÀn: Memory Loops - Tonspuren zu Orten des NS-Terrors in Mû¥nchen 1933-1945 (1/5) - 26.09.2010 | ||
|
Herzog-Max-Straûe Herzog-Rudolf-Straûe Antonienstraûe Knorrstraûe / Mit Peter Brombacher, Caroline Ebner, Florian Fischer, Julia Franz, Gabriel Ascanio Hecker, David Herber, Hans Kremer, Laura Maire, Steven Scharf, Joana Verbeek von Loewis / Musikrealisation: Carl Oesterhelt/Michaela MeliûÀn / Komposition/Realisation: Michaela MeliûÀn / BR HûÑrspiel und Medienkunst inZusammenarbeit mit der Landeshauptstadt Mû¥nchen/Kulturreferat, Freie Kunst im ûÑffentlichen Raum 2010 / LûÊnge: 56'21 // Die ErzûÊhlungen zweier Brû¥der fû¥hren durch diese Erinnerungsschleife. Ihre Eltern engagierten sich in einer kommunistischen Organisation, die Mutter war Jû¥din: Die Repressionen gegen die Familie lieûen nicht lange auf sich warten. ãWenn sie dann noch aus ihrer Wohnung rausmû¥ssen und nach Milbertshofen in diese Drecksbuden mit Holzpritschen. Eine Woche vorher haben sie noch eine Wohnung gehabt mit einem Kleiderschrank und Teppich und VorhûÊngen...ã
Die Stimmencollage aus den Berichten der beiden Brû¥der markiert wichtige Punkte und Strecken auf der Karte des NS-Terrors gegen Juden in Mû¥nchen: das Rathaus, die Lindwurmstraûe, von der Herzog-Max- zur Herzog-Rudolf-Straûe, von der Knorrstraûe nach Berg am Laim, vom Wittelsbacher Palais zum Hauptbahnhof Richtung Theresienstadt. Seit 1945 leben die Brû¥der wieder in Mû¥nchen und sind bis heute in der Erinnerungspolitik aktiv engagiert. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 26.09.2010
Datum: 26.09.2010Länge: 00:56:42 Größe: 51.92 MB |
||
| Julian Doepp: Ostsee - 12.09.2010 | ||
|
Mit Tino Mewes, Katharina Rivilis, Tonio Arango, Bernhard Schû¥tz, Manon Kahle / Komposition: tarwater / Realisation: Julian Doepp / BR 2010 / LûÊnge: 51'47 // Halb akademische Detektivstory, halb Melodram aus dem vernetzten Alltag, erzûÊhlt Ostsee von den verwirrenden Wechselwirkungen zwischen Gefû¥hlen in der virtuellen und der 'realen' Welt, zwischen NûÊhe und Information, Voyeurismus und Vertrauen. Ein kalter Februar. Ein Kongress û¥ber "Virtuelle Gemeinschaften" in einer UniversitûÊtsstadt nahe der Ostsee. Der Doktorand Jakob fû¥hlt sich fehl am Platze. Von seinem Professor wird er als technischer Assistent abgestellt, den Glauben an seine Dissertation hat er lûÊngst verloren. Doch nach einem der VortrûÊge bittet Yael, eine junge Dozentin, ihn um Hilfe. Ein Freund ist verschwunden. Der Videospiel-Designer Hiztory, den sie im Netz kennenlernte, hat seine virtuelle IdentitûÊt gelûÑscht. Die einzige Chance, ihn zu finden, besteht in einer von Jakob entwickelten Suchmaschine: ein Programm, das Texte im Internet stilistisch vergleicht und dadurch den Autor aufspû¥ren kann. Die Chats und Mails, mit denen Jakob die Suchmaschine fû¥ttert, sind Bestandteile einer zerrissenen Liebesgeschichte. Sie berichten von digitaler Keuschheit, von der Angst vor der Wirklichkeit und von Yaels PlûÊnen fû¥r ein Computerspiel, dessen Ziel ein guter Tod ist. Und er erfûÊhrt, dass Hiztory kurz vor seinem Verschwinden von Selbstmord sprach. Als Yael und Jakob eine Nacht miteinander verbringen, nimmt eine elektronisch vermittelte Dreiecksbeziehung ihren Lauf.
|
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 12.09.2010
Datum: 12.09.2010Länge: 00:52:06 Größe: 47.70 MB |
||
| Vlada Maria: Fensterplatz - 10.09.2010 | ||
|
Mit Miriam Strû¥bel, Josef Simon, Holger Foest, Johannes Fast, Susanne Wolgemuth, Vlada Tcharyeva, Johannes Schaff / Realisation: Vlada Maria / BR 2010 / LûÊnge: 32'54 // Sie kommen und gehen. Beobachten heimlich und auch offensichtlich. Mitfahrer des ûÑffentlichen Nahverkehrs. Reisende im Untergrund. Ihre Gesichter spiegeln sich undeutlich in den nutzlosen Fenstern der U-Bahn. Dafû¥r ist er also da, dieser Fensterplatz mit û¥berflû¥ssiger Aussicht. Der Untergrund ist ein Ort der Desorientierung, ein Ort der Gedankenablagerung, aber auch einer, der den alltûÊglichen Rû¥ckblick heraufbeschwûÑrt und manchen in einen erkenntnisreichen Zustand versetzt. Besonders geeignet ist die Reise im Untergrund um TagtrûÊume, Hirngespinste und Wû¥nsche weiterzuspinnen, zu û¥berprû¥fen oder auszusortieren. WûÊren da nur nicht diese stummen, fremden Mitreisenden, mit denen man auf engem Raum unfreiwillig auf Tuchfû¥hlung geht, die diesen Ort der Muûe, inmitten der Hektik der Groûstadt von einem Augenblick auf den nûÊchsten in einen anonymen und bedrohlichen Ort verwandeln kûÑnnen.
Fensterplatz ist eine multiperspektivische Anordnung von flû¥chtigen Gedanken und non verbalen Konversationen zwischen Passagieren wûÊhrend einer U-Bahnfahrt, die in Wirklichkeit nie stattgefunden hat. Die Autorin simuliert mit drei Schauspielern und drei Schauspielerinnen eine alltûÊglichen Fahrt und lûÊsst sie darauf los improvisieren. Schnell entwickelt ein Protagonist einen Charakter mit gespaltener PersûÑnlichkeit. Und immer wieder teilt die Autorin den Passagieren ihre Rechte mit. Sie erinnert daran, dass sie ihre Assoziationen nur bilden dû¥rfen, damit sie daraus ein HûÑrspiel erstellen kann und betrachtet die beim virtuellen Reisen entstandenen Gedanken und Ideen als ihr Eigentum. Mind the Gap and please take your wishes with you. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 10.09.2010
Datum: 10.09.2010Länge: 00:32:29 Größe: 29.74 MB |
||
| Kathrin RûÑggla: die alarmbereiten - 03.09.2010 | ||
|
Mit Dorothee Metz, Hanns Zischler, Achim Bogdahn, Imke KûÑhler, Susanne Affolter, Eva Brunner, Tony de Maeyer / Komposition: Bo Wiget / Regie: Leopold von Verschuer / BR 2009 / LûÊnge: 54'29 // In Redaktionssitzungen, den Talkformaten, Radio- und Fernsehsendungen, in ElternbeirûÊten, den Mitarbeiterbesprechungen und ûÑffentlichen Sicherheitshinweisen - û¥berall tûÑnt der Katastrophensound. Wir sind stûÊndig konfrontiert mit Schutzbestimmung, ûngsten, Norm-Messungen, Vorsichtsmaûnahmen, Verbrauchertipps, aber auch ZerstûÑrungs- und Gewaltphantasien, UntergangserzûÊhlungen und Endzeitgeschichten. Die derzeit vorherrschende ErzûÊhlform der Wissenschaft ist das Szenario. Die Prognose ihr Ziel. Was passiert, wenn A und B eintreten, und wenn C auf sich warten lûÊsst. Daneben beobachten wir argwûÑhnisch jeden wirtschaftlichen Aufschwung der ehemaligen SchwellenlûÊnder, der mit steigenden Treibhausgas-Emissionen einhergeht. Nicht zu vergessen der nach oben schnellende ûlpreis! Und gab nicht der grûÑûte russische ûlkonzern im letzten Frû¥hjahr bekannt, sie hûÊtten ihren FûÑrderzenit bereits û¥berschritten? wir wissen es nicht mehr so genau. Ein Gefû¥hl der Vagheit hat sich lûÊngst eingeschlichen, eine Unsicherheit und eine bestûÊndige Ahnung der Desinformation. In unserem Bewusstsein û¥berlagern sich die Dinge, StrûÑme von Informationen verschiedenster Provenienz und emotionaler Lagen, die wir oft nicht mehr zu sortieren wissen. Und was machen wir? Wir arbeiten diese ûngste und Vorstellungen klein, reagieren mit ûbersprungshandlungen, VerdrûÊngungsmechanismen, rationalen und irrationalen Dementi.
In Tausenden von ûberlegungen, kolportiertem Halbwissen, Paranoiaphantasien, aber auch Ablenkungsmodellen findet eine Telefon-BeschwûÑrung auf allen Ebenen des fernmû¥ndlichen Universums statt: als Talkformat im Radio mit ZuhûÑrerzuschaltung, als intimes nûÊchtliches TelefongesprûÊch oder HûÑrerbeschimpfung, in Warteschleifen oder Telefonwerbeformaten. Im Zentrum steht eine KassandrasekretûÊrin, deren Unmut alles zu organisieren scheint und die ihren eigenen Prophezeiungen nur hinterherhinken kann, obwohl sie diese nur zu gerne û¥berholen wû¥rde. Denn schlieûlich ist es immer besser, schon am Ausgang der Geschichte zu stehen, als sie noch vor sich zu haben. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 03.09.2010
Datum: 03.09.2010Länge: 00:54:48 Größe: 50.21 MB |
||
| Raymond Federman: Die Kadaver. Eine Fabel in 6 Bildern und einer Liste - 27.08.2010 | ||
|
Mit Renûˋ Dumont, Oliver NûÊgele, Stefan Wilkening / Aus dem Amerikanischen von Gaby Hartel / Bearbeitung: Gaby Hartel / Komposition: zeitblom / Regie: Katja Langenbach / BR 2010 / LûÊnge: 54'42 // Ein Mann in seinem kalifornischen Arbeitszimmer mit Traumaussicht: Die Sonne strahlt, die VûÑgel durchziehen das wolkenbetupfte Himmelsblau und keiner hetzt ihn, denn sein einziger Job ist das Schreiben. Ein Luxuszustand? Nicht ganz, denn der Schriftsteller Raymond Federman (1928-2009) denkt in seiner letzten HûÑrspielarbeit û¥ber das Sterben nach. Genauer: û¥ber das Leben nach dem Tod. Das Thema ist an sich nichts Neues in seinem Schaffen, denn zwei Dinge haben das Schreiben Federmans seit jeher bestimmt: die traumatische Erfahrung als ûberlebender des Holocaust und seine unbûÊndige Lust, diese Erfahrung in eine vitale, verspielte Literatur einzuschreiben. Oberstes Handlungsgesetz war dabei immer die û¥berzogene Erfindung, die Abschweifung und das selbstironische Lachen û¥ber den unbeholfenen Versuch, angesichts des groûen schweigenden Nichts eine Sprachwelt erschaffen zu wollen.
Genauso hat Federman sein letztes Wort û¥ber die ãletzten Dingeã angelegt: als polyphon erzûÊhlte, vital wuchernde Fabel, die sich in sechs Bildern und einer Liste vor den Ohren seines Publikums entfaltet. Getrieben und getragen von drei munter durcheinander redenden Stimmen, entwickeln sich Science-Fiction-Phantasien aus abstrakten Bildern, Fragen nach dem Aussterben der Dinosaurier folgen Echos philosophischer Trostmechanismen. Nur um immer wieder frûÑhlich demontiert zu werden, denn eine Antwort auf die Frage nach dem ãDanachã wollte der Autor nicht geben. Vielmehr der Nachwelt das komischste Buch û¥ber den Tod hinterlassen. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 27.08.2010
Datum: 27.08.2010Länge: 00:55:01 Größe: 50.41 MB |
||
| Paul Wû¥hr: Verirrhaus - 20.08.2010 | ||
| Realisation: Paul Wû¥hr / BR/WDR 1972 / LûÊnge: 51'35 // Dieses Originalton-HûÑrspiel ist Teil einer Trilogie, die Paul Wû¥hr fû¥r den Bayerischen Rundfunk realisierte. Der erste Teil mit dem Titel "Preislied" wurde 1972 mit dem HûÑrspielpreis der Kriegsblinden ausgezeichnet. "Verirrhaus" verbindet Satzfragmente, Bruchstû¥cke von ûuûerungen, um aus der "ûkonomie des Sprechens auszubrechen" und um das Unausgesprochene, das, was zwischen - und hinter - dem Gesagten steht, hûÑrbar zu machen. ãIn meinem HûÑrspiel verwende ich Aussagen aus GesprûÊchen mit insgesamt zwûÑlf jû¥ngeren Menschen, deren Bewusstsein an unseren gesellschaftlichen Bedingungen ã Leistungswettbewerb zwischen den Geschlechtern, in Beruf und Familie ã erkrankt ist, die sich zur Neuorientierung ihrer PersûÑnlichkeit aus der gewohnten Umwelt vorû¥bergehend zurû¥ckgezogen und in psychiatrische Behandlung begeben haben.ã (Paul Wû¥hr) | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 20.08.2010
Datum: 20.08.2010Länge: 00:51:52 Größe: 47.53 MB |
||
| Eran Schaerf: Heute ist Mittwoch der 10. Dezember - 06.08.2010 | ||
|
Mit Peter Veit / Regie: Eran Schaerf / BR 2009 / LûÊnge: 45'07 // Zwei Minuten Stille im Radio, ihre Vorgeschichte und ihre Folgen. Vielleicht waren es auch drei Minuten, jedenfalls war es pû¥nktlich 9 Uhr morgens und manche HûÑrerInnen erwarteten die Nachrichten. Heute wû¥rden sie den Sender wechseln oder ins Netz gehen, aber es ist 1990 und in Deutschland gibt es gerade mal einen Privatsender und wenig im Netz. Konnte deshalb die Nachricht, dass es keine Nachrichten gab, eine Nachricht werden? Ja, aber nicht allein. Dazu gehûÑrt das Zusammenspiel zwischen den Erwartungshaltungen der HûÑrer, dem Selbstbild des Senders und nicht zuletzt der Berufsethik eines Nachrichtensprechers. ãHeute ist Mittwoch der 10. Dezemberã sagten am Tag der Aufnahme des HûÑrspiels zahlreiche Nachrichtensprecher zu Beginn ihrer Sendungen. Das sagen sie so. Gertrude Stein sagt, ãdie IrlûÊnderin kann sagen, dass heute jeder Tag ist, Caesar kann sagen, dass jeder Tag heute ist und sie sagen, jeder Tag ist wie sie sagen.ã Sagen wir so, der 10. Dezember ist der 13. September, besonders wenn nichts gesagt wird.
ãMû¥nchen. Sprecher schlief ein, keine Nachrichten im Bayerischen Rundfunk. Der Vater eines 2jûÊhrigen Kindes habe eine unruhige Nacht gehabt, da der Nachwuchs an einer fiebrigen ErkûÊltung leide und mehrfach aufgewacht sei.ã (dpa-Meldung vom 13.9.1990) Mit seinem neuen HûÑrspiel fû¥hrt Eran Schaerf seine Auseinandersetzung mit den medialen Konstitutionen des Rundfunks fort. Bereits in seiner als HûÑrspiel des Jahres 2002 ausgezeichneten BR-Produktion Die Stimme des HûÑrers entwickelt er ein selbstreflexives Spiel mit dem Medium, indem er einen ortlosen automatischen Moderator einsetzt, der HûÑreranrufe sowie Sendematerial von Fremdstationen wiedergibt. Dabei fû¥hrt er den HûÑrer durch den Frequenzwechsel zwischen Manipulation, Fiktion und RealitûÊt und erûÑffnet ihm den Raum fû¥r die irritierende Ungewissheit dazwischen. Damit entwickelt Die Stimme des HûÑrers eine Reflexion der eigenen HûÑrgewohnheiten und medialen Inszenierungen von ûffentlichkeit. Der automatische Moderator erhûÊlt seine Stimme von dem Nachrichtensprecher Peter Veit, der auch in Schaerfs folgenden hûÑrspielûÊsthetischen Verhandlungen des Radios immer wieder zu hûÑren ist. So in Sie hûÑrten Nachrichten (BR 2005), in dem die Wirklichkeit zu einer Montage von MûÑglichkeiten wird, um die Grenzen der Genres ã der Nachrichten und des HûÑrspiels, der Wirklichkeit und der Fiktion ã auszudehnen. Auch in Schaerfs im Februar dieses Jahres urgesendetem Nachrichten-HûÑrspiel Nichts wie Jetzt (BR 2009) hat Peter Veit eine Rolle û¥bernommen. Mit Heute ist Mittwoch der 10. Dezember machen sich Eran Schaerf und Peter Veit daran, ausbleibende Nachrichten und ihre Kontextualisierungen wieder zu erzûÊhlen, wieder aufzufû¥hren, wieder auszustrahlen. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 06.08.2010
Datum: 06.08.2010Länge: 00:45:28 Größe: 41.63 MB |
||
| phonofix: Du kannst nicht immer schimmern, mein Schatz! - 30.07.2010 | ||
| Mit Anna Graenzer, Patrick Gû¥ldenberg, Janna Horstmann, Steffen Klewar, Sebastian Thiers / Komposition: Matthias Grû¥bel / Realisation: phonofix / BR 2009 / LûÊnge: 54'24 // Es gibt einen Schimmer, der uns verspricht, daû das 20. Jahrhundert endlich zu Ende ist, der Schimmer einer Welt, die alle betreten kûÑnnen, immer wenn sie wollen. Im always-on-Zustand ist Utopie lebendig wie nie, als aufmû¥pfiger Teenager hat sie Wege gefunden, sich û¥ber die gesamte Welt zu verteilen. Um unser Wahrnehmungssystem in dieser world wide world dreht sich Du kannst nicht immer schimmern, mein Spatz! Das Bloggen als Mischung aus privater und ûÑffentlicher ûuûerung, als Softwarefehler. Das life 2.0 als Bootleg des life 1.0. Zwischen LogosphûÊre und BlogosphûÊre schauen auch Brigitte Zypries, Tine Wittler und der Road Runner immer mal wieder vorbei und fragen: How to become a famous blogger? Wo die NeutralitûÊt des Web beschnitten werden soll, zeigt sich sein Potential: Findet sich IdentitûÊt gerade nicht in geschlossenen Blindtexten, sondern da, wo etwas schiefgeht? Wenn die Software knackt, kann IdentitûÊt die eigenen MûÑglichkeiten und Bedingungen in immer neuen Remixen befragen. Dagegen stellt sich eine Geschichte, die festgeschrieben und nicht aktualisierbar oder kopierbar sein will; Geschichte als Original, gehortet im Headquarter der Hochkultur. KûÑnnen Menschen Wege finden, Macht, Wissen und Daten nicht anzusammeln, sondern zu verteilen, durch non-blind copy? KûÑnnen sie Fehler nicht als Fehler verstehen, sondern als Teile gemeinsamer Geschichte? KûÑnnen sie mit den GerûÊten zusammenleben und Wahrnehmung mit ihnen teilen?JûÑrg Albrecht, Texter von phonofix, beschûÊftigt sich mit der Verbindung von Macht und noch nicht zuende entwickelten Technologien. Matthias Grû¥bel, Musiker von phonofix, nimmt unfertige und im Werden begriffene Technologien in Form von Open-Source Software und selbstgeformten elektronischen Arbeitsumgebungen als Bestandteile seiner Musik. So setzen phonofix ihre Arbeit fort, Gegenwart mitsummbar, Text mittanzbar zu machen. Bastard-Pop-artig mischen sie verschiedene recordings: Butler und Theweleit, Bugs Bunny und bugging Blogs, Gitarrenschlieren und Delaytû¥rme, das Jahr 1997 und heute.ãDas 21. Jahrhundert in der garbage can, in der sich alle Fehler versammeln, um gemeinsam Geschichte zu machen, um gemeinsam zu leben, Fehler der Programme, der GerûÊte und deiner IdentitûÊt. Bis der Download abgeschlossen ist und ihr nicht mehr wiût, ob es eure Band jemals gab. [ãÎ] Podcast: the uppumping century / the downdumping century. Download it NOW! (JûÑrg Albrecht)ã | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 30.07.2010
Datum: 30.07.2010Länge: 00:54:40 Größe: 50.09 MB |
||
| Thomas Meinecke/Move D: WORK - 23.07.2010 | ||
| Mit Eric D. Clark, Thomas Meinecke, Move D / Komposition und Realisation: Move D / Thomas Meinecke / BR 2009 / LûÊnge: 51'19 // Bereits in den 1920er Jahren konnte man in den USA eine etymologische Vermischung der SphûÊren Arbeit und Liebe wahrnehmen, als nûÊmlich sogenannte working girls (junge, berufstûÊtige Frauen, meistens Angestellte in Bû¥ros, die kurze Kleider trugen, noch kû¥rzere Haare, und in der ûffentlichkeit rauchten) nicht nur den ersten breiten, unû¥bersehbaren Schwung mit bislang unbekannter SouverûÊnitûÊt û¥ber ihre SexualitûÊt verfû¥gender Frauen (mehr als nur soziologisch) markierten, sondern im gemeinen Umgangston konnte working girl stets auch eine Prostituierte bedeuten. Im subkulturellen Jive bildete sich die Silbe work zunehmend zu einer Vokabel fû¥r selbstbestimmte, nicht selten sexuell dissidente AktivitûÊten aus, bis sie in der û¥berwiegend queeren, zumeist lateinamerikanischen Subkultur der (von Judith Butler und Madonna glorifizierten) voguenden BallsûÊle Spanish Harlems zu einem zentralen Terminus wurde. You Better Work hieû der Refrain des Superhits Supermodel der drag queen RuPaul, und das war wirklich nicht als Aufruf zur Arbeitsmoral der white anglo-saxon protestant (WASP) society der USA gemeint (der dazugehûÑrige Videoclip wurde in New Yorks fû¥r seine schrûÊgen Bordsteinschwalben berû¥chtigtem meat-packing district gedreht). Die Underground House Music New Yorks, Chicagos Booty Bass oder Detroits Ghetto-Tech nutzt die Vokabel bis heute im Kontext kaum verhohlener sexueller Metaphern (work my body over), die hier aber, zumal oft sehr dialektisch bipolar kodiert, nicht dem (handels)û¥blichen Sexismus dienen, sondern (im Dreieck der Diffamierungen race, class and gender) kritisches Potential entfalten. David Moufang und Thomas Meinecke haben sich durch das Repertoire dieser aufregenden Musik ge-arbeitet und aus unzûÊhligen Samples, gepaart mit Aussagen einschlûÊgig Involvierter (dance veterans, drag queens, DJs), auch ihren eigenen Stimmen und Instrumenten, einen hypnotischen Mix produziert. Andere RûÊume, andere Stimmen. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 23.07.2010
Datum: 23.07.2010Länge: 00:51:39 Größe: 47.32 MB |
||
| Raymond Federman: Playtextplay II - 07.07.2010 | ||
| Mit Raymond Federman, Jon Sass (Tuba), Maceo Parker, Pee Wee Ellis, Fred Wesley / Realisation: Herbert Kapfer, Regina Moths / BR 1992 / LûÊnge: 14'16 // Unter dem Titel 'Playtexts' fasst Federman die Sprachspiele, lautpoetischen Arbeiten und verschiedenen experimentellen und 'konkreten' Texte zusammen, die neben den groûen Prosatexten entstanden sind. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 07.07.2010
Datum: 07.07.2010Länge: 00:14:35 Größe: 10.06 MB |
||
| Thomas Harlan: Rosa - Die Akte Rosa Peham - 02.07.2010 | ||
|
Mit Manfred Zapatka, Heiko Raulin, Bernd Moss, Axel Milberg, Sophie von Kessel, Karin Anselm / Bearbeitung: Michael Farin / Komposition: Helga Pogatschar / Regie: Bernhard Jugel / BR/WDR 2001 / LûÊnge: 78'32 // In den sechziger Jahren stieû Thomas Harlan bei Recherchen û¥ber Kriegsverbrechen auf Gerû¥chte ein Dorf, an dem die Deutschen die Technologie des Massenmords erprobten. Eine Lichtung bei Kulmhof in Polen. Aus der schneeverwehten Ebene wûÑlbt sich das Dach eines Erdhauses, ein Pferd ohne Schweif ist an den rauchenden, klapprigen Schornstein gebunden, der aus dem Boden ragt. In der HûÑhle hausen Rosa Peham und Jû°zef Najman. Rosa ist die ehemalige Verlobte von Franz Maderholz, dem Zahlmeister des Kulmhofs, eines Vernichtungslagers im Zweiten Weltkrieg. Die Asche der Opfer fû¥llt den Boden der Lichtung, die seit Kriegsende Rosas Heimstatt ist. Seltsame Pflanzen wuchern dort, verwachsene Tiere bewohnen den Wald. Franz ist bei der PartisanenbekûÊmpfung in den Karstgebirgen vor Triest verschollen, Rosa hat sich 1948 mit Jû°zef liiert. Auch ihm wird eine dunkle Vergangenheit nachgesagt.
Jahrzehnte spûÊter erfahren ein Filmteam und ein Theologe aus alten Akten von Rosa, den damaligen Ereignissen und den unheimlichen Lebensformen im Wald. Sie spû¥ren den Schicksalen der Beteiligten nach. Die Spuren fû¥hren ins polnisch-ukrainische Grenzgebiet, in Warschauer Archive, die Karstgebirge vor Triest, eine Lungenheilanstalt in den Alpen, Phonoarchive, ins Berlin der Nazizeit, nach Walldû¥rn am Odenwald und in andere StûÊdte Deutschlands. Einer der Verbû¥ndeten des Filmteams ist Karol Leszczynski, ein Untersuchungsrichter in Warschau, dessen Leben sich nur um die AufklûÊrung zweier Verbrechen dreht. Aber auch Franz Maderholz lebt noch: im hohen Alter macht er sich, von einer dunklen Sehnsucht heimgesucht, wieder auf zu den StûÊtten seiner groûen Liebe und des Grauens. Der zeitliche Rahmen des Romans ãRosaã erstreckt sich von 1942 bis 1993. Virtuos spielt Thomas Harlan mit verschiedenen ErzûÊhlebenen. Dokumente, Briefe, Phonoaufnahmen, Berichte und VerhûÑrprotokolle geben in atemlosem Stakkato ungeheuerliche Geschehnisse preis. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 02.07.2010
Datum: 02.07.2010Länge: 01:18:51 Größe: 72.23 MB |
||
| Ludwig Thoma: Die Dachserin - 18.06.2010 | ||
| Mit Franz FrûÑhlich, Thea Aichbichler, Albert Spenger u.a. / Regie: Olf Fischer / BR 1953 / LûÊnge: 20'52 // Einakter in bayerischer Mundart - Sie ist angeklagt, eine andere Frau beleidigt zu haben. Der Verteidiger der Angeklagten legt sich fû¥r sie ins Zeug: "Seien wir froh, dass unserem bayerischen Volk noch eine gesunde und derbe Kraft innewohnt". | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 18.06.2010
Datum: 18.06.2010Länge: 00:21:10 Größe: 19.42 MB |
||
| Thomas von Steinaecker: HerzrhythmusgerûÊusche - 04.06.2010 | ||
| "Ein Herz. Es ist 93 Jahre alt und gehûÑrt Richard TûÊubner. In 57 Minuten wird es aufgehûÑrt haben zu schlagen." TûÊubner rekapituliert sein Leben. Im Mittelpunkt steht dabei sein phûÊnomenales GehûÑr. Nur dieses lieû ihn den Krieg unbeschadet û¥berstehen, nur dieses lieû ihn zum talentiertesten Ventilatorenhersteller in Bayern werden. TûÊubner hûÑrt noch einmal den Klang der federnden Schritte seiner Frau Lissi, das Rattern seiner Ventilatoren, die GerûÊusche seiner Familie im Alltag. Und den Krebs, an dem Lissi starb. All das verbindet sich in seinem Kopf zu kleinen Sinfonien. Aber TûÊubner ist sich nicht mehr sicher, wie es wirklich war. Sein akustisches GedûÊchtnis lûÊsst ihn sein Leben in immer neuen Varianten hûÑren. Und dann ist da noch diese penetrante Stimme, die TûÊubner die ganze Zeit Fragen stellt, obwohl sie sowieso mehr û¥ber ihn zu wissen scheint, als er selbst. // Mit Martin Umbach, Fred Maire, Gabriel Raab, Katja Bû¥rkle, Bettina Redlich, Erich Hallhuber, Elmar Brandt, Uli Winters, Sabine Kastius, Stefan Kastner, Friedrich Schloffer, Tobias Schormann u.a. / Komposition: Simon Stockhausen /Realisation: Bernadette Sonnenbichler/Thomas von Steinaecker / BR 2010 / LûÊnge: 57'00 Seine Jugend im oberfrûÊnkischen Hof, der Krieg, seine groûe Liebe, seine Karriere als Maschinenbauer, die Geburt seiner Tochter, der Tod seiner Frau. Es ist ein langes, erfû¥lltes Leben, auf das TûÊubner zurû¥ck blickt, jedoch kein auûergewûÑhnliches. Oder macht er sich da etwas vor? Schlieûlich hat TûÊubner eine unwahrscheinliche Begabung: sein phûÊnomenales GehûÑr. Nur dieses lieû ihn den Krieg unbeschadet û¥berstehen, nur dieses lieû ihn zum talentiertesten Ventilatorenhersteller in Bayern werden. Und auch sonst bestimmten vor allem seine Ohren sein Leben: der Klang der federnden Schritte seiner Frau Lissi, das Rattern seiner Ventilatoren, die GerûÊusche seiner Familie im Alltag ã das alles verbindet sich in TûÊubners Kopf zu Melodie, zu kleinen Sinfonien, nach deren Rhythmus er lebt und funktioniert und jede kleinste StûÑrung darin irritiert zur Kenntnis nimmt. Bis er eines Tages den Krebs hûÑren kann, der im KûÑrper von Lissi wû¥tet. Wurde seine besondere Gabe damit nicht gleichsam zu einem Fluch, hat er mit seiner GerûÊuschempfindlichkeit seiner Familie nicht sogar das Leben zur HûÑlle gemacht und sich darû¥ber hinaus stur geweigert, aus der Begabung Kapital zu schlagen? TûÊubner ist sich nicht mehr sicher, wie es wirklich war. Sein akustisches GedûÊchtnis lûÊsst ihn sein eigenes Leben in immer neuen Varianten hûÑren und nicht nur das ã auch die geschichtlichen Ereignisse laufen in TûÊubners Ohren anders ab, als sie laut Geschichtslexikon und der ãStimmen des Jahrhunderts CDã, die ihm seine Tochter geschenkt hat, gewesen sein sollen. Ist TûÊubner dabei, sich im Labyrinth seines Innenohrs zu verirren? Und dann ist an diesem Nachmittag auch noch eine penetrante Stimme da, die TûÊubner die ganze Zeit Fragen stellt, obwohl sie sowieso mehr û¥ber ihn zu wissen scheint, als er selbst. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 04.06.2010
Datum: 04.06.2010Länge: 00:57:19 Größe: 52.52 MB |
||
| Ulrike Haage: Die Stille hinter den Worten - 28.05.2010 | ||
|
HûÑrspielkomposition in 9 Bildern / Mit Anna-Lena Zû¥hlke (Stimme), Carlos Bica (Kontrabass), Ulrike Haage (prûÊparierter Flû¥gel, Elektronik, O-TûÑne) / Komposition und Realisation: Ulrike Haage / BR 2008 / LûÊnge: 41'34 // "La vûˋritûˋ est personelle." Ein Autor hat sich davongemacht. Ein paar Worte hat er uns hinterlassen, die nur noch in blassen Erinnerungsfragmenten die RûÊume beleben; Worte, die wie fern vergangene Reflexe einstiger Ideen aufscheinen. Seine Abwesenheit zeichnet eine tûÑnende Spur des Verschwindens, weckt die Erinnerung an eine schemenhafte PrûÊsenz, die nun nicht mehr Sprache ist, sondern bloûer Nachhall der Worte ã Gedankenspuren, die sich in Tonspuren verwandelt haben. Wir, die Verlassenen, bleiben zurû¥ck in dem Raum des vollen, erfû¥llten Schweigens. Doch zwischen den GerûÊuschen, den Satzfragmenten und den TûÑnen muss ES noch zu finden sein: dieses Gewesene, das so gegenwûÊrtig ist. Jeder Ton, jede Silbe, jedes Wort und jeder Name gleicht einer Anrufung, um den Raum des Schweigens mit einer spû¥rbaren PrûÊsenz zu fû¥llen: Schemen des Realen, der Leidenschaft, des Todes. Nichts verschwindet.
ãEs entsteht eine pausenintensive Zwiesprache mit sich selber, SûÊtze treffen auf Worte und verschwinden in der Musik. Die Musik reagiert, erschafft einen wort-losen Raum, den Frei-Raum fû¥r eigene Gedanken. Die Stille hinter den Worten wird hûÑrbar. Nichts verschwindet spurlos. Nicht in den Rissen der Welt, nicht im Arkanum des Schweigens.ã (Ulrike Haage) |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 28.05.2010
Datum: 28.05.2010Länge: 00:41:53 Größe: 38.39 MB |
||
| Ludwig Thoma: Erster Klasse - 21.05.2010 | ||
| Einakter in bayerischer Mundart / Mit Franz FrûÑhlich, Thea Aichbichler, Albert Spenger u.a. / Regie: Olf Fischer / BR 1955 / LûÊnge: 35'05 // Ein Ministerialrat und zwei Bauern im Zug nach Mû¥nchen. Die Bauern reiûen zotige Sprû¥che und prahlen mit ihren Tricks GeschûÊfte zu machen. Die Stimmung kippt, als herauskommt, dass der Bauer in der Politik und dem Ministerialrat vorgesetzt ist. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 21.05.2010
Datum: 21.05.2010Länge: 00:35:25 Größe: 32.47 MB |
||
| Ludwig Thoma: GelûÊhmte Schwingen - 21.05.2010 | ||
| Einakter in bayerischer Mundart / Mit Franz FrûÑhlich, Thea Aichbichler, Albert Spenger u.a. / Regie: Olf Fischer / BR 1953 / LûÊnge: 17'42 // Ein egozentrischer Dramatiker ist in Aufruhr. Sein neuestes Stû¥ck wird vom Publikum zerrissen. Es sei zu 'altmodisch'. Der Schwiegervater, auf dessen Kosten der Dichter lebt, kommt ins Haus. Er verlangt von ihm, dass er von jetzt an 'modern' dichte. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 21.05.2010
Datum: 21.05.2010Länge: 00:18:01 Größe: 16.54 MB |
||
| Robert Lax: 21 pages - 14.05.2010 | ||
| Mit Robert Lax / BR 1994/99 / LûÊnge: 66'48 // Die poetische Biographie eines der groûen Unbekannten der neueren amerikanischen Literatur. "21 pages heiût deshalb 21 pages, weil das Manuskript aus 21 Manuskriptseiten bestand. Das ganze Buch habe ich in einer einzigen Nacht geschrieben, im Lichtkegel einer Taschenlampe, im Bett sitzend." | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 14.05.2010
Datum: 14.05.2010Länge: 01:07:07 Größe: 61.48 MB |
||
| Sigrid Hauff: is was - was is: Robert Lax - 07.05.2010 | ||
| PortrûÊt des amerikanischen Dichters Robert Lax / Mit Peter Fricke, Horst Raspe, Lorenz Meyboden / Regie: Herbert Kapfer / BR 1990 / LûÊnge: 52'00 // Einfachheit, Kontemplation, direkte Kommunikation, Konzentration auf das Existentielle und Essentielle, Einheit von Leben und Werk - diese Begriffe eignen sich fû¥r eine erste AnnûÊherung an Robert Lax. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 07.05.2010
Datum: 07.05.2010Länge: 00:52:19 Größe: 47.94 MB |
||
| Hartmut Geerken: bunker - 30.04.2010 | ||
|
Mit Hartmut Geerken / Realisation: Hartmut Geerken / BR 1996 / LûÊnge: 66'03 // "bunker" beschreibt einen chronobiologischen Selbstversuch: Der Autor unterzog sich 1986 einem Test, indem er sich vier Wochen lang in einem schallisolierten Bunker tief in einem Berg einem kû¥nstlichen Tag aussetzte. Was er hier erlebt, wie er damit umgeht, von der Auûenwelt vollstûÊndig
abgeschirmt zu sein ... beschreibt er in diesem HûÑrspiel. SelbstgesprûÊche werden immer hûÊufiger, schlieûlich stellen sich imaginierte Partner ein. ... 23 Tonbandkassetten fû¥llt Geerken in diesen 31 Tagen - das akustische Dokument einer freiwilligen Isolierung. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 30.04.2010
Datum: 30.04.2010Länge: 01:06:19 Größe: 60.76 MB |
||
| Eva Meyer: Der Kriegstourist - 23.04.2010 | ||
| Essay zu Hermann Brochs Roman "Hugenau oder die Sachlichkeit" / Mit Saskia Mallison, Christiane Roûbach / Realisation: Eva Meyer / BR 2009 / LûÊnge: 44'16 // "Was geschieht, wenn Werthaltungen nicht mehr von einer Zentralstelle aus geleitet werden und eine Atomisierung der Wertgebiete einsetzt? Entgleitet uns dann jede Form der Ethik und also auch jede wertschaffende TûÊtigkeit? Werden wir rastlos im Getriebe selbstûÊndig gewordener Werte? Sind wir Schlafwandler, die nicht mehr wissen was sie tun? Der Zerfall der Werte kû¥ndigt sich in Brochs Schlafwandler in den Figuren des Romantikers Pasenow und des Anarchisten Esch an, um dann ã wûÊhrend des 1. Weltkriegs ã in der sachlichen Lebenshaltung Huguenaus zu kulminieren. WûÊhrend Pasenows Zustand noch der einer Sehnsucht ist, die keine Entsprechung in der Wirklichkeit findet, steht Esch schon zwischen dem Wunsch nach einer Ordnung und der Einsicht in ihre UnmûÑglichkeit. Er wird vom Kriegstouristen Huguenau umgebracht, der sich von all diesen Problemen verabschiedet hat und sich den neuen VerhûÊltnissen bestens anpasst: Er kann nûÊmlich Werte wechselnd handhaben und das heiût opportunistisch. Aber die Frage ist: Was geschieht mit den im Wertzerfall freiwerdenden KrûÊften? Sind sie nur noch Kampfmittel im Streite der einzelnen Wertgebiete? Sind sie nur noch Mittel der gegenseitigen Zerfleischung? Sind sie nur noch Mord? Es sind die jeweiligen Wertgebiete, die aus der Masse des Irrationalen eine Gruppe ãguterã irrationaler KrûÊfte rekrutieren, um mit deren Hilfe den gefû¥rchteten weiteren Zerfall zu hemmen und die eigene Bestandslegitimation zu erbringen. Doch statt seinen Bestand aufrechtzuerhalten, indem es sich selbstgenû¥gsam auf den ihm innewohnenden irrationalen Gefû¥hlswert beruft, muss ein jeweiliges Wertgebiet diese Imitation eines Totalsystems aufgeben. Es muss sich als ein Gebiet unter anderen begreifen, in dem keines sich gegen ein anderes durchsetzen muss und wir es mit einer Vielzahl von unmerklichen und uneinheitlichen ûbergûÊngen zwischen Gebieten zu tun bekommen. Die Wirklichkeit zerfûÊllt in ein Gefû¥ge von mehreren Ebenen in mehreren Personen, in eine PluralitûÊt von Stimmen, RûÊumen, Zeiten, sowie deren Kombinatorik. In allem und jedem kommt es auf das VerhûÊltnis zur Freiheit an. Das gilt auch fû¥r einen wie Huguenau, doch gelangt er nicht weiter als bis zur Freiheit des Mords. Deshalb kommt es vor, dass er mit wegwerfender Handbewegung etwas abzutun sucht, û¥ber dessen Herkunft er sich keine Rechenschaft geben kann. Nicht zuletzt liegt es wohl daran, dass sich um ihn unmerklich eine Kluft auftut, eine tote Zone des Schweigens. Gewiss haben wir es hier mit dem Aufkommen von Situationen zu tun, zu denen es nur noch zufallsbedingte Beziehungen zu geben scheint und die einen in ZustûÊnde versetzen, in denen man nur noch hindûÊmmert und gleichgû¥ltig wird. Doch geben sie uns mit der Zeit einen Faden an die Hand, der uns durch eine Vielzahl mûÑglicher ûbergûÊnge fû¥hrt. Was man an Aktion und Reaktion verliert, wenn man in diesen Situationen nicht gleich seinen Vorteil wittert, gewinnt man an HellhûÑrigkeit. Und hûÑrbar wird die stilbildende Kraft der Zeit.ã (Eva Meyer) | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 23.04.2010
Datum: 23.04.2010Länge: 00:44:35 Größe: 40.86 MB |
||
| Ania Mauruschat: Das ABC des Bazon Brock - 16.04.2010 | ||
| Realisation: Ania Mauruschat / BR 2009 / LûÊnge: 52'20 // Eine Radio-Reise durch die Biografie von Bazon Brock anhand von Stichworten aus seinem Werk. Der Versuch des Portraits eines unfassbaren Mannes, der nach der Erfahrung von Krieg, Totalitarismus, Holocaust, Flucht und Schuld, gegen diesen erfahrenen Abgrund anzusprechen scheint. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 16.04.2010
Datum: 16.04.2010Länge: 00:52:30 Größe: 48.10 MB |
||
| Eran Schaerf: Nichts wie Jetzt - 09.04.2010 | ||
| Mit Franziska Ball, Pauline Boudry, Peter Veit / Regie: Eran Schaerf / BR 2009 / LûÊnge: 37'02 // "Willkommen im Interface-Studio der zusammengeschlossenen Sendeanstalten. Hier kûÑnnen Sie Geschichten aus Ihrem Alltag auffû¥hren und Sie sind live auf Sendung. Um sich zu registrieren, geben Sie 'EmpfûÊnger unbekannt' oder 'Miss Test' ein. Wiederholen Sie Ihre Eingabe um sich aus dem Empfangsbereich zurû¥ckzuziehen. Wenn Sie nichts tun, schaltet sich die Aufnahmefunktion innerhalb von 59 Sekunden automatisch ausã, sagt ein Moderator in automatischem Ansageton und erklûÊrt damit die Spielregeln fû¥r Eran Schaerfs neues HûÑrspiel. Eine HûÑrerin loggt sich ein und stellt sich und ihren Mann als ausgewanderte Figuren einer englischsprachigen Geschichte vor. Da sie nicht als solche erkannt werden wollen, beschlieûen sie, sich fû¥r die deutschsprachige Sendung umzubenennen. Wie auch immer sie heiûen werden ã mit der Vorstellung eines neuen Namens versuchen sie, ihre Rolle als Figuren einer Geschichte mit der Rolle realer Personen zu tauschen. In der Geschichte gab es in der Nachbarwohnung eine SchlûÊgerei. Die Frau hûÑrte Schreie, intervenierte jedoch nicht, da sie damit zugegeben hûÊtte, ihre Nachbarn belauscht zu haben. Von der Wiederauffû¥hrung dieser Szene fû¥r die Sendung verspricht sie sich die MûÑglichkeit, die Handlung, zu der sie in der Geschichte nicht in der Lage war, live nachholen zu kûÑnnen. Doch bereits bei der Eingabe der Geschichte treten Fehler auf: ãFehler 111: Es gibt Figuren, die in der Sprache beheimatet sind, aber eine Kurzgeschichte ist nicht ein Land, aus dem man auswandern kann. Fehler 243: Geschlechtsmerkmale unberechenbar. Fehler 576: Doppelbesetzung. Sie sind diejenige, die berichtet und diejenige, von der berichtet wird.ã Wie in der Geschichte, so funktioniert auch in der Sendung die ûbertragung nicht einwandfrei, da das RadiogerûÊt der leidenschaftlichen RadiohûÑrerin gelegentlich GesprûÊche aus Nachbarwohnungen û¥bertrûÊgt ã oder heimliche Telefonate von HaushûÊlterinnen wûÊhrend ihre Arbeitsgeberinnen nicht zuhause sind, auch Bekundungen von Magenbeschwerden, sinnlicher Liebe, abgrundtiefer Eitelkeit, Vertrauen, Verzweifelung und ErlûÊuterungen zur Heimvorfû¥hrung eines Urlaubsfilms. Ob der Nachbar fû¥r die Sendung seine Frau noch einmal schlagen wû¥rde? Ob die Nachbarin dann die Treppe hinauflaufen wû¥rde, um zu helfen? Diese Vorstellung ruft in ihrem GedûÊchtnis zunûÊchst eine andere Geschichte ab, in der sie selbst einer Macht unterworfen war und ein Opfer von Gewalt wurde. Gespalten zwischen der Opferrolle, die sie in der einen Geschichte einnehmen musste, und der Machtposition, die sie durch das Belauschen in der anderen Geschichte eingenommen hat, schiebt die HûÑrerin die Handlung auf. Eigentlich ist sie der Meinung, sie hûÊtte die Funktion SchrittgerûÊusche-Treppe-Aufstieg aktiviert. Oder geht es in der Sendung doch um mehr, als was man hûÑrt? Ging der Moderator wirklich davon aus, dass sie die Treppe hinauflaufen wû¥rde? | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 09.04.2010
Datum: 09.04.2010Länge: 00:37:21 Größe: 34.24 MB |
||
| Johann Gottfried Seume: Mein Leben - 01.04.2010 | ||
| Mit Peter Fricke, Matthias von Stegmann / Bearbeitung: Garleff Zacharias-Langhans / Komposition: Wulf Schaeffer / Regie: Christoph Lindenmeyer / BR 1994 /LûÊnge: 43'28 // "Wie oft habe ich gewû¥nscht, daû ich kein Buch als den Katechismus und kein Land als das Knauthainer Kirchspiel kennte. Wû¥rde ich nicht weit ruhiger und viel glû¥cklicher sein?" Johann Gottfried Seume, 1763 in einem Dorf in Sachsen geboren ã Bauernsohn, hochbegabt, vom Pfarrer entdeckt, von einem Adligen gefûÑrdert, zur Schule und zur UniversitûÊt geschickt, damit er Theologie studiere und Pfarrer werde: Der UniversitûÊt entlaufen, der Heimat entlaufen, von den Hessen zwangsrekrutiert und als Soldat nach Amerika verkauft; heimkehrend von den Preuûen ergriffen und wieder Soldat; entlaufen, eingefangen, endlich freigegeben. Feind aller Ungleichheit, KûÊmpfer fû¥r Gerechtigkeit, Liebhaber der Antike, Bewunderer des MilitûÊrs: Er promoviert û¥ber ãdie Waffen der Alten und die Waffen der Neuenã. Lehrer in Leipzig, Offizier in Warschau; als Sympathisant der Polen steht er im Dienst ihrer russischen Feinde. Er ist unglû¥cklich in der Liebe und rastlos im Wandern. Nirgends hûÊlt es ihn. Zu Fuû geht er von Leipzig nach Syrakus, û¥ber Warschau durchs Baltikum nach Petersburg und Moskau. ãWer gehtã, sagt er, ãsieht anthropologisch und kosmisch mehr, als wer fûÊhrt.ã Er lernt die ûrmsten und die Reichsten kennen, die Edlen und den Adel. Den ãgeistvollen Wandererã nennt ihn ein Freund. Er schreibt Gedichte, AufsûÊtze, Reiseberichte; er schreibt politische Pamphlete, die niemand zu drucken wagt. Kurz vor seinem Tod, 1810, beginnt er, sein Leben zu erzûÊhlen; mit den Worten ãund nunã bricht er ab. Postum erscheint 1813 seine Autobiographie Mein Leben. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 01.04.2010
Datum: 01.04.2010Länge: 00:43:48 Größe: 40.14 MB |
||
| Ingrid Caven/Pierre Henry: Schattenzonen - 19.03.2010 | ||
| Mit Ingrid Caven / Literarische Vorlage: Jean-Jacques Schuhl / Aus dem FranzûÑsischen von Uli Aumû¥ller / Komposition: Pierre Henry / Bearbeitung: Ingrid Caven / Realisation: Ingrid Caven/Pierre Henry / BR/MaerzMusik/Berliner Festspiele/MaerzMusik 2003 / LûÊnge: 61'20 // 'Schattenzonenã ist eine Montage: Ein Potpourri aus dem Leben der Romanfigur Ingrid Caven, Erinnerungsbruchstû¥cke aus 50 Jahren Deutschland. Von der Ostseekû¥ste û¥ber Saarbrû¥cken, Mû¥nchen und New York bis nach Paris. Homer, Baudelaire, Tristan Tzara und Rainer Werner Fassbinder tauchen auf. KûÑrper und Kunstlieder, Allergien und Stimmû¥bungen. Das Kreisen um eine unwahrscheinliche Wahrheit, die namenlos bleibt: ãeine dunkle Zone im Gehirnã. Die Basis fû¥r dieses HûÑrstû¥ck bildet Jean-Jacques Schuhls Roman ãIngrid Cavenã, der mit dem Prix Goncourt 2000 ausgezeichnet wurde. Ingrid Caven hat das Werk bearbeitet und stimmlich umgesetzt. Pierre Henry entwickelte dazu eine Klanglandschaft zwischen E und U, musique concrû´te, Chanson, Remix und Rezitativ. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 19.03.2010
Datum: 19.03.2010Länge: 01:11:26 Größe: 65.40 MB |
||
| Ernst Jandl: das rûÑcheln der mona lisa - einfû¥hrung in ein hûÑrspielexperiment - 05.03.2010 | ||
| Mit Ernst Jandl / BR 1970 / 14'59 // Ernst Jandl gibt eine Einfû¥hrung in sein radiophones Stû¥ck "das rûÑcheln der mona lisa". Ohne erklûÊrerischen Duktus, ohne auf Kosten des HûÑrspiels zu viel auszudeuten, gibt Jandl Einblicke in die Entstehung und die Kontexte der Produktion. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 05.03.2010
Datum: 05.03.2010Länge: 00:15:22 Größe: 14.11 MB |
||
| Ernst Jandl: das rûÑcheln der mona lisa - 05.03.2010 | ||
| ein akustisches geschehen fû¥r eine stimme und apparaturen / Realisation: Ernst Jandl / BR/HR/NDR 1970 / LûÊnge: 25'00 // Jandl sieht in seinem HûÑrspiel die "Skepsis gegenû¥ber den MûÑglichkeiten der menschlichen Kommunikation schon damit angedeutet, dass es ja letzten Endes ein einziger Monolog ist und dass diese eine Stimme auch den Einzelnen in einer auûerordentlich groûen Abgeschlossenheit zeigt. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 05.03.2010
Datum: 05.03.2010Länge: 00:25:25 Größe: 23.32 MB |
||
| Albrecht Kunze: The Big Beat - 26.02.2010 | ||
| Mit Viola Seiffe, Karolina Sauer, Claudia Splitt, Natalie Welch, Antje Schulz / Komposition und Realisation: Albrecht Kunze / BR 1995 / LûÊnge: 52'41 // Die Front-Show "The Big Beat". Es treten auf: Engel der Angst, KûÑniginnen der Gemetzel, Hû¥terinnen des Melodrams mit Texten alter Girl-Group-Songs. Von AbhûÊngigkeit und Schmerz, TrûÊnen und Tod zum Soundtrack des Krieges in der Entfernung. "he hit me - and it felt like a kiss" Danach: Tanz der Luftwaffenhelferinnen an der Lagekarte. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 26.02.2010
Datum: 26.02.2010Länge: 00:53:00 Größe: 36.44 MB |
||
| Albrecht Kunze: Slight Rushing Movements - 19.02.2010 | ||
| Mit Ruth Hoffmann, Amy Leverenz, Karolina Sauer, Werner Dickel, Matthias Lorenz / Komposition und Realisation: Albrecht Kunze / BR 1994 / LûÊnge: 52'28 // Eine Stelle aus Stanley Kubrick's 'Full Metal Jacket' dient als Prolog fû¥r dieses Nachtstû¥ck û¥ber Todesangst und TûÑten, û¥ber die Furcht vor dem Verschwinden und der UnmûÑglichkeit stehenzubleiben. Es geht um Augenblicke, in denen Angst entsteht, um Momente, in denen diese Angst in das Bewuûtsein tritt, um den ûbertritt in die Welt, in der nicht mehr ein DJ mein Leben retten kann (so sehr ich mir das auch wû¥nschte), und in der deswegen manche versuchen, gegen die Stille der Angst anzusingen (vielleicht als Erinnerung). | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 19.02.2010
Datum: 19.02.2010Länge: 00:52:48 Größe: 36.29 MB |
||
| Ernst Toller: Eine Jugend in Deutschland (3/3: GefûÊngnis) - 12.02.2010 | ||
| Mit Steven Scharf, Paul Herwig, Michael Tregor, Martin Carnevali, Andreas Bittl, Stefan Wilkening, Maximilian Brû¥ckner, Andrûˋ Jung, Oliver Losehand, Rudolf Waldemar Brehm, Wolfgang Menardi, Oliver Mallison, Michael A. Grimm, Brigitte Hobmeier / Komposition: Jakob Diehl / Bearbeitung und Regie: Katja Langenbach / BR 2008 / LûÊnge: 57'14 // Ernst Toller, geb. am 1. Dezember 1893 in Samotschin, Kreis Kolmar, Kriegsfreiwilliger, Pazifist, RevolutionûÊr, Schriftsteller, Fû¥hrer der RûÊteregierung, gewûÊhlter Abschnittskommandant der Roten Armee an der Front vor Dachau, tauchte bei der Eroberung Mû¥nchens durch Freikorps und Reichstruppen unter, wurde am 4. Juni 1919 in Schwabing verhaftet und als Vorsitzender des Zentralrates in der Mû¥nchner RûÊterepublik wegen Hochverrats zu fû¥nf Jahren Festung verurteilt. Als Dramatiker in den 20er Jahren weltberû¥hmt, den Nazis als Jude, RevolutionûÊr, Schriftsteller verhasst wie kaum ein anderer. 1933 infolge der Machtû¥bernahme der Nationalsozialisten Emigration, zuerst in die Schweiz, danach nach England und in die USA. Selbstmord am 22. Mai 1939 im Mayflower Hotel in New York als Folge schwerwiegender psychischer Probleme, dem Gefû¥hl politischer Ohnmacht und der Nichtbeachtung als Schriftsteller in den USA. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 12.02.2010
Datum: 12.02.2010Länge: 00:57:33 Größe: 39.56 MB |
||
| Ernst Toller: Eine Jugend in Deutschland (2/3: Revolution) - 05.02.2010 | ||
| Mit Steven Scharf, Rudolf Waldemar Brehm, Elisabeth Wasserscheid, Andreas Bittl, Oliver Mallison, Paul Herwig, Stefan Wilkening, Michael Tregor, Ferdinand Schmidt-Modrow, Wolfgang Menardi, Oliver Losehand, Michael A. Grimm, Maximilian Brû¥ckner, Oliver Mallison, Martin Carnevali, Annete Paulmann / Komposition: Jakob Diehl / Bearbeitung und Regie: Katja Langenbach / BR 2008 / LûÊnge: 57'17 // Auch an der zweiten Mû¥nchner RûÊterepublik beteiligt Toller sich aktiv. Er kûÊmpft als Truppenfû¥hrer der Roten Armee an vorderster Front in der Umgebung von Dachau. Doch auch diese RûÊterepublik stellt sich als nicht stabil heraus, sie wird durch Freikorps und Reichswehren mit viel Blutvergieûen niedergeschlagen. Alle Mitglieder des Vollzugsrates werden verhaftet, Toller versteckt sich. Er wird polizeilich gesucht. Alle, die ihn decken oder verstecken, schweben ebenfalls in Lebensgefahr. Er wird in einem seiner Verstecke aufgegriffen und im Juni 1919 zu fû¥nf Jahren Festungshaft wegen Hochverrats verurteilt. WûÊhrend er in mehreren bayerischen GefûÊngnissen seine Strafe absitzt, findet an der Volksbû¥hne Berlin die Urauffû¥hrung seiner Dramen Die Wandlung (1919) und Masse Mensch (1921) statt. Toller wird ein bekannter Dramatiker. Um ein Zeichen gegen die unmenschlichen Haftbedingungen zu setzen, tritt Toller in den Hungerstreik. Nach seiner Entlassung wird er nach Sachsen abgeschoben. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 05.02.2010
Datum: 05.02.2010Länge: 00:57:36 Größe: 39.59 MB |
||
| Ernst Toller: Eine Jugend in Deutschland (1/3: Jugend) - 29.01.2010 | ||
| Mit Steven Scharf, David Herber, Philip GûÑtz, Annette Paulmann, Anna Barbara Kurek, Elisabeth Wasserscheid, Julia Loibl, Maximilian Brû¥ckner, Paul Herwig, Michael Tregor, Stefan Wilkening, Oliver Losehand, Andreas Bittl, Michael A. Grimm, Andrûˋ Jung, Ferdinand Schmidt-Modrow, Brigitte Hobmeier / Komposition: Jakob Diehl / Bearbeitung und Regie: Katja Langenbach / BR 2008 / LûÊnge: 57'15 // 1933 erschien im Amsterdamer Exilverlag Querido "Eine Jugend in Deutschland", der autobiographische Roman des expressionistischen Autors Ernst Toller. 1893 geboren in einem behû¥teten jû¥dischen Elternhaus erlebt er in Frankreich den Ausbruch des Ersten Weltkrieges als Literatur-, Philosophie- und Jurastudent. Sofort reist der Patriot Toller nach Deutschland, meldet sich freiwillig als Soldat und wird Unteroffizier. An der Front lernt er den Krieg aus nûÊchster NûÊhe kennen. Der Enthusiasmus fû¥r den Kampf fû¥r das Vaterland schwindet schnell. Von den Grausamkeiten des Krieges und dem Massensterben an der Front erschû¥ttert, erkrankt er schwer und wird kriegsuntauglich. Toller setzt in Mû¥nchen sein Studium fort und trifft dort u.a. Thomas Mann, Frank Wedekind und Rainer Maria Rilke. In Heidelberg lernt er Max Weber kennen und ist Mitbegrû¥nder des Kulturpolitischen Bunds der Jugend in Deutschland, der "fû¥r eine friedliche LûÑsung der Widersprû¥che des VûÑlkerlebens" und "Abschaffung der Armut" kûÊmpfen will. Die Reaktion auf die Grû¥ndung folgt auf dem Fuû: alle mûÊnnlichen Mitglieder des Kampfbundes werden als kriegstauglich in die Kasernen geschickt. Toller aber liegt im Krankenhaus und ist deswegen fû¥r die MilitûÊrbehûÑrden nicht greifbar. Er kann rechtzeitig fliehen und kûÊmpft, durch seinen Einsatz an der Front zum entschiedenen Kriegsgegner geworden, in Mû¥nchen an der Seite Kurt Eisners gegen die Verantwortlichen des Kriegs. Nach seiner Teilnahme an Kundgebungen wird er verhaftet und nutzt die Zeit im MilitûÊrgefûÊngnis, die Schriften von Marx, Engels und Rosa Luxemburg zu studieren. Vom Ausbruch der Revolution Anfang November 1918 erfûÊhrt er im Krankenbett. Die Arbeiter in den Fabriken, die KriegsgeschûÊdigten, Studenten, Bû¥rger, ziehen in die Kasernen der StûÊdte, wo sich die kaiserlichen MilitûÊrmûÊchte den rebellierenden Massen ergeben. Der Arbeiter- und Soldatenrat wûÊhlt Kurt Eisner zum ersten MinisterprûÊsidenten des neu ausgerufenen Freistaates Bayern. Kurt Eisner wird am 21.02.1919 auf offener Straûe ermordet. Der Zentralrat der Arbeiter-, Bauern- und SoldatenrûÊte û¥bernimmt die Regierungsgewalt. Am 07.04.1919 wird die erste Mû¥nchner RûÊterepublik ausgerufen. Sie ist der Versuch, aus dem aus dem KûÑnigreich Bayern entstandenen Freistaat einen sozialistischen Staat in Form einer RûÊtedemokratie zu schaffen. Toller wird der Vorsitzende ihres Zentralrates. Nach nur sechs Tagen wird der von der USPD gefû¥hrte Zentralrat von den Kommunisten abgesetzt und die zweite Mû¥nchner RûÊterepublik ausgerufen. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 29.01.2010
Datum: 29.01.2010Länge: 00:57:34 Größe: 39.57 MB |
||
| Hans Platzgumer: Etwa 90 Grad - 22.01.2010 | ||
|
Mit Rainer Bock, Mogens von Gadow, Paul Herwig / Komposition: Hans Platzgumer / Regie: Ulrich Lampen / BR 2008 / LûÊnge: 57'47 // Es ist der 1. April 1909. 87 Grad 47 Minuten nûÑrdliche Breite. Commander Robert Peary, amerikanischer Held und Rassentheoretiker, bricht mit einer kleinen Polgruppe zur letzten Etappe auf dem Weg zum Nordpol auf. Bis auf vier Inuit und seinen Diener Matthew Henson hat er alle Begleiter zurû¥ckgeschickt. Er ist 53 Jahre alt und acht seiner Zehen sind erfroren, so dass er keine lûÊngeren Strecken auf dem Eis mehr gehen kann. Sein einst penibel gefû¥hrtes Logbuch beginnt sich im Frostnebel aufzulûÑsen. Immer geheimnisvoller werden die vagen Eintragungen, bis schlieûlich ganze Seiten fehlen und selbst das Ziel, die Eroberung des Pols, nicht mehr genannt wird. Am gleichen Tag, etwa 10 Breitengrade sû¥dlicher, kûÊmpft ein anderer Amerikaner um das ûberleben im arktischen Eis. Er ist auf dem Weg in Richtung Sû¥den, wo er der Welt seinen Triumph verkû¥nden will. Pearys ehemaliger Expeditionsarzt Frederick Cook behauptet, bereits im April des Vorjahres den Pol erreicht zu haben. Doch auf dem Rû¥ckweg trieb ihn die Eisdrift ab und zwang ihn zu einer ûberwinterung unter unvorstellbaren Entbehrungen. Er û¥berlebte die Polarnacht. Doch seine Aufzeichnungen erreichten nie die Shetland-Inseln, von wo aus er im September 1909 seine Nordpolentdeckung verkû¥nden wird. Hans Platzgumer schickt 2008 eine weitere Person in das ewige Eis. Sebastian Fehr ist vor der ûberflussgesellschaft Mitteleuropas geflû¥chtet und befindet sich auf dem Weg zu seinem ultimativen Ziel, dem Erfrieren in der totalen Einsamkeit des Franz-Josef-Lands, den nûÑrdlichsten Inseln der Welt. Dort gedenkt er seine menschliche Existenz ein fû¥r alle mal abzulegen. Benommen von Schmerztabletten und geblendet vom andauernden Schneelicht spricht er die Eindrû¥cke seines Verschwindens in ein Diktafon.
Hans Platzgumers HûÑrspiel ist eine Collage aus drei Tage- bzw. Logbû¥chern, in denen die Grenzen zwischen Fakten und Fiktion, zwischen Wahrheit und Wahnvorstellung mit jedem weiteren Tag in der Eiswû¥ste unkenntlicher werden. Entstanden ist eine Darstellung aus drei Perspektiven, die sich vereinen und aus unterschiedlichen Motiven dasselbe Ziel anpeilen: den entlegensten Ort der Welt, das Ende der Messbarkeit, die AuflûÑsung der Ratio. Dort oben auf etwa 90 Grad Nord, mitten im Nichts. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 22.01.2010
Datum: 22.01.2010Länge: 00:58:06 Größe: 39.94 MB |
||
| Kathrin RûÑggla: der tsunami-empfûÊnger - 15.01.2010 | ||
| Mit Linda Olsansky, Eva Brunner, Tony de Maeyer, Martin Engler, Hanns Zischler, Simone Kabst, Dominik Glaubitz, Karena Lû¥tge, Leopold von Verschuer / Komposition: Bo Wiget / Regie: Leopold von Verschuer / BR 2010 / LûÊnge: 54'08 // Ein FinanzkrisenhûÑrspiel: "'eine nachhilfestunde in sachen wirtschaft' hat der soziologe dirk baecker die finanzkrise genannt, als wûÊren wir gemeinsam eifrige schû¥ler und wû¥rden in einem riesigen weiterbildungsgebûÊude unterwegs sein, und vielleicht sind wir das auch. zwar lûÊngst nicht mehr im guten alten arbeitsamt, auch nicht mehr ganz in der agentur fû¥r arbeit, die sich vermutlich demnûÊchst selbst abschaffen wird, und doch ã um eine art agentur handelt es sich. nur welche lehrer erwarten uns dort? welche mitschû¥ler stehen an den gûÊngen und fû¥hren ihre kleinen deals durch, ihre konspirativen gesprûÊche û¥ber dritte, die gleichermaûen looser wie gefû¥rchtete chefs sind? welche streber begleiten uns auf unserem weg nach oben? oder nach unten? so einfach ist das nicht mehr zu sagen, denn die architektur ist ganz schûÑn ins rutschen gekommen. es ist jedenfalls kein harmloses gebûÊude, das nach den alten marktwirtschaftlichen prinzipien von konkurrenz und freiem wettbewerb funktioniert, sondern eines, das ordentlich austeilt und einen im stich lûÊsst. eines, das orientierung verweigert und milliardenlûÑcher reiût. in seinem zentrum immer noch der fahrstuhl, den wir ja schon von heiner mû¥ller her kennen, nur, dass er kein toter fahrstuhl ist, sondern einer, der anweisungen gibt und ein eigenleben fû¥hrt. und wenn er uns in den sogenannten bûÑrsenhimmel bringt, in dem ein ominûÑser notenbankchef thront und diverse kûÑpfungen verordnet, dann heiût das noch lange nicht, dass uns dort notwendigerweise ein glû¥ckliches ende blû¥ht.ã (Kathrin RûÑggla) | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 15.01.2010
Datum: 15.01.2010Länge: 00:54:27 Größe: 37.43 MB |
||
| Hartmut Geerken: nach else lasker-schû¥lers tragûÑdie ich&ich (fûÊllt der vorhang in herzform) - 08.01.2010 | ||
| Mit Irmgard FûÑrst, Alice Franz, Ruth Hellberg, Margarete GrûÊf, Grete Wurm / Realisation: Hartmut Geerken / BR 1995 / LûÊnge: 69'53 // Grundlage des HûÑrspiels ist ein Textkonstrukt aus den Regieanweisungen des Dramas "Ichundich" von Else Lasker-Schû¥ler (1940 im Exil in Jerusalem entstanden), das als kaum auffû¥hrbar gilt. Eine "theatralische TragûÑdie", die jahrelang von den Nachlaûverwaltern unter Verschluû gehalten wurde. Eine Herausforderung also fû¥r das HûÑrspiel. Allerdings hat Geerken nicht den Originaltext als Grundlage gewûÊhlt, sondern aus den Regieanweisungen ein Textkonstrukt des Dramas geschaffen, das er mit Marschtritten und Fetzen aus Hitlerreden unterlegt. Das Stû¥ck, in dem Personen aus Goethes Faust unter anderem mit sinistren Gestalten des Dritten Reichs zusammentreffen, wird bei Geerken zu einem meditativen Sprachspiel mit fû¥nf Sprecherinnen, die in einer ritualûÊhnlichen Situation das HûÑrspiel improvisierend entwickeln und vorantreiben. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 08.01.2010
Datum: 08.01.2010Länge: 01:10:11 Größe: 48.23 MB |
||
| Thomas Meinecke/Move D: Flugbegleiter - 01.01.2010 | ||
|
Mit Thomas Meinecke / Komposition: Move D / Realisation: Thomas Meinecke/Move D / BR 2004 / LûÊnge: 77'42 // Karol arbeitet als Flugbegleiter. In seiner Freizeit widmet er sich mit Vorliebe Resignifizierungen in der Musik: Wenn leichtverstûÊndlicher Swing zu schwierigem Be-Bop umkodiert wird oder Disco als House Music erneut in den sexuell andersdenkenden Underground abtaucht. Insbesondere beschûÊftigt ihn die Frage, was eigentlich vorgefallen ist, wenn einer Musik vorgeworfen wird, sie sei zu sû¥û. Karol gerûÊt zunehmend in den Bann der Queer Music, begeistert sich fû¥r die ûsthetik des Camp, die er gemeinsam, teils in einem dezenten Liebesreigen, teils mittels theoretischer Lektû¥ren und ErûÑrterungen, mit seinen Kolleginnen Heidi, Ashley, Kristina sowie seinem Kollegen Felix in diversen Hotelzimmern der Welt auslotet. Seine heterosexuelle Orientierung erkennt er dabei gleichsam als das Andere der HomosexualitûÊt.
In seinem Roman "Tomboy", der dem HûÑrspiel gleichen Titels zugrunde liegt, widmete sich Thomas Meinecke der sozialen Konstruktion der Frau. Das HûÑrspiel "Flugbegleiter", das zeitgleich zu Meineckes neuem Roman Musik entstanden ist, stellt die Frage in den Mittelpunkt: Was ist eigentlich ein Mann? WûÊhrend in der HûÑrspielfassung von "Tomboy" Meinecke und Move D mit einzelnen vom Autor gelesenen Textausschnitten als Material-Endlosloops auf den SoundflûÊchen des Komponisten arbeiteten, prûÊsentiert Flugbegleiter den Autor als Interpreten der verwobenen Geschichten seiner Protagonisten, die sich immer wieder auf Karols Themen zubewegen. Move Dãs zitatreichen Kompositionen begleiten den jet-settenden, musikbewegten Diskurs. In freundlicher ûbernahme erzûÊhlen sie die in "Flugbegleiter" theoretisch erûÑrterten Komplexe ohne Worte weiter. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 01.01.2010
Datum: 01.01.2010Länge: 01:17:57 Größe: 53.56 MB |
||
| Julian Doepp: "zu wû¥ten gegen ein stummes Ding" - Moby-Dick und das Radio - 11.12.2009 | ||
|
Mit Eva Gosciejewicz, Andreas Neumann, Thomas Albus / Realisation: Julian Doepp / BR 2002 / LûÊnge: 54'00 // Wale sprechen nicht. Aus ihrem KûÑrper dringt ãkeine Silbe, kein Knurren, Grunzen oder Brû¥llenã, schreibt Herman Melville. Wie lûÊsst sich so ein 'stummes Dingã im Radio darstellen? Paradoxerweise hat Moby-Dick gerade akustisch Karriere gemacht. Im nordamerikanischen Raum ist der weiûe Wal in allen hûÑrbaren Genres zu finden - darunter die ãMoby-Dickã-Kantate des Komponisten Bernard Hermann, HûÑrspiele von Orson Welles oder von dem Komiker-Duo Abbott & Costello, das Musical ãMoby Dick!ã oder eine Performance von Laurie Anderson. Mehr als ein Dutzend HûÑrstû¥cke, die auf Melvilles Roman beruhen, wurden auch vom deutschsprachigen Radio produziert: von Ernst Schnabels dreiteiliger Fassung von 1948 û¥ber eine Adaption des Rundfunks der DDR von 1978 bis zum destillierten Klassiker im Fû¥nf-Minuten-Format aus den 90ern.
Eine Dokumentation û¥ber ãMoby-Dickã im Radio als Auftakt zur zehnteiligen HûÑrspielserie von Klaus Buhlert: Der neue ãMoby-Dickã geht û¥ber die Abenteuergeschichte von der Jagd auf den Wal hinaus und û¥bersetzt erstmals auch Melvilles stilistische Experimentierfreude und scharfe Gesellschaftskritik ins Medium Radio. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 11.12.2009
Datum: 11.12.2009Länge: 00:54:13 Größe: 37.27 MB |
||
| JûÑrg Albrecht: Moon Tele Vision - 04.12.2009 | ||
|
Mit JûÑrg Albrecht, Anna Graenzer, Patrick Gû¥ldenberg, Janna Horstmann, Steffen Klewar, Ulf Schmitt, Maryam Zaree / Komposition: phonô¯noir / Realisation: phonofix (JûÑrg Albrecht, Matthias Grû¥bel) / BR 2008 / LûÊnge: 55'58 // Mit der Fuûspur eines amerikanischen Astronauten im Mondboden, der noch in zehn Millionen Jahren zu sehen sein wird, prûÊgen sich die Hoffnungen des Westens auf die Herrschaft û¥ber Erde, Weltraum und Geschichte in Staub ein. Mit der Flagge im Mondboden, die Anfang der Achtziger auf amerikanischen Bildschirmen zu sehen ist, prûÊgen sich schnell wechselnde Farben und ein Name in die Sehrinde der gerade neu Geborenen ein. Der Name: MTV, fû¥r Moon Tele Vision.
Drei Astronauten starten 2008 ins All, um den Tod ihres Freundes Jan Jupiter auf dem Mond aufzuklûÊren. Dort finden sie eine Mini Disc, von Sternenstaub umhû¥llt. Wurde Jan Jupiter bei einer Fahrt im Mondauto durch Meteoriteneinschlag getûÑtet? Waren die Bilder von Videoclips schuld, die û¥ber den Bordcomputer des Raumschiffs flimmern? Oder hat er sich selbst das Leben genommen? Zusammen mit drei Astronautinnen der feministischen Raumfahrt begeben sich die Freunde von Jan Jupiter in seine und ihre Vergangenheit, auf der Erde und im All. Auch SandmûÊnnchen International schaut zwischendurch im Raumanzug vorbei. Was aber ist, wenn die Sterne auf einmal anders aussehen? Was ist echt, was gefûÊlscht, in der eigenen Geschichte, der Geschichte des Musikfernsehens und der Raumfahrt? Ist die Mondlandung der USA 1969 nur ein Fake? Ist die Mondlandung von MTV 1981, mit der die allererste Sendeminute beginnt, also nur der Fake des Fakes? WûÊhrend der Mond, unterstû¥tzt von Google Moon, sein Versprechen hûÊlt, jede Nacht fû¥r die Menschen da zu sein, stirbt das Musikfernsehen zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Entlang der Weltraummythen des Pop, von David Bowie bis zu den Klaxons, erzûÊhlt Moon Tele Vision von einer Jugend im Outer Space der Musik, im zu Ende gehenden Zeitalter des Videoclips. Dabei entwickeln phonofix eine textliche und musikalische Komposition, eine Space Opera, die ebenso mit den Elementen der Science Fiction Serials spielt wie mit den Mitteln der Oper. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 04.12.2009
Datum: 04.12.2009Länge: 00:56:17 Größe: 38.69 MB |
||
| ARD Radio Tatort: Robert Hû¥ltner: Dienstschluss - 27.11.2009 | ||
| Mit Florian Karlheim, Brigitte Hobmeier, Michael A. Grimm, Michael Schreiner, Jû¥rgen Tonkel, Peter Rappenglû¥ck, Hans Georg Panczak, Ulla Geiger, Stephan Zinner, Eisi Gulp, Florian Fischer, Kathi Leitner, Markus Brandl, Johannes Herrschmann, Markus BûÑker, Christiane Blumhoff, Ferdinand Schmidt-Modrow, Florian Schrei, Heinz Peter, Wolfgang Rackl / Komposition: zeitblom / Regie: Ulrich Lampen / BR 2009 / LûÊnge: 53'54 // Alarm in Bruck am Inn: Am Rande der Altstadt schlagen Flammen aus einer Kellerwerkstatt. Anwohner sind der Meinung, kurz davor den Knall einer Explosion gehûÑrt zu haben. Feuerwehr und Funkstreife kommen zu spûÊt, der Besitzer der Werkstatt kann nur noch tot geborgen werden. Der allein lebende Mittdreiûiger genoss den Ruf eines harmlosen Bastlers, von dessen Waffenleidenschaft man zwar gewusst, ihr aber keine grûÑûere Bedeutung beigemessen hat. ZunûÊchst tappen die Ermittler im Dunkeln. War es ein Unfall, war es Selbstmord oder Mord? Dann mehren sich die Hinweise, dass der Tote mit der rechten Szene zu tun gehabt hat. Im Brandschutt werden mehrere Kriegswaffen gefunden. Und in Bruck am Inn wurde gerade eine "Heimatpartei" gegrû¥ndet | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 27.11.2009
Datum: 27.11.2009Länge: 00:54:14 Größe: 37.28 MB |
||
| Josef Anton Riedl: c.e. oder conclamatum est - 20.11.2009 | ||
| Fû¥r Sprecher und vier Klaviere auf einen Text von Hans Henny Jahnn nach einer Idee von Herbert Kapfer / Klavier: Jan-Philip Schulze, Ruschana Pamirova, Sebastian Berweck, Christian Schulte / Sprechen: Michael Lentz / musica viva/BR HûÑrspiel und Medienkunst 2009 / LûÊnge: 11'00 // Wind keucht ums Haus. Vier MûÊnner "im Regen so grau wie Schatten" nûÊhern sich. Sie tragen schwarze ûlmûÊntel, das Wasser rinnt von ihren Hû¥ten. Es ist das Ende der Niederschrift des Gustav Anias Horn, dem zweiten Teil der unvollendeten Roman-Trilogie "Fluss ohne Ufer" von Hans Henny Jahnn. Horn muss erkennen, dass sein gewaltsamer Tod unmittelbar bevorsteht. "Es ist das Wirkliche - die wirkliche Begegnung": Mit wachsender Hast kritzelt Horn seine letzten Zeilen. Ein Ich schreibt um sein Leben. Die 'Niederschrift' bricht ab, der Romanteil endet mit der Anmerkung: Am Schluû sind die Zeilen vollkommen unleserlich. Zudem ist das Heft offenbar mit Heftigkeit zugeschlagen und in ein Fach des Schreibtisches geschleudert worden, so daû die noch feuchte Tinte verschmiert wurde. Nur zwei Buchstaben stehen mit merkwû¥rdiger Klarheit da, 'c.e.' Man kann sie zwanglos als die Abkû¥rzung von 'conclamatum est' deuten. "conclamatum est" steht fû¥r die altrûÑmische Totenklage. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 20.11.2009
Datum: 20.11.2009Länge: 00:11:19 Größe: 7.81 MB |
||
| Andreas Ammer/FM Einheit: Lost & Found: Das Paradies - Oratorium nach John Miltons 'Paradise Lostã - 13.11.2009 | ||
|
Mit Anita Lane, Alexander Hacke, Gû¥nter Rû¥ger, James Blood Ulmer / Manuskript, Komposition, Regie: Andreas Ammer, FM Einheit / BR 2004 / LûÊnge: 76'24 // Auf dem Prû¥fstand: Das verlorene Paradies in der Fassung von John Miltons 1658-1665 geschriebenem epischen Poem 'Paradise Lost'. Milton besingt in reimlosen Jamben den Verlust Edens und unter ãVernachlûÊssigung jedes moralischen Zwecksã (P.B. Shelley) den Teufel als nicht gûÊnzlich unsympathischen Anstifter dieses Sû¥ndenfalls. Der spektakulûÊre Stoff hat schon gelegentlich dem Musiktheater einige schûÑne Momente beschert: Von Haydn bis Penderecki reichen die Versuche, Miltons grandiosen Gesang vom schauderhaften Wirken des leibhaftigen Satans in KlûÊnge zu û¥bersetzen.
In Ammers und Einheits Oratorium ãLost & Found: Das Paradiesã wechselt der hohe Stil des Gedichts mit der LautstûÊrke moderner Musik. Die Handlung, die von nichts weniger als dem Schicksal der gesamten Menschheit spricht, erscheint hingegen heute so beilûÊufig wie eine surrealistische Soap-Opera. Man kann sie mit all ihren Verwicklungen gerafft referieren. Und wenn am Ende Satans Mission doch erfû¥llt ist, wenn die von Gott so grandios geplante neue Welt samt den neuen Wesen, den Menschen, verlassen daliegt, wenn Adam und Eva ein Liebespaar wie jedes andere geworden sind, dann erstirbt auch der letzte Ton der Musik, und es wird heiûen: ãSie weinen ein paar TrûÊnen ã bald sie trocknend; Vor ihnen lag die Welt. (...) So gehen sie, Hand in Hand, langsamen Schrittes Durch Eden den einsamen Pfad dahin.ã Das verlorene Paradies, XII. Gesang |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 13.11.2009
Datum: 13.11.2009Länge: 01:16:43 Größe: 52.71 MB |
||
| Gû¥nther Koch: Geisterspiel - 06.11.2009 | ||
| Mit Gû¥nther Koch, Helmut BûÑttiger / Realisation: Helmut BûÑttiger/Bernhard Jugel/Gû¥nther Koch / BR 2005 / LûÊnge: 94'55 // "Es ist ein beklemmendes Gefû¥hl...ã - mit diesen Worten beginnt Gû¥nther Koch am 26. Januar 2004 die Reportage des wohl ungewûÑhnlichsten Spiels der deutschen Fuûballgeschichte. Zwei Monate vorher war bei der Begegnung Alemannia Aachen - 1.FC Nû¥rnberg der Trainer der Nû¥rnberger Mannschaft von einem Wurfgeschoû aus dem Publikum getroffen worden. Das DFB-Sportgericht verfû¥gte daraufhin die Wiederholung der Partie unter Ausschluû der ûffentlichkeit. Im Stadion waren neben Medienvertretern nur je 40 Offizielle eines jeden Vereins und einige Dutzend Ordner zugelassen. Ein Fuûballspiel vor leeren RûÊngen, ein Geisterspiel ã welche Stimmung mag sich da einstellen? In einer 90-minû¥tigen Echtzeit-Reportage lûÊût Gû¥nther Koch die BeschrûÊnkungen der gewohnten Fuûballberichterstattung weit hinter sich. Zwischen die Kommentierung des Spielverlaufs schiebt er immer wieder historische Exkurse zur Geschichte der beiden Vereine, der Bundesliga, des Aachener Tivoli, in dem das Spiel stattfindet. Auf ErkundungsgûÊngen im leeren Stadion unterbricht er seine Reportage durch Interviews mit Ordnern, Journalisten, einer Wû¥rstlverkûÊuferin und Michael A. Roth, dem PrûÊsidenten des 1. FC Nû¥rnberg, und zeichnet dadurch das vielstimmige Bild einer Partie, die vor allem durch die Abwesenheit dessen gekenzeichnet ist, was sonst ã nicht zuletzt akustisch ã den Fuûball ausmacht: das enthusiastische, empûÑrte, erboste, begeisterte, auf jeden Fall lautstark mitgehende Publikum, das aus dem Klangbild von Sendungen wie ãHeute im Stadionã nicht wegzudenken ist. Im Geisterspiel hûÑrt man statt des Publikums die GerûÊusche des Spiels: das Klatschen und Ploppen des Balls, die Schreie der Spieler und Trainer, gelegentlich unterbrochen von Ansagen des Stadionsprechers und dû¥nnem Beifall der Ordner und Offiziellen. Selbst den Geist des Tivoli, eine in weiûe Laken gehû¥llte Gestalt, die vor leeren RûÊngen einsame La Ola-Wellen zelebriert, holt sich Gû¥nther Koch vors Mikrophon ã doch der Geist bleibt stumm. Der Reporter hingegen redet sich heiser, muû entsetzt berichten, wie der 1.FC Nû¥rnberg die anfûÊngliche Fû¥hrung verspielt, wie Aachen sich mit einem 3:2 die Herbstmeisterschaft (im Januar!) sichert und mûÑchte am Ende nie mehr in seinem Leben einem weiteren Geisterspiel beiwohnen. Seinen Bericht beendet er mit einem flammenden Appell an die Fairness aller Fuûballfans ã ãdamit uns das fû¥r die Zukunft erspart bleibt!ã | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 06.11.2009
Datum: 06.11.2009Länge: 01:35:10 Größe: 65.39 MB |
||
| Ror Wolf/Jû¥rgen Roth: Das langsame Erschlaffen der KrûÊfte - Ein Fuûball-HûÑrstû¥ck in 6 Kapiteln - 30.10.2009 | ||
|
Mit Gû¥nther Koch, Christian Brû¥ckner, Manfred Breuckmann, Rudi Michel / Regie: Ror Wolf/Jû¥rgen Roth / BR 2006 / LûÊnge: 25'48 // Ror Wolfs FuûballhûÑrspiele aus den siebziger Jahren - montiert aus OriginaltûÑnen von Reportern, Experten, Fans - haben den Fuûball fû¥r die Literatur und die HûÑrspielkunst entdeckt. Ein gutes Vierteljahrhundert spûÊter folgt eine abschlieûende Radio-Reise in die Gefilde dieses Sports. /
Ror Wolf spielt mit dem Spiel: Ritualisierte Fuûballphrasen und emotionale Ausbrû¥che spielen einander die BûÊlle zu. "Der Ball ist rund" ist eines der legendûÊren Fuûball-HûÑrspiele Ror Wolfs, in dem Material, das Wolf 1971-79 bei Radio-Fuûballsendungen mitgeschnitten hat, collagiert wird. Ein Vierteljahrhundert, nachdem die letzte der abenteuerlustigen Expeditionen ins Reich des Fuûballs produziert wurde, begeben sich Ror Wolf und Jû¥rgen Roth mit "Das langsame Erschlaffen der KrûÊfte" auf eine ã abschlieûende ã Radio-Reise in die Gefilde des Fuûballs. In sechs Kapiteln erzûÊhlen sie an Hand von collagiertem Sprachmaterial von Aufschwû¥ngen und Abstû¥rzen, von der Zermû¥rbung schlieûlich, vom Versiegen der kûÑrperlichen und sprachlichen KrûÊfte. Dabei knû¥pfen sie an formale Verfahren an, wie sie in den HûÑrstû¥cken der siebziger Jahre entwickelt wurden, und gehen zugleich û¥ber sie hinaus. Denn am Ende geht es nicht nur im Fuûball um die ãKunst des AufhûÑrensã. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 30.10.2009
Datum: 30.10.2009Länge: 00:26:05 Größe: 17.95 MB |
||
| Jan Peters: Lost Tapes Found 1, 2, 3 - 23.10.2009 | ||
|
Mit Jan Peters, Silke Fischer, Peter Ott, Stûˋphane Riethauser, Marie-Catherine Theiler / Komposition: Pit Przygodda / Realisation: Jan Peters, Pit Przygodda / BR 2009 / LûÊnge: 24'07 // Ein unerwarteter Anruf: V. sagt, er habe die Liebe seines Lebens gefunden, seine Arbeit als wissenschaftlicher Assistent schon gekû¥ndigt und in Kû¥rze werde er fortziehen, in eine andere Stadt in einem anderen Land, wo seine Liebe lebt.
Was das alles mit ihm zu tun hat, begreift Jan Peters, der Autor dieses HûÑrspiels, erst als V. die Auszahlung des Kautionsanteils fû¥r die damals gemeinsam angemietete Wohnung davon abhûÊngig macht, dass die Garage im Hof entrû¥mpelt wird. Der fû¥r die Filme und HûÑrspiele von Jan Peters typische autobiographische Ausgangspunkt ist in Lost Tapes Found 1, 2, 3 ein Garagentor, mit dem sich plûÑtzlich eine fast vergessene Welt ûÑffnet. Mitten im Durcheinander von unzûÊhligen Filmdosen, Tû¥ten voller Audiotapes, Kisten ungeordneter VideobûÊnder und Stapeln selbstentwickelter Fotos findet sich ein Exemplar des Manifests "Das Recht auf Faulheit" von Paul Lafargue aus dem Jahr 1883, erschienen 1978 als Raubdruck in der Edition "Sonne und Faulheit". Es ist der Satz ãDie einzige akzeptable Wirtschaftsform in dieser Gesellschaft ist die Sperrmû¥llabfuhrã im Vorwort von Aslan V. Grimson, der den HûÑrspielautor davon abhûÊlt, den Inhalt der Garage in GûÊnze zum Recyclinghof zu bringen. Stattdessen wird alles in sein Atelier verfrachtet und Stû¥ck fû¥r Stû¥ck auf (ûÑkonomische) Auswertbarkeit û¥berprû¥ft. Mit viel Witz und (Selbst-)Ironie sucht Jan Peters in seinem unverhofft wiederentdeckten Bild-, Ton- und Textarchiv nach Antworten auf die groûen (und kleinen) Lebensfragen. Dabei heraus kommen die drei 8-minû¥tigen Videos fû¥r die artmix.galerie "Lost Tapes Found 1, 2, 3". Das HûÑrspiel ist die Audio-Remix-Version dieser drei Videos. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 23.10.2009
Datum: 23.10.2009Länge: 00:24:26 Größe: 16.82 MB |
||
| Raymond Federman: Playtextplay I - 09.10.2009 | ||
| Mit Raymond Federman, Jon Sass (Tuba) / Realisation: Herbert Kapfer, Regina Moths / BR 1992 / LûÊnge: 13'11 // Der amerikanische Dichter Raymond Federman trûÊgt auf unnachahmliche Weise seine Gedichte vor, geschult am Jazz, musikalisch und spielerisch. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 09.10.2009
Datum: 09.10.2009Länge: 00:13:30 Größe: 9.31 MB |
||
| Katharina Franck: Das Signal wurde û¥ber Radio gegeben - Ein Cut-Up - 02.10.2009 | ||
|
Mit Katharina Franck, Mathias Mauersberger / Regie: Katharina Franck / BR 2007 / LûÊnge: 14'10 // Der Vorabend der portugiesischen Nelkenrevolution, mit der die Armee die Salazar-Diktatur unblutig beendet: Gegen 22.45 Uhr am 24. April 1974 sendet RûÀdio Clube Portuguûˆs "E Depois Do Adeus" ("Nach dem Abschied"). Das Lied von Paulo de Carvalho ist ein erstes verschlû¥sseltes Signal fû¥r die aufstûÊndischen Truppen. Keine zwei Stunden spûÊter, um ca. 0.30 Uhr, sendet RûÀdio RenascenûÏa den Protestsong, der als AuslûÑser der Revolution in die Geschichte eingeht: ãGrûÂndola, Vila Morenaã (ãGrandola, braungebrannte Stadtã). Ein Radiosprecher liest die erste Strophe des von der Diktatur verbotenen Liedes vor, im Anschluss erklingt die Version des antifaschistischen SûÊngers Zeca Afonso: ein Signal, dessen Aufrufcharakter fû¥r die RadiohûÑrer deutlich erkennbar ist ã nur ist noch nicht jedem klar, auf was genau der Appell abzielt. Fû¥r die militûÊrischen Einheiten jedoch, die sich zur ãBewegung der StreitkrûÊfteã bekennen, stellen die Verse das vereinbarte Zeichen zum bewaffneten Aufstand dar. Am Morgen kommt ein Nachbar herû¥ber und sagt: ãWir schicken die Kinder heute nicht in die Schule, es ist Revolution!ã Knapp 18 Stunden nach Ausstrahlung des Revolutionsliedes ist Europas ûÊlteste Diktatur gestû¥rzt.
Katharina Franck verbindet O-TûÑne aus der Radioreportage O Dia 25 De Abril ã Tagebuch der Revolution von Pedro Laranjeira und eigene Erinnerungstexte zu einem Cut-Up zwischen Revolution und Stillstand. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 02.10.2009
Datum: 02.10.2009Länge: 00:14:27 Größe: 9.97 MB |
||
| Eva Meyer/Eran Schaerf: Flashforward - 18.09.2009 | ||
|
Mit Elfriede Jelinek, Laurence Rickels, Hinrich Sachs, Inga Svala Thorsdottir, Suchan Kinoshita, Mitja Tusek / Komposition: noto aka carsten nicolai / Regie: Eva Meyer/Eran Schaerf / BR/intermedium/Haus der Kunst Mû¥nchen 2004 / LûÊnge: 55'37 // Es beginnt mit einem MissverstûÊndnis, durch das MûÑglichkeit auf Vergangenheit fûÊllt. Ohne zu wissen, was es war, wissen wir doch, wie etwas gesagt, gehûÑrt, gesehen wurde, eine Liebesgeschichte oder ein ûÑffentliches Ereignis. Davon geht ein Programm aus, das flashbacks in flashforwards konvertiert. Zwischen GedûÊchtnis und Hoffnung hûÊlt es einen Platz frei und sucht dafû¥r eine Stimme. Ist es ein Zeuge, ein GeschichtenerzûÊhler, Berichterstatter, ihr gemeinsamer Programmierer oder eine im Rollenwechsel begriffene Figur? Zur Erkennung dieser VerdûÊchtigen wird eine Stimmprobe veranstaltet, in der jeder zum Statisten fû¥r die SûÊtze von anderen wird. Doch der Augenblick der Erkenntnis potentialisiert sich in Serie, die Grenze zwischen Realem und Fiktivem wird zu einem informativen Raum. Wenn drei oder mehr Statisten von Stimmen ihre Rolle verlassen, um sich mit ihrem GedûÊchtnis zu synchronisieren, ist ihre Intervention kein Ausflug in ihre Vergangenheit, die neu konfiguriert erscheint. Das seinem Bild entrissene Sprechen automontiert sich durch ein System von Entkopplungen wieder zusammen. Sind es Blickrichtungen auf eine im Unendlichen liegende Liebesgeschichte? Dieselbe und doch eine andere. Feedback | Help Zwischen GedûÊchtnis und Hoffnung hûÊlt es einen Platz frei und sucht dafû¥r eine Stimme. Ist es ein Zeuge, ein GeschichtenerzûÊhler, Berichterstatter, ihr gemeinsamer Programmierer oder eine im Rollenwechsel begriffene Figur? Zur Erkennung dieser VerdûÊchtigen wird eine Stimmprobe veranstaltet, in der jeder zum Statisten fû¥r die SûÊtze von anderen wird. Doch der Augenblick der Erkenntnis potentialisiert sich in Serie, die Grenze zwischen Realem und Fiktivem wird zu einem informativen Raum. Wenn drei oder mehr Statisten von Stimmen ihre Rolle verlassen, um sich mit ihrem GedûÊchtnis zu synchronisieren, ist ihre Intervention kein Ausflug in ihre Vergangenheit, die neu konfiguriert erscheint. Das seinem Bild entrissene Sprechen automontiert sich durch ein System von Entkopplungen wieder zusammen. Sind es Blickrichtungen auf eine im Unendlichen liegende Liebesgeschichte? Dieselbe und doch eine andere. Feedback | Help |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 18.09.2009
Datum: 18.09.2009Länge: 00:55:55 Größe: 38.44 MB |
||
| Peter Jacobi: Wo? - 11.09.2009 | ||
|
Mit Jochen Busse, Thilo Prû¥ckner / Regie: Bernd Lau / BR 1989 / LûÊnge:12'47 // Herr Schaller und Herr Zug diskutieren û¥ber den Klang von Ortsnamen wie "Aalen", "Baden-Baden", "Fallingbostel" und "EckernfûÑrde". Welchem gebû¥hrt der erste Platz? Schaller wirft Zug vor, er habe keine Prinzipien, weil er jeden Tag einem anderen Ortsnamen den Vorzug gibt. Zug sieht das mehr dynamisch: "Jeder Standpunkt ist nur momentan. Alle Positionen sind nacheinander zu verlassen, um die Wirklichkeit von allen Seiten zu besehen." Natû¥rlich kommt es immer nur auf den momentanen Standort an - ob er nun Aalen oder Oberaudorf heiût. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 11.09.2009
Datum: 11.09.2009Länge: 00:12:20 Größe: 11.30 MB |
||
| monochrom: Zukunftslektorat - 04.09.2009 | ||
| Mit Birge Tetzner, Frank Apunkt Schneider, Richard Wientze / Realisation: Frank Apunkt Schneider, Richard Wientze / BR 2004 / LûÊnge: 52'38 // Mit dem Thema Zukunft wird ûÊsthetisch, kulturell, politisch, gesanglich und medial oft leichtfertig umgegangen. Dabei haben wir es doch nur von unseren Vergangenheiten geborgt. In sieben Episoden sprechen sie û¥ber die Zukunftsentwû¥rfe aus den Bereichen Forschung, Schlager, Innenpolitik, Mittelstand, Volksmusikfachzeitschriften, InternetprûÊsenz und gesunder Menschenverstand, die ihnen dabei û¥ber den Weg laufen, um sie so zu verstehen, zu erklûÊren und zu verbessern. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 04.09.2009
Datum: 04.09.2009Länge: 00:52:57 Größe: 36.40 MB |
||
| Katja Huber: Melonen - 28.08.2009 | ||
|
Mit Mira Partecke, Meriam Abbas, Stephan Zinner, Martin Butzke, Joche Striebeck, Helga Roloff, Michel Habeck, Sherin Lotze, Lorenz Nufer, Benjamin MûÊhrlein, Burchard Dabinnus, Anna BûÑger, Dorothea Lata / Komposition: iso 68 / Regie: Christiane Klenz / BR 2004 / LûÊnge: 54'33 // Abschied und Neubeginn, eine russische Familienidylle mit Hindernissen. "Julia wacht in Volgograd auf. Lena schnarcht. Anver wûÊlzt sich im Bett. Noch klingelt kein Wecker. Es ist heiû. Groûmutter flû¥stert: Melonen. Sag ihnen, dass du Melonen willst." Julia ist aus Deutschland. Hinter ihr liegt eine LiebesaffûÊre mit Vladimir, der sie zuletzt noch in Mû¥nchen besucht hat. In Volgograd trifft sie nach zwei Jahren ihre Freunde Lena und Anver wieder. Die beiden sind im Begriff eine Familie zu grû¥nden, und Julia begleitet sie bei ihrem Umzug nach Astrachan. Auf dem Weg vom Bahnhof zu Anvers Eltern treffen sie den gebû¥rtigen Astrachaner Ilja Nikolaj Uljanov, Lenins Vater ã in Form einer Bronzestatue. Doch fû¥r weltberû¥hmt hûÊlt man in Astrachan heute vor allem die saftigen Melonen. Nach Ankunft im neuen Heim in der tartarischen Steppe kommen Spannungen auf. Anvers Vater begrû¥ût Julia mit Hitlergruû. Die Mutter serviert Kalmû¥ckenkuchen, die Groûmutter berichtet von ihren Erlebnissen mit deutschen Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Die jungen Leute flû¥chten auf die Datscha zur Melonenernte, und Julia sich in Erinnerungen an den Abschiedsbesuch von Vladimir.
Die Inszenierung des HûÑrspiels setzt auf den Effekt der Langsamkeit, so wird die Geschichte zu einem einzigen gedehnten Moment. Die Musik des Mû¥nchner/Hamburger Elektronik-Duos iso 68 (Florian Zimmer/Thomas Leboeg) unterstû¥tzt die somnambule AtmosphûÊre, die im Text angelegt ist. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 28.08.2009
Datum: 28.08.2009Länge: 00:54:51 Größe: 37.70 MB |
||
| Ulrich Gerhardt/Gû¥nter Heû: ûbergang û¥ber die Beresina - 21.08.2009 | ||
|
Realisation: Ulrich Gerhardt,Gû¥nter Heû / BR 1993 / LûÊnge: 90'11 // Subjektives PortrûÊt der deutschen Kriegsjahre 1941/42 als O-Ton-Collage aus 17 Schallplattenfolien des Amateur-Tontechnikers Jû¥rgen Tradt, der als junger Soldat wûÊhrend des Fronturlaubs Tonaufnahmen mit Hilfe eines Schallplatten-SchneidegerûÊts Marke Contiphon herstellte. Zu hûÑren sind u.a. O-TûÑne aus: Radiosendungen, TelefongesprûÊchen, eine Rede von Rudolf Heû vor Arbeitern der Firma Messerschmitt in Augsburg, ein Interview mit dem bei der Invasion Kretas verwundeten Max Schmeling, Hetzkommentare, Frontberichte, abgehûÑrte Feindsender, von Tradt selbst produzierte akustische ûuûerungen, Ansagen ... |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 21.08.2009
Datum: 21.08.2009Länge: 01:30:21 Größe: 82.72 MB |
||
| Kalle Laar: SûÈo Paulo Tracks - 14.08.2009 | ||
|
Realisation: Kalle Laar / BR 2002 / LûÊnge: 24'00 // Das Projekt "Metropolis - portraits in sound and image of the major cities in the world" fû¥hrte Kalle Laar gemeinsam mit dem Fotografen Michael Wesely im Frû¥hjahr 2002 nach SûÈo Paulo. An ausgewûÊhlten Orten der 16-Millionen-Einwohner-Stadt stellt der eine Stative fû¥r Kamera und der andere fû¥r Mikrophon auf, um gleichzeitige, fotografische Ton-Aufnahmen fû¥r ihr Projekt zu machen, wobei die Belichtungszeit der Fotografie und die LûÊnge der Tonaufzeichnung identisch sind. Bilder und Sounds werden als Vinyl-Picture-Discs verûÑffentlicht und an verschiedenen Orten der Welt ausgestellt und vorgespielt. Abgekoppelt entsteht ein HûÑrstû¥ck in Korrespondenz zu diesem audiovisuellen Projekt, 12 Tracks, die Kalle Laar aus den fû¥r SûÈo Paulo typischen Stadtsounds herausgefiltert und bearbeitet hat ã Tracks, die auch ohne den visuellen Kontext den KlûÊngen und Rhythmen der Metropole auf der Spur sind.
Kalle Laars Interesse an metropolitanen Soundaufnahmen wurzelt in seiner Arbeit im von ihm gegrû¥ndeten TemporûÊren Klangmuseum, mit dem er den musikalischen und kulturellen QualitûÊten des akustischen Alltags nachspû¥rt: www.klangmuseum.de |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 14.08.2009
Datum: 14.08.2009Länge: 00:23:55 Größe: 16.46 MB |
||
| Valeri Scherstjanoi: Heimkehrreime - 07.08.2009 | ||
| Mit Valeri Scherstjanoi / Regie: Bernhard Jugel / BR 2004 / LûÊnge: 44'04 // Heimkehr und Kehrreim gehen in dieser Sendung eine poetische Verbindung ein. Heimgekehrt ist der Lautdichter Valeri Scherstjanoi ins nûÑrdliche Ostpreuûen - die Heimat seiner Vorfahren mû¥tterlicherseits. Dort lebten einst zwischen Weichsel und Memel die Pruzzen, ein westbaltisches Volk, dem das heutige Preuûen seinen Namen verdankt. Die Pruzzen vermischten sich mit deutschen und anderen Einwanderern, ihre Sprache starb im 17. Jahrhundert aus. Sprachreste erhielten sich in nordostpreuûischen Ortsnamen ã teilweise mit deutschen Namen kombiniert. Alle diese Namen sind inzwischen verschwunden. Manche Orte wurden 1938 von den Nationalsozialisten umbenannt, weil sie nicht richtig deutsch klangen. Nach 1945 ersetzte die sowjetische Administration alle deutschen Ortsnamen durch russische. Doch noch sind die alten Namen nicht ganz verschwunden. Sie sind festgehalten in Broschû¥ren wie dem ãOrtsnamenverzeichnis Gebiet Kaliningrad (nûÑrdliches Ostpreuûen)ã. Scherstjanoi will die Namen seiner Heimat (PrûÊtlack, Nimmersatt, Pelludschen, Matzkutschen, Prosit, Tilsit) ãzurû¥ck in den groûen deutschen Wortschatz holenã und hat sie daher rû¥cklûÊufig, d.h. entsprechend ihrer Endsilben geordnet. Eine Klangsymphonie aus Kehrreimen. Heimkehrreime. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 07.08.2009
Datum: 07.08.2009Länge: 00:44:23 Größe: 30.51 MB |
||
| Tina Klopp: Mein Gelb ist dein Grû¥n - 31.07.2009 | ||
|
Mit Hermann Bohlen, Georg Cadeggianini, Nava Ebrahimi, Monika Julie Hunger, Michael Weins, Resa Memarnia / Komposition: Ben Sturm / Realisation: Tina Klopp / BR 2008 / LûÊnge: 55'37 // Wir fragen einander stûÊndig, wie es uns geht. Aber eigentlich wissen wir gar nichts vom anderen. Vielleicht ist es mûÑglich, etwas wirklich Neues zu erfahren, wenn man exakt die gleichen Dinge tut, die ein Anderer sonst immer tut. Gib dein Leben auf. ûbernehme das Leben eines Anderen. Vergiss, wer du vorher gewesen bist. Versuche, ganz der Andere zu sein. LûÑsche seine Existenz aus, bis nur noch Platz fû¥r dich da ist. Guck, was dann mit dir passiert. Das Beobachten und Nachahmen von Emotionen ruft einer Studio zur Neurobiologie des Einfû¥hlungsvermûÑgens zufolge im Gehirn ûÊhnlich Erregungsmuster hervor wie das eigene Tun. Dabei wurden nicht nur die an der Empathie beteiligten Hirnareale gefunden, sondern auch deren neurobiologische Mechanismen untersucht: ãAuf Grund empirischer Untersuchungen korreliert die Empathie positiv mit verschiedenen Intelligenzmaûen, emotionaler StabilitûÊt, kognitiven Differenzierungsleistungen und hûÑherer Struktur der Spracheã, heiût es in der Studie. ãFehlende Empathie verbindet sich dagegen mit Stereotypenbildung, Intoleranz und Vorurteil.ã Auf der anderen Seite muss auch der JûÊger sehr viel Einfû¥hlungsvermûÑgen fû¥r seine Opfer entwickeln, - sonst wûÊre er wenig erfolgreich. Fû¥nf Testpersonen haben die Aufgabe, ab sofort in ein anderes Leben zu schlû¥pfen. Sie bekommen nur eine Adresse, den Haustû¥rschlû¥ssel, ein paar wenige Daten und Handlungsanweisungen. Sie kennen den anderen nicht. Sie û¥bernachten in der anderen Wohnung, schauen aus dem anderen Fenster, trinken aus der anderen Tasse, blûÊttern in den anderen Fotoalben. Nur das AufnahmegerûÊt ist dabei. Kann man sich in das andere Leben hineindenken? Sogar Emotionen empfinden, die einem zuvor unbekannt waren? Wie der wohl ist, der sein Zimmer mit Kinderzeichnungen ausstaffiert hat. Wie es sich fû¥r den wohl anfû¥hlt, der morgens um fû¥nf in die dunkle Kû¥che tapst, um fû¥r die Freundin die Brote zu schmieren, die gleich raus muss zur Frû¥hschicht.
Ist Empathie wirklich mûÑglich? Vielleicht scheitert sie schon an den grundlegenden Dingen. Wenn wir von Grû¥n reden, wissen zwar alle, was gemeint ist. Aber wie sieht der andere Grû¥n wirklich? Vielleicht sieht es fû¥r ihn ganz anders aus. Vielleicht ist sein Grû¥n mein Gelb. Oder umgekehrt. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 31.07.2009
Datum: 31.07.2009Länge: 00:55:56 Größe: 38.44 MB |
||
| FranûÏoise Cactus: Autobigophonie - 24.07.2009 | ||
|
Mit FranûÏoise Cactus, Patrick Catani, Brezel GûÑring, Chris Immler, Felix Kubin, Beth Love, Gina dôÇOrio, Deborah Schamoni / Komposition: Brezel GûÑring / Regie/Realisation: Brezel GûÑring, FranûÏoise Cactus / BR 2004 / LûÊnge: 59'10 // Gut erfunden ist halb erlebt. FranûÏoise Cactus erzûÊhlt, wie alles gewesen sein kûÑnnte. Die Kindheit verbringt sie im Schloû ihrer Ahnen in einem franzûÑsischen Kaff namens La Grenouillû´re, wo sie Zeugin der Leberzirrhose ihres Groûvaters wird. Erste Jugendlieben fallen in die Zeit der Mairevolution `68, an der sie sich mit der Plû¥nderung der dûÑrflichen BûÊckerei beteiligt, und werden mit der Abschiebung ins MûÊdchenpensionat beendet. Sie verlûÊsst die franzûÑsische Provinz und geht ins geteilte Berlin, wo sie unter anderem Schlagzeugerin der MûÊdchenband Die Bomben wird. Auftritte in leeren Clubs und skurrilen Wohngemeinschaften im Berlin/Kreuzberg der achtziger Jahre folgen. Dem HûÑrspiel Autobigophonie liegt der comichaft-absurde Text ihres gleichnamigen Buches zugrunde. Viele der û¥ber hundert kurzen Kapitel, von denen manche nicht mehr als fû¥nf Zeilen lang sind, wurden von FranûÏoise Cactus und Brezel GûÑring in Songs umgewandelt, Szenen mit befreundeten Berliner Musikern und Schauspielern umgesetzt, die Handlung eingebettet in ein Register, das Figuren, SchlagwûÑrter und Sponsoren verwaltet - von A wie ãAnonyme Alkoholikerã û¥ber V wie ãVerzweifeltes MûÊdchen, das Wasser aus einer Pfû¥tze trinktã bis Z wie ãZig Zag, ZigarettenblûÊttchenã.
ãFû¥r die Arbeit an unserem HûÑrspiel waren Jacques Demys gesungene Filme sehr inspirierend. Ich bewundere Jacques Demys unschuldigen Ton und seinen Optimismus. Die Lieder, die in seinen Filmen gesungen werden, haben einen experimentellen Charakter. Meistens reimen sie sich nicht, oft haben sie eine fragliche Metrik, aber was sie charmant und unvergesslich macht, ist, dass sie natû¥rliche Dialoge widerspiegeln. Dadurch, dass solche SûÊtze wie: ãGuten Tag, ich mûÑchte eine Tasse Kaffeeã gesungen werden, wird das ganze Leben zur Poesie.ã (FranûÏoise Cactus) |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 24.07.2009
Datum: 24.07.2009Länge: 00:59:29 Größe: 40.88 MB |
||
| Britta HûÑper: Der KûÑnig des westlichen Schwungs - 17.07.2009 | ||
|
Nach einer Idee von Ulrich Bassenge / Mit Peter Lohmeyer, April Hailer, Reiner SchûÑne, Frank Spilker, Laura Maire, Leoni Bassenge, Christian Friedel, Michael Habeck, Tim Seyfi, Wolfgang Pregler, Marion Breckwoldt, Hans Kremer, Fred Maire, Thorsten Nindel, Tommy Piper, Veronika Reichard, Undine Schmiedl, Anneke Schwabe, Kai Taschner, Irina Wanka, Stephan Zinner. / Radio Playboys: Ulrich Bassenge, Reinhard Bassenge, JûÑrn BûÑsel, Henning Eichler, Thomas FrûÑmming, G-Rag, Ulrike GlinsbûÑckel, Peter Holzapfel, Andre Huthmann / Komposition: Ulrich Bassenge / Regie: Leonhard Koppelmann / BR 2004 / LûÊnge: 79'55 // Der KûÑnig des westlichen Schwungs alias Spade Cooley wurde Anfang der 40er Jahre mit "Shame on you" an der Westkû¥ste zum Star. Fortan bezeichnete er sich selbst als King of Western Swing. In den gut 35 Jahren seiner Karriere erlebte Spade Cooley den Aufstieg und Fall auf besonders dramatische Weise. Nach Jahren des Ruhms lieûen Alkoholismus, Amphetamine und zunehmende Paranoia Spade Cooleys Stern sinken. Bandinterne Schwierigkeiten fû¥hrten zur AuflûÑsung seiner erfolgreichen Combo. Alle ehrgeizigen Vorhaben der 50er Jahre scheiterten. 1961 katapultierte Spade Cooley sich zurû¥ck auf die Titelseiten. In einem Anfall rasender Eifersucht hatte Cooley seine Frau grausam misshandelt und zu Tode gefoltert. Mit den Worten ãYouãre gonna watch me kill her, otherwise Iãll kill me and you tooã zwang er die Tochter, der Tat beizuwohnen.
Das HûÑrspiel ist Splattermovie, Melodram und Musical zugleich, Britta HûÑper siedelt die Geschichte in einem mythischen Amerika an, wissentlich schwankend zwischen Recherche, Nachdichtung und Klitterung. Die Protagonisten singen deutsch, sprechen deutsch. Die Radio Playboys spielen dazu Lieder, die in freier Nachdichtung groûe Songs des Western Swing neu erfinden. Die Komposition von Ulrich Bassenge ist Western Swing mit einem zeitgenûÑssischen ãedgeã, sie berû¥hrt Americana, Filmmusik und Elektronika. GerûÊusch- und Musikebene vermischen sich. In den zwischen die Szenen gestreuten Inserts kommen die groûen Themen ShowgeschûÊft, Musik, Drogen, Spiel, Zeit, PrûÊrie, Tod, Liebe zur Sprache, die auch die Themen groûer Countrysongs sind. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 17.07.2009
Datum: 17.07.2009Länge: 01:20:00 Größe: 73.25 MB |
||
| Britta HûÑper: Kant und Laib - Warten fû¥r AnfûÊnger (1-10) - 10.07.2009 | ||
| Mit Paul Herwig, Philipp Moog / Musikbearbeitung: Albert PûÑschl / Regie: Annegret Arnold / BR 2005 / LûÊnge: 26'50 // Kant und Laib warten. Warum, wo und worauf ist nicht eindeutig zu klûÊren. Klar ist lediglich, dass sie warten. Wie es sich anhûÑrt, wenn Zwei warten, wûÊhrend unklar bleibt, welche Position der eine im Warten des jeweils anderen einnimmt, wird in zehn Einzelszenen durchgespielt. Es gibt viel zu erwarten, aber die Warteschleife ist nicht unbedingt und uneingeschrûÊnkt ratgebertauglich. Im Dialog schimmern soziale Befindlichkeiten und gesellschaftliche UmstûÊnde durch, begleitet von einer Art Musikquiz. Aber was verraten die scheppernden Einspielungen populûÊrer Songs û¥ber die Situation, die sozialpolitische Relevanz des Wartens, die Wartenden und die Position der ZuhûÑrenden? Sind beispielsweise "These boots are made for walkin" oder "Movie Star" einfach schûÑne Lieder, Situationsbeschreibung oder ein Appell? Man hûÑre ã und warte. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 10.07.2009
Datum: 10.07.2009Länge: 00:27:15 Größe: 18.75 MB |
||
| Scanner: Warhol's Surfaces - 03.07.2009 | ||
|
Komposition: Robin Rimbaud (alias Scanner) / Realisation: Robin Rimbaud (alias Scanner), Barbara SchûÊfer / BR 2003 / LûÊnge: 60'00 // Die Komposition des Londoner Soundkû¥nstlers Scanner nimmt Interviewmaterialien mit Andy Warhol aus den frû¥hen 70er Jahren als Ausgangspunkt. ãDieser Soundtrack versucht, etwas AuûergewûÑhnliches aus etwas sehr GewûÑhnlichem zu machen. Warhol beantwortet eine Reihe von Fragen. ãIf you want to know all about Andy Warhol, just look at the surface: of my paintings and films and me, and there I am. There's nothing behind itã, sagte Andy Warhol selbst. Er war ein Kû¥nstler, den das Banale interessierte, die Langsamkeit und NormalitûÊt des alltûÊglichen Konsum-Lebens, und er reflektierte das in seinen Arbeiten, in seiner Kleidung, seinem Auftreten und eben auch in seiner Art und Weise zu sprechen.ã (Scanner)
Scanner schû¥rft im Material und bringt ungewûÑhnliche akustische Momente an die OberflûÊche, ausgedrû¥ckt in Warhols Wortwahl, seiner Atmung, seiner Art, ZûÊsuren zu setzen. Die Stimme Warhols wird bearbeitet, in Schichten, Strukturen zerlegt. Die Worte lûÑsen sich auf. In der Transformation der Sounds, in Loops, zeigt sich die Idee von Langeweile um den Pop-Art-Kû¥nstler. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 03.07.2009
Datum: 03.07.2009Länge: 01:00:17 Größe: 41.44 MB |
||
| Michael Farin: Der innere Turm - 26.06.2009 | ||
|
Mit Alexandra Maetz, Tim SchlûÑder, Oliver Baierl, Alexej Sagerer / Regie: Bernhard Jugel / BR 1995 / LûÊnge: 28'47 // Dieses HûÑrspiel fû¥hrt in die Welt des kû¥nstlichen Schlafes, in die Welt vergangener TrûÊume. Ein Kind, ein Fremder, ein Trunkener, ein Unbeteiligter setzen hypnotisch-magische Kindheitseindrû¥cke frei, setzen sich ihnen aus. Sie repetieren Erinnerungsfetzen an den Groûvater, den Onkel, und begeben sich in einen sentimentalen Raum, den Raum der
Erinnerung. Dieser Raum ist voller "vorgefundener Objekte", dem Stimmengewirr einer Weihnachtsfeier, den Bruchstû¥cken eines WeihnachtshûÑrspiels, der Musik aus einer anderen Zeit. In diesem Raum schieben sich die Stimmen ineinander, verbinden sich mit den TûÑnen, den GerûÊuschen, lûÑsen sich darin auf, setzen sich darin fort, werden zu einer Stimme, zu einem Gebilde, einem Gewebe aus Traum und Nacht. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 26.06.2009
Datum: 26.06.2009Länge: 00:29:06 Größe: 20.02 MB |
||
| Hendrik Lorenzen: Schaum - 19.06.2009 | ||
|
Realisation: Hendrik Lorenzen / BR 1996 / LûÊnge: 22'11 // Obdachlose, DrogenabhûÊngige und Bettler kommen in Hendrik Lorenzens HûÑrstû¥ck "Schaum" zu Wort - aber nicht wie sonst: "Schaum" ist kein Sozialreport. Die Interviewten sprechen vielmehr û¥ber Politik und Philosophie, Geld und Stars, fremde LûÊnder und ganz zentrale Dinge des Lebens. Ihre Sprache ist banal und verstû¥mmelt, voller auseinandergefallener SûÊtze und emotionaler Ausbrû¥che. Ihre Geschichten scheinen einer Art beschûÊdigter NormalitûÊt zu entspringen, die zerbrochen und offen daliegt. Die Musik kontrastiert und verformt den Text, lûÊût das Gesagte real und zugleich surreal erscheinen. Diese Form kann eine neue Wahrnehmung der Menschen in sozialer Not und unserer alltûÊglichen Welt bewirken. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 19.06.2009
Datum: 19.06.2009Länge: 00:22:31 Größe: 15.50 MB |
||
| Hendrik Lorenzen: Deutsch Sû¥dwest - 12.06.2009 | ||
|
Komposition und Realisation: Hendrik Lorenzen / BR 1998 / LûÊnge: 67'25 // Aus Berichten, Briefen und Tagebû¥chern von Expeditionen, Missionaren, Farmersfrauen, Beamten und Soldaten aus der ehemaligen Kolonie Deutsch-Sû¥dwest Afrika entstand das "Drehbuch" fû¥r dieses HûÑrstû¥ck - eine Textcollage û¥ber den Beginn der Kolonisation, û¥ber erste SchutzvertrûÊge und erste kriegerische Auseinandersetzungen, û¥ber den Hereroaufstand, dessen blutige Niederschlagung und die Zeit nach 1907, im GepûÊck des Autors auf der Reise nach Namibia. Deutsch-Namibier und deutschsprachige Namibier lesen die Textfragmente, lesen sie vor, kommentieren sie zuweilen, und der Autor zeichnet diese Konfrontation mit der Geschichte auf, das aufgenommene Material verarbeitet er in seiner Komposition. ãEine Art ãGeschichtsforschungã mit kû¥nstlerischen Mitteln, als dessen Werkzeug die Musik die RealitûÊtsbruchstû¥cke bearbeitet und û¥ber das Konkrete hinaus einige Facetten der û¥bergroûen kolonialen UmwûÊlzungen sinnlich erfahrbar macht. Nicht um die NacherzûÊhlung von historischen Ereignissen geht es in erster Linie, sondern um die Rekonstruktion einer Wahrnehmungã (Hendrik Lorenzen). ãFû¥r die Mission ist bei uns offenbar eine neue, bedeutsame Zeit angebrochen dadurch, daû das geeinte und erstarkte Deutschland nun seit kurzem auch anfûÊngt, den ihm zukommenden Anteil der sich vervollstûÊndigenden Weltherrschaft der europûÊischen VûÑlker zu beanspruchen .... (und) ... Kolonieen zu erwerbenã (Rheinische Missionsberichte 1884). |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 12.06.2009
Datum: 12.06.2009Länge: 01:07:47 Größe: 46.59 MB |
||
| Franz Kafka: In der Strafkolonie - 05.06.2009 | ||
|
Mit Peter Simonischek / Regie: Ulrich Gerhardt / BR 2007 / LûÊnge: 72'52 // Kafkas ErzûÊhlung entstand im Oktober 1914 unter dem Eindruck des beginnenden Ersten Weltkriegs und ging 1919 in Druck. In seiner Inszenierung teilt der Regisseur Ulrich Gerhardt den Text in Segmente ein, die er zu einem vielstimmigen HûÑrspielmonolog verbindet. Ein angesehener Forschungsreisender erhûÊlt die Einladung, an einer ûÑffentlichen Exekution teilzunehmen, um einen Einblick in das Rechtssystem der Strafkolonie zu erhalten, die auf einer weit entfernten Insel gelegen ist. Der dort herrschenden Rechtsordnung folgend wird dem Angeklagten vor der Hinrichtung weder die MûÑglichkeit gegeben, sich zu verteidigen, noch verkû¥ndet man ihm vor der Vollstreckung das Urteil. Es findet keine AbwûÊgung û¥ber die VerhûÊltnismûÊûigkeit des Urteils statt, denn in der Strafkolonie herrscht der Grundsatz: ãDie Schuld ist immer zweifellos.ã Eine Apparatur fû¥hrt den Hinrichtungsprozess durch, indem sie dem Verurteilten das Gebot, das er û¥bertreten hat, in die Haut einritzt, nebst den gesamten KûÑrper umspannenden Verzierungen. Der Vorgang schreitet fort, bis die Nadeln tief in das Fleisch des Verurteilten eindringen und diesem die Bedeutung der Einschreibungen aufgeht. Nach dieser zwûÑlfstû¥ndigen Folter durchsticht eine besonders lange Nadel den Kopf des Verurteilten, er stirbt und wird entsorgt. Der Reisende beobachtet die AblûÊufe. Er prû¥ft die Vorgehensweise, wûÊgt ab, reflektiert seinen Standpunkt ã solange wie mûÑglich bleibt er in einer reinen Betrachterposition.
Auûerhalb von Prag nahm Kafka nur ein einziges Mal an einer Lesung eigener Werke teil: Im November 1916 stellte er in Mû¥nchen seine ErzûÊhlung In der Strafkolonie vor. Die Veranstaltung war ein Misserfolg, von den knapp 50 Besuchern verlieûen einige bereits wûÊhrend des Vortrags den Saal, Rezensionen sprachen von dem Text einhellig als ãstofflich abstoûendã und bezeichneten Kafka als ãLû¥stling des Entsetzensã. Fû¥r Kafka selbst stellte "In der Strafkolonie" jedoch einen HûÑhepunkt seines literarischen Schaffens dar. In einem Brief vom 11. Oktober 1916 an seinen Verleger Kurt Wolff ûÊuûerte er in Bezug auf diese ErzûÊhlung: ãGott weiû wie tief ich auf diesem Weg gekommen wûÊre, wenn ich weitergeschrieben hûÊtte oder besser, wenn mir meine VerhûÊltnisse und mein Zustand das, mit allen ZûÊhnen in allen Lippen, ersehnte Schreiben erlaubt hûÊtten.ã |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 05.06.2009
Datum: 05.06.2009Länge: 01:13:06 Größe: 50.23 MB |
||
| Carlfriedrich Claus/Ernst Horn/Bernhard Jugel: Basale Sprech-OperationsrûÊume (Remix) - 29.05.2009 | ||
| Komposition: Ernst Horn / Realisation: Bernhard Jugel/Ernst Horn / BR 1997 / LûÊnge: 18'05 // Ein Remix ist die erneute Abmischung einer bereits verûÑffentlichten Aufnahme. Ursprû¥nglich von DJs entwickelt, um die TanzqualitûÊten von Hits herauszuarbeiten bzw. zu verstûÊrken, ist der Remix inzwischen ein eigenes kû¥nstlerisches Ausdrucksmittel zur Dekonstruktion und Rekonstruktion bereits vorhandenen akustischen Materials. Bei "Basale Sprech-OperationsrûÊume (Remix)" werden Arbeitsweisen der Popmusik auf ein experimentelles HûÑrspiel angewandt. Ausschnitte aus den Lautprozessen von Carlfriedrich Claus werden in Samples und Loops umgewandelt und so zum Ausgangspunkt musikalischer Prozesse, die aber immer vom Klangcharakter der Originalaufnahmen geprûÊgt sind. Mund- und KlopfgerûÊusche werden rhythmisiert, transponiert, û¥bereinandergeschichtet, verlûÊngert, gestaucht. Aus einem realen Klangkontinuum wird ein virtuelles, aus GerûÊuschen entstehen Melodien, Lautpoesie mutiert zu Musik. So wird der Remix hier zum Mittel der Grenzû¥berschreitung zwischen akustischem Experiment und musikalischer Alltagserfahrung. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 29.05.2009
Datum: 29.05.2009Länge: 00:18:16 Größe: 16.73 MB |
||
| Stefan Weigl: Marienplatz - 22.05.2009 | ||
| Mit Maria Peschek / Regie: Renate Pittroff / BR 2006 / LûÊnge: 34'14 // Einmal LûÑwe, immer LûÑwe. Der KioskpûÊchter Rudi Aumiller, der am Mû¥nchner Marienplatz Fanartikel seines Lieblingsvereins verkaufte, hat sich vor wenigen Tagen umgebracht. Ehefrau Wally macht Inventur, eine Warenbestands-Inventur, die zur Lebens-Inventur wird. Zwischen Grillschû¥rzen, Liga-Wimpeln und Retro-Schals rekapituliert die Witwe die wichtigsten Momente eines Ehelebens mit einem eingefleischten ãSechzgerã: ãMitgefangen, mitgehangen praktisch und meinen Sie vielleicht, i wûÊr freiwillig in diese laute Wohnung an der Tegernseer Landstrasse zogn? Aber das Wohnzimmer hat halt genau 18,60 Quadratmeter GrundflûÊche ham mû¥ssn und desweng hat der Rudi gsagt, 18,60 Quadratmeter ist ein gûÑttlicher Fingerzeig und mir mû¥ssns nehmen.ã Wally hat sich einen denkbar schlechten Tag fû¥r ihre Inventur ausgesucht. Denn wûÊhrend sie im Kiosk der Sache mit dem Leben und Sterben auf den Grund geht, fû¥llt sich der Marienplatz mit Bayernfans, die ihrer Mannschaft, die schon wieder irgendeinen Meistertitel gewonnen hat, zujubeln wollen. Wallys Worte gehen im LûÊrm der Menge unter. Stefan Weigl thematisiert in seinem HûÑrspiel seine Heimatstadt, setzt Blau gegen Rot und spielt ã auch akustisch ã in einem Mikrokosmos das Prinzip Armut und Reichtum durch. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 22.05.2009
Datum: 22.05.2009Länge: 00:34:32 Größe: 23.76 MB |
||
| Wolfgang Mû¥ller: Sûˋance Vocibus Avium - 15.05.2009 | ||
|
Mit Claudia Urbschat-Mingues / Regie: Wolfgang Mû¥ller / BR 2008 / LûÊnge: 54'26 // Mit dem Verschwinden einer Vogelart verstummt auch deren Gesang. Seit 1600 sind schûÊtzungsweise 150 Vogelarten ausgestorben. Neben den ûberresten in naturkundlichen Sammlungen in Form von BûÊlgern, Skeletten und Eiern existieren auch eine Anzahl wissenschaftlicher Beschreibungen. Nur sehr wenige dieser beinhalten jedoch Angaben zur Stimme des Vogels. Wolfgang Mû¥ller bat befreundete Musiker, eine mûÑglichst naturalistische Rekonstruktion des verstummten Vogelgesanges nach den existierenden wissenschaftlichen Angaben vorzunehmen. Die Vogelstimmen werden gestaltet von Justus KûÑhnke, Annette Humpe, Frederik Schikowski, Frieder Butzmann, Hartmut Andryczuk, Max Mû¥ller, Nicholas Bussmann, FranûÏoise Cactus, Brezel GûÑring, Khan, Namosh und ihm selbst. Dafû¥r lûÑsen sie ihre IdentitûÊt als Musiker und Kû¥nstler auf und verwandeln sich in einen bestimmten, ausgestorbenen Vogel, den sie nun durch dessen Gesang verkûÑrpern.
Wolfgang Mû¥ller analysiert in der "Sûˋance vocibus avium" auûerdem die Sprache der Wissenschaftler, Entdecker und Forscher, die den Vogel und seine Umgebung begreifbar und anschaulich machen wollten und wollen. Welche Sprache wird dabei eingesetzt, was klingt aus ihr? Welche WûÑrter werden verwendet, um die Gestalt und das Wesen des ausgestorbenen Vogels zu rekonstruieren? Bereits 1994 rekonstruierte Wolfgang Mû¥ller in ReykjavûÙk fû¥r sein BR-HûÑrspiel "Das Thrymlied" die LautûÊuûerungen des ursprû¥nglich in Europa heimischen und vollstûÊndig ausgerotteten nordatlantischen Riesenalks (alca impennis). Dessen Laute wurden 1844 von drei islûÊndischen Seeleuten bei der TûÑtung der letzten Exemplare letztmalig vernommen und in einem Artikel des Wissenschaftlers Dr. Alfred Newton aus Cambridge in der Zeitschrift Ibis (1858) beschrieben. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 15.05.2009
Datum: 15.05.2009Länge: 00:54:45 Größe: 37.64 MB |
||
| Limpe Fuchs: Pferd solo - 08.05.2009 | ||
| Mit Alexej Sagerer / Realisation: Limpe Fuchs/Bernhard Jugel / BR 1992 / LûÊnge: 18'54 // Zwei Personen. Schritte auf Holz. Grillen. Entferntes Kindergeschrei. Holzknirschen. Dann: GleichmûÊûige RuderschlûÊge, Sommer, Kahnfahren. Wer sind die beiden Menschen? Der eine bleibt aktiv am Rudern, der andere lûÊsst angestaute Erlebnisse herausstrûÑmen. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 08.05.2009
Datum: 08.05.2009Länge: 00:19:12 Größe: 13.22 MB |
||
| Limpe Fuchs: Caccia - 01.05.2009 | ||
|
Realisation: Limpe Fuchs / BR 1991 / LûÊnge: 21'53 //Ein Picknick am Waldrand: Leute reden, essen, trinken. Im Wald: Stille, VûÑgel, Bach. Dann die VerûÊnderung: Die Leute setzen sich in Bewegung. Mit Gewehren, Hunden, Rufe im Wald. Hundegebell, Walky Talky, FluchtgerûÊusche von Tieren. MotorengerûÊusch tief im Wald. Eine Hetzjagd beginnt. Schluûinferno.
Die Musik begleitet das Geschehen: Schlag auf Ballastsaite, SchlûÊge auf Steinplatten, zwei Pauken gehen mit, fallen in Trag, rennen mit - oder dagegen? Das Geschehen ist nicht aufzuhalten. Ein akustisches Dokument, das zur Stellungnahme auffordert. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 01.05.2009
Datum: 01.05.2009Länge: 00:22:12 Größe: 15.29 MB |
||
| Sascha Dickel: Bio-Nostalgie - 24.04.2009 | ||
|
Mit Stephan Bissmeier, Paul Herwig / Komposition: Jakob Diehl / Regie: Katja Langenbach / BR 2007 / LûÊnge: 41'12 // Die Frau tanzt fû¥r ihn vor der Illusion eines Sandstrandes, in einem Werbefilm, den er auf Dauerloop geschaltet hat. Er lebt im Internet, denn die Welt der Netze hat û¥ber die Welt des Fleisches gesiegt. Im Jahr 2072 hat die Menschheit ihre lûÊstigen KûÑrper zurû¥ckgelassen und existiert nur noch in Form von DatenstrûÑmen im Netz. Jeder kann jederzeit kopiert und û¥berwacht werden, und reich ist, wer viel Speicherplatz besitzt. Der Science-Fiction-Monolog Bio-Nostalgie ist das Siegerstû¥ck des Jurypreises im internationalen Autorenwettbewerb what if - visionen der informationsgesellschaft, den der Bayerischen Rundfunk und das Online-Magazin telepolis.de anlûÊsslich des Informatikjahrs 2006 ausgeschrieben hatten. WûÊhrend ein Teil seines multitaskingfûÊhigen Bewusstseins die Frau aus dem Werbefilm verfolgt, erhûÊlt er ein ungewûÑhnliches Angebot. Zusammen mit ihr soll er an einem Experiment teilnehmen, das zunûÊchst wie ein anachronistisches Spiel fû¥r Bio-Nostalgiker erscheint: Fû¥r einen Tag haben sie die MûÑglichkeit, echte KûÑrper zu erhalten, in die ihr Bewusstsein heruntergeladen wird ã die MûÑglichkeit, an einem unvollkommenen, aber wirklichen Strand zu liegen. Doch als alles fû¥r den Download bereit ist, fû¥hrt ihre Sehnsucht nach der Wirklichkeit zu einer unerwarteten Erkenntnis.
Der Science-Fiction-Monolog "Bio-Nostalgie" ist das Siegerstû¥ck des Jurypreises im internationalen Autorenwettbewerb "what if ã visionen der informationsgesellschaft", den der Bayerischen Rundfunk und das Online-Magazin telepolis.de anlûÊsslich des Informatikjahrs 2006 ausgeschrieben hatten. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 24.04.2009
Datum: 24.04.2009Länge: 00:41:32 Größe: 28.56 MB |
||
| Mathias Greffrath: Windows oder: Mû¥ssen wir uns Bill Gates als einen glû¥cklichen Menschen vorstellen - 17.04.2009 | ||
|
Mit Tobias Lelle / Komposition: Martina Eisenreich / Regie: Bernadette Sonnenbichler / BR 2005 / LûÊnge: 54'28 // Bill Gates, amerikanischer Programmierer und Unternehmer, steht im Mittelpunkt des HûÑrspielmonologs. Der Erfinder und Begrû¥nder von Microsoft verwirklichte fû¥r sich den 'american dreamã und stellt so ein faszinierendes, aber auch irritierendes und beunruhigendes PhûÊnomen unseres kapitalistischen Zeitalters dar. In Verwertung einiger biographischer Fakten wagt ein Schauspieler einen fiktiven Blick in das prozessorenhafte Denken eines WeltenschûÑpfers. Als kûÑnnte sich der HûÑrer in verschiedene ûste und Gabelungen dieser unû¥berschaubaren Matrix klicken, wird weniger die Person des Microsoft-Erfinders, sondern vielmehr das GesamtphûÊnomen Gates beleuchtet. Auf verschiedenen Ebenen ûÑffnen und schlieûen sich temporeich Fenster, HûÑr-RûÊume, zu zahlreichen GedankenrûÊumen. Ein û¥berzeugter Tû¥ftler reflektiert GeschûÊftliches, Privates, Erinnerungen, Begegnungen, Ereignisse und GesprûÊche, die Bandbreite reicht von wissenschaftlich-anthroposophischen ErûÑrterungen zu Gedanken û¥ber unumstûÑûliche Vorstellungen von Gewinn und Verlust, û¥ber selbst auferlegte HûÊrte und firmeninterne Unerbittlichkeit. ãEin korrekt geschriebenes Programm tut immer und zu jeder Zeit alles, was Du ihm sagst. Ganz genau und hundertprozentig. Und wenn Du einen Fehler machst, merkt die das sofort. Die Maschine. Und zeigt es Dir. Nur Dir. Du baust was hin. Und nur was Du hinbaust, ist da. Ist Deins. Und alles ist ganz klar. Da ist kein drauûen mehr. Das gibt SICHERHEIT.ã
Mathias Greffraths Monolog, der ursprû¥nglich als Theatertext entstanden ist, folgt keiner linear narrativen ErzûÊhlweise, sondern besteht aus ineinander verschiebbaren, beweglichen Textbausteinen, die die dauernde gedankliche Vernetzung und Neu-Ordnung des Inputs und Outputs eines multitasking-fûÊhigen Gehirns formal widerspiegeln. In der HûÑrspielfassung probiert die Schauspieler die ãRolle Gatesã immer wieder neu, unterstû¥tzt und kontrolliert von einem Sounddesign in schnellen zyklischen Sprû¥ngen. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 17.04.2009
Datum: 17.04.2009Länge: 00:54:45 Größe: 37.64 MB |
||
| Katja Huber: Hechtzeit - 10.04.2009 | ||
| Mit Mira Bartuschek, Melanie von Sass, Helga Fellerer, Maximilian Brû¥ckner, Tobias Vandieken / Komposition: iso68 / Regie: Christiane Klenz / BR 2002 / LûÊnge: 21'25 // Katja Huber erzûÊhlt vom heutigen Russland. Mit ihrer poetisch-rhythmischen Sprache gelingt es der Mû¥nchner Autorin einen Kontrast aufzubauen zur Dû¥rftigkeit des beschriebenen Alltags. Beim HûÑren breitet sich ein intensives Gefû¥hl fû¥r den fremden, "wilden" Osten aus. Wenn nicht um Liebe, so geht es in "Hechtzeit" zumindest um verliebte Gefû¥hle: Julia, deutsche Austauschstudentin, flirten auf Lenas Geburtstagsparty mit russischen Jungs, die wie James Dean oder wenigstens wie Zirkusdirektoren aussehen. Ihre Zuneigung zeigen die Jungs, indem sie Julia und Lena einen riesigen Hecht schenken - oder mit einem Schrubber vom Balkon winken. Es geht aber auch um viel Wodka, um den Kater danach, um heiûe Tage ohne Wasser und Strom. Und um ein Osterwunder. Behutsam verstûÊrkt wird die dichte AtmosphûÊre durch Soundgewebe des Mû¥nchner/Hamburger Elektronik-Duos iso68 (Florian Zimmer/Thomas Leboeg). | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 10.04.2009
Datum: 10.04.2009Länge: 00:21:45 Größe: 14.98 MB |
||
| Ulrike Draesner: beziehungsmaschine - 03.04.2009 | ||
| Mit Judith Hofmann, Kornelia Boje, Christoph Lindert / Regie: Bernhard Jugel / BR 1998 / LûÊnge: 15'00 // "Eine Frau, in ihrem Zimmer, am Boden. Ihr Partner hat sich gerade von ihr getrennt. Sie fû¥hlt sich erniedrigt, bedrû¥ckt. Das allmûÊhlich dunkel werdende Zimmer ist leer, bis auf einen Stuhl und einen leuchtenden roten Punkt. Computer?, Stereoanlage?, sie selbst? Die Frau beginnt, sich nach sich zu fragen. In kreisenden Bewegungen û¥bersetzt sie die wahrgenommenen GegenstûÊnde in innere Tatsachen, Gefû¥hle und Erinnerungen. Ihr Monolog stellt SûÊtze und Satzfragmente durch genau komponierte Wiederholungen in immer neue ZusammenhûÊnge - und schickt so das Ich auf eine innere Reise. Es entdeckt, daû dem Abstand zu anderen eine innere Fremdheit vor sich selbst entspricht. Glattes, gekûÊmmtes Ichzeug, das man ihr angetrimmt hat, û¥berdeckt die inneren Strudel und Stromschnellen. Der Schmerz û¥ber die Trennung lûÑst diesen Auûenpanzer, der auch ein Panzer aus vorgefertigter Sprache ist. Die Eltern, die ihn dem Ich angelegt haben, mischen sich noch einmal mit ErziehungssûÊtzen, Lebensregeln und Kommentaren ein. Das Ich erkennt, daû die Beziehungsmaschine viel weiter geht als ãnurã MûÊnnerverhûÊltnisse betreffend. Sie ist eine Lebensmaschine: ohne Vermittlung des unverstellten Ichraums nach auûen wird das Ich absterben. ûber den Boden kriechend stûÑût die Frau auf zwei Straûenbahnschienen - die eigene Vergangenheit und Zukunft. Ihr wird bewuût, daû ihr weiches, verletzliches Fleisch darauf festgenagelt ist. Doch wenn sie es wagt, die ihr zugefû¥gten Erstarrungen und Schmerzen von innen aufzubrechen, besteht die MûÑglichkeit, die Schienen in Arme zurû¥ck zu verwandeln - und damit einen anderen zu berû¥hren.ã (Ulrike Draesner) | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 03.04.2009
Datum: 03.04.2009Länge: 00:15:19 Größe: 10.55 MB |
||
| ARD Radio Tatort: Robert Hû¥ltner: Hexenjagd - 30.03.2009 | ||
| In einer zum WochenendhûÊuschen umgebauten Fischerhû¥tte am Inn ist die 17-jûÊhrige Janina tot aufgefunden worden. Sie galt in der Stadt als kû¥hle SchûÑnheit und hat unzûÊhlige Verehrer abblitzen lassen. Der Verdacht fûÊllt sofort auf den Besitzer der Hû¥tte, Rupert Scheffler. Offenbar hatte der Stadtrat und Familienvater ein VerhûÊltnis mit dem MûÊdchen. Alle Indizien sprechen gegen ihn. Allerdings fallen den auf eigene Faust ermittelnden Ortspolizisten Ferdl Raab, Rudi Egger und Senta Pollinger einige Ungereimtheiten auf. Die Kioskbesitzerin Nanni weiû zu berichten, dass auch der 19-jûÊhrige Sohn von Scheffler ein Auge auf Jenny geworfen haben soll. Die Beamten begeben sich auf die Suche nach ihm, und finden ihn am Boden zerstûÑrt. Ist der Mord an der jungen Frau Teil eines Familiendramas? Doch dann nimmt Rudi Egger eine Spur auf, die in die dunkle Vergangenheit von Bruck am Inn fû¥hrt. // Mit Florian Karlheim, Brigitte Hobmeier, Michael A. Grimm, Michael Schreiner, Jû¥rgen Tonkel, Peter Rappenglû¥ck, Gisela Schneeberger, Stephan Zinner, Hans Kitzbichler, Stephan Bissmeier, Hans Georg Panczak, Wilhelm Manske, Jutta Schmuttermaier, Eisi Gulp, Peter Fricke, JûÑrg Hube / Komposition: zeitblom / Regie: Ulrich Lampen / BR 2009 / LûÊnge: 53'52 // In einer zum WochenendhûÊuschen umgebauten Fischerhû¥tte am Inn ist die 17-jûÊhrige Janina tot aufgefunden worden. Sie galt in der Stadt als kû¥hle SchûÑnheit und hat unzûÊhlige Verehrer abblitzen lassen. Der Verdacht fûÊllt sofort auf den Besitzer der Hû¥tte, Rupert Scheffler. Offenbar hatte der Stadtrat und Familienvater ein VerhûÊltnis mit dem MûÊdchen. Alle Indizien sprechen gegen ihn. Allerdings fallen den auf eigene Faust ermittelnden Ortspolizisten Ferdl Raab, Rudi Egger und Senta Pollinger einige Ungereimtheiten auf. Die Kioskbesitzerin Nanni weiû zu berichten, dass auch der 19-jûÊhrige Sohn von Scheffler ein Auge auf Jenny geworfen haben soll. Die Beamten begeben sich auf die Suche nach ihm, und finden ihn am Boden zerstûÑrt. Ist der Mord an der jungen Frau Teil eines Familiendramas? Doch dann nimmt Rudi Egger eine Spur auf, die in die dunkle Vergangenheit von Bruck am Inn fû¥hrt. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 30.03.2009
Datum: 30.03.2009Länge: 00:54:10 Größe: 37.23 MB |
||
| Monika Weiû: Rising Sound - 27.03.2009 | ||
|
Mit Udo Wachtveitl / Realisation: Monika Weiû / BR 1994 / LûÊnge: 31'37 // "Rising Sound" ist der Versuch, das Aufeinandertreffen von Kulturen hûÑrbar zu machen: das reibungslose Miteinander japanischer Traditionen mit westlicher Moderne (so wie die Japaner sie verinnerlichen). All dies im sozialen Gefû¥ge allgegenwûÊrtig und niemals in Frage gestellt. Es ist der Versuch, das Aufeinandertreffen von Kulturen hûÑrbar zu machen: das reibungslose Miteinander japanischer Tradition mit westlicher Moderne (so wie die Japaner sie verinnerlichen) sowie das Aufeinanderprallen der japanischen Einheit mit uns, die wir die westliche Moderne, der Westen sind. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 27.03.2009
Datum: 27.03.2009Länge: 00:31:54 Größe: 21.95 MB |
||
| ARD Radio Tatort: Robert Hû¥ltner: Irmis Ehre - 20.03.2009 | ||
| Mit Anna Clarin, Stephan Murr, Florian Karlheim, Brigitte Hobmeier, Stephan Bissmeier, Michael A. Grimm, Peter Weiû, Michael Schreiner, Andreas Buntscheck, Leopold Hornung, Peter Rappenglû¥ck, Gisela Schneeberger, Wolfgang M. Bauer, Eisi Gulp, Thomas Holtzmann, Anton Pointecker, Hans Kitzbichler, JûÑrg Hube, Winfried Frey, Wolfgang Aigner / Komposition: zeitblom / Regie: Ulrich Lampen / BR 2008 Am Flussufer der Kleinstadt Bruck am Inn liegt eine Leiche, die niemand zu kennen scheint, und die frisch verheiratete Irmi hat AlptrûÊume... Der Polizeiobermeister Rudi Egger besucht mit seiner Kollegin Senta Pollinger die Hochzeit seines alten Freundes Hubert. Doch die bayerische Idylle der Kleinstadt Bruck am Inn hûÊlt nicht an: Am Flussufer ist eine Leiche gefunden worden. Die IdentitûÊt des Unbekannten klûÊrt sich rasch: Der Tote war in Mû¥nchen einschlûÊgig bekannt ã es ist ein Mann aus dem Rotlicht-Milieu, dem nachgesagt wird , dass seine geistige BeschrûÊnktheit nur noch von seiner BrutalitûÊt û¥bertroffen wurde. Die ûÑffentliche Meinung ist schnell mit Vermutungen bei der Hand, und einige schlecht beleumdete Stadtbewohner geraten ins Visier der Ermittler. Das hiesige, eher harmlose Rotlichtmilieu wird durchforstet. Vergeblich. Zum ûrger des leitenden Kommissars aus der Kreisstadt sind es die jungen Polizisten vor Ort, die auf die Spur des TûÊters kommen ã und auf eine Episode im Leben der jungen Braut, an die sie nicht mehr erinnert werden mûÑchte. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 20.03.2009
Datum: 20.03.2009Länge: 00:54:19 Größe: 37.33 MB |
||
| Thomas Meinecke/Move D: û¥bersetzungen/translations - 13.03.2009 | ||
|
Komposition/Realisation: Thomas Meinecke, Move D / BR 2007 / LûÊnge: 51'59 // Ansatz- und Ausgangspunkt der aktuellen Produktion "û¥bersetzungen/translations" war der Wunsch, einmal eine Arbeit zu erstellen, bei der nicht zuerst (und damit letzten Endes û¥bergeordnet) ein Text existierte, sondern die eher abstrakte, serielle NarrativitûÊt der Musik als gleichberechtigt, eigentlich sogar tonangebend erscheinen wû¥rde. In einem Studio des BR in Mû¥nchen buchstabierte beziehungsweise sang Thomas Meinecke das deutsche und englische/amerikanische Alphabet in allen zwûÑlf TûÑnen der Tonleiter und nahm diese Aufnahme, einzelnen Tasten einer Schreibmaschine gleich, mit nach Heidelberg, wo in David Moufangs Re-Source Studio WûÑrter und TûÑne, ohne Einsatz eines Mikrophons fû¥r die Stimme, spontan ineinander verschrûÊnkt, gleichsam synchron (zusammen-) gesetzt wurden, mit dem einzigen û¥bergeordneten Prinzip: einer ûbersetzung vom Deutschen ins Englische, respektive umgekehrt. Diese auffallend lakonisch gelagerten ûbertragungen mussten nicht immer in verbaler Weise (Osterglocke/Daffodil) stattfinden, sondern ihr Schwerpunkt, ihr Drall, ihr GefûÊlle konnte auch kulturell (Ursula Andress), politisch (Henry Kissinger) oder ûÑkonomisch (Mini Cooper) kodiert sein. Thomas Meinecke, der seit 1980 in der Mû¥nchner Band F.S.K. spielt, brachte seine Pocket Trumpet mit und griff einmal auch zu David Moufangs Gitarre. Zehn sehr verspielte, in ihrer Vertracktheit mitunter an surrealistische Vexierbilder erinnernde bis unmittelbar (und vor Ort als solche getestete) clubtaugliche Tracks sind auf diese Weise binnen einer Woche am Neckar entstanden, eher ein Album als ein WûÑrterbuch.
Ausgezeichnet mit dem Karl-Sczuka-Preis 2008 fû¥r HûÑrspiel als Radiokunst. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 13.03.2009
Datum: 13.03.2009Länge: 00:52:18 Größe: 35.96 MB |
||
| Raymond Federman: The voice in the closet - Englische Autorenlesung - 06.03.2009 | ||
| Mit Raymond Federman / BR 1990 / LûÊnge: 31'11 // "Mein Leben begann in einem Schrank!" So umschreibt Federman das zentrale Ereignis seines Lebens: Versteckt in einem Schrank bzw. einem Kabuff entkommt er 1942 in Paris der drohenden Deportation. "Tod" und "Wiedergeburt" des Jungen in diesem Versteck bestimmen die folgende IdentitûÊtssuche, sind Metapher in den literarischen Arbeiten Federmans, die sich zu einem einzigen Werk zusammenfû¥gen. AllgegenwûÊrtig ist das zentrale, unaussprechliche Ereignis seines Lebens, das stûÊndig umgangen, berû¥hrt und fiktionalisiert werden muû - die Ausrottung seiner Familie, ein Schicksal, dem er nur entging, weil seine Mutter ihn in einen Schrank sperrte. "Ich war dreizehn oder vierzehn, als meine Eltern deportiert wurden, und an die Zeit davor habe ich nur ûÊuûerst verschwommene Erinnerungen. Ab dem Tag, an dem ich jenen Schrank verlieû, kann ich die Geschichte eines jeden einzelnen Tages nacherzûÊhlen." Doch es ist nicht eine Stimme, die in diesem Schrank spricht, es sind mehrere, einander ergûÊnzende, sich widersprechende Stimmen, - es ist der Autor Raymond Federman, der die Geschichte seines Lebens sucht, umkreist und immer wieder neu erzûÊhlt. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 06.03.2009
Datum: 06.03.2009Länge: 00:31:30 Größe: 21.67 MB |
||
| Dolores: Prima Leben Und Sparen - 27.02.2009 | ||
|
Mit Evelyn HûÑhne, Andreas Neumeister, Computerstimme Victoria / Ton: Bernd Jestram, Bo Kondren / Komposition: Ronald und Robert Lippok / Realisation: Andreas Neumeister, Ronald Lippok, Robert Lippok / BR 1998 / LûÊnge: 33'55 // "zu Plastik hatten wir von Anfang an ein ausgesprochen gutes VerhûÊltnis. zu Hartplastik, zu Lego for example, hatten wir von Anfang an das beste VerhûÊltnis. zu den Grundfarben hatten wir dank Lego von Anfang an das beste VerhûÊltnis. Plastik als grenzenlos formbares Medium. Kunststoff als eine der Errungenschaften dieses letzten Jahrtausendjahrhunderts.
A&P fû¥r attraktiv und preiswert A&P eigentlich fû¥r Atlantic und Pacific PLUS fû¥r Prima Leben Und Sparen: was Dolores vorschwebt ist ein Jet-Set-Dasein auf, notfalls, niedrigem Niveau Chronik des ersten Weltkriegs. Chronik des zweiten Weltkriegs. Jahreschroniken, Jahrzehntchroniken, Jahrhundertchroniken, Jahrtausendchroniken, macht zwei ChronikanlûÊsse mehr als in normalen Jahrzehnten. (hier in der Wohnung gibt es keine zwei Uhren, die auch nur annûÊhernd die gleiche Zeit anzeigen wû¥rden.) alles auf den letzten Drû¥cker, alles gerade noch. gerade noch Neunzigerjahre, gerade noch 20. Jahrhundert, gerade noch zweites Jahrtausend. hoffentlich fûÊngt das dritte Jahrtausend auch pû¥nktlich an, Zeit wirds, daû das dritte Jahrtausend endlich anfûÊngt, alles gerade noch, wir stecken mitten im Speicherwahn zurû¥ck. zu Hartplastik, zu Vinyl zum Beispiel, hatten wir von Anfang an ein ausgesprochen gutes VerhûÊltnis. zu Polycarbonat hatten wir von Anfang an ein pragmatisches VerhûÊltnis. gesampelt kehren Kratzer wieder auf CD prima leben und stereo: zu Plastikmusik, zu synthetischer Musik hatten wir von Anfang an das beste VerhûÊltnisã (Andreas Neumeister). ãDoloresã ist ein gemeinsames Projekt der Brû¥der Robert und Ronald Lippok mit Andreas Neumeister. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 27.02.2009
Datum: 27.02.2009Länge: 00:34:15 Größe: 23.56 MB |
||
| Sigrid Hauff: Die Familien Friedlaender und Ruest im franzûÑsischen Exil - Eine Dokumentation zu Hartmut Geerkens HûÑrspiel-Trilogie 'Maûnahmen des Verschwindens' - 20.02.2009 | ||
| Mit Kornelia Boje, Peter Fricke, Leo Bardischewski, Lorenz Meyboden, Mario Andersen, Heidi Treutler / Realisation: Herbert Kapfer / BR 2004 / LûÊnge: 62'15 // Das Exil verûÊnderte die Existenz der miteinander verwandten Intellektuellen-Familien Friedlaender und Ruest radikal. Die Leiden der Emigrantenkinder, die aus ihrer natû¥rlichen Entwicklung herausgerissen und 1941 in Frankreich interniert wurden, sind unvorstellbar und kaum bekannt. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 20.02.2009
Datum: 20.02.2009Länge: 01:12:35 Größe: 49.88 MB |
||
| Hartmut Geerken: stûÑûe gû¥rs (Maûnahmen des Verschwindens: Eine Exiltrilogie) - 06.02.2009 | ||
|
nach aufzeichnungen des zivilinternierten heinz-ludwig friedlaender / Mit Heinz-Ludwig Friedlaender (Zivilinternierter), Lorenz Meyboden (Zwischentexte) / Realisation: Hartmut Geerken / BR 1991 / LûÊnge: 67'10 // "das schriftliche grundmaterial: das sind stûÑûe von postkarten und briefen aus mehr als 14 franzûÑsischen internierungslagern aus den jahren 1939 bis 1945. die mehrzahl dieser durch einen zufall û¥berlieferten zeitdokumente stammt aus den berû¥chtigten lagern von les milles und gurs. ein gewisser heinz-ludwig friedlaender ist der absender, adressat sind die eltern, die sich im exil in paris versteckt halten. sein vater war der jû¥dische philosoph (altkantianer) und groteskenschreiber salomo friedlaender/mynona, der mit arischer frau und 21-jûÊhrigem sohn 1933 aus dem arisch verpesteten berlin flû¥chten muûte, um ihrer aller leben zu retten.
das originalton-material des hûÑrspiels sind bandaufnahmen, die ich im februar 1986 in paris und im august desselben jahres in wartaweil mit dem 73jûÊhrigen heinz-ludwig friedlaender gemacht habe. knapp zwei jahre danach, 1988, wurde friedlaender tot in der kû¥che seiner ûÊrmlichen wohnung in paris aufgefunden, wo er 54 jahre lang gewohnt hatte. niemand weiû, wie er gestorben ist, sicher ist, daû er alleine war. die im hûÑrspiel kompositorisch und improvisatorisch eingesetzten gerûÊusche sind ebenfalls aus sprache entstanden, die allerdings elektronisch so deformiert wurde, daû sie ihren informationsgehalt nicht mehr preisgibt. daû die sprache auf diese weise ûÊsthetisch ausgenutzt wird, heiût nicht, daû dadurch unbedingt eine dramatisierung des gesagten erreicht werden soll. das hûÑrspiel ãstûÑûe gû¥rsã vermittelt einerseits die situation, in der sich deutsche emigranten aus dem dritten reich in franzûÑsischen lagern befanden: in einem unentschiedenen schwebezustand zwischen ãschutzbefohlenenã und ãkriegsgefangenenã. andererseits wirft das hûÑrspiel auch ein licht auf eine bis heute noch nicht geschriebene geschichte der kinder von deutschen emigranten: traumata eines von vornherein zum scheitern verurteilten lebens.ã (Hartmut Geerken) |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 06.02.2009
Datum: 06.02.2009Länge: 01:07:29 Größe: 46.37 MB |
||
| VorlûÊufig definitiv? Die Macher des Radioexperiments "M.o.E. Remix" im GesprûÊch - 30.01.2009 | ||
| Mit Katarina Agathos, Klaus Buhlert, Karl Corino, Walter Fanta, Herbert Kapfer / Moderation: Christoph Lindenmeyer / BR 2004 / WerkstattgesprûÊch û¥ber "Der Mann ohne Eigenschaften. Remix" - "VorlûÊufig definitiv" ist eine Formulierung, die der Autor Robert Musil einer seiner Figuren im Roman "Der Mann ohne Eigenschaften" in den Mund legte. "VorlûÊufig definitiv" - so kûÑnnte auch die Arbeitsweise von Musil bezeichnet werden, die vom Prinzip Entwurf/Gegenentwurf gekennzeichnet war. Der Roman ist ein Klassiker der Moderne, aber auch Fragment. Der textkritisch digitalisierte literarische Nachlass Musils, die verûÑffentlichten Romanteile und GesprûÊche mit Musil-Forschern und Kû¥nstlern waren die Basis fû¥r das Projekt Der Mann ohne Eigenschaften. Remix, das als Audio- und Print-Version verûÑffentlicht und in Bayern2Radio urgesendet wurde. Die KomplexitûÊt und Dimension des Projekts erforderte eine intensive Zusammenarbeit und einen Diskussionsprozess der beteiligten Macher, der sich û¥ber den gesamten Zeitraum der Planung und Realisierung erstreckte. Vom Schreibexperiment zum Radioexperiment: Im Spannungsfeld zwischen Forschung und Kunst sollte eine Produktion entstehen mit dem Anspruch, erstmals auf wissenschaftlicher Grundlage Musils Schreibexperiment in seiner gesamten Dimension kû¥nstlerisch darzustellen. Zum Abschluss des Projekts stellen sich die Fragen: VorlûÊufig definitiv? Wurde die Produktion ihrem Anspruch gerecht? Kann Textkritik und Radiokunst in Einklang gebracht werden? Welche Bedeutung hat der Remix fû¥r die Musil-Rezeption? | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 30.01.2009
Datum: 30.01.2009Länge: 00:56:23 Größe: 38.76 MB |
||
| Klaus Ramm: "das beginnt irgendwo hat kein ziel verlûÊuft sich zieht kreise will nirgendwo ankommen & endet an einem beliebigen punkt" - Hartmut Geerkens Wege in die Radiokunst und sein Verschwinden darin - Ein Radioessay - 16.01.2009 | ||
| Mit Klaus Ramm, Hartmut Geerken / Regie: Klaus Ramm / BR 1999 / LûÊnge: 60'20 // Anhand charakteristischer Produktionen und mit vielen Ausschnitten und Zitaten erlûÊutert Klaus Ramm Konzepte und Arbeitsweisen des HûÑrspielmachers Geerken, insbesondere seine Neigung, als Person hinter dem akustischen Material und den zu dessen Organisation entworfenen Regeln zurû¥ckzutreten. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 16.01.2009
Datum: 16.01.2009Länge: 00:58:59 Größe: 40.55 MB |
||
| Katharina TeichgrûÊber: ûber die Notwendigkeit, sich im Bett umzudrehen - GesprûÊch mit Alexander Kluge û¥ber einen ungedrehten Film zum "Mann ohne Eigenschaften" - 02.01.2009 | ||
|
Mit Katharina TeichgrûÊber, Alexander Kluge, Marianne Kiss, Stefan Gabanyi, Sophia BierûÊugel / Realisation: Katharina TeichgrûÊber / BR 2004 /LûÊnge: 57'45 // Ulrich! ...Tausende von Dû¥nndruckseiten eines Romans. Und er bleibt doch unbestimmt! Ist Ulrich willenlos? Er scheint kaum in der Lage, seine eigene Wohnung einzurichten. Fû¥r eine Geliebte kann er sich schon gar nicht entscheiden. Aber in den Augen dieses Mannes - angeblich ohne Eigenschaften - spiegelt sich die Welt des 20. Jahrhunderts. Was sich in ihm alles zusammenfasst geht nur schwer in einen Roman, fand Robert Musil. Denn nichts, so der Schriftsteller, sei in der Literatur so schwer darzustellen wie ein denkender Mensch.
Ein Problem im Sinne des Zeitaufwandes ist auch die Lektû¥re des Werks durch heutige Leser ã ãungefûÊhr bis zur HûÊlfte des ersten Bandes bin ich gekommenã. (In Wirklichkeit etwas weniger: nur bis zum Kapitel, wo General Stumm von Bordwehr ãOrdnung in den Zivilverstandã bringen will.) Um also die Zeit der Konsumenten zu sparen, drehen wir einen Film, circa 80 Jahre nach Entstehung des Buchs. Regisseur: Alexander Kluge. Zeigen wir Ulrich in seinem SchlûÑûchen, Wien 1913? Er geht aus, trifft auf diese oder jene Dame, eine bildsatte Gesellschaft, û¥bernimmt die Funktion eines politischen Durchlauferhitzers. Ironischer KûÊltegrad etwa von Horst Buchholz in Felix Krull. Ereignisse wûÊren zum Beispiel: TestamentsfûÊlschung, Irrenhausbesuch, WaffenhûÊndler, deutschtû¥melnde Studentenverbindung, Geschwisterinzest, Serienkiller. Kommt zwar alles im Roman vor, wû¥rde ihn aber kaum û¥bersetzen. Ulrich wûÊre empûÑrt, der Geschichte zum Stoff zu dienen. Er bewegte sich wenig, auch die Welt um ihn war trûÊge: beinahe stehende Bilder! Wahrnehmen, Denken, stundenlang Reden - zu viel mehr kam es nicht in seinem aktionsarmen Leben. (Nur in seltenen Momenten hielt er dies fû¥r einen Mangel.) Als heutiges Filmprojekt also eine Herausforderung! Und im Bû¥ro des Produzenten fûÊllt natû¥rlich sofort der Satz, Kino mû¥sse ãGeschichten erzûÊhlenã....Dieser Ulrich!... ãhat keine Eigenschaften, und eine Handlung gibtãs auch nicht, der Film hat keinen Anfang, kein Ende und einen Mittelteil schon gar nicht!ã Der Glaube an den Erfolg lûÊût sich durch solche Argumente nicht erschû¥ttern. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 02.01.2009
Datum: 02.01.2009Länge: 00:58:00 Größe: 39.87 MB |
||
| Bernadette Sonnenbichler: Weltberû¥hmt und ungelesen - Robert Musils "Mann ohne Eigenschaften" - 26.12.2008 | ||
| Mit Bernadette Sonnenbichler, Detlef Kû¥gow / Realisation: Bernadette Sonnenbichler / BR 2004 / LûÊnge: 52'19 // "Dieses Buch ist ein Monstrum, eine Foltermaschine, es lûÊdt zu einer Lektû¥re ein, die ein Selbstmord, ein Selbstmord beim Lesen ist" schrieb der Autor und Regisseur Jean-FranûÏois Peyret einmal û¥ber Robert Musils Jahrhundertroman "Der Mann ohne Eigenschaften". TatsûÊchlich empfinden viele Leser Musils Hauptwerk in seinem ausschweifenden, ironischen Stil als sperrig und unbequem. Umfangreicher als die Bibel, und dennoch Fragment geblieben, ziert das Buch unzûÊhlige Bû¥cherregale nicht nur im deutschsprachigen Raum. Zur Hand genommen wird es jedoch wenig. Nur selten finden sich unerschrockene, eifrig-disziplinierte Leser, die Musil und seiner Hauptfigur Ulrich von der ersten bis zur letzten Seite - û¥ber zahllose essayistische Exkurse hinweg - folgen. Und noch bevor er in den Ozean der im Grunde recht ereignisarmen Geschichte eintaucht, weiû der Leser bereits, dass er nie in den Genuss einer gûÊnzlichen AuflûÑsung all der begonnenen gesellschaftlichen und psychologischen Verstrickungen kommen zu wird, da der Tod Robert Musils im Jahre 1942 die Vollendung verhinderte. Ist also Musils kurz vor seinem Tod geûÊuûerter Wunsch, der Roman wûÊre ãnoch ungedruckt und noch zu schnû¥ren und zu beschneidenã, der Schlû¥ssel dazu, weshalb der Nachwelt ein nahezu unlesbares, einzigartiges Meisterwerk vermacht wurde? Oder liegt es doch an den Lesern, die der Ideenwelt Musils einfach nicht gewachsen sind? Musil selbst war der Meinung, dass die deutschen Leser nicht mehr lesen kûÑnnen. Und die sich dennoch mit seiner Literatur beschûÊftigten, seien nichts mehr als ãein kleiner Kreis von Hypersensiblen, die keine RealitûÊtsgefû¥hle mehr - nicht einmal perverse - haben, sondern nur literarische Vorstellungen davonã. Woran liegt es also, dass dem Weltruhm des Buches fast gleichberechtigt die totale Unkenntnis û¥ber dessen Inhalt zur Seite steht? GesprûÊche mit deutschen und ûÑsterreichischen Experten, Philologen, Autoren, Schauspielern, Germanisten, Bibliothekaren und vielen anderen sollen etwas Licht ins Dunkel bringen.ãLiteratur ist ein kû¥hner, logischer kombiniertes Leben. Ein Erzeugen oder Herausanalysieren von MûÑglichkeiten. Sie enthûÊlt das Noch-nicht-zu-Ende-Gekommene der Menschen, den Anreiz seiner Entwicklung am Brennen.ã (Robert Musil) | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 26.12.2008
Datum: 26.12.2008Länge: 00:52:38 Größe: 36.18 MB |
||
| Thomas Kretschmer: Vom Romanfragment "Der Mann ohne Eigenschaften" zum Remix - Ein Werkstattbericht - 12.12.2008 | ||
|
Mit Thomas Kretschmer, Andreas Neumann, Heiko Ruprecht / Realisation: Thomas Kretschmer / BR 2004 / LûÊnge: 58'08 // In einer 20-stû¥ndigen Produktion bringt der Bayerische Rundfunk Robert Musils "Der Mann ohne Eigenschaften" als Remix ins Radio. Gleichzeitig erscheint eine Edition mit dieser Audioversion und einer 450-seitigen Buchpublikation. Zwei Jahre dauerten die Arbeiten an diesem Projekt. Alleine an der Radio-Produktion sind 20 Schauspieler beteiligt, ein halbes Jahr lang arbeitete Regisseur Klaus Buhlert im Studio. "Der Mann ohne Eigenschaften. Remix" ist kein HûÑrspiel im klassischen Sinn. Stattdessen setzt die Produktion auf das Prinzip der offenen Form, um dem Charakter von Musils Hauptwerk gerecht zu werden. Der Roman ist Fragment geblieben: Zu Lebzeiten verûÑffentlichte Musil drei Teile, die einen Umfang von 1.600 Seiten haben. Nach seinem Tod im Jahr 1942 fand man seinen Nachlass zum "Mann ohne Eigenschaften", ein Konvolut von Mappen und BlûÊttern mit insgesamt mehr als 6.000 Seiten. Doch erst eine 1992 erschienene CD-ROM machte den Nachlass zugûÊnglich. Inzwischen ist eine erweiterte digitale Ausgabe der Werke Musils in Vorbereitung. Sie war eine wichtige Grundlage bei der Erstellung des Produktionsmanuskripts fû¥r den Radioremix, das in einem kontinuierlichen Prozess von zahlreichen Konzeptdiskussionen im Spannungsfeld zwischen kû¥nstlerischer Freiheit und wissenschaftlicher Genauigkeit entstand. Den Originaltext Musils, von Entwû¥rfen und Skizzen bis zu verûÑffentlichten Passagen, ergûÊnzen OriginaltûÑne und Statements von Autoren, Kulturwissenschaftlern und Kennern seines Werks. ãDie GesprûÊche bzw. Montagen aus diesen GesprûÊchen sind als Material ebenso relevant wie der Romantext selbstã, heiût es in dem von Katarina Agathos und Herbert Kapfer zum Remix entwickelten Konzept.
Auch die Regiearbeit von Klaus Buhlert ist auf den essayistischen Charakter von Musils Text wie auf das Prinzip der offenen Form ausgerichtet. Die zentrale Idee seines Konzeptes beschreibt er mit dem filmischen Mittel der subjektiven Kamera: ãDas heiût, die Figur fûÊrbt, dadurch dass sie den ErzûÊhltext zu groûen Teilen û¥bernimmt, plûÑtzlich einen vom Autor mehr oder weniger neutral gehaltenen ErzûÊhltext durch ihre Sichtweise, die sie aus der subjektiven Figur heraus gewinnt. Und das hebt die Figur dann aus dem epischen Rahmen eines Romans in einer solchen akustischen Umsetzung heraus. Die Figur wird eine handelnde dramatische Figur, stûÊrker jedenfalls als im Roman beabsichtigt.ã Die Sendung von Thomas Kretschmer begleitet die Entwicklung des Projekts und gibt in weiteren GesprûÊchen mit Schauspielern und dem Regisseur Einblicke in die Entstehung der Produktion "Der Mann ohne Eigenschaften. Remix". |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 12.12.2008
Datum: 12.12.2008Länge: 00:58:28 Größe: 40.19 MB |
||
| Thomas Kretschmer: Ein Kraftfeld von Ideen und Ereignissen - Stimmen zu Robert Musils "Der Mann ohne Eigenschaften" - 21.11.2008 | ||
|
Mit Thomas Kretschmer, Axel Wostry / Realisation: Thomas Kretschmer / BR 2004 / LûÊnge: 57'39 // "Der Mann ohne Eigenschaften" ist unter anderem bekannt durch seine Darstellung der Doppelmonarchie kurz vor dem 1. Weltkrieg und beliebt wegen der Fû¥lle von zitierfûÊhigen Aphorismen. Darû¥ber hinaus besticht Musils Fragment gebliebener Roman als ein offener, nicht abgeschlossener Text mit seiner Fû¥lle von Darstellungsformen und Themen. Gleichzeitig ist sein Platz im Kanon der Weltliteratur gerade wegen des fragmentarischen Charakters umstritten.
ãIch mûÑchte BeitrûÊge zur geistigen BewûÊltigung der Welt geben. Auch durch den Romanã ûÊuûerte Robert Musil 1926 in einem GesprûÊch. Das Schreibexperiment "Der Mann ohne Eigenschaften" umfasst ErzûÊhlung, Essay, Abhandlung, ûberlegung und Skizze. Der Text verhandelt Diskurse und Ideen, forscht etwa in der Beschreibung der Doppelmonarchie ãKakanienã nach den Grû¥nden fû¥r den Ersten Weltkrieg und stellt Fragen, die noch immer Gû¥ltigkeit haben: ãDie Dichtung hat nicht die Aufgabe, das zu schildern, was ist, sondern das, was sein soll; oder das, was sein kûÑnnte, als TeillûÑsung dessen, was sein soll. Zur Dichtung gehûÑrt wesentlich das, was man nicht weiû; die Ehrfurcht davor. Eine fertige Weltanschauung vertrûÊgt keine Dichtung.ã Thomas Kretschmer hat in GesprûÊchen und Interviews mit Literaturwissenschaftlern und Autoren Stimmen und Statements gesammelt, die sich mit der Ideenwelt von Musil auseinandersetzen: ãWirklichkeitssinn und MûÑglichkeitssinnã, ãphantastische und pedantische Genauigkeitã, das ãPrinzip des unzureichenden Grundesã der ãandere Zustandã, das ãTausendjûÊhrige Reichã und die ãinduktive Gesinnungã. Die Sendung fû¥hrt Musils ãBeitrûÊge zur geistigen BewûÊltigung der Weltã in die Gegenwart fort und wagt sich an Analyse und Interpretation des "Mann ohne Eigenschaften". GesprûÊchspartner sind der Moderator und Autor Roger Willemsen, der Regisseur Volker SchlûÑndorff, die Schriftsteller Juli Zeh und Robert Menasse, der ûÑsterreichische Vizekanzler a. D. Erhard Busek, die Literaturwissenschaftlerin Inka Mû¥lder-Bach, der Kulturwissenschaftler Joseph Vogl u. a. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 21.11.2008
Datum: 21.11.2008Länge: 00:57:58 Größe: 39.85 MB |
||
| Walter Fanta: Musils M.o.E. als Thriller - Drehbuch-Lesung - 31.10.2008 | ||
|
Mit Thomas Albus, Thorsten Nindel, Mogens von Gadow, Tim Seyfi, Trystan Pû¥tter, Sebastian KûÑnig, Barbara Novotny, Franziska Werner, Daniela Keckeis / Bearbeitung: Walter Fanta/Bernadette Sonnenbichler / Regie: Bernadette Sonnenbichler / BR 2004 / LûÊnge: 57'53 // Es wurde behauptet, Robert Musils Mann ohne Eigenschaften wûÊre kein echter Roman, er habe keine Geschichte. Die vorliegende Bearbeitung tritt den Gegenbeweis an. Sie stellt die spielfilmreife Handlung heraus, die der Roman trotz seines Essayismus erzûÊhlt. Das Romangeschehen von 1913-14 ist in die Gegenwart verpflanzt, ãKakanienã konsequent durch ãEuropaã ersetzt. Die Verwicklungen um eine - wirkliche oder eingebildete - europûÊische IdentitûÊt rû¥cken in die Mitte. Die HûÑrer werden sich Kamerafahrten durch zwei gedachte SphûÊren vorstellen: eine lûÊngs der politischen Intrige, in die der ãMann ohne Eigenschaftenã Ulrich als SekretûÊr der EuropûÊischen Aktion gezogen wird; sie gerûÊt ins Stocken, wenn Ulrich aus der Politik aussteigt und sich ins Private und Esoterische zurû¥ckzieht, findet aber, anders als im Roman, noch zu einem ãBombenã-Finale. Diese SphûÊre prallt auf die welt-unvertrûÊglichen ãanderen ZustûÊndeã und fantastische TrûÊume der Hauptfiguren Ulrich und Agathe und der von ihrem Popanz Mo(osbrugger) besessenen Clarisse.
In der Bearbeitung des Bayerischen Rundfunks ist die Provokation noch verstûÊrkt, die schon in dem Unterfangen liegt, aus dem philosophischen Roman einen Spielfilm-Thriller der Gegenwart zu verfertigen. Und zwar deswegen, weil sich die Lesung aus dem Drehbuch einen gerafften und unheimlich zugespitzten Durchmarsch durch das Filmskript Walter Fantas bahnt. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 31.10.2008
Datum: 31.10.2008Länge: 00:58:12 Größe: 40.01 MB |
||
| Walter Fanta: "Wenn ich auch mit dem Mann ohne Eigenschaften noch lange nicht fertig bin..." - Robert Musil und sein unvollendeter Roman - 12.09.2008 | ||
| Mit Achim HûÑppner, Detlef Kû¥gow, Axel Wostry / Realisation: Annegret Arnold / BR 2004 / LûÊnge: 52'18 // Es hûÊtte die zweite BuchverûÑffentlichung des ûÑsterreichischen Schriftstellers Robert Musil (1880-1942) werden sollen, zu dem er schon 1905 in Berlin mit ersten Vorarbeiten begann. Nach dem Ersten Weltkrieg setzte er sie als Projekt zu einem groûen satirischen Zeitroman fort. 1924 gab Musil seine BerufstûÊtigkeit als psychologischer Fachbeirat im Heeresministerium in Wien und als Feuilleton-Mitarbeiter der Prager Presse auf, um sich nur mehr der Arbeit an dem Romanprojekt zu widmen, dessen erstes und zweites Buch 1930 bzw. 1933 unter dem Titel "Der Mann ohne Eigenschaften" bei Ernst Rowohlt in Berlin erschien. Damit sah Musil seine literarische Aufgabe aber noch nicht als gelûÑst an, in der Fortsetzung des zweiten Buchs wollte er nichts weniger, als ãaus einer Unzahl von Ideen, die uns beherrschen, weil wir keine von ihnen beherrschen, die Geschichte einer ungewûÑhnlichen Leidenschaft ableiten, deren schlieûlicher Zusammenbruch mit dem der Kultur û¥bereinfûÊllt, der anno 1914 bescheiden begonnen hatã. Musil arbeitete mit schlieûlich nachlassenden KrûÊften bis zu seinem Tod am 12. April 1942 im Genfer Exil daran weiter, er hinterlieû kein fertiges Buch, sondern 12.000 Manuskripte in 60 Mappen und 40 Heften. Es handelt sich um den in der Geschichte der Literatur wohl einmaligen, schier unglaublichen Fall, dass ein Autor ein Vierteljahrhundert nichts anderes tut als an einem einzigen Buch, der EnzyklopûÊdie seiner Zeit, zu schreiben. Einmalig auch der Versuch, etwas, das sich normalerweise nur dem Auge des philologisch geschulten Betrachters erschlieût, HûÑrern zugûÊnglich zu machen. Die Manuskripte Musils erûÑffnen spannende Einblicke in eine WerkstûÊtte des Schreibens. Wie aus der RealitûÊt Fiktion entsteht und wie der Autor grobe Handlungsentwû¥rfe in zahlreichen Umformungsstufen zu ironisch und mythisch verdichteter reflexiver literarischer Prosa verwandelt, dies wird in der Tat hûÑrbar gemacht. Walter Fanta ist als Herausgeber der digitalen Edition des Nachlasses zum "Mann ohne Eigenschaften" am Robert-Musil-Institut fû¥r Literaturforschung in Klagenfurt tûÊtig. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 12.09.2008
Datum: 12.09.2008Länge: 00:52:38 Größe: 36.18 MB |
||
| Karl Corino: Schû¥rflizenz fû¥r ins Grab mitgenommene Geheimnisse - Die Recherchen zur Biographie Robert Musils - 05.09.2008 | ||
| Mit Karl Corino, Achim HûÑppner, Detlef Kû¥gow, Beate Himmelstoû / Realisation: Karl Corino / BR 2004 / LûÊnge: 58'18 // Durch den Verlust von Robert Musils Wiener Nachlass gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, durch die Vernichtung seiner Bibliothek, seiner Familienpapiere, seiner gesamten Korrespondenz bis 1938, seines Foto- und Zeitungsausschnitt-Archivs, aufgrund der Zerstreuung seiner exilierten Freunde û¥ber die ganze Welt war die Situation fû¥r den Biographen ziemlich schwierig. Andererseits zeigten die erhalten gebliebenen Papiere Musils, dass sein Werk in eklatanter Weise autobiographisch geprûÊgt war ã Musil hat weniger erfunden als gefunden und das Material des eigenen Lebens wie das seiner Familie und Freunde in sein episches und dramatisches Werk transformiert. So kaschierte er mitunter die Namen der realen Vorbilder fû¥r seine Figuren (wie z. B. im TûÑrless) nur minimal, machte freizû¥gig von den prekûÊren Schicksalen seines Jugendfreundes Gustav Donath und dessen psychisch kranker Frau Alice Gebrauch, und gleichzeitig hat er viele Spuren ebenso sorgfûÊltig verwischt. Wenn man diesen Geheimnissen auf die Spur kommen wollte, hatte man die Archive vieler LûÊnder zu durchforsten und mit den Augenzeugen zu sprechen, ihre Erinnerungen festzuhalten. Man hatte die SchauplûÊtze dieses Poeten-Lebens aufzusuchen; man durfte die FriedhûÑfe nicht meiden. Denn bisweilen fû¥hrte nur von den GrûÊbern eine Spur zurû¥ck ins Leben. Beispiel: die Familiengruft der Boyneburgs in Klagenfurt, die eine FûÊhrte zu dem mystisch bramarbasierenden BûÑsewicht Beineberg im TûÑrless legte. Ein Biograph darf prinzipiell kein Erkenntnismittel verschmûÊhen, selbst die Kriminalistik darf nicht zu kurz kommen. Die Quarzlampe kann die schwarzen Balken familiûÊrer Zensur in bestimmten heiklen Dokumenten sichtbar machen, und wo Wissenschaft und Technik versagen, muss unter UmstûÊnden der Zufall weiterhelfen, der in WitwenmûÊntel eingenûÊhte Manuskripte plûÑtzlich wieder ans Tageslicht befûÑrdert. Freilich gibt es Grenzen, die nicht oder nur mit grûÑûter Mû¥he zu û¥berschreiten sind: wenn etwa Augenzeugen aus Verbitterung oder aus Diskretion die Auskunft verweigern oder wenn durch die Ungunst der VerhûÊltnisse sûÊmtliche bû¥rgerlich beglaubigten Lebensspuren eines Menschen, etwa von Musils frû¥h verstorbener LebensgefûÊhrtin Herma Dietz (ãTonkaã), verloren gegangen sind. Mitunter bleiben dann nur Hypothesen und Mutmaûungen. Aber sie sind bekanntlich, nach Musil, das Mut-Maû. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 05.09.2008
Datum: 05.09.2008Länge: 00:58:37 Größe: 40.29 MB |
||
| Thomas Meinecke: Texas Bohemia (3/3) - 29.08.2008 | ||
| Realisation: Thomas Meinecke / BR 1993 / LûÊnge: 19'57 // Texas Bohemia ist eine HûÑrspiel-Collage aus ûÊuûerst raren sprachlichen sowie musikalischen (sehr soulvollen, zumeist texas-bûÑhmischen) OriginaltûÑnen, welche ich im heutigen Texas (MûÊrz und April 1992) aufgezeichnet habe. Die û¥ber ihre Herkunft und ihren Alltag - mal im holsteinischen, mal im pfûÊlzischen Idiom - sprechenden Texaner heiûen Harold und Meta Pahl, Marge Mueller, Joseph Emanuel Knutzen und Ronny Sachs, Harvey Meiners und Edgar Heinsohn, sind im Alter zwischen 41 und 82 Jahren und verstûÊndigen sich tûÊglich im sogenannten Texas-Deutschen. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 29.08.2008
Datum: 29.08.2008Länge: 00:20:21 Größe: 14.02 MB |
||
| Thomas Meinecke: Texas Bohemia (2/3) - 22.08.2008 | ||
| Realisation: Thomas Meinecke / BR 1993 / LûÊnge: 20'08 // Texas Bohemia ist eine HûÑrspiel-Collage aus ûÊuûerst raren sprachlichen sowie musikalischen (sehr soulvollen, zumeist texas-bûÑhmischen) OriginaltûÑnen, welche ich im heutigen Texas (MûÊrz und April 1992) aufgezeichnet habe. Die û¥ber ihre Herkunft und ihren Alltag - mal im holsteinischen, mal im pfûÊlzischen Idiom - sprechenden Texaner heiûen Harold und Meta Pahl, Marge Mueller, Joseph Emanuel Knutzen und Ronny Sachs, Harvey Meiners und Edgar Heinsohn, sind im Alter zwischen 41 und 82 Jahren und verstûÊndigen sich tûÊglich im sogenannten Texas-Deutschen. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 22.08.2008
Datum: 22.08.2008Länge: 00:20:30 Größe: 14.12 MB |
||
| Thomas Meinecke: Texas Bohemia (1/3) - 15.08.2008 | ||
| Realisation: Thomas Meinecke / BR 1993 / LûÊnge: 20'02 // Texas Bohemia ist eine HûÑrspiel-Collage aus ûÊuûerst raren sprachlichen sowie musikalischen (sehr soulvollen, zumeist texas-bûÑhmischen) OriginaltûÑnen, welche ich im heutigen Texas (MûÊrz und April 1992) aufgezeichnet habe. Die û¥ber ihre Herkunft und ihren Alltag - mal im holsteinischen, mal im pfûÊlzischen Idiom - sprechenden Texaner heiûen Harold und Meta Pahl, Marge Mueller, Joseph Emanuel Knutzen und Ronny Sachs, Harvey Meiners und Edgar Heinsohn, sind im Alter zwischen 41 und 82 Jahren und verstûÊndigen sich tûÊglich im sogenannten Texas-Deutschen. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 15.08.2008
Datum: 15.08.2008Länge: 00:20:25 Größe: 14.06 MB |
||
| Hartmut Geerken: sû¥dwûÊrts, sû¥dwûÊrts (Maûnahmen des Verschwindens: Eine Exiltrilogie) - 01.08.2008 | ||
|
HûÑrspiel nach einer dokumentarischen Niederschrift von Anselm Ruest / Mit Peter Fricke / Realisation: Hartmut Geerken/Herbert Kapfer / BR 1989 / LûÊnge: 47'41 // Der deutsche Autor und Philosoph Anselm Ruest wird 1940 in Frankreich zusammen mit vielen anderen Leidensgenossen in einem Gû¥terzug 'sû¥dwûÊrts' deportiert.
Einerseits heiût es, die Emigranten sollten vor dem Zugriff der vorrû¥ckenden Nazitruppen geschû¥tzt werden, andererseits wurden sie wie Kriegsgefangene behandelt. Der jû¥dische Emigrant, um den es hier geht, es ist der libertûÊre Autor und Philosoph Anselm Ruest, schreibt wûÊhrend des mehrtûÊgigen Transports und unmittelbar danach einen ûÊuûerst detaillierten dokumentarischen Bericht û¥ber diese Verschickung im verschlossenen Viehwaggon von Cûˋpois nach Marseille. - Der Text fand sich in Ruests Nachlaû. Die artifizielle Ausdrucksweise in klassisch gedrechselten SûÊtzen macht den beklemmenden Reiz dieses Berichts aus, vor allem im Hinblick auf die menschenunwû¥rdige Situation, die er beschreibt. Hartmut Geerken hat sich diesem Text zu nûÊhern versucht, indem er 1988 die aus Ruests Text vage rekonstruierte Strecke 'mit offenem Mikrofon' nachfuhr. Was er akustisch einfangen konnte, hat nichts mehr zu tun mit Ruests Bericht. Fast fû¥nfzig Jahre sind vergangen, und aus unverschweiûten Gleisen sind verschweiûte geworden. 1988 gibt es nichts, was an die Deportation von 1940 erinnert, es sei denn, daû die Orte, an denen Ruest und Geerken sich aufhielten, und die Strecken, die sie fuhren, deckungsgleich waren; aber auch das bleibt unsicher. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 01.08.2008
Datum: 01.08.2008Länge: 00:47:53 Größe: 32.92 MB |
||
| Michael Farin/Katrin Seybold: Lisa Fittko, Chicago 2000 - 25.07.2008 | ||
|
Interviews: Katrin Seybold/Catherine Stodolsky / Musik: Zeitblom / Realisation: Michael Farin / BR 2006 / LûÊnge: 54'22 // "Es gibt gewisse Bû¥cher, hinter denen eine der Weiûen Rose wû¥rdige Lebensgeschichte steht. Lisa Fittkos Erinnerungen sind von dieser Art", schrieb Jû¥rgen Habermas zu Lisa Fittkos Buch "Mein Weg û¥ber die PyrenûÊen" (1985).
Lisa Fittko, 1909 geboren, entstammt dem deutschsprachig-bûÑhmischen Judentum. Sie wûÊchst in Wien und Berlin auf. 1933 muss sie Deutschland wegen ihrer politischen Untergrundarbeit verlassen und flieht nach Prag. Hier lernt sie ihren Mann Hans Fittko kennen, der im kommunistischen Widerstand aktiv ist. Als die Deutschen seine Auslieferung verlangen, fliehen beide in die Schweiz und geraten û¥ber Holland nach Paris. Dort wird sie 1940 wie Hannah Arendt und zehntausend andere Frauen als ãfeindliche AuslûÊnderin" in dem berû¥chtigten Lager Gurs interniert, entkommt beim Einmarsch der Deutschen und findet ihren Mann wieder. Zusammen fliehen sie nach Marseille. Weil sie keine gû¥ltigen Papiere haben, reist sie, nach Auswegen suchend, an die franzûÑsisch-spanische Grenze, um einen Fluchtweg auszukundschaften. Da steht plûÑtzlich Walter Benjamin vor der Tû¥r. Lisa Fittko hat Walter Benjamin û¥ber die PyrenûÊen gefû¥hrt und spûÊter ã unter Einsatz ihres Lebens ã gemeinsam mit ihrem Mann, weit mehr als hundert anderen Verfolgten die Flucht vor den Nazis ermûÑglicht. Denn nachdem die Vichy-Regierung mit dem NS-Regime einen Auslieferungsvertrag fû¥r alle Emigranten geschlossen hatte, war Sû¥dfrankreich zur Menschenfalle geworden. Um wenigstens einige Intellektuelle und Kû¥nstler zu retten, hatten in die USA geflohene deutsche Sozialisten das ãEmergency Rescue Committeeã gegrû¥ndet. ûber einen alten Schmugglerpfad schleusten sie Schriftsteller, Nazigegner, Reichstagsabgeordnete, ûrzte und viele andere nach Portbou, Spanien. Ende 1941 wird Lisa und Hans Fittko der Aufenthalt in der Grenzregion untersagt. Ihre Flucht nach Kuba gelingt, spûÊter sogar, allerdings erst 1948, die Einreise in die USA, nach Chicago. Im Jahre 2000 hat sich Lisa Fittko vor der Filmkamera in einem mehrstû¥ndigen Interview noch einmal schlaglichtartig all dessen erinnert. In dieser daraus eigens fû¥r das Radio produzierten O-Ton-Collage erzûÊhlt sie uneitel, anschaulich und bisweilen mit einem dem Leid abgetrotzten Humor von dem, was sie fû¥r das ãSelbstverstûÊndlicheã hûÊlt: gegen die Nazi-Barbarei Widerstand zu leisten und Menschen zu retten. Auf dem Denkmal fû¥r die ãunbesungenen Heldenã Hans und Lisa Fittko in Banyuls steht denn auch noch heute: ãEs war das SelbstverstûÊndliche." Am 11. MûÊrz 2005 ist Lisa Fittko in Chicago gestorben. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 25.07.2008
Datum: 25.07.2008Länge: 00:54:42 Größe: 37.61 MB |
||
| Michaela MeliûÀn: FûÑhrenwald (engl. Version) - 17.07.2008 | ||
| Voices: Julian Doepp, Sabine Gietzelt, Christina HûÊnsel, Jenny Holdaway, Jamie Knight, Thomas Meinecke, Stefan Merki, Barbara SchûÊfer, Florian Schairer, Moritz Vinken / Translator: Jacqueline Todd / Composer: Michaela MeliûÀn/Carl Oesterhelt / Realisation: Michaela MeliûÀn / BR/kunstraum muenchen 2005 / Length of time: 59'59 // Adolf-Hitler-Platz, Independence Place, Kolping-Platz: The FûÑhrenwald Settlement is a crucible of german history in WWII and post war periods. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 17.07.2008
Datum: 17.07.2008Länge: 00:59:59 Größe: 41.23 MB |
||
| Kathrin RûÑggla: ein anmaûungskatalog fû¥r herrn fichte - 11.07.2008 | ||
|
Mit Stefan Merki / Regie: Barbara SchûÊfer / BR 2006 / LûÊnge: 34'34 // Die Schriftstellerin Kathrin RûÑggla setzt sich in sechs anmaûungen in einem ursprû¥nglich als Radioessay fû¥r das BR-Nachtstudio entstandenen Text mit den Einflû¥ssen Hubert Fichtes (1935-86) auf ihr eigenes Schreiben auseinander. Der Text ist hier als HûÑrspiel realisiert. Gesprochen von einer Stimme bekleidet RûÑggla drei Positionen: die der ãreisezûÑgerlichen autorinã, die ãder unautobiographischen autorinã und die von ãfichte als zitatmaschineã. Fichtes literarische Methoden, vor allem die des Interviews, die Tonbandaufzeichnungen seiner Hamburger Lesungen im Star Club oder die ethnologischen Reiseberichte werden Gegenstand der Selbstbefragung, in der es heiût: ãsoll das eine erklûÊrung sein, soll das die entschuldigung sein fû¥r die gewaltige anmaûung û¥ber sich selbst zu schreiben. sein eigenes leben als material? da kann fichte noch hundertmal sagen, das sei das normalste und û¥berhaupt die bedingung des schreibens - ich halte mein leben doch nicht fû¥r die ûÑffentlichkeit interessant.
und doch, das wûÑrtchen ãichã hast du auch durchkonjugiert in deinen bû¥chern, so wie fichte es vielleicht durchDEkliniert hat, es durch verschiedene identitûÊten, figuren hetzend, sie wegschieben, es mit erzûÊhlerpositionen umkreisend, kaschierend. dem ich immer identitûÊten vorsetzend, die jûÊcki oder detlev heiûen mûÑgen, figuren fû¥r den schauspieler fichteã. |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 11.07.2008
Datum: 11.07.2008Länge: 00:34:52 Größe: 23.99 MB |
||
| Eran Schaerf: Die Stimme des HûÑrers - 13.06.2008 | ||
|
Mit Peter Veit / Regie: Eran Schaerf / BR/ZKM/intermedium2 2002 / LûÊnge: 40'24 // "Hier ist 'Die Stimme des HûÑrers', eine von einem automatischen Moderator betriebener Rundfunksender fû¥r HûÑreranrufe. 'Die Stimme des HûÑrers' sendet abwechselnd auf gekauften und nicht in Betrieb genommenen Frequenzen. Sie finden den Sender, indem Sie beim ZuhûÑren auf der FM-Skala auf und ab wandern. Wenn es keine Anrufe gibt, schaltet der automatische Moderator um auf Sendersuche. In diesem Fall werden Sie hûÑren, was immer in Ihrem Empfangsbereich zu finden ist. 'Die Stimme des HûÑrers' ist fû¥r den Inhalt der gesendeten BeitrûÊge nicht verantwortlich." "Ohne jegliche akustische Illustration entwickelt das hochartifzielle und packende Stû¥ck eine Welt, in der es kein Jenseits des Mediums zu geben scheint." (Jurybegrû¥ndung HûÑrspiel des Jahres 2002) Sie finden den Sender, indem Sie beim ZuhûÑren auf der FM-Skala auf und ab wandern. Wenn es keine Anrufe gibt, schaltet der automatische Moderator um auf Sendersuche. In diesem Fall werden Sie hûÑren, was immer in Ihrem Empfangsbereich zu finden ist. Die Stimme des HûÑrers ist fû¥r den Inhalt der gesendeten BeitrûÊge nicht verantwortlich. Die Sprache der Sendung, der Stil und die LûÊnge des Gesprochenen hûÊngen von den HûÑrern ab. Identifizieren Sie sich als ich, sie, er oder es - Die Stimme des HûÑrers ist fû¥r die Wiedergabe von identifizierenden Angaben nur begrenzt eingerichtet. Ihr Beitrag wird nicht aufgezeichnet. Zwei Programme assistieren dem automatischen Moderator und kûÑnnen von Ihrem Beitrag aktiviert werden: das Register und der Index. Das Register beinhaltet Daten wie Namen von Personen, Orten, Kriegen, Zeitungen, sowie Szenario-Funktionen. Gelegentlich ersetzt das Register die Wiedergabe der Namen durch die Angabe Soundso, fû¥gt zu den von Ihnen erwûÊhnten Daten Alternativen hinzu, oder informiert Sie û¥ber weitere NutzungsmûÑglichkeiten der Stimme des HûÑrers. Der Index ist auf die Erkennung von Wortwiederholungen oder Wortkombinationen programmiert. Wenn er sie als einen Versuch erkennt, Ihrerseits eine Diskussion zu programmieren, meldet er die wiederholten WûÑrter und beginnt erneut mit dieser Ansage. Unmittelbar darauf wechselt Die Stimme des HûÑrers die Frequenz. Die Stimme des HûÑrers ist ein adressenloser Ort am Rande der Demokratie. Das Zielpublikum ist per definitionem nicht vorhanden. Der Sender wird ermûÑglicht durch die groûzû¥gige Unterstû¥tzung des Visacard-Inhaber-Clubs und der Gastarbeiter-Gesellschaft fû¥r Visa-Antragsteller. Um weitere Spenden wird nicht aufgerufen. Die Stimme des HûÑrers im FM-Wechsel. (Die Stimme des HûÑrers, Ansage) |
||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 13.06.2008
Datum: 13.06.2008Länge: 00:40:27 Größe: 27.82 MB |
||
| Berg Lauchstaedt/Thomas Meinecke/Thomas Palzer: Das jû¥ngste Gericht - Hercule Perrier hat nie gelebt - 30.05.2008 | ||
| Mit Berg Lauchstaedt, Thomas Meinecke, Thomas Palzer / Realisation: Berg Lauchstaedt, Thomas Meinecke, Thomas Palzer / BR 1989 / LûÊnge: 24'32 // Eine authentische Diskussion in volkstû¥mlicher Reproduktion. Drei Personen, Berg Lauchstaedt, Thomas Meinecke und Thomas Palzer, unterhalten sich û¥ber den Sinn des Schreibens. Worû¥ber soll aufgeklûÊrt werden? Wozu und womit? Welche Rolle spielt dabei Peter Ustinov? Und wer spielt Versuchsperson eins? Eine Hausfrau? Wem hat Thomas Bernhard die Unterhose angezû¥ndet? Dem Bû¥rgermeister von Wien? Agatha Christie? | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 30.05.2008
Datum: 30.05.2008Länge: 00:24:52 Größe: 17.11 MB |
||
| Maria Volk: eschen junge zwei - 16.05.2008 | ||
| Mit Matthias von Stegmann, Cornelia Mû¥ller / Komposition: Ulrich Bassenge / Regie: Herbert Kapfer / BR 1990 / LûÊnge: 16'41 // Liebe: das alte Lied? Ein Blickwechsel genû¥gt, und Amy und Jorge haben einander erkannt. Die gegenseitige ErwûÊhlung macht die Liebenden stolz. Sie tauschen ihre Geschichten aus. "Ohne daû es Amy und Jorge bemerken, û¥berkreuzen sich die beiden Geschichten an einem Band, an dessen Ende die Freiheit festgebunden ist. Das Band ist danach fest zwischen ihnen verspannt... Trotz abwechselnder gegenseitiger Ermahnungen hûÑren Amy und Jorge nicht auf zu reden, und so versûÊumen sie den Schlaf... Auch bei Amy geht die Herzspange auf." Liebe: das Hohe Lied. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 16.05.2008
Datum: 16.05.2008Länge: 00:17:01 Größe: 11.73 MB |
||
| Ulrich Bassenge: fusion - 18.04.2008 | ||
| Mit Detlef Kû¥gow, Rainer Buck / Komposition/Realisation: Ulrich Bassenge / BR 1989 / LûÊnge: 10'10 // Der Komponist und Autor Ulrich Bassenge sampelt in seiner Collage O-Ton-Material von den Auseinandersetzungen um den Bau der Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf. Daraus entstehen futuristische piû´ces, die das Klangmaterial als HûÑrspiel 'wiederaufbereiten'. Dem Kompositionsprinzip der strukturalistischen Klanganalyse folgend, macht Bassenge den Rhythmus des atomaren Fortschritts hûÑrbar, der Archetypen kriegerischer Auseinandersetzung birgt. | ||
 Audio im externen Player abspielen
Audio im externen Player abspielen Download starten:
Download starten: Rechte Maustaste und "Ziel speichern unter..." wählen. ![Audio-Infos [Audio]-Infos](/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://www.br-online.de/podcast/img/tooltipp.gif) Datum: 18.04.2008
Datum: 18.04.2008Länge: 00:10:33 Größe: 7.29 MB |
||


 Wetter
Wetter