|
Belletristik
Romane, Erzählungen, Novellen
Blutige Ernte
Krimis, Thriller & Agenten
SF & Fantasy
Elfen, Orcs & fremde Welten
Sprechblasen
Comics mit Niveau
Quellen
Biographien, Briefe & Tagebücher
Geschichte
Epochen, Menschen,
Phänomene
Politik
Theorie, Praxis & Debatten
Ideen
Philosophie & Religion
Kunst
Ausstellungen, Bild- & Fotobände
Tonträger
Hörbücher & O-Töne
Videos
Literatur in Bild & Ton
Literatur
Live
Veranstaltungskalender
Zeitkritik
Kommentare, Glossen & Essays
Autoren
Porträts, Jahrestage & Nachrufe
Verlage
Nachrichten, Geschichten & Klatsch
Film
Neu im Kino
kino-zeit
Das Online-Magazin
für Kino & Film
Mit Film-Archiv, einem bundesweiten
Kino-Finder u.v.m.
www.kino-zeit.de
Anzeige

Klassiker-Archiv
Übersicht
Shakespeare Heute
Shakespeare Stücke
Goethes Werther,
Goethes Faust I,
Eckermann,
Schiller,
Schopenhauer,
Kant,
von Knigge,
Büchner,
Mallarmé,
Marx,
Nietzsche,
Kafka,
Schnitzler,
Kraus,
Mühsam,
Simmel,
Tucholsky
Die aktuellen Beiträge werden am
Monatsende in den jeweiligen Ressorts archiviert, und bleiben dort
abrufbar.
Wir empfehlen:


Andere
Seiten
Diskutieren Sie
mit Gleichgesinnten im
FAZ Reading Room
Joe Bauers
Flaneursalon
Gregor Keuschnig
Begleitschreiben
Armin Abmeiers
Tolle Hefte
Curt Linzers
Zeitgenössische Malerei
Goedart Palms
Virtuelle Texbaustelle
Reiner Stachs
Franz Kafka
counterpunch
»We've
got all the right enemies.«
Riesensexmaschine
Nicht, was Sie denken?!
texxxt.de
Community für erotische Geschichten
Wen's interessiert
Rainald Goetz-Blog
|
 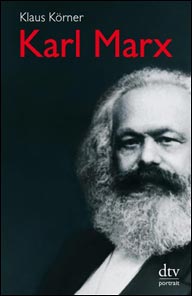 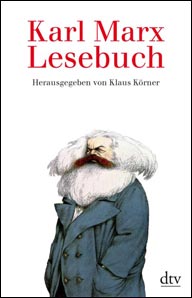
Marx ist Marx ist Marx
»Marx'
Irrtümer und unerfüllte Prophezeiungen in Sachen Kapitalismus verblassen zur
Bedeutungslosigkeit gegenüber der chirurgischen Präzision, mit der er die Natur
der Bestie bloßgelegt hat.«
Francis
Wheen erklärt das unbekannte Meisterwerk »Das Kapital«
Von
Jürgen Nielsen-Sikora
Karl Marx wurde 1818 geboren. Drei Jahre zuvor zeichnete der Wiener Kongress
nach der Niederlage Napoleons die geopolitische Landkarte des europäischen
Kontinents völlig neu. Der national vereinte Einheitsstaat, der die Interessen
des Volkes vertreten und seine Grundrechte schützen, darüber hinaus jedoch auch
Möglichkeiten eröffnen sollte, sich in diesem Staat ökonomisch und sozial
entfalten zu können, sollte von nun an Kennzeichen gleichberechtigter
freiheitlicher Verfassungsstaaten des 19. Jahrhunderts sein. Das mochte in der
Theorie richtig sein, taugte aber in der Praxis wenig. Denn die Zeit des Vormärz
hatte grundsätzlich nicht nur mit dem Gegensatz von Ost und West in Europa zu
kämpfen, sondern vor allem mit der sozialen Frage, die im Anschluss an
zahlreiche Bankenzusammenbrüche, Fabrikschließungen und die beginnende
industrielle Revolution zutage trat. Insbesondere im Anschluss an die Agrarkrise
der 1840er Jahre, die Missernte 1847, die damit einsetzenden Hungersnöte (z.B.
1844 in Schlesien) sowie das schwindende Vertrauen in eine Politik, die als
Restaurationspolitik angetreten seit Jahren eine restriktive Demagogenverfolgung
betrieb, offenbarte zur »Blütezeit des Kapitals« (Hobsbawm)
massive soziale Schieflagen, die die europäische Öffentlichkeit auf den Plan
rief. So wurden zunächst in Paris, später, und zwar durch die Besetzung des
Ständehauses des badischen Landtags in Karlsruhe, Forderungen gestellt, die auf
die Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt in einer vom
Pauperismus, von einer künstlich
produzierten Armut bedrohten Epoche abhoben.
In den so genannten »Dresdner Forderungen« hieß es beispielsweise: »1. Freiheit
der Presse (…). 2. Freiheit des religiösen Bekenntnisses und der kirchlichen
Vereinigung. 3. Freiheit des Versammlungs- und Vereinsrechts. 4. Gesetzliche
Sicherstellung der Person gegen willkürliche Verhaftung, Haussuchung und
Untersuchungshaft. 5. Verbesserung des Wahlgesetzes (…). 6. Öffentlichkeit und
Mündlichkeit der Rechtspflege mit Schwurgericht. 7. Vereidigung des Militärs auf
die Verfassung. 8. Verminderung des stehenden Heeres, Umbildung des
Militärwesens und der Bürgerbewaffnung (…).« Die Dresdner Forderungen schlugen
sich unter anderem in den Formulierungen der Paulskirchenverfassung nieder. Doch
die Verfassung vom 28. März 1849 war zwar die erste demokratisch beschlossene,
jedoch nie in Kraft getretene Verfassung für ganz Deutschland. Auch wenn sie
letztlich am Widerstand der deutschen Fürsten, insbesondere des Königs von
Preußen, scheiterte, bedeutete sie einen enormen Modernisierungsschub für die
europäischen Staaten. Mit der Einrichtung umfassender Bürgerrechte waren
freilich die überzeugten Anti-Demokraten nicht einverstanden. Teile des alten
Bürgertums betrachteten skeptisch bis missgünstig die jüngsten Entwicklungen von
Paris bis Prag. Wünsche, die alte Ordnung wieder einzurichten ließen sich auch
jetzt noch, knapp 20 Jahre nach dem Sturz Karl X., vernehmen. Doch die
Entwicklung einer breiteren Öffentlichkeit, die sich Meinungsvielfalt,
Pressefreiheit und ein größeres Parteienspektrum erkämpft hatte, war trotz der
Gegenrevolution nicht mehr aufzuhalten. Interessierte Bürger und Lobbyisten,
weit über tausend Zeitungen, unter ihnen zunächst auch Karl Marx´ Neue
Rheinische Zeitung, erhielten Einzug in das europäische Gesellschaftsleben.
Gegen die »Hexenmeister« der bürgerlichen Revolution des Jahres 1789 setzten der
Autor des Kapitals und sein Kollege Friedrich Engels (1820-1895), für den
die Politik Napoleons die wahre Religion der modernen Bourgeoisie war, auf die
proletarische Revolution und damit auf die Krise der bürgerlichen Gesellschaft
insgesamt. Für Marx und Engels aber war 1789 der Prolog für den Aufstand des
Proletariats zur Klärung der sozialen Frage, bei der mit dem Kapital, dem
»Henker vor der Türe« (Engels), abgerechnet werden sollte. Nichtsdestotrotz
konstatierte Marx bereits im Manifest, mit Heraufkunft der Bourgeosie seien die
Gegensätze der Völker nahezu verschwunden, woran die Handelsfreiheit, der
Weltmarkt und die industrielle Produktion wesentlichen Anteil gehabt hätten.
Freilich könne erst die Herrschaft des Proletariats diese Entwicklung zu einem
Ende führen, sowie die Ausbeutung der Individuen und damit letztlich der
Nationen stoppen: »In dem Maße, wie die Exploitation des einen Individuums durch
das andere aufgehoben wird, wird die Exploitation einer Nation durch die andere
aufgehoben« heißt es noch im Manifest der Kommunistischen Partei von 1848.
Man wird sich diese
gesellschaftlichen Entwicklungen zur Mitte des 19. Jahrhunderts vor Augen führen
müssen, will man Marx verstehen und sich von seinen Adepten des 20. Jahrhunderts
nicht gänzlich den Blick auf seine Schriften verstellen lassen. »Moi, je ne suis
pas marxiste« ließ Marx selbst verlautbaren: Marx ist Marx ist Marx. Liest man
ihn also im politischen Kontext, in dem seine Thesen entstanden sind, zeigt sich
erst, wie scharfsinnig er die veränderten Lebens- und Arbeitsbedingungen, die
Modernisierung und Rationalisierung seiner Zeit analysiert hat.
»Das
Kapital«, das zum Jahresende 1867 erschien, diskutiert die
Entstehung, die Organisation und die Gesetze der Ökonomie des 19. Jahrhunderts.
Es zeichnet den Weg vom Handwerk zur Fabrik nach und stellt den Menschen auf
Grund des Verkaufs seiner Arbeitskraft als Ware dar. Arbeitskraft und Arbeiter
werden bei Marx zur elendesten Ware. Der Arbeiter bleibt in seinem Tun stets der
Knecht des Kapitals. Das Kapital andererseits ist für ihn die Regierungsgewalt
über die Arbeit und ihre Produkte. Dem Arbeiter bleibt die Arbeit stets
äußerlich. In ihr verneint er seine eigene Existenz, so dass er letztlich in und
durch seine Arbeit an seiner eigenen Existenz leidet, wohingegen der Kapitalist,
der müßige Gott, der nie für den Bedarf, sondern immer nur für den Profit Waren
produziert, am »Gewinn seines toten Mammons« leidet. Heißt es noch in Matthäus
6, Vers 24: „Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon“, so widerlegt Marx
ebendiese These durch eine kritische Anatomie der Bourgeosie, deren Wesen er in
der politischen Ökonomie sucht. Die politische Ökonomie ist zugleich das Skelett
der bürgerlichen Gesellschaft, ohne dass sie zusammenbrechen würde. Die
Bourgeosie hat grundsätzlich neue Bedingungen der Unterdrückung geschaffen,
indem sie Kapital akkumuliert und durch diese Akkumulation eine Akkumulation des
Elends auf Seiten der Arbeiter in Kauf genommen hat. Deshalb wachse nicht nur
die Widerwärtigkeit der Arbeit, sondern im selben Atemzug nehme auch noch der
Lohn ab. Je mehr das produktive Kapital wachse, desto mehr Arbeitsteilung gebe
es. Dies führe zu einer schärferen Konkurrenz unter den Arbeitern, so dass sich
der Lohn letzten Endes zusammenziehe. Marx Forderung ist deshalb die Abschaffung
des Privateigentums.
Der britische Journalist
Francis Wheen, der bereits durch eine Marx-Biografie in Erscheinung trat, hat
nun das „unbekannte Meisterwerk“, so die Einleitung, einem breiten Publikum
zugänglich gemacht. Das englische Original erschien 2006 unter dem Titel „Marx´s
Das Kapital. A Biography“ und wurde von Kurt Neff ins Deutsche übertragen. In
drei Kapiteln erläutert Wheen darin die Vorgeschichte des „Kapitals“ durch
zahlreiche biografische Hinweise, widmet sich dann dem Buch selbst sowie seinen
Wahrheiten und Irrtümern, die er in wesentlichen Zügen rekapituliert und deutet,
um abschließend „das Fortleben“ dieses wirtschaftsphilosophischen Klassikers zu
untersuchen. Sein Fazit: »Der Untergang der Bourgeosie und der Sieg des
Proletariats sind ausgeblieben. Aber Marx´ Irrtümer und unerfüllte
Prophezeiungen in Sachen Kapitalismus verblassen zur Bedeutungslosigkeit
gegenüber der chirurgischen Präzision, mit der er die Natur der Bestie
bloßgelegt hat. Während nach wie vor alles Ständische und Stehende verdampft,
wird die anschauliche Schilderung, die das »Kapital« uns von den Kräften gibt,
die unser Leben bestimmen, und von der Unbeständigkeit, Entfremdung und
Ausbeutung, die sie hervorbringen, niemals an Klang und Bedeutung verlieren
wird, und auch nicht die Kraft, uns die Welt scharf ausgeleuchtet ins Blickfeld
zu rücken. (…) Weit davon entfernt, unter den Trümmern der Berliner Mauer
begraben zu sein, tritt Marx vielleicht erst jetzt in seiner wahren Bedeutung
ins Licht. Er könnte durchaus noch zum einflussreichsten Denker des 21.
Jahrhunderts werden.«
Dieser Prophezeiung schließen sich auch zwei weitere Bände aus dem Münchner
dtv-Verlag an, für die der Publizist Klaus Körner verantwortlich zeichnet, und
die allesamt zum 125. Todestag erschienen sind. Sein Marx-Lesebuch sowie seine
Marx-Biografie bilden zusammen mit Wheens Interpretation eine erfrischende
Einführung in Marx´ Denken und regen dazu an, den Vater der Kapitalismuskritik
wieder im Original zu lesen. Zudem lassen die drei schmalen Bände daran
erinnern, dass Marx recht wenig mit dem Marxismus zu tun hat, der ihn nach
seinem Tode instrumentalisiert hat. Schließlich zeigen sie, dass Marx´ Kritik
der politischen Ökonomie trotz der veränderten Lebensbedingungen im 21.
Jahrhundert und den veränderten Vorzeichen des »Katastrophenkapitalismus« (Naomi
Klein), in dem die Arbeit zusehends einem international agierenden Devisenmarkt
weicht und Arbeitskraft mehr und mehr als Dienstleistung ausbuchstabiert wird,
immer noch so aktuell ist wie sein Versuch, einen Beitrag zur Demokratisierung
der Gesellschaft insgesamt zu leisten. Man betrachte in diesem Zusammenhang nur
einmal den Transformationsprozess der Demokratie in den vergangenen 30 Jahren,
in denen sich eine Verformung der politischen Ordnung vollzogen hat, die nicht
wirklich hinterfragt worden ist. Zwar sind die demokratischen Institutionen
weiterhin intakt, aber die politischen Verfahren und Regierungen zeigen
verstärkt Züge vordemokratischer Zeiten, so dass der Einfluss von Eliten,
Lobbyisten und »spin doctors« immer größer wird. Zugleich geht der Anteil der
arbeitenden Bevölkerung gegenüber der Kapitalvermehrung zurück. Der begrenzten
Macht der Regierung steht zusehends die unbegrenzte der kapitalistischen
Wirtschaft gegenüber. Der britische Politikwissenschaftler Colin Crouch spricht
aus diesem Grunde gar von der »Entropie der Demokratie« bzw. von
»Postdemokratie«. Diese Diskussion wird so schnell nicht beendet sein. Und
möglicherweise hat Marx auch dann ein Wörtchen mitzureden. Das hat dtv richtig
erkannt.
Jürgen Nielsen-Sikora
|
Francis Wheen
Karl Marx, Das Kapital
Bücher, die die Welt veränderten
Aus dem Englischen von Kurt Neff
dtv
128 Seiten
ISBN 978-3-423-34458-6
Euro 9,90
Klaus Körner, (Hrsg.)
Karl-Marx-Lesebuch
Herausgegeben von Klaus Körner
dtv
304 Seiten
ISBN 978-3-423-34464-7
Euro 8,90
Klaus Von Körner
Karl Marx
dtv portrait
192 Seiten
ISBN 978-3-423-31089-5
Euro 10,00
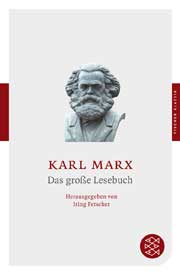 Iring
Fetscher (Hrsg.) Iring
Fetscher (Hrsg.)
Karl Marx
– Das grosse Lesebuch
Fischer Taschenbuch Verlag
544 Seiten, Broschur
ISBN 978-3-596-90002-2
Preis € (D) 8,00
Marx & Engels
in Zitaten
|



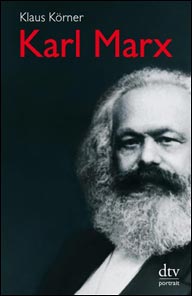
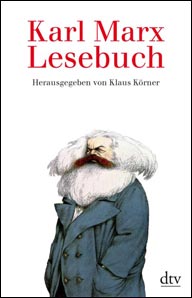
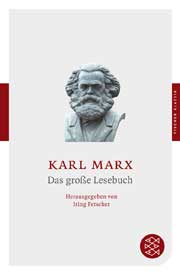 Iring
Fetscher (Hrsg.)
Iring
Fetscher (Hrsg.)