|
Glanz@Elend |
Biographie
-
Politik & Geschichte |
|
|
|
Preisrätsel Verlage A-Z Medien & Literatur Museen & Kunst Mediadaten Impressum |
|||
|
Ressorts |
|||
|
|
Franziska Augstein gehört zu den etablierten Größen des deutschen Feuilletons. Von 1987 bis 1989 war sie Redakteurin beim Magazin der Wochenzeitung Die Zeit, ab 1997 bei der FAZ, zunächst als Redakteurin im Feuilleton-Ressort, schließlich als Kulturkorrespondentin. Anfang 2001 wechselte sie zum Feuilleton der Süddeutschen Zeitung. Nun hat Franziska Augstein ein Buch über einen Mann veröffentlicht, der es ihr besonders angetan hat: Jorge Semprun. Ein Mann, der das Jahrhundert der Extreme wie nur wenige seiner Zeitgenossen durchlitten, durchlebt und überlebt hat. Ein Mann, der Praxis und Theorie, Politik und Literatur mit seinem Leben verbunden hat. Ein Mann der Tat, weil beseelt von einer Idee. Es ist dieses außergewöhnliche Leben, das Semprun zum Thema seiner Bücher macht. Und es ist dieser Mann, den Franziska Augstein zum Thema ihres Buches macht. Doch noch mehr als von Jorge Semprún handelt dieses Buch von der Kraft einer Idee, deren Verspottung wir in den nächsten Monaten zur Genüge erleben werden. Es ist die kommunistische Idee, der Glaube an den Kommunismus oder, wie es der große französische Historiker François Furet einmal nannte, die kommunistische Illusion. Und Furet wusste ganz genau, was er da schrieb, denn auch er war ihr verfallen. »Sie«, so beschreibt er die Illusion des Kommunismus, »ist nicht das, was man als eine falsche Einschätzung bezeichnen könnte, die sich mittels Erfahrung durchschauen und korrigieren ließe, sondern eher ein tiefes inneres Engagement – und damit einem religiösen Glauben nicht unähnlich.«[1] Tiefes inneres Engagement und eine quasi-religiöse Einstellung prägte auch das Leben von Jorge Semprún, zumindest eine Zeit lang und vor allem während seiner wichtigsten Lebensphasen. Und es ist wohl keine Fehlinterpretation, dass diese Illusion, wenn es denn eine war, ihm mehrmals am Leben gehalten hat. Die kommunistische Illusion gab Semprún Kraft, Halt und Zuversicht in den Jahren im französischen Widerstand, als Häftling im KZ Buchenwald und während seines Kampfes im Untergrund gegen das Franco-Regime in Spanien. Dass der Kommunismus solche Heroen hervorbrachte, auch daran sollte in den kommenden Monaten, wenn man seinen Zusammenbruch vor 20 Jahren feiern wird, gedacht werden. Semprún wurde am 10. Dezember 1923 geboren, einem ereignisreichen Jahr, wie Augstein schreibt: Lenins zweiter Schlaganfall, die Errichtung eines ersten Lagers auf den Solowezki-Inseln im Stile des Haftsystems, das Solscheniyzin als »Archipel Gulag« bezeichnen sollte, Hitlers Putschversuch in München, Lukács Werk »Geschichte und Klassenbewusstsein«, die Errichtung einer Militärdiktatur in Spanien unter General Miguel Primo de Rivera. All diese Ereignisse und ihre Folgen waren, so die Biografin, für Sempruns Leben entscheidend. Dieser wuchs in einer großbürgerlichen und politisch aktiven Familie in Madrid auf. Der Vater seiner Mutter, Antonio Maura, war mehrmals spanischer Ministerpräsident gewesen. Als Republikaner ging Semprúns Familie beim Ausbruch des Spanischen Bürgerkriegs 1936 ins Exil. Als Franco den Krieg gewonnen hatte, zog sie Anfang 1939 weiter nach Paris, wo Jorge, nach einem standesgemäßen Abitur am Gymnasium Henri IV, an der Sorbonne Philosophie studierte. In Zeiten des Krieges tut man sich schwer, Ideen zu studieren, wenn die Einsicht in die Notwendigkeit ruft. Jorge Semprún trat 1941 zunächst der Résistance bei, ein Jahr später der Kommunistischen Partei. Damit gewann er zwar mutige, aber nicht unbedingt kluge Freunde. Im Oktober 1943 wurde Semprún, infolge der Leichtsinnigkeit seines Kompagnons wegen, von der Gestapo verhaftet und schließlich, nach Verhören und Folter, im Januar 1944 in das KZ Buchenwald deportiert. Dort zahlte sich seine Mitgliedschaft in der KP aus. Die Kommunisten hatten ein System entwickelt, die ihren zu schützen. Er überlebte das KZ Buchenwald und erlebte seine Befreiung im Frühjahr 1945. Am 23. April bestieg er einen Lastwagen, verließ mit den zu den Siegermächten zählenden Franzosen das Lager und kehrte nach Paris zurück. Dort gab er sich dem Eifer für die kommunistische Idee hin. In seiner Zelle mit der Nummer 722 taten es ihm etliche Intellektuelle gleich, die berühmteste unter ihnen war Marguerite Duras. Aber nicht nur dem Kommunismus gaben sie sich hin, sondern auch der Liebe, Semprúns erste wie zweite Ehefrau waren ebenfalls Mitglied der Zelle. Bei den Debatten über die Theorie des Kommunismus und wie man Stalins Volten damit zu erklären seien, war Semprún stets vorne dabei, doch Debattieren allein war ihm zu wenig. Von 1953 bis 1962 hielt er sich unerlaubt in Spanien auf, wo Semprun unter Decknamen wie Federico Sanchez den Widerstand der spanischen KP gegen das Franco-Regime koordinierte. In seinem Buch mit dem Titel »Autobiografía de Federico Sánchez« aus dem Jahr 1977 schildert er diese Zeit. 1954 wurde er Mitglied des Zentralkomitees der Partei, ab 1956 saß er im Politbüro. Auch in dieser Zeit sollte er erleben, was es bedeutete, Anhänger der kommunistischen Idee zu sein. Im Juni 1959 wurde Simon Sanchez Montero, ein enger Mitstreiter Semprúns, gefangengenommen. Man wollte von ihm dessen Aufenthaltsort erfahren. Erfahren hieß konkret, dass Sanchez systematisch zusammengeschlagen und gefoltert wurde. Semprún setzte darauf, dass sein Genosse nicht aussagen werde und kehrte in die Wohnung zurück, deren Adresse Sanchez bekannt war. Semprún ging also nach Hause, las dort ein Buch, legte sich zu Bett, schlief, erwachte und lebte in den folgenden Tagen, in denen Sanchez gefoltert wurde, weiter wie gehabt. Als die beiden sich 1966 wiedersahen, fragte Sanchez, was Semprún denn an jenem Tag der Festnahme gemacht habe. Semprún antwortete, er sei nach Hause gegangen. Da, so erinnert sich Semprún, habe Sanchez erleichtert aufgeatmet. Semprúns Aufstieg innerhalb der spanischen KP endete 1964, als er wegen »parteischädigenden Verhaltens« ausgeschlossen wurde. 1963 hatte Semprun Solschenizyns Roman »Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch« gelesen und verlangte daraufhin die Aufklärung von Verbrechen in der spanischen KP. Es kam zu ideologischen Kämpfen zwischen den stalinistischen und undogmatischen Strömungen innerhalb der Partei. Semprun verlor seine Hoffnungen in den Kommunismus und ohne religiösen Glauben war ein tiefes inneres Engagement nicht mehr möglich. Der Ausschluss war eine Formalie, die Semprún nichtsdestoweniger zutiefst verletzte. In einem Gespräch mit Augstein bezeichnete er 1964 als das Jahr, in dem er gestorben sei.
Franziska Augstein ist ein zartes Buch gelungen, ein nachdenkliches,
reflektiertes. Deshalb sollte es gelesen werden. Dieser positiven Einschätzung
zum Trotz zwei, drei kritische Bemerkungen. Überflüssig sind die verkrampften
Einleitungen jedes Kapitels. Augstein hätte sich die störenden Bezüge zu ihrem
Leben und ihren politischen Einschätzungen sparen bzw. subtiler einflechten
können. Was ich vermisste, war ein genaueres Portrait Spaniens. Vor allem auch
deshalb, weil es spannend ist, wie dieses damals unterentwickelte Land am Rande
Europas eine so zentrale Rolle in der Zwischenkriegszeit und nach dem Zweiten
Weltkrieg spielen konnte. Der spanische Bürgerkrieg war auch ein Lackmustest für
die Idee einer werteorientierten und streitbaren Demokratie. Dieser Test
scheiterte grandios, auch deshalb stieg die Zahl der Anhänger von Kommunismus
und Faschistmus in Frankreich z.B. enorm. Mit einer derart laschen, die eigenen
Werte verratenen bürgerlichen Ideologie wollten nur noch die wenigsten zu tun
haben. Der These, die Augstein auch in einer Rezension eines Buches von Semprun
vertritt,[2]
dass der Nazismus und der sowjetische Totalitarismus das 20. Jahrhundert geprägt
haben, halte ich die ideologische Kraft der Idee einer liberalen Demokratie
entgegen. Das beweisen Männer wie Charles de Gaulle, Winston Churchill und
Franklin D. Roosevelt vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg. Diese Ebene
fehlt mir in Augsteins Buch, obwohl sie in Semprúns spätem Leben eine Rolle
spielte. Schließlich übernahm er als ehemaliger (?), geläuterter (?) Kommunist
unter Felipe González 1988 das Amt des Kulturministers, das er als Parteiloser
bis 1991 ausübte. Das franquistische Spanien ab 1945 ist kein Nachklapp zur
Zwischenkriegszeit Mitteleuropas. Was es eigentlich war und warum es Jorge
Semprún anzog, warum er dort sein Leben aufs Spiel setzte, jenseits seiner
spanischen Herkunft und seines Hangs zum Risiko, das wäre eine weitere spannende
Frage, die Augstein anhand der Biographie Semprúns hätte stellen können.
Vielleicht war und ist ihr aber Spanien zu randständig und zu weit entfernt von
den angelsächsisch-französisch-deutschen Diskursen. Schade! [1]Francois Furet: Das Ende der Illusion. Der Kommunismus im 20. Jahrhundert, München – Zürich (Piper) 1996
[2]
Franziska Augstein: „Was für ein schöner Sonntag!“, in: Süddeutsche
Zeitung vom 10. Juli 2004.
|
Franziska Augstein |
|
|
Glanz@Elend
|
|||

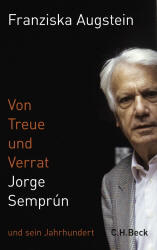 Genug
für sieben Leben
Genug
für sieben Leben