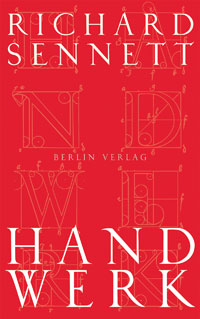|
Glanz@Elend |
Soziologie & Geschichte |
|
|
|
Preisrätsel Verlage A-Z Medien & Literatur Museen & Kunst Mediadaten Impressum |
|||
|
Ressorts |
|||
|
|
Richard Sennetts "Handwerk", das erste Buch einer Trilogie über materielle Kultur (die anderen Bände sollen "Krieger und Priester" und "Der Fremde" heissen), ist mehr als eine Kultursoziologie des Handwerks. Es ist eine emphatisch-euphorische Schrift für all diejenigen, die ihrer Arbeit mit Hingabe nachgehen und sie um ihrer selbst willen gut machen wollen. Das ist für Sennett die Definition des Handwerkers. Sie üben eine praktische Tätigkeit aus, doch ihre Arbeit ist nicht nur Mittel zu einem anderen Zweck. Ob dieser Bestimmung bedarf es Sennetts Bekenntnis am Ende des Buches, ein Anhänger der philosophischen Denkschule des Pragmatismus zu sein, fast nicht mehr.
Engagiertes Tun Die kulturell seit Jahrhunderten bestehende Trennung zwischen Kopf- und Handarbeit will Sennett aufheben. Dafür legt er sich sogar noch posthum mit (seiner Lehrerin) Hannah Arendt und deren Verachtung für den "Animal laborans" (das arbeitende Tier Mensch) zu Gunsten des "Homo faber" an. Unter der falschen Alternative Kopf versus Hand leide letztlich der Kopf und sowohl Verständnis als auch Ausdruck nehmen Schaden. Bei jedem guten Handwerker, so die These, stehen praktisches Handeln und Denken in einem ständigen Dialog. Sennett versucht sich als zweiter Diderot, der in seiner Encyclopédie die Leser in den Salons bat, einfache arbeitende Menschen…zu bewundern (ohne Gefahr zu laufen, einer Verkitschung oder gar falschen Heroisierung anheim zu fallen). Dies berücksichtigend, und weil Wittgenstein und dessen Wort von den "Grenzen der Sprache" erwähnt wird, sei am Rande (ein bisschen süffisant) gefragt, warum es im Buch keine Illustrationen und Bilder gibt, die einige Umständlichkeiten hätten beheben können.
Fast überbordende
Opulenz Er veranschaulicht, wie unter dem Deckmantel der "Qualitätssicherung" das britische Gesundheitswesen zum Fordismus verkommt, weil es, extrem arbeitsteilig, einer Bürokratie verpflichtet ist und nicht mehr den Menschen im Fokus hat und postuliert seine die Ambivalenz des Begriffs "Qualität" (hierauf wird noch einzugehen sein). Der Leser wird in mittelalterliche Werkstätten geführt, in denen es anfangs keine Trennung zwischen Privatleben und Arbeit gab, bekommt Einblicke in die Trinität Meister-Geselle-Lehrling (und in die Ersatzvaterrolle des Meisters dem Lehrling gegenüber) und wird mit der Auseinandersetzung mit Fragen der Autorität und der Autonomie innerhalb der Werkstatt konfrontiert. Man geht mit den Gesellen, die sich anderswo zum Meister ausbilden lassen und wagt einen Blick in die Werkstätten Stradivaris, die nach dessen Ableben der unwiderbringliche Verlust des stillschweigenden Wissens (später, genauer, implizites Wissen genannt) untergingen. Niemand weiss bis heute genau, was die Musikinstrumente Stradivaris so einmalig macht – das Wissen hierum, nirgendwo festgehalten, ist auf immer verloren gegangen; etwas am Charakter ihrer Werkstätten muss den Wissenstransfer verhindert haben.
Geduld und heilsames
Scheitern Es gibt eine kleine Industriegeschichte des Glasbläserhandwerks, die Differenzen zwischen Handwerk, Kunstwerk (Kunstwerke sind Zeugnisse eines inneren Lebens) und Kunsthandwerk werden ausführlich dargelegt und dem Leser wird der Unterschied zwischen Spiegelwerkzeugen, Replikanten und Robotern erklärt. Sennett unternimmt eine kurze Kulturgeschichte des Ziegels, entwirft eine Chronik der Entwicklung vom profanen Schneidemesser bis zum Skalpell des Chirurgen, belehrt über die Zunahme der materiellen Güter seit dem 15. Jahrhundert und den sich hieraus ergebenden Konsequenzen für die Herstellung dieser Güter, führt den Leser zur französischen Papier- und Textilindustrie des 18. Jahrhunderts, entdeckt das "Erhabene" im Flachschraubenzieher, philosophiert über eine gebotene Mehrdeutigkeit in der Stadtplanung, vergleicht den Gebrauch der Hand beim Musiker, Glasbläser – und Koch, sinniert mit fast fernöstlichem Duktus über die Notwendigkeit des Handwerkers zur Geduld (Wenn etwas länger dauert als erwartet, höre auf, dagegen zu kämpfen!), referiert über die Differenz zwischen sozialem und antisozialem Expertentum, wettert gegen den alles nivellierenden und die Kreativität tötenden, individualfeindlichen Perfektionismus und lobt stattdessen das "heilsame Scheitern" (Montaigne), plädiert für die Langeweile…als Anreiz und regt zu Reflexion[en] über das Material an, die den unvollkommenen Ziegel als Ikone der Qualität erscheinen lassen. Sennett führt den Leser zum Museumsbau nach Bilbao, in den Peachtree Centre nach Atlanta, Georgia und vergleicht ausführlich die Architektur der Häuser, die Ludwig Wittgenstein und Alfred Loos in Wien Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut haben. Und das sind alles nur Ausrisse aus diesem so detailreichen Buch. "Handwerk" ist ein Kompendium gespickt mit Thesen, Lektüreeindrücken, Geschichten (und Geschichtchen), Verknüpfungen, Allegorien, Abschweifungen. Das ist an- und aufregend und bildend – aber auch gelegentlich (und leider mehr als man möchte) anstrengend und ermüdend. Sennetts weitschweifiges Mitteilungsbedürfnis, welches sich, wie man an den zahlreichen Fussnoten sehen kann, auf einer enormen Fülle von Lektüre stützt, erdrückt den Leser dann doch im einen oder anderen Fall, wenn die Exkurse dann Pirouetten drehen und zur Dekoration des angelesenen Wissens werden.
Unverständliche
Anleitungen Gerade letztere hebt er besonders hervor; eine kochende Bekannte, 1970 als Flüchtling aus dem Iran in die USA gekommen, pflegte diese Art von Beschreibung. Das Kochrezept klingt dann (zunächst) phantastisch: "Dein totes Kind. Erwecke es zu neuem Leben. Fülle es mit Erde. Sei vorsichtig! Es sollte nicht zuviel essen. Lege ihm den goldenen Mantel an. Und bade es. Wärme es, aber sei vorsichtig! Ein Kind stirbt von zu viel Sonne. Lege ihm die Juwelen an. Das ist mein Rezept." Tatsächlich wunderschön - und Sennett erläutert auch, was die einzelnen Formulierungen zu bedeuten haben. Aber als praktische Anleitung taugt dies auch nicht. Vorher beklagt Sennett zu Recht, dass zuviel implizites Wissen vorausgesetzt wird – aber das ist hier ja nicht anders. Bei einem vorherigen Beispiel empfahl er schon, das Entbeinen von einem Fachmann vornehmen zu lassen. Damit hätte sich die eingangs gestellte Frage erübrigt. Und am Ende weiss man immer noch nicht, wie Anleitungen aussehen und geschrieben werden können, die man auch tatsächlich "gebrauchen" kann. Der Leser bleibt – nicht nur hier – alleine gelassen. Trotz dieser gelegentlich fruchtlosen Verirrungen ist dieses Buch eminent lehrreich. Sennetts emphatischer Handwerks- und Handwerkerbegriff zeigt neue Aspekte auf, die man sonst in dieser Konzentration kaum geliefert bekommt. So wird eine Neudefinition des Begriffs der Routine vorgenommen, den er aus seiner negativen Konnotation "befreit" und in das weite Feld des "Übens" überführt, in dem sie zum Entwicklungsvorgang wird. Übung dient als Erlernen eines Rhythmus, der unweigerlich zum Handwerk dazugehört aber keinesfalls mit sturer Wiedergabe gleichgesetzt werden darf. Aber auch die Philippika gegen die Perfektion, die Versuch und Irrtum unterbinden und somit keine Innovationen und Neuentwicklungen zulassen, ist anregend, auch wenn Sennett Perfektionismus als Obsession in pathologische Gefilde überführt und als zwanghafte Störung rubriziert.
Plädoyer für das Chaos
und die sieben Leuchter Mit grossem Vergnügen wird dessen Plädoyer für das Chaos des Handwerkers, welches sinnvoll, ja notwendig ist, um seine Arbeitsverfahren besser zu verstehen und seine sieben Anleitungen oder "Leuchter" für den verwirrten Handwerker und für jeden, der direkt mit der Herstellung materieller Objekte arbeitet zitiert. Fünf der "sieben Leuchter" sind:
"der Leuchter der
Aufopferung": darunter versteht Ruskin (wie auch ich) die Bereitschaft, etwas um
seiner selbst willen zu tun, also Hingabe; Ruskins Ablehnung der Gegenwart, sein Eintreten für das leidenschaftliche Verlangen nach einem verlorenen Freiraum, in dem der Handwerker zumindest zeitweilig die Kontrolle verlieren darf, fasziniert Sennett. Dass er sich am Ende doch gegen Ruskins extreme Positionen wendet und nicht den Kampf gegen die Maschine, sondern in der Arbeit mit ihr die radikale emanzipatorische Herausforderung sieht (Sennett bezeichnet dies als aufgeklärtes…Verständnis), dürfte eher rationalen Erwägungen geschuldet sein. Im weiteren Fortgang des Buches werden durchaus - mal versteckt, mal offen - Thesen Ruskins von Sennett adaptiert.
Jeder kann ein guter
Handwerker werden Vereinfacht bedeutet das: Wer spielen kann, kann auch handwerken. Im weiteren Verlauf werden dann die gängigen multiple-choice Intelligenztests, die – so Sennett - problematisierendes Denken negativ bewerten und bei denen es keine Zeit zum Nachdenken gibt, zu Gunsten der Fähigkeit des Handwerkers in die Tiefe zu gehen verworfen. Damit soll von der Fixierung auf einen einzigen Wert wie beispielsweise dem Intelligenzquotienten abgerückt werden. Der Schluss, dass Menschen mit einem IQ von 85…durchaus mit denselben Problemen fertig werden wie die Masse der Intelligenteren ist allerdings kühn, auch wenn er mit der kleinen Einschränkung nur etwas langsamer versehen wird. Da kommt das zen-buddhistische Versuche nicht, das Ziel zu treffen! als romantisches Trostpflaster vielleicht gerade recht. Trotz der bereits erwähnten Detail- und Materialfülle, die sich allerdings häufig an Vergangenem orientiert, vermisst der Leser Aspekte des gegenwärtigen "globalen Handwerkens". Sennett konstatiert richtigerweise, dass mit dem technologischen Wandel seit Mitte des 19. Jahrhunderts für grosse Teilen der Arbeitnehmer nur die Alternative Dequalifizierung oder Entlassung blieb. Dieser Prozess dürfte in den Industrienationen inzwischen weitgehend abgeschlossen sein, d. h. eine weitere Freisetzung von Arbeitskräften durch neue Technologien ist in grösserem Rahmen im Handwerk nicht mehr zu erwarten (im Dienstleistungssektor mag dies anders aussehen). Daher wäre es in einer Schrift über das Handwerk durchaus notwendig gewesen zu zeigen, wie das "verbliebene Handwerk" aus ökonomischen Gründen nun sukzessive in sogenannte Billiglohnländer ausgelagert wird und welchen Einfluss dies auf die Herstellungsprozesse, die Produkte – und den "Konsum" hat. Die Achillesverse dieses Buches ist Sennetts fast kauzig-ablehnende Meinung über den Begriff der Qualität, der in die Nachbarschaft des so verteufelten Perfektionismus gestellt wird. Dabei ist in seiner am Ende vorgetragene Charakteristik des guten Handwerkers implizit so etwas wie Qualitäts- und Fortschrittsdenken angelegt. Nur weil "Qualität" zwischenzeitlich als Floskel durch die Werbeindustrie vereinnahmt und instrumentalisiert wurde, ist es nicht einzusehen, warum ein peinlich genaues, präzises und hochwertiges Arbeiten, erreicht durch Üben, durch gelegentliches Scheitern, durch "Versuch und Irrtum" – warum ein solch qualitativ hochwertiges Produkt fast dämonisiert wird. Ausgerechnet dieser Punkt bleibt von einer genaueren Erörterung ausgespart. Gregor Keuschnig Die kursiv gedruckten Passagen sind Zitate aus dem besprochenen Buch
Sie
können diesen Beitrag hier kommentieren:
Begleitschreiben |
Richard Sennett
|
|
|
Glanz@Elend
|
|||