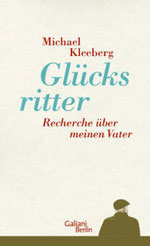|
Glanz&Elend Literatur und Zeitkritik |
|||
|
Home Termine Literatur Krimi Biografien, Briefe & Tagebücher Politik Geschichte Philosophie Impressum & Datenschutz |
|||
|
|
|||
|
|
Glücklich
ist, wer vergißt ...
Von Lothar Struck |
||
|
"Glücksritter" nennt Michael Kleeberg seinen neuen Roman. Roman? Der Untertitel verrät Anderes: "Recherche über meinen Vater". Eine Biographie? Nein, das ist es auch nicht. Vielleicht "Autofiktion"? Irgendwann hatte sich dieser Begriff für solch ein literarisch-biographisches Schreiben gefunden und hier scheint er zu passen. Unlängst hatte Klaus Kastberger bei einem Text zum Bachmannpreis versucht, (auto)biographisches Schreiben von seinem bisweilen negativen Image zu befreien. Er wies unter anderem auf die Schwierigkeiten dieser Gattung hin. Und tatsächlich: Schriftsteller, die es gewohnt sind, Fiktionen zu entwickeln, bekommen durch die "Geschichte", die sie erzählen wollen, sozusagen Grenzen gesetzt. Je weiter sie diese dehnen, desto größer wird der fiktionale Anteil, der zumeist vom Leser nicht beurteilt werden kann, weil er die Nuancen der Wirklichkeit nicht kennen kann. Dabei sind es zumeist die fiktionalen Anteile, die für den Schreibenden notwendig sind, um sich eine gewisse Distanz zu verschaffen. Diese fehlt in der Ausgangssituation häufig, weil der Stoff allzu persönlich ist. Und hier findet sich womöglich der Grund für den zweifelhaften Ruf solcher Art von Prosa: Entweder wird es anklagend bis jammernd. Oder es ufert in veritable Selbstbeweihräuchung des Erzählers aus. Man erfährt wahlweise wie schrecklich die Kindheit, der Vater/die Mutter, die Verwandten, die Gesellschaft waren und/oder wie man es schon mit zwölf oder dreizehn Dostojewski, Rilke oder Brecht gelesen hatte. Um es vorweg zu nehmen: Von dieser Art öder Selbstinszenierung ist "Glücksritter" meilenweit entfernt. Natürlich kommt Michael Kleeberg in diesem Buch vor – er macht keinen Hehl daraus und heißt schlichtweg Michael. Er ist der Ich-Erzähler. Die Familie, um die es geht, sind die Kleebergs. Aber er nimmt sich auch gleichzeitig zurück; eigentümlicherweise erfährt man über Michael relativ wenig, aber vom Vater (und der Mutter) sehr viel. Und das genau ist Absicht. Es beginnt 2011. Michael hat festgestellt, dass seine Eltern auf den sogenannten Nigeria-Trick hereingefallen sind. Sie hatten sich sogar 8000 Euro geliehen um an versprochene Millionen zu kommen. Nur noch ein Schritt, eine Einzahlung, sei man entfernt. Der Erzähler ist fassungslos und hier setzt das Nachdenken über diesen Mann ein, seinen Vater, und dessen Frau, die fast ertaubte Mutter. Beide waren damals 80 Jahre alt, aber beileibe nicht senil. Wie kann man darauf hereinfallen? Weil man glaubte, endlich mal an der Reihe zu sein, endlich mal Glück zu haben? Kleeberg holt in seinem Buch "Glücksritter" weit aus, geht zurück bis in die jeweiligen Elterngenerationen. Seine Recherchen bekommen im Oktober 2014, nach dem Tod des Vaters, neuen Schwung. Er befragt seinen betagten aber rüstigen Onkel, besucht einen Cousin, findet eine Cousine. Die Mutter ist zu diesem Zeitpunkt leider an Demenz erkrankt, aber sie hat schriftliche Aufzeichnungen hinterlassen. Und es gibt Briefe: So hatte sein Vater, Werner Kleeberg, um seine Ingrid schon um ihre Abiturzeit herum, 1952, geworben. Michael imaginiert die erste Zusammenkunft Ingrids mit der Familie Kleeberg. Man hielt sich für etwas Besseres, hatte vielleicht irgendwo einen adligen Vorfahren (genealogische Forschungen später brachten hierzu keine Erkenntnisse). Friedrich, Werners extrovertierter, zwei Jahre älterer Bruder, war der Wortführer der Familie. Aber Ingrid dürfte sich ebenfalls zunächst unwohl gefühlt haben. Denn auch in ihrer Familie pochte man auf einen gewissen sozialen Status. Die beiden heiraten dennoch schnell. 1959 wird Michael geboren. Die Mutter bleibt zu Hause. Die Familie zieht mehrmals durch die beruflichen Anstellungen des Vaters um (Bitz, Friedrichshafen, Böblingen, dann Hamburg). Er arbeitet in der EDV-Branche, verdiente 1964 immerhin 2300 Mark brutto im Monat. Der Versuch, sich selbständig zu machen, scheitert 1967. Er verliert 15000 Mark. Angeblich sind die anderen Anteilseigner schuld. Die Mutter gerät in Panik, redet von "Schuldturm", obwohl das Geld vorhanden war. War dies einer der Momente als der Vater beim Sohn (damals acht Jahre alt) für lange Zeit so etwas wie die Würde verloren hatte? Egal, Werner findet eine Neuanstellung. 1971 wird er bei der Besetzung eines Abteilungsleiter-Postens übergangen. Ein "Doktor" wird ihm, der eigentlich drangewesen wäre, vorgezogen. Eine Kränkung, die seinen Minderwertigkeitskomplex (er hatte "nur" Volksschule) verstärkt. Ja, er war vertrauensselig, ehrlich, anständig. Fachlich ohne Makel. Aber er "war unbeliebt bei den Mitarbeitern, von denen er zu viel verlangte, und er war blind gegenüber den Hierarchien des Unternehmens und den für den eigenen Erfolg." Werner war ein Eigenbrötler, konnte nicht führen, weil er meinte, alles besser zu können. An den verhältnismäßig raschen Wechseln der Automobile zeigte sich der ökonomische Aufstieg. Aber es gab immer wieder Rückschläge. Als er sich eine Eigentumswohnung kaufte und diese vermietete, geriet er an einen Mieter, der nicht zahlte und den er erst kostspielig herausklagen musste. Nach zwei Jahren gelang dies – in dieser Zeit hatte er drei Monatsmieten erhalten. "Pech wieder einmal, oder aber eben die Blindheit meines Vaters in der Beurteilung von Menschen, die ihn unfähig machte, irgendjemanden richtig einzuschätzen oder zu durchschauen." Es gab Rachegelüste, "das Bedürfnis nach Revanche und die Konsequenz, dass nach jedem solchen Pechfall der Anspruch auf Glück stieg." Und dann schien alles passend: 1973 bekam er eine Abteilungsleiterstelle, dotiert mit monatlich 3800 Mark brutto. Aber nur für sechs Monate. Dann wurde er entlassen; warum, bleibt nebulös. Zwei Jahre später ging es berufsbedingt weit in den Norden, nach Hamburg-Großhansdorf. Die Umstände des Grundstückskaufs und Hausbaus werden genau beschrieben. Aber auch hier hat Werner Pech: Die Branche wandelt sich, er wird arbeitslos – und das mit Anfang 50. Die Aufstiegsgeschichte war endgültig vorbei. In dieser Zeit muss er umschulden. Die Hypothekenzinsen waren auf 11% gestiegen. Noch 2011 war die Immobilie nicht abgezahlt. Die bezahlte Preis für die Immobilie wird am Ende um das zweieinhalbfache höher sein als die ursprüngliche Kalkulation. In seiner Branche gibt es keine adäquaten Arbeiten für ihn mehr. Er verändert sich beruflich, wird Versicherungsvertreter. Eine Arbeit, die maßgeschneidert für ihn ist und ihm wider Erwarten gefällt. Er nimmt endlich kein "Bellergal" mehr (ein Barbiturat). Werner, "Deutschlands einziger ehrlicher Versicherungsvertreter. Zumindest der einzige, dessen Kunden im Schadensfall wirklich manchmal etwas von ihrer Versicherung kriegen." Aber es braucht Jahre, um auskömmlich davon leben zu können. Rücklagen können nicht gebildet werden, aber zum Leben reichte es. Und für die Unterstützung von Michael und seines Studiums ebenfalls. Er war der "große Diskrete", der "Geheimnistuer". War es Diskretion, Distanz oder doch eher Gleichgültigkeit? Seine Menschenkenntnis ging oft genug von seinem eigenen Ethos aus. Ein Blick ins Männerauge, Handschlag – und alles war besiegelt. Nicht immer war das erfolgreich. Freunde hatte die Familie eigentlich keine. Einige duzte man. Aber Freunde? Er ließ niemand an sich heran. "Familie waren nur wir drei", konstatiert der Sohn. "Wir waren uns genug." Der Onkel und das "schwarze Schaf", die Schwester Elfriede, waren Verwandte. Wer war dieser Mann? Was hat er erlebt in den Kriegsjahren. Kinderlandverschickung für ein oder zwei Jahre, Schulzeugnis mit 14 – und dann, 1945, im Chaos des Zusammenbruchs lässt man ihn alleine nach Hause. Vom Westerwald bis nach Frankfurt. Menschen, die nur sich selber kennen, keine Rücksicht auf das Kind mit dem Pappköfferchen nehmen. Bahnhofsphobie zeit seines Lebens. Eindrucksvoll wie Kleeberg dies evoziert. Parallel die Familie der Mutter. Eine unglaubliche Empathielosigkeit dort, wie die Nachforschungen ergeben. Hinzu kommen die Aufzeichnungen der Mutter zur "Reichskristallnacht", nach einem Bombenangriff; die Toten auf den Straßen. Akribisch werden diese Erlebnisse, die zu dauerhaften Prägungen werden, rekonstruiert. Subkutan bleibt, so ist der Erzähler überzeugt, der Vater für den Rest des Lebens "infiziert" mit Goebbels' Propaganda. Verharmlosungen, Relativierungen, kleine Lügen. Die Geschichte von der Jüdin in Frankfurt, die unbehelligt auf der Bank sitzen durfte, lässt er von einem Stadthistoriker prüfen: Es kann nicht so gewesen sein. Kleeberg entschlüsselt den "unpersönlichen Antisemitismus" seines Vaters. Nicht rechthaberisch, nicht richtend, aber sorgfältig. Und er entdeckt bei sich selber eine Form "rassistischer Herablassung", als er von einer Begegnung mit Polen über deren Freundlichkeit und Klugheit spricht – etwas, was er von Italienern oder Franzosen niemals derart betonen würde. Als hätte sich dies ein wenig vererbt. Die Generation der um 1930 Geborenen waren Kinder von traumatisierten, die meist nichts von ihren Deformationen wussten. Sie waren Frontkämpfer gewesen, hart gegen sich selbst und ihren Kindern. Und diese erlebten dann abermals eine "heillose Zeit", voll mit Indoktrination. Eine "Jugend ohne Gott" (Ödön von Horváth) wuchs heran. Plötzlich wird eines der beiden Motti des Buches klar, der Ausschnitt aus Hitlers "Reichenberger Rede" von 1938: "Und sie werden nicht mehr frei ihr ganzes Leben – und sie sind glücklich dabei." Das erste wurde für viele furchtbare Realität bis hinein ins Alter – das Glücklichsein hingegen ist ein schrecklicher Zynismus. Sieben Jahre danach war die "Tektonik der Welt" zerstört. "Wohin ging das Trauma, die Wut, der Hass, die Verunsicherung dieser Opfergeneration?" Einer Generation, die verdrängte. Es ging an den Wiederaufbau. "Es gab keinen Burn-out und keine Arbeitsverweigerung, im Gegenteil, einen nie dagewesenen Fleiß und übermenschliche Disziplin. Und es war auch keine Generation von Trauerklößen. Sie konnten lachen, sie konnten feiern, sie lebten wieder wie andere." Eines konnten sie schlecht: Trauern. Aber man "musste ja leben", so sagt es Onkel Friedrich einmal. Rar die glücklichen Momente mit dem Vater. Und umso kostbarer. Der Bau von Drachen im Herbst etwa, mit einer endlos langen Schnur. Wobei der Vater alles alleine machte und der Sohn zum Zuschauen verdammt war. Oder der Vater als Geschichtenerzähler (auch das eine Prägung durch den Krieg, wie sich später herausstellt). Er zeichnete sogar Comics für seinen Sohn. Aber es gab auch Prügel. Interessant, wie der Erzähler Kleeberg dieses damals durchaus übliche Strafen als "Grenzverlauf des Bildungsniveaus" entwickelt. Immer tiefer bohrt sich der Erzähler in die Biographie. Was war das "Rosebud"-Erlebnis des Vaters? Wo war die Idylle der Kindheit? Es gab keine. Oder, genauer: er findet keine. Aber ist nicht diese Suche vielleicht schon falsch oder übergriffig? Kleeberg ist ehrlich, auch mit sich selber. Warum schämte er sich bisweilen für seinen Vater? Hatte er die Dünkel, die der Vater so hasste? Kleeberg weiß, dass mit der heutigen Sicht die Urteile leicht, alles andere als gerecht sind. All die mühsam gefundenen Fakten und die Schlüsse hieraus bleiben Spekulation. Ganz zum Schluss findet er dann doch noch ein Szenario, in dem der Vater aufblühte und die vielleicht glücklichsten Augenblicke abseits der Familie erlebte. Es war in einer Schankstube im Wald mit zwei entfernten Verwandten und diese Mischung aus dem "Gran Bedauern" und dem "Schimmer Erleichterung" wenn er vom Kind Michael zum Essen gerufen wird und gehen soll. Fast eine Versöhnung mit dem Leben. Bedingt durch den Umzug vom Haus in eine Wohnung verpasst Werner eine Krebsvorsorgeuntersuchung. Als die Krankheit dann diagnostiziert wird, gibt es bereits Metastasen. Abermals vermischen sich Pech und Tragik. In den letzten Monaten hat sich der Vater mit dem Sohn als Schriftsteller halbwegs versöhnt. Und vice versa. Aber sterben wollte er alleine. So, wie er eigentlich auch gelebt hat. Der Titel "Glücksritter" ist die einzige ironische Volte des Buches. Ansonsten ist der Ton behutsam, dem Subjekt seiner Neugier zugewandt, suchend, weder anklagend noch exkulpierend. Es gibt nichts zu enthüllen, aber einiges zu entdecken. Und gerade dahin liegt die Freiheit dieser Prosa, die sich verweigert, etwas zu "zeigen", zu "demaskieren" oder anzuklagen. Stattdessen wird erzählt und manchmal auch heraufbeschworen. Wer Kleebergs Generation angehört, wird so manches wiedererkennen. Und einiges neu sehen. En passant gelingen unterschwellig interessante Generationenskizzen, wie man sie ähnlich beispielsweise in Kleebergs "Karlmann"-Romanen schon kennt. Ja, "Glücksritter" ist ein wunderbares, ein zutiefst wahrhaftiges, grandioses Buch.
Artikel online seit 20.08.20 |
Michael Kleeberg |
||
|
|
|||