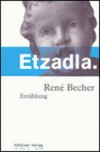|
Belletristik
Romane, Erzählungen, Novellen & Lyrik
Blutige Ernte
Krimis, Thriller & Agenten
SF & Fantasy
Elfen, Orcs & fremde Welten
Quellen
Biographien, Briefe & Tagebücher
Geschichte
Epochen, Menschen & Phänomene
Politik
Theorie, Praxis & Debatten
Ideen
Philosophie & Religion
Kunst
Ausstellungen, Fotobücher & Bildbände
Tonträger
Hörbücher & O-Töne
Videos
Literatur in Bild & Ton
Literatur Live
Veranstaltungskalender
Zeitkritik
Kommentare, Glossen & Essays
Autoren
Porträts, Jahrestage & Nachrufe
Verlage
Nachrichten, Geschichten & Klatsch
Film
Neu im Kino
Klassiker-Archiv
Übersicht
Shakespeare Heute
Shakespeare Stücke
Goethes Werther,
Goethes Faust I,
Eckermann,
Schiller,
Schopenhauer,
Kant,
von Knigge,
Büchner,
Mallarmé,
Marx,
Nietzsche,
Kafka,
Schnitzler,
Kraus,
Mühsam,
Simmel,
Tucholsky
Die aktuellen Beiträge werden am
Monatsende in den jeweiligen Ressorts archiviert, und bleiben dort
abrufbar.
Wir empfehlen:



Andere
Seiten
Diskutieren Sie
mit Gleichgesinnten im
FAZ Reading Room
Joe Bauers
Flaneursalon
Gregor Keuschnig
Begleitschreiben
Armin Abmeiers
Tolle Hefte
Bücher-Wiki
Literaturportal von Jokers
deutsches literatur archiv marbach
Literaturportal
Curt Linzers
Zeitgenössische Malerei
Goedart Palms
Virtuelle Texbaustelle
Alf Poier
Genie & Wahnsinn
Reiner Stachs
Franz Kafka
counterpunch
»We've
got all the right enemies.«
telepolis
fängt da an, wo andere
Magazine aufhören
ZIA
Die Zentrale Intelligenz Agentur ist ein
kapitalistisch-sozialistisches
Joint Venture mit dem Anspruch, neue Formen der Kollaboration zu
etablieren.
Riesensexmaschine
Nicht, was Sie denken?!
texxxt.de
Community für erotische Geschichten
Wen's interessiert
Rainald Goetz-Blog
Bookmarks

 |
René
Becher, geboren 1977 in Bayreuth. Studium Germanistik, Geschichte und
Buchwissenschaften in Mainz und Düsseldorf. Studium am Deutschen
Literaturinstitut Leipzig. 2004 Preisträger beim Berliner
Open-Mike-Literaturwettbewerb. Im Frühjahr 2008 erscheint im Leipziger
Plöttner Verlag seine Erzählung Etzadla. Er lebt und arbeitet als freier
Autor in Bayreuth.
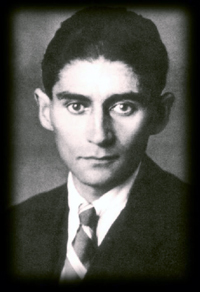 K
wie Klaustrophilie K
wie Klaustrophilie
Essay über Kafkas Schreiben
Irgendwann musste dieser Schreiber lebenslänglich bekommen haben. Und dann
machte dieser Schreiber sich dieses Schicksal einfach zu Nutze. Dieser
Schreiber schrieb. Er zwang
sich. Er musste sich zwingen. „Gott will nicht, daß ich schreibe, ich aber,
ich muß“1, eröffnet er bereits 1903 Oskar Pollak, und lässt nicht mehr davon
ab, trotzdem er zeitlebens der Zweifler bleibt. Er spricht von seiner
„Unfähigkeit zu schreiben“.2 Er sagt,
dass er „keine Zeile gemacht“3 habe, die er anerkenne.
Stattdessen streicht er immer wieder durch und setzt neu an. Fehler sind
alles andere als schrecklich. Sie sind unverzeihlich. Er setzt also neu an,
kämpft erneut an gegen eine nicht sichtbare Macht, die ihn an seinen
Schreibtisch fesselt. Diesen unwissend verurteilten Schreiber.
Dieser Schreiber ist nie zufrieden. Das schon frühe Zuwidersein, die eigenen
Texte betreffend, zieht sich wie ein roter Faden durch sein Wirken. „Der
größte Teil ist mir widerlich, das sage ich offen (...)“, so der Schreiber
kaum zwanzigjährig an Pollak, „es ist mir unmöglich, das ganz zu lesen
(...).“4 Wenig ändert sich bis zu seinem Tod am 3. Juni 1924. Er hat Phasen,
in denen er sich als Schriftsteller sieht. Und er hat Phasen, in denen ihm
alles aus dem Ruder läuft. Sein Wirken ist
eine einzige Selbstbestimmung, eine einzige Selbstbehauptung immer und immer
wieder. In den Briefen und nicht zuletzt in den Tagebüchern findet er
Zuflucht. Hier spricht er vom Nichtschreibenkönnen, vom stundenlangen Sitzen
am Schreibtisch, von seinen Zweifeln und Ängsten.
Aber es gibt auch Momente, in denen er an seine Fähigkeiten glaubt. Es sind
die Momente der völligen Hingabe, der völligen ungestörten Selbstaufgabe
tatsächlich. Diesen Moment hat er wohl zum ersten Mal in der Nacht auf den
23. September 1912, als er Das Urteil „in einem Zug“ schreibt. „(...)
Die fürchterliche Anstrengung und Freude, wie sich die Geschichte vor mir
entwickelte, wie ich in einem Gewässer vorwärtskam (...).“5 Dann der letzte
geschriebene Satz, der Gang zu den gerade aufgewachten Schwestern, der erste
Vortrag. „Nur so kann geschrieben werden“, erklärt er, „nur in einem
solchen Zusammenhang, mit solcher vollständigen Öffnung des Leibes und der
Seele.“6 Er stellt seine Ausdauer unter Beweis, sagt gegenüber Max Brod:
„Weiß du, was der Schlußsatz bedeutet? – Ich habe dabei an eine starke
Ejakulation gedacht.“7 Sein Urteil – ein hinausgezögerter Orgasmus.
Im selben Jahr schreibt, oder besser: ejakuliert er auch Die
Verwandlung.
Aber er bleibt unbeständig, trotz der
Urteilserfahrung:
Entweder kommt er zu früh oder gar nicht. Wie bei seinem Romanvorhaben
Amerika zu Beginn des Jahres 1912. „Der Roman ist so groß, wie über den
ganzen Himmel hin entworfen (...) und ich verfitze mich beim ersten Satz,
den ich schreiben will.“8
Amerika
bleibt Fragment, wie
auch Das Schloss, wie auch Der Proceß. Und wieder die
Ungewissheit, der Zweifel.
Er lässt die Freunde daran teilhaben. Schreibt ihnen den Literaturprozess
begleitende Briefe. An Felice: „(...) Eine solche Geschichte müßte man
höchstens mit einer Unterbrechung in zweimal 10 Stunden niederschreiben,
dann hätte sie ihren natürlichen Zug und Sturm, den sie vorigen Sonntag in
meinem Kopfe hatte.“9
So wie das Leben durfte auch das Schreiben keine Pause erfahren, befindet
er. Schon wieder dieses Durchschreiben. Alles andere wäre Schwäche. „Schade,
dass in manchen Stellen der Geschichte deutlich meine Ermüdungszustände und
sonstigen Unterbrechungen und nicht dazugehörige Sorgen eingezeichnet sind
(...).“10 Dieser Schreiber ist oft müde. Tagsüber arbeitet er in der
Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt. Nachts dann sitzt er am heimischen
Schreibtisch, „die ungeheuere Welt“11 im Kopf.
Das ist sein Schicksal. „Vielleicht gibt es auch ein anderes Schreiben“,
räumt er ein, weiß aber: „Ich kenne nur dieses; in der Nacht, wenn mich die
Angst nicht schlafen lässt, kenne ich nur dieses.“12
Seine Prosa ist Stillstandsprosa. Ich denke an den Landvermesser K., der
versucht, ins Schloss zu gelangen, aber - wie auch anders - es gelingt ihm
nicht. Ein Sich-im-Kreise-Drehen, ein Auf-der-Stelle-Treten, das ist Kafka.
Ein Traum, der sich in die Länge zieht, scheinbar endlos dahinzieht,
irgendwann ist Schluss, ohne Auflösung, manchmal mitten im Satz. Seine
(angefangenen) Geschichten sind wie aufgerichtete „Pferde vor dem
Zirkusdirektor“13, sie starren „bis morgen nacht zum Himmel“14. Der Text,
das ist Kafka. Er kann sich gar nicht von dem lösen, was er da schreibt.
„Ich habe kein literarisches Interesse“, versichert er, „sondern bestehe aus
Literatur (...).“15
In seiner Erzählung Das Urteil heißt der Protagonist Bendemann. An
Felice schreibt er: „(...) Sieh nur die Namen! (...) Georg hat so viel
Buchstaben wie Franz, ‚Bendemann’ besteht aus Bende und Mann, Bende hat so
viel Buchstaben wie Kafka und auch die zwei Vokale stehn an gleicher Stelle
(...).“16 Im selben Brief beteuert er sein Nichtwissen um diese
Merkwürdigkeit während des Verfassens. Einen Monat später – die Verwandlung
entsteht – ähnlich Merkwürdiges. Der
Protagonist trägt den Namen Gregor Samsa. Samsa: So viele Buchstaben wie
Kafka und die Vokale stehen an selber Stelle. Fand dieser Schreiber etwa
Gefallen an der Selbststilisierung in den eigenen Texten? Oder geschah hier
tatsächlich etwas unbewusst? Man muss ersteres vermuten, zumal er immer
wieder Figuren in Erscheinung treten lässt, die sich, lakonisch wie sein
Stil, einfach nur K. nennen (Der Prozess, Das Schloss). Im Gespräch mit
Gustav Janouch erklärt (und gesteht) er: „Samsa ist nicht restlos Kafka. Die
Verwandlung ist kein Bekenntnis, obwohl es – im gewissen Sinne – eine
Indiskretion ist.“17 Nein, diese Literatur ist keine Bekenntnisliteratur.
Bei diesem Schreiber handelt es sich um eine Literatur der absoluten
Notwendigkeit. Indiskretion ist hier unvermeidlich. Er schont weder sich
selbst, noch sein Umfeld. Wie sehr es sich bei diesem Schreiben um ein
authentisches Schreiben handelt, mag uns vielleicht das Prosastück, oder
vielmehr die Veröffentlichungsgeschichte des Prosastücks Großer Lärm
zeigen.
Zunächst gedacht als Tagebucheintrag. Im Oktober des folgenden Jahres dann
wurde dieser Eintrag in den Prager Herder
Blättern
veröffentlicht. Wenig
später schickt er Felice diesen Text und schreibt hinzu: „Nein, ganz
zurückgezogen von meiner Familie lebe ich nicht. Das beweist die beiliegende
Darstellung der akustischen Verhältnisse unserer Wohnung, die zur wenig
schmerzlichen öffentlichen Züchtigung meiner Familie gerade in einer kleinen
Prager Zeitschrift erschienen ist.“18
Was mir
fehlt, ist Zucht (...).19
Irgendwann muss dieser Schreiber zu der Erkenntnis gelangt sein, dass sein
Schreiben ein isoliertes zu sein hat. Und so beschloss dieser Schreiber
fortan aus einer Isolation heraus zu schreiben. „Ich muss viel allein sein“,
führt er an, „was ich geleistet habe, ist nur ein Erfolg des Alleinseins.“20
Wenn wir an Schriftsteller denken, denken wir dann nicht auch sofort an die
Einsamkeit? Dieser Schreiber geht darüber hinaus: „Ich brauche zu meinem
Schreiben Abgeschiedenheit, nicht wie ein Einsiedler, das wäre nicht
genug, sondern wie ein Toter. Schreiben in diesem Sinne ist ein tieferer
Schlaf, also Tod, und so wie man einen Toten nicht aus seinem Grabe ziehen
wird und kann, so auch mich nicht vom Schreibtisch in der Nacht.“21 So
bitter diese Aussage, wer möchte bei ihm an ihr zweifeln? Dieser Schreiber
geht mit dem Schreiben und das Schreiben geht mit ihm. Das Schreiben sei
seine „einzige innere Daseinsmöglichkeit“22, so Kafka einmal an Felice.
Es gibt diese Autoren des Rückzugs. Proust beispielsweise, der 1905 nach dem
Tod der Mutter in sein mit Kork isoliertes Zimmer flüchtete, dort seine
verlorene Zeit fand und abschloss. Oder Flaubert (den Kafka auch las),
der 1864 den Rückzug suchte.
Kafka ist ein Stubenschreiber. Nennen wir es Klaustrophilie. Der Rückzug
nach der Arbeit in die Enge, in den geschlossenen Raum wirkt sich auf sein
Schreiben aus. „Oft dachte ich schon daran, dass es die beste Lebensweise
für mich wäre, mit Schreibzeug und einer Lampe im innersten Raume eines
ausgedehnten, abgesperrten Kellers zu sein.“23 Ein verlagerter armer Poet,
denkt man vielleicht. Aber das wäre ja Verklärung.
Heute pilgern wir in die Prager Alchimistengasse, schauen, wie dieser
Schreiber so tickte, oder vielmehr: Warum er so tickte? Ja, das ist Enge,
Isolation, da lässt es sich gut ausbrechen, denkt man dann in Haus
Zweiundzwanzig, leicht gebückt stehend. Ein Prager Freund erzählte mir
einmal, wir liefen zum Hradschin, dass dieser Schreiber tatsächlich nie in
dieser Wohnung gelebt habe. Es sei schlichtweg eine Erfindung für Touristen,
so er allen Ernstes. Ich glaubte ihm und war sehr enttäuscht. Später bei
einem Glas Bier fragte ich ihn, welcher Schriftsteller für das Prager
Selbstverständnis am Bedeutendsten sei, und glaubte, die Antwort schon zu
wissen. Als der Freund dann aber von einem Jaroslav Hasek murmelte, traute
ich mich nicht mehr einzulenken und schwieg.
Und er lebte doch in Haus Zweiundzwanzig. Ich habe mich nach meinem
Prag-Besuch schlau gemacht. Es ist seine vierte (und nicht einmal letzte)
Wohnung in Prag, wo er schlussendlich Ruhe zu finden glaubt, Ruhe vor den
zugeschlagenen Türen und dem großen Lärm der Hausbewohner: „Schon früher
dachte ich daran (...), ob ich nicht die Türe bis zu einer kleinen Spalte
öffnen, schlangengleich ins Nebenzimmer kriechen und so auf dem Boden meine
Schwester und ihr Fräulein um Ruhe bitten sollte.“24 Überempfindlichkeit,
auch dafür steht Kafka.
Die wichtigsten Texte dieses Schreibers spielen oder beginnen in einem
Zimmer. „(...) Georg Bendemann, ein junger Kaufmann, saß in seinem
Privatzimmer (...)“25, so startet Das Urteil. Aus der
Verwandlung:
„Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich
in seinem Bett zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt (...).“26 Und
Josef K.’s Verhaftung im Proceß findet ja in dessen Wohnung statt.
Die Türen sind nie verschlossen. Diese Isolation bedarf gar keiner
verschlossenen Türen. Diese Isolation begleitet dich durch das Treppenhaus,
hinaus auf die Straße, durch die Gassen. Neben dem (isolierten) Raum in
Kafkas Werk gibt es die Figur des Vaters, die unnahbare Autorität, Symbol
für Macht und Unterdrückung. Diese Figur findet sich in den wichtigsten
Texten Kafkas – von der Verwandlung bis zum Schloss. Hier haben wir dieses
Anschreiben gegen diese Autorität in der Literatur, diese Bewältigung im
Text. Es wäre nicht Kafka, würde das Individuum über den Machtapparat
siegen. Wir haben es mit verzweifelten Helden zu tun. Ein verzweifelter Held
– so muss auch Kafka sich gesehen haben. Und das macht seine Literatur zur
modernen.
Ich habe immerfort eine Anrufung im Ohr:
‚Kämest du, unsichtbares Gericht!’27
Irgendwann muss dieser Schreiber bemerkt haben, dass Schmerz Freude
bereitet. Und dann konnte dieser Schreiber wohl nicht mehr davon ablassen,
wollte immer mehr und mehr und trieb sich durch seine Literatur. „Ja“,
gesteht er, „das Foltern ist mir äußerst wichtig, ich beschäftige mich mit
nichts anderem als mit Gefoltert-Werden und Foltern.“28 Das ist schon
rigoros. Er lässt sich im seinem Proceß, auf dem Boden liegend,
durchprügeln. In der Strafkolonie guckt er zu, wie der Verurteilte
auf diesen „eigentümlichen Apparat“29 gelegt wird. Der
Handelsvertreter Samsa wacht als ungeheueres Ungeziefer auf.
Im Schloss stirbt K. vor Entkräftung.30 Ein gnadenloser Schreiber
ist er. Gnadenlos gegen sich selbst tatsächlich. „Ich werde mich nicht müde
werden lassen. Ich werde in meine Novelle hineinspringen und wenn es mir das
Gesicht zerschneiden sollte.“31 Und der Gnadenlosschreiber springt. Immer
und immer wieder.
Das Thema Schreiben in dieser Literatur: „Weißt Du wenn ich so etwas
hinschreiben will wie das folgende, nähern sich schon die Schwerter, deren
Spitzen im Kran mich umgeben, langsam dem Körper, es ist die vollkommenste
Folter; wenn sie mich zu ritzen anfangen, ich rede nicht vom einschneiden,
wenn sie mich also nur zu ritzen anfangen ist es schon so schrecklich dass
ich sofort, im ersten Schrei, alles verrate, Dich, mich, alles.“32 Und in
der Strafkolonie: „Zitternd sticht sie (Anm.: die Egge) ihre Spitzen in den
Körper ein (...).“33 Die „vollkommenste Folter“ also. Dieser Schreiber liebt
den Schmerz. Wo noch? Wo noch lässt er Schwerter, Nadeln, Messer sausen? Im
Proceß sind wir Zeugen von K.’s endgültiger Verurteilung. Und er
schreibt: „(...) an K.’s Gurgel legten sich die Hände des einen Herren,
während der andere das Messer ihm ins Herz stieß und zweimal dort drehte.“34
Und immer wieder in den Tagebuchnotizen: „Jedes Wort, gewendet in der Hand
der Geister (...), wird zum Spieß,
gekehrt gegen den Sprecher.“35 Auch in den Briefen. An Brod: „(...) wenn ich
den Zwang zum Schreiben in mir fühlen würde, (...) wie für einen Augenblick
in Stresa, wo ich mich ganz als eine Faust fühlte, in deren Innern die Nägel
in das Fleisch gehen (...).“36 Schreiben für ihn – eine Tortur. Eine
lustvolle Tortur, die unabdingbar ist. Das Schreiben als stete schmerzhafte
Erfahrung, die gemacht werden muss (Im Übrigen schrieb Kafka mit der Feder).
Dieser Schreiber erscheint uns heute als ein Schreiber, der sich selbst
geißelte, der sich selbst Isolationshaft auferlegte, der sich zwang, in der
Nacht nachzusitzen. Er schrieb aus sich heraus, beinahe völlig distanzlos.
„Mir immer unbegreiflich, daß es jedem fast, der schreiben kann, möglich
ist, im Schmerz den Schmerz zu objektivieren (...).“37 Dies bleibt ihm
zeitlebens ein Rätsel. Kafka schreibt - und leidet.
Ende des
Schreibens. Wann wird es mich
wieder aufnehmen?38
Wieder zu schreiben versucht, fast nutzlos.39
Vollständige
Stockung. Endlose Quälerei.40
Und schließlich hat dieser Schreiber für sich erkannt, dass seine Literatur
eine Scheiterhaufenliteratur ist. Und dann hat dieser Schreiber seinen
Freund Max Brod darum gebeten, alles „restlos und ungelesen zu
verbrennen“41.
1 Kafka, Franz:
Briefe 1902-1924, S.21
2
Kafka, Franz: Tagebücher
1910-1923, S.11
3
Briefe, S.85
4
Brod, Max: Über Franz
Kafka, S.58
5
Tagebücher, 214
6
ebd.
7
Über Franz Kafka, S.114
8
Briefe, S.96
9
Kafka, Franz: Über das
Schreiben, S.53
10
ebd., S.55f.
11
Tagebücher S.224
12
Briefe, S.384
13
Tagebücher, S.332
14
Über das Schreiben, S.55
15
ebd., S.137
16
ebd., S.24
17
Über das Schreiben, S.60
18
ebd., S.13
19
Über Franz Kafka, S.58
20
Tagebücher, S.228
21
Über das Schreiben, S.135
22
ebd., S.133
23
ebd., S.131
24
Tagebücher, S.104
25
Kafka, Franz: Die
Erzählungen und andere ausgewählte Prosa, S.47
26
ebd., S.96
27
Tagebücher, S.25
28
Kafka, Franz: Briefe an
Milena, S.244
29
Die Erzählungen, S.164
30
vgl. Über das Schreiben,
S.102
31
Tagebücher, S.21
32
Briefe an Milena, S.197
33
Die Erzählungen, S.173
34
Kafka, Franz: Der Proceß,
S.241
35
Tagebücher, S.429
36
Briefe, S.90
37
Tagebücher, S.387
38
ebd., S.334
39
ebd., S.336
40
ebd., S.336
41
Über das Schreiben, S.153
Literaturverzeichnis
Kafka, Franz: Die Erzählungen und andere ausgewählte Prosa,
Roger Hermes (Hrsg.), Frankfurt/Main 2000
Kafka, Franz: Der Proceß, Frankfurt 2002
Kafka, Franz: Über das Schreiben, Erich Heller/Joachim Beug
(Hrsg.), Frankfurt 1983
Kafka, Franz: Tagebücher 1910–1923, Max Brod (Hrsg.),
Frankfurt 1976
Kafka, Franz: Briefe an Milena, Max Brod (Hrsg.), Frankfurt 1975
Kafka, Franz: Briefe 1902-1924, Frankfurt 1975
Brod, Max: Über Franz Kafka, Frankfurt 1977
|
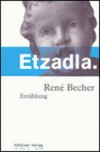
René Becher
Etzadla
Erzählung
Plöttner Verlag, Leipzig
128 Seiten
ISBN
978-3-938442-42-5
|


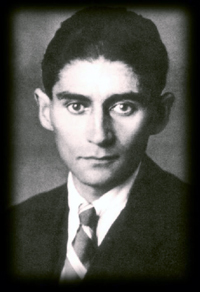 K
wie Klaustrophilie
K
wie Klaustrophilie