Seite
1
2
3
Hannes Opel
Kritik des Rausches
Der dritte Raum
Michel Foucault, der die Konstruktionen der Welt in sprachlich artikulierte Verständnisse von Wahrheit unter kultureller und zeitlicher Dimension zerlegt, gibt das notwendige Vokabular an die Hand. Wir können das Ich und das Nicht-Ich als zwei getrennte, sich jedoch bedingende Räume verstehen. So hätten wir die Eingangs skizzierte Konstellation: Das Bewusstsein als einzig mögliches Verständnis, sozusagen als Heim des Ich, und das Äußere als Chaos. Der Rausch ist nun als ein dritter Raum vorstellbar, der sich zwischen den ersten beiden bewegt.
Dieser Raum ist dynamischer Vermittler und tritt reflexiv und produktiv bedingend für die beiden anderen auf. Indem er sich auf den Unbewussten Raum zu bewegt, wirkt der Rausch reflexiv auf das Bewusstsein, da er mit dem Ich zu spielen beginnt, und indem er schließlich wieder zum Ich zurückkehrt wirkt er produktiv, da er das Ich bzw. seine Welt immer wieder neu zusammensetzt.
Ein Vergessen als Beweis
Denkt man den Rausch auf diese Art, ist er nicht nur von wertend-weltlichen Diskursen befreit, sondern tritt durch das reflexiv-produktive Spiel gleichzeitig zersetzend und erschaffend auf. Diese starke These macht den Mut zu Denkabenteuern und eine Bereitschaft zum Mitspielen notwendig.
Indem sich die konstruierte Begrifflichkeit des Rausches in einem ästhetischen Prinzip auflöst, lässt sich die ursprüngliche Bedeutung des Begriffs nun wiederum gegen das Bewusstsein richten. So erfüllt gerade das Bewusstsein, die bedingungslose Illusion der eigenen Identität in der Welt, alle Qualitäten eines Rauschzustandes. Ein Subjekt, so massiv der Ich-Sucht verfallen, dass es sich seine Existenz ohne „Selbst“ weder vorstellen kann noch will.
Nietzsche hat dieses Problem sehr treffend in seinem Essay „Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn“ verdeutlicht. Das Ich entwirft die Welt und beginnt dann, das Vergessen der eigenen Urheberschaft zu kultivieren, so dass es nach einiger Zeit diese wiederum als Beweis der eigenen Existenz heranziehen kann.
Im heutigen virtuellen Zeitalter wird ein solches Vergessen auf die Spitze getrieben, da eine bereits verwaltete Welt durch das Übersetzen in eine technische Sprache den Menschen als Schöpfer etabliert, der doch eigentlich durch die Transformation dieser Welt in den Tiefen seines Ich-Wahns verschwindet. Dadurch kommt also ein erschwerender Faktor hinzu, denn durch die vielfache Übersetzung des Bewusstseins, muss dieses, bevor es in den beschriebenen Diskurs eintreten kann, erst einmal zu „sich“ zurückfinden.
… zurück «
» weiter …
Seite
1
2
3
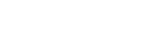
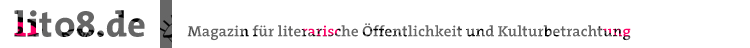




![Michel Foucault: Die Ordnung der Dinge [Copyright (c) Suhrkamp Verlag]](opel-kritik-des-rausches-foucault.jpg)

![Alexander Kupfer: Die künstlichen Paradiese [Copyright (c) J. B. Metzler Verlag]](opel-kritik-des-rausches-kupfer.jpg)