|
Seite 1 2 Glücklich drogentotIn Clemens Meyers Debütroman „Als wir träumten“ wird problemstadtteiladäquat geraucht, getrunken, geprügelt und geklaut und hin und wieder ist mal einer tot Genauso wollten wir das sehen: Als verkündet wurde, dass Clemens Meyer für seinen Erzählungsband „Die Nacht, die Lichter“ den diesjährigen Preis der Leipziger Buchmesse erhalten würde, sprang der notdürftig elegant gekleidete Schriftsteller auf, umarmte eine nicht genauer definierte Nebendame, nahm von seinem Flaschenbier einen stürmischen Schluck, der zur Hälfte auf seinem hellblauen Hemd landete. Über Clemens Meyer reden alle gerne. Kein Bericht, kein Artikel über ihn, in dem nicht erwähnt, ja betont würde, dass der Autor früher als Wachmann, Bauarbeiter, Gabelstaplerfahrer gearbeitet hätte (so nun auch in diesem). In Interviews erkundigt man sich nach dem Befinden seines Hundes oder fragt, fast entrüstet, über Glatzen-Meyers Verschwinden: „Warum haben Sie sich denn die Haare wachsen lassen?“ (Spiegel Online) Man ruft bei ihm an und schreibt belustigt: „Er nimmt den Hörer ab, klingt verschlafen. Es ist ein Uhr mittags.“ (FAZ) Schaut her, wir haben in unserem Literaturbetrieb auch so einen! So ein richtiger Rockstar ist das! Drückt seinen tattoobedeckten Körper bis mittags in die Kissen! Wettet beim Pferderennen wie ein ostdeutscher Bukowski! Und – hört, hört! – im Knast war er auch schon mal! Meyer frisst! Meyer tanzt!! Meyer verklärt sich!!! Gerne wird Meyer mit dem Ich-Erzähler Daniel seines 2006 erschienenen Debütromans „Als wir träumten“ verwechselt, weil er wie dieser Mitte der siebziger Jahre geboren wurde und wie dieser im ärmlich-finsteren Osten Leipzigs aufwuchs. Daniels Freunde heißen Rico, Mark oder Pitbull, und auch Daniel wird problemstadtteiladäquat Danie genannt. Man raucht, man trinkt, man prügelt, man klaut, und immer mal wieder muss einer in den Knast oder ins Heim oder ins Krankenhaus, die Träume sind klein und rar und bleiben trotzdem unerfüllt, aber irgendwo findet sich immer Trost, ein Schnaps, eine Disco, ein Puff, und einer stirbt, und ein anderer stirbt, und irgendwann zwischendurch fällt auch mal die Mauer. Die Jungs, die über Jahre begleitet werden, fühlen sich ständig genötigt, eine bestimmte Pose einzunehmen, sich ein großes, wildes Leben überzustreifen, und Meyer ist meisterhaft darin, sie dabei mitfühlend zu entlarven: Der Mithäftling, dem Daniel an seinem ersten Jugendknastmorgen auf dem Weg zum Waschraum begegnet, hat eine riesige Narbe über der Brust und „eine riesige Flasche Shampoo in der Hand, mit einem Bären drauf, der mit bunten Kugeln jonglierte.“ Seine stärksten Momente hat das Buch, wo Meyer Diskrepanzen herausstellt: Der Schläger säubert dem Frischverprügelten unter der Dusche das Gesicht. Eine alte Frau wird zwar bestohlen, aber auch beschützt. Und in einer großartigen Szene schwenken die Dreizehnjährigen auf einer der Montagsdemonstrationen stolz die Pionierfahne, weil sie gehört haben, dass es dort „für den Frieden“ ginge. Seite 1 2 Copyright © Clara Ehrenwerth – Sep 15, 2008 |
|
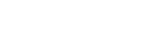





![Clemens Meyers: Als wir träumten [Copyright (c) S. Fischer Verlag]](ehrenwerth-meyer-traeumten-cover.jpg)
