Das Junkie-ABCDie Welt des Junkies ist hart und chaotisch. Doch man kann sie auch nüchtern betrachten. Ein alphabetischer Überblick in zwei Teilen. Teil 1, von A-L I wie IndividuumDer Junkie ist völlig allein und auf sich gestellt. Er vereint damit einen weiteren Dualismus: Einerseits wirkt er als →cooler Kämpfer, als starkes Individuum, allein in der anonymen Großstadt. Andererseits ist diese Alleinstellung seiner extremen Abhängigkeit geschuldet. Er ist Outlaw, Außenseiter und Einzelgänger. Es waren schon immer diese Figuren, die besonders faszinierend in ihrer Stärke und Schwäche, in ihrer faktischen Verletzlichkeit und scheinbaren Unverletzbarkeit wirkten. Der Junkie ist sowohl Inbild der Abhängigkeit wie auch der Individualität. Seine Abhängigkeit ist die →extremste Form von Schwäche, aber die um ihn zelebrierte Ästhetik ist die extremste Form von Stärke. J wie JugendkulturDie Ästhetik des Junkies findet sich in nahezu jeder nach ihm aufgekommenen Jugendkultur wieder (obwohl sich jene dieses Umstandes häufig nicht bewusst sind). Straight Edger beispielsweise, deren Subkultur sich fast ausschließlich über Abstinenz und verantwortungsvolles Leben definiert, sehen aus und hören ähnliche →Musik wie die ununterbrochen saufenden →Punks. Natürlich ist Straight Edge eine Abspaltung des Punk, der sich wiederum am Junkielook orientiert hat. Dennoch ist das subkulturhistorische Eigeninteresse offenbar so verzerrt, dass Klischeebilder eines Junkies, eines Punks und eines Straight Edgers nebeneinander stehen könnten, ohne sich merklich zu unterscheiden. Doch Junkieästhetik bestimmt längst nicht mehr nur jugendliche Subkulturen. Auf den Laufstegen der Modewelt ist der „Heroinchic“ spätestens seit den 90er Jahren „in“. Junkies eignen sich als Werbemittel und Projektionsfiguren, die hellen Seiten ihrer ambivalenten →Faszination werden idealisiert und die Gefahren kollektiv ausgeblendet. K wie KriegIn seiner gesamten Erscheinung, seinem Habitus, Verhalten, seiner Wirkung und Außenwahrnehmung, führt der Junkie einen Krieg. Alles zusammengenommen, versteht er seine Sucht als der Kultur geschuldet, an der er zugrunde geht. Es gibt das Bild des frierenden Junkies aus Filmen, Bildern und Klischees. Der Junkie hat die Arme eng verschränkt an die Brust gepresst, den Kopf zwischen die hochgezogenen Schultern gedrängt und die Beine aneinandergedrückt. Er zittert oder wippt zumindest auf und ab. Mal wurde dieses Verhalten der Kälteempfindung auf Entzug zugeordnet, mal der verzerrten, falschen Körperwahrnehmung auf Droge. Die Wahrheit ist ein psychisches Frieren: Der Junkie erfriert an der Kultur. Dieses mentale Zugrundegehen an der Kultur, der er sich nicht anpassen oder unterordnen will, führt ihn zum physischen Zugrundegehen an der Droge. Der Junkie setzt seinen Körper im Krieg gegen Kultur und Gesellschaft ein, während er gleichzeitig dem Krieg mit der Droge ausgesetzt ist. Der Körper ist dabei immer zentrale Figur. All das trägt zur →Faszination bei: Im Krieg ist der Junkie das starke →Individuum, und ist der Krieg gegen die Kultur gerichtet, involviert das Politik, Gesellschaftskritik und Kulturablehnung. Daraus resultiert →Coolness. Im →Punk finden sich diese Elemente wieder: Bis in die kleinste Junkiegeste der verschränkten Arme und den hochgezogenen Schultern erfrieren auch sie an der Kultur, der sie sich nicht anpassen oder unterordnen wollen. L wie LiebeAuch im Junkieleben gibt es Liebe. Die ganze Drogenkultur um das Heroin ist Liebe: die Droge ist die Geliebte, der Junkie der Liebende. Die Liebe zu ihr gleicht mehr →Verfall und Sucht, was sie schließlich auch ist. Damit ist es eine für immer bindende, →extreme Liebe, auch eine einseitige Liebe, vor allem eine zerstörerische. Es kann nichts neben der geliebten Droge geben, keine anderen Beschäftigungen, keine Wirklichkeit mehr und auch keinen anderen Lebensinhalt oder –sinn. Copyright © Maren Lachmund – Aug 15, 2008 |
|
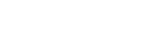
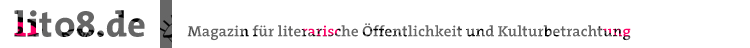




![Lachmunds Junkie-ABC [Copyright (c) n/a]](lachmund-junkie-abc-1.jpg)
![Lachmunds Junkie-ABC [Copyright (c) n/a]](lachmund-junkie-abc-2.jpg)
